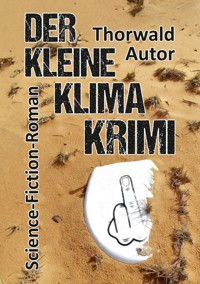4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Zwischen Tigern und Touristen
- Sprache: Deutsch
Der Autor hat sich zu einer Indienreise entschlossen. Allein. In Indien. Er möchte gerne Tiger sehen. In freier Wildbahn. Klingt alles ein bisschen verrückt? Ist es auch, aber auch zum Brüllen komisch. Der Autor trifft auf allerlei exotisches Getier, darunter Riesenphytons, engagierte Tourguides, wildentschlossene Elefantenführer und Tiger, die lieber ihre Ruhe hätten, als von Touristen, deren Elefantenführern und Tourguides durch den Dschungel gejagt zu werden. Und so ein Tiger ist auch schnell mal sauer. Bei dieser Gelegenheit stellt der Autor dann fest, dass auch Reitelefanten sich vor wütenden Tigern fürchten. Für die eilige Flucht steht glücklicherweise neben ängstlichen Elefanten auch der Jeep des Tourguides zur Verfügung, der auf den zärtlichen Kose-namen »little starting problem« hört und der aufgrund technischer Besonderheiten einen Hügel zum Starten braucht. Eine Eigenschaft, die ihr Potential erst voll entfaltet, wenn man auf einen wilden Elefantenbullen trifft und weit und breit kein Hügel in Sicht ist. Neben viel Getier trifft der Autor nicht unerwartet auch auf viele Inder, viel Indien und viele exotische Gewohnheiten der Einheimischen, die alle einen indischen Touch haben. Band 2 wartet mit einer weiteren Indienreise auf, die ebenfalls durch verschiedene Nationalparks führt und mehr oder weniger enge Kontakte mit Tigern schildert sowie auf die Besonderheiten indischer Fortbewegungsmittel eingeht: »Zwischen Tigern und Touristen II - Eine satirische Safari in Indien - deep in the heart of jungle« Mit »Happy Homo sapiens safariens - Eine satirische Safari tief ins Innere des Safaritourismus« erscheint in Kürze ein Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Thorwald Autor
Zwischen Tigernund Touristen
Eine satirische Safari in Indien
little starting problem
21.08.2016
Copyright: © 2016 Thorwald Autor
Lektorat: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Umschlag & Satz: Sabine Abels – www.e-book-erstellung.de
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
Softcover
978-3-347-48138-1
Hardcover
978-3-347-48142-8
E-Book
978-3-347-48145-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Spiel ist vorbei
Der Tiger hat sich entschlossen, das Katz- und Mausspiel auf seine eigene Art und Weise zu beenden, und greift an. Aus einer Entfernung von ca. 20 Metern stürzt er sich durch die Büsche hindurch auf uns. Wir können den angreifenden Tiger selbst nicht sehen. Nur die sich bewegenden Äste und das Gebrüll lassen unmissverständlich erkennen, dass das Spiel nun vorbei ist. Ich lasse meine Kamera fallen und halte mich mit beiden Händen am Sitz des Reitelefanten fest. Auch der Mahout hat seine Ruhe verloren. Er brüllt so laut er kann: »Hat! Hat! Hat!« Das heißt so viel wie: »Geh weg! Geh weg! Geh weg!« Die Frage, wen er damit meint – den Tiger oder seinen Reitelefanten -, muss momentan offenbleiben, da sich die Dinge für längere Fragestunden etwas zu rasant entwickeln.
Der Tiger kommt wie eine Kugel aus dem Lauf auf uns zugeschossen. Schon hat er den letzten Busch – zwei Meter vor dem Elefanten, der noch vergeblich versucht auszuweichen – erreicht und setzt zum Sprung an.
Hinweis für zarte Gemüter:
Auch wenn es angesichts der oben beschriebenen Konstellation unglaublich klingt und eventuell etwas Spannung aus der Geschichte nimmt, kann ich den Leser schon mal beruhigen: der Tiger hat mich nicht gefressen, obwohl der Kopf dieses Tigers in nächster Nähe und in Augenhöhe vor mir auftauchte.
In Indien
Es ist Vormittag. Es ist Januar. Es ist kalt. Es stinkt. Mir stinkts. Ich sitze in einem Zug auf dem Hauptbahnhof in Delhi und sehe aus dem vergitterten Fenster. Ich sehe Schmutz und Müll. Es regnet. Meine innere Wetterlage ist noch um einiges schlechter als die äußere. Bilder aus der Tourismuswerbung von weißen Stränden, Sonne, Meer und dergleichen mehr tauchen in meinem Kopf auf. Irgendwie sieht die Welt da draußen anders aus als in den allseits beliebten Hochglanzprospekten der Reisebüros.
Welcher Teufel hat mich bloß geritten, in diesem Land Urlaub zu machen? Noch gestern war ich guten Mutes und bereit, den Gefahren Indiens (Kobras, Tiger, Autos, Inder, Touristen) erneut zu trotzen. Ich hatte schon entsprechende Erfahrung in meinem ersten Indienurlaub gesammelt. Damals verbrachte ich auf den Spuren der Tiger mehrere Wochen im Corbett-Nationalpark. Nun steht der Besuch von drei Nationalparks auf dem Plan.
Trotz meiner Erfahrung mit den indischen Verhältnissen ist meine Stimmung angesichts der indischen Wirklichkeit nun wider Erwarten schlagartig und vollkommen abgestürzt. Aber Gott sei Dank weiß ich, dass sich die seelische Großwetterlage nach einiger Zeit wieder bessern wird. Wahrscheinlich ist schon morgen oder spätestens am Ende des Urlaubes der Anpassungsprozess an Indien abgeschlossen und überhaupt wird es wohl nicht mal halb so schlimm werden, wie es mir meine Gefühle momentan vorgaukeln. Was ich zu diesem Zeitpunkt Gott sei Dank noch nicht weiß ist, dass in diesem Urlaub einiges schiefgehen wird, zum Beispiel, dass mir unter anderem ein echter angreifender Tiger näher kommen wird, als seinerzeit der ausgestopfte Tiger dem Helden im Film Der Tiger von Eschnapur. Aber davon habe ich momentan noch keine Ahnung und kann mich dem trügerischen Gefühl hingeben, dass mich selbiges trügt.
Noch gestern habe ich im Freundeskreis meine Scherze über Indien, die Inder, die Touristen und die Tiger gemacht und zum x-ten Mal ein paar Kalauer aus meinem letzten Indien-Urlaub aufgewärmt. Die Geschichten habe ich schon so oft erzählt, dass sie allmählich die indische Realität vollkommen verdrängt haben. Der ganze Urlaub schien ein einziger Spaß und ein großes Abenteuer gewesen zu sein. Da liegt es doch nahe, diesem lustigen Land, in dem aufgrund des günstigen Klimas die Kalauer das ganze Jahr über reif sind und nur darauf warten, gepflückt zu werden, einen weiteren Besuch abzustatten. In einem Anfall von geistiger Umnachtung habe ich fünf ganze und eine halbe Woche gebucht.
Ein Blick aus dem Fenster rückt die Vorstellungen wieder zurecht und ich erinnere mich dunkel daran, dass zwischen den Kalauern viel Platz für Indien war. Ich habe keine Ahnung, wie ich auch nur eine halbe Woche überstehen soll, und würde am liebsten wieder aus dem Zug aussteigen und den nächsten Flug in Richtung Good old Germany nehmen.
Schuld an der Misere sind diese Blechbüchsen mit Düsenantrieben an beiden Seiten. Sie katapultieren die Touristen im Handumdrehen und annähernd mit Schallgeschwindigkeit in andere Zeit- und völlig andere Kulturzonen. Leider besitzt nicht nur der Körper der Touristen eine träge Masse, die mit dem Alter meistens noch beträchtlich zunimmt, sondern auch der Geist, dessen Trägheit mit zunehmendem Alter ein ähnliches Verhalten zeigt. Noch bevor sich die Erde einmal umdreht, spuckt die Blechbüchse die Touristen an einem fremden Strand beziehungsweise in einem fremden Flughafen wieder aus.
Die Zeit bis zur Landung und vor allem die Zeit bis zum Start in Richtung Heimat ist nicht ungefährlich. Der Gedanke an die nächste Zukunft könnte zumindest bei den intelligenteren Touristen bereits während des Fluges Angstzustände oder vielleicht noch Schlimmeres auslösen. Um Panikattacken im Flugzeug zu unterdrücken, haben sich deshalb fast alle Fluglinien darauf geeinigt, den Touristen in den Flugzeugen eine halbwegs heile Welt vorzugaukeln und sie von trüben Gedanken abzulenken. Raffinierterweise tun sie das nicht, indem sie versuchen, alle Wünsche zu erfüllen, sondern indem sie absichtlich kleine Fehler in das System einbauen. Der dadurch touristenseitig generierte Unmut hält die Touristen meist erfolgreich davon ab, darüber nachzudenken, dass sie momentan wie eine Kugel durch die Luft schießen und, schlimmer noch, in Kürze in einem Land sein werden, in dem der westliche Lebensstandard eventuell genauso weit weg ist wie der Westen selbst. Dies gilt zumindest für diejenigen Touristen, die bei der Buchung nicht darauf geachtet haben, dass immer mindestens ein oder, besser noch, mehrere gute Sterne über ihnen schweben.
Für die sternlosen Touristen gibt es nach der Landung in der Ferne zunächst noch eine kleine Schonzeit, da die Flughäfen meist westlichem Standard entsprechen. Spätestens nach Verlassen des Flughafens trifft es die mit den aufstoßenden Leckerbissen aus dem Flugzeug kämpfenden Touristen eventuell wie ein Schlag, auf englisch: Hit. Das ist der Start der Hitparade. Da hilft auch kein noch so eifriges Lesen von professioneller Reiseliteratur. Im Gegenteil: Oft breitet sich bei der Ankunft spontan das Gefühl aus, man selbst oder zumindest der Autor der Reiseliteratur sei am falschen Flughafen ausgestiegen und man hätte lieber noch ein, zwei Stationen mit dem Aussteigen warten sollen.
Eben noch in Good old Germany steht der Erholungswillige schlagartig in einem vollkommen anderen Land. Die kulturelle Übergangszeit ist noch weit geringer als der Verstand manches Büroflüchtlings. Es geht dem Erholungssuchenden ähnlich wie den Augen, wenn plötzlich zu viel Licht beziehungsweise Lux auf dieselben trifft: Zuerst schmerzt es etwas und man braucht einige Zeit, bis sich die Augen angepasst haben. Genauso ist es, wenn plötzlich zu wenig Luxus auf den Touristen trifft. Auch hier sind einige Tage für eine Anpassung nötig, bis sich der Körper an das neue Luxusniveau gewöhnt hat.
ICE-Zeit
Einige Stunden vorher saß ich noch im ersten ICE, der morgens von München nach Frankfurt fährt. Das Ambiente war irgendwie anders: purer Luxus sickerte durch die Poren.
Pünktlich startete der ICE und brachte mich ohne jede Verzögerung zur fliegenden Blechbüchse nach Frankfurt. Das heißt … fast ohne jede Verzögerung. Ein Sturm hatte einige Bäume auf die Gleise geworfen und nach einer halben Stunde Fahrt blieb der Zug stehen und weigerte sich, weiterzufahren. Die Zeit wurde knapp und ich fühlte einen deutlichen und immer stärker werdenden Zugzwang.
Diesen Zwang spürten auch die anderen potenziellen Büroflüchtlinge und man konnte sie aufgrund ihres Verhaltens klar von den normalen Passagieren unterscheiden. Viele saßen wahrscheinlich auf Kohlen beziehungsweise, da sie etwas Kleingeld mit sich führten, auf Kohle. Die Kohle fing nun an zu brennen und die Reaktionen der Betroffenen waren entsprechend. Es stellte sich heraus, dass eine junge Dame in meinem Abteil dasselbe Flugzeug wie ich gebucht hatte. Es handelte sich um eine Sannyasin, wie an den mitgeführten homöopathischen Mitteln, die sie mir stolz zeigte, unschwer zu erkennen war. Die Sannyasin hatte die Mittelchen alle im Handgepäck, da sie bei einer Bestrahlung des Gepäcks mit Röntgenstrahlen um deren Wirksamkeit fürchtete.
Der Schaffner bemühte sich redlich, uns zu beruhigen: »Solange der Zug nur steht und sich nicht setzt, ist alles nur halb so schlimm.«
Nach 20 Minuten entschloss sich der Zug sich zu setzen und erst einmal ein bisschen auszuruhen.
Erst nach weiteren 20 Minuten stand er wieder auf und endlich ging es weiter. Das könnte gerade noch reichen.
Nach der Ankunft in Frankfurt liefen die Sannyasin und ich zur S-Bahn. Dabei trugen wir die guten homöopathischen Mittel, die eine beträchtliche Erdanziehung entwickelten, gemeinsam und hofften nach erreichen der S-Bahn, dass die Mittel noch nicht abgelaufen waren. Schließlich kamen wir am Flughafen an. Ein kundiger Angestellter sagte uns, wo unser Flugzeug startete und im Laufschritt, diesmal mit Gepäckwagen, ging es dorthin. Dort angekommen, mussten wir leider feststellen, dass nicht alle Angestellten kundig sind. Irgendwie waren wir am vollkommen falschen Ende des Flughafens gelandet und mussten nun, wieder im Laufschritt, das gesamte Terminal durchqueren.
Doch dann waren wir endlich am Ziel, gerade noch rechtzeitig. Die Passagiere saßen noch im Gate und wir konnten uns entspannen. Die ganze Hetze war, wie sich nun herausstellte, sowieso für die Katz, da der Flug erst mit beträchtlicher Verspätung startete. Damit wir uns nicht langweilten, wurde die Zeit genutzt, uns den Frankfurter Flughafen im Detail zu zeigen: Das Gate wurde noch zweimal verlegt, aber auch das ging vorbei. Schließlich saß ich im Flugzeug neben Sannyasin Nr. 2. Die junge Dame hatte einen Seehund aus Stoff dabei. Wahrscheinlich hatte auch sie Angst, dass die Röntgenstrahlen dem Plüschtier Schaden zufügen könnten. Erwartungsgemäß unterschieden sich die Mitreisenden dieses Fluges etwas von denen anderer, um nicht zu sagen normaler Flüge.
Ich wartete entspannt auf den Start, als mein Name über Lautsprecher ausgerufen wurde. Ich sollte umgehend zur Chefstewardess gehen, es gäbe ein kleineres Problem zu klären. Mir schwante Übles. War die ganze Aufregung umsonst? Hatte man abgelaufene homöopathische Mittel in meinem Plüschseehund entdeckt? War ich vielleicht der einzige Normale im ganzen Flugzeug? Letzteres war, warum auch immer, eher unwahrscheinlich. Die Stewardess wollte aber nur meine Platzkarte ansehen und ich konnte beruhigt zu meinem Platz zurückgehen und auf den Start warten.
Die Düsen wurden eingeschaltet, wir starteten und das übliche Ablenkungsprogramm wurde aktiviert: Das Essen verschaffte dem Magen etwas Beschäftigung, der Film lief an und die Qualität entsprach durchaus der, die man in Düsenkinos erwarten konnte.
Obwohl auch in höheren Gefilden ein Sturm tobte, lag dem Flugzeug anscheinend kein Baum im Weg, zumindest gab es keine Verzögerungen und das Flugzeug machte keinerlei Anstalten stehen zu bleiben oder sich gar zu setzen. Vielleicht hatte sich die Flugleitung auch dazu entschlossen, die Verzögerungen aus Sicherheitsgründen doch lieber gleich am Flughafen durchzuziehen, folglich war eine weitere Verzögerung während des Fluges doch eher unwahrscheinlich.
Nach einigen Stunden erfolgte die Landung in Delhi am frühen Morgen. Es war Winter und auch in Delhi war es ziemlich kalt. Eine dichte Wolkendecke verhinderte die Sicht auf die Sterne, aber dies störte mich nicht weiter, da ich sowieso sternenlos gebucht hatte.
Das Reisebüro in Deutschland hatte ganze Arbeit geleistet. Nach den üblichen Kontrollen sah ich schon meinen Namen auf einem Schild: Ich wurde erwartet. Ein Inder im Anzug, der sogar Deutsch sprach, empfing mich. Ich wechselte noch ein paar Dollar und erhielt im Gegenzug einige Bündel Rupien. Anschließend gingen wir zum wartenden Auto mit Chauffeur. Obwohl das Auto keinen Stern auf der Kühlerhaube hatte und die Wolken immer noch dicht waren, hatte ich in diesem ganzen Ambiente das Gefühl, dass ich von mehreren Sternen umgeben war, und fühlte mich entsprechend wohl. Der Kulturschock stellte sich nur bedingt ein. Bis jetzt war der Ablauf wie bei meinem letzten Urlaub und mir schwante noch nichts Übles. Als alter Hase wusste ich ja, was mich erwartete, und war von Delhi, dem Linksverkehr und dergleichen Kleinigkeiten nicht weiter überrascht.
Am Bahnhof in Delhi
Meine Reiseplanung hatte eigentlich noch ein paar Stunden Nachtruhe in einem Hotel vorgesehen, aber aufgrund der Verspätung des Flugzeuges wurde daraus nur ein Frühstück. Anschließend brachte mich der Herr vom Reisebüro zum Bahnhof.
Als wir uns meinem Zug näherten, war es allerdings mit der Schonzeit definitiv vorbei und die Hitparade wurde eingeläutet: Bei der Lok handelte es sich um eine alte Dampflok, die ihre besten Tage wohl schon hinter sich hatte, als die ersten Engländer in Indien landeten. Der restliche Zug hatte sich optisch perfekt an die Lok angepasst. Dieser Zug war offensichtlich nicht mit dem berühmten Palace on Wheels identisch, der zwar ebenfalls in Delhi startet, aber anscheinend von einem anderen Gleis.
Der Herr vom Reisebüro begleitete mich bis in mein Abteil. Dabei ging er immer zwei Schritte hinter mir und ließ mir stets den Vortritt. Was ich für einen Akt der Höflichkeit hielt, war aus Sicht des Inders wahrscheinlich pure Notwendigkeit. Er wusste aus Erfahrung, dass am ersten Tag der Entzug von Luxus am härtesten ist und viele Touristen nicht gewillt sind, die Hitparade abzuarbeiten, und stattdessen eher gewillt sind, die Flucht anzutreten. Da kann ein wenig seelischer Beistand und vor allem die Blockade des Fluchtweges nicht schaden. Um mich abzulenken, sprach er mit blumigen Worten von der weiteren Reise. Aber die kannte ich schon, schließlich hatte ich den Ablauf selbst entworfen. Die ganze Reiseroute sollte im Norden von Indien verlaufen.
Geplant war folgender Ablauf:
a) mit dem Zug von Delhi nach Lucknow
b) am nächsten Tag mit dem Auto weiter zum Dudhwa Nationalpark an der Grenze zu Nepal
c) nach einigen Tagen mit Auto und Zug wieder zurück nach Delhi
d) weiter mit dem Auto in den Corbett-Nationalpark nordöstlich von Delhi
e) mit dem Auto wieder zurück nach Delhi und weiter in den Keoladeo-Nationalpark
f) abschließend mit dem Auto nach Agra zum Tadsch Mahal und zum Schluss mit dem Zug zurück nach Delhi
Das Abteil, in das mich der Inder schließlich mehr hineinschob als hineinkomplimentierte, entsprach nicht ganz meinen Erwartungen.
Jetzt sitze ich also in meinem Luxusabteil, in dem der Luxus schon vor langer Zeit versickert ist. Es handelt sich um ein Schlafwagenabteil, das Platz für zwei Personen in horizontaler Lage bietet und bis auf einen, mit seinem Schicksal hadernden, vertikalen Touristen noch unbesetzt ist. Etwas über Kopfhöhe ist eine zweite Pritsche. Ich bin in einem Abteil für die zweite Klasse beziehungsweise zweite Kaste, und zwar für Raucher, wie ich an einem großen Brandfleck an der Wand unschwer erkennen kann. Das Fenster ist klein, vergittert und lässt sich nicht öffnen – wahrscheinlich um die Reisenden daran zu hindern, während der Fahrt aus dem Zug zu springen.
Zugabteil, Schlafwagen, rechts die Hochsicherheitstasche
Durch das Fenster kann ich die anderen Reisenden auf dem Bahnsteig betrachten. Anscheinend fahren nach Lucknow, ein Name, der sich verdächtig nach luck no anhört, nicht allzu viele Touristen; zumindest keine Weißlinge, denn ich kann nur Inder entdecken und auch diese machen nicht den Eindruck, als ob sie eine Urlaubsreise antreten. Rein geografisch ist zwar Hinterindien nicht mit meinem Ziel identisch, aber das Ambiente deutet darauf hin, dass wir direkt dorthin fahren.
Zwei der zusteigenden Inder kommen in mein Abteil und setzen sich auf die Bank neben mich. Jetzt wird es etwas eng. Ich versuche höflichkeitshalber, ein Gespräch zu beginnen, aber die beiden Inder sprechen fast überhaupt kein Englisch. Das stört mich nicht, denn ich will sowieso lieber meine Ruhe haben und mich meinen Depressionen hingeben.
Ein weiterer Inder taucht auf. Ohne Worte klettert er auf die obere Schlafliege. Anscheinend handelt es sich um einen Inder aus einer höheren Kaste. Das kann ja lustig werden. Seine Füße werden genau in Gesichtshöhe vor sich hinbaumeln und mir die Gelegenheit geben, die Arbeit der hiesigen Schuster näher in Augenschein zu nehmen. Vielleicht lassen sich anhand der Spuren an den Schuhen sogar noch Rückschlüsse auf die Sauberkeit der indischen Straßen ziehen. Auch ein schusterübergreifender Vergleich ist sicher möglich, sobald erst einmal mehrere Inder oben sitzen. Aber meine Bedenken sind zumindest zu diesem Zeitpunkt noch unnötig: Der Bursche macht es sich auf der oberen Pritsche bequem und legt sich der Länge nach hin. Diese Gefahr ist vorerst gebannt.
Abfahrt in Delhi
Schließlich fährt beziehungsweise dampft der Zug los. Jetzt ist es endgültig zu spät, um auszusteigen. Mit dem Start des Zuges wurde anscheinend auch die Erlaubnis zum Rauchen erteilt, zumindest geben sich die Inder genüsslich einem Rauchopfer hin. Auch der Bursche in der oberen Etage ist anscheinend aktiver Raucher, wie man aus dem Ascheregen, der sporadisch von oben herabrieselt, erkennen kann. Das stört die unten Sitzenden überhaupt nicht, zumindest nicht diejenigen, die Hindi sprechen, auch wenn sie nichts sagen: es gehört anscheinend zum guten Ton unter indischen Rauchern, über solche Kleinigkeiten hinwegzusehen.
Die delhischen Häuser ziehen nun langsam an uns vorbei. Zwischendurch tauchen manchmal Ansiedlungen von Slums auf. Vor einer dieser Siedlungen macht der Zug einen Halt, bleibt aber zunächst noch stehen. Ich denke natürlich sofort an den ICE und sehe auf die Uhr, um die Zeit zu stoppen, bis er sich setzt. Auf jeden Fall kann ich die Zeit nutzen, den Slum etwas genauer zu betrachten. Es handelt sich um graue Holzhütten mit grauem Grasdach in grauer Landschaft. Mir graut es. Zwischen den Hütten und dem Bahndamm befindet sich ein Tümpel, der sich in der Farbgebung perfekt an die Häuser angepasst hat. Meine Stimmung hat das dringende Bedürfnis sich dem Bild anzupassen und rutscht noch ein bisschen tiefer. Langsam müsste sie aufschlagen. Aber ich habe mein Tagestief noch nicht erreicht.
Mangels Toiletten verrichten viele Inder ihre Notdurft in freier Natur. Scheinbar ist die Natur an einigen Stellen etwas freier als sonst. Besonders an einigen Stellen des Bahndamms hat die Freiheit, wie es scheint, etwas höhere Freiheitsgrade und diese Stellen sind bei der Bevölkerung äußerst beliebt und werden am Vormittag gerne benutzt, vor allem, wenn ein Zug vorbeifährt. Rein subjektiv habe ich den Eindruck, dass die Darmbewegungen durch den Dampf der Lok angeregt werden, denn es herrscht ein reges Treiben an einzelnen Bereichen des Bahndamms. Die vielen Hintern, die hier gelüftet werden, erinnern mich daran, dass ich auf dem Weg in Richtung Hinterindien bin. Rein zufällig habe ich bei der Passage der Freilufttoiletten mein Tagestief endgültig erreicht, schlage aber nicht hart auf, sondern lande weich in diversen Häufchen. Als wir endgültig die Stadt und deren Vororte verlassen und das flache Land erreichen, ist der Sinkflug der Stimmung beendet und ich bemerke einen leichten Aufwärtstrend.
WC im Zug
Angeregt durch die vielen Inder in Sitzhaltung, die in nächster Nähe zum Fenster vorbeigezogen sind, meldet sich nun auch meine Blase zu Wort. Der Kaffee vom Frühstück entwickelt eine beträchtliche und ständig steigende Neigung zur Frischluft. Ich vermute, dass der Zug keine Pinkelpausen macht, was allein schon aufgrund des Gedränges auf dem Bahndamm wenig Sinn machen würde. Wahrscheinlich gibt es in diesem Zug irgendwo eine Toilette. Ich muss mich wohl langsam auf die Suche machen.
Ein Problem ergibt sich allerdings durch mein Gepäck: Es besteht aus einem normalen Wanderrucksack und aus einer Hochsicherheitstasche. Die Hochsicherheitstasche war bis zum letzten Indienurlaub mittels eines Schlosses an den beiden Laschen des Reißverschlusses noch absperrbar. Das Schloss hängt zwar immer noch am Reißverschluss, aber es hat seit einem kleinen Zwischenfall keine Funktion mehr; sobald man am Reißverschluss zieht, geht die Tasche an einem Ende auf. Da das nur ich weiß, ist es eigentlich egal, ob die Tasche wirklich verschlossen ist oder ob sie nur so tut als ob. Trotzdem bleibt ein unsicheres Gefühl und es fällt mir anscheinend bedeutend schwererer als der Tasche, so zu tun, als ob die Tasche fest verschlossen ist.
Ich habe doch Bedenken, dass nicht nur ich, sondern auch mein Gepäck beim Gang zur Toilette eine gewisse Erleichterung erfährt. Viele Inder sind für westliche Maßstäbe unglaublich arm. Touristen beziehungsweise deren Gepäck wären allemal eine fette Beute. Erstaunlicherweise hört man dennoch selten davon, dass Touristen bestohlen werden. Viele Inder sind anscheinend nicht nur unglaublich arm, sondern auch unglaublich ehrlich. Trotzdem sollte man sie nicht mehr als notwendig in Versuchung führen.
Mein ursprünglicher Plan sah vor, das Gepäck zur Erleichterung mitzunehmen, um es vor einer Erleichterung zu bewahren. Den Gedanken, mit meinem Gepäck beladen durch den Zug zu stolpern, finde ich jetzt allerdings nicht mehr erleichternd, sondern eher beschwerlich. Außerdem habe ich Zweifel, ob sich in der Toilette eine Ablage für Rucksäcke und Hochsicherheitstaschen befindet. Wahrscheinlich ist es eher vorgesehen, dass man das Gepäck auf den Boden stellt. Dabei besteht aber das Risiko, dass anschließend eine längere und intensive Reinigung des Gepäcks notwendig wird. Die Reinigung könnte man wiederum nur auf der Toilette durchführen und ob unter diesen Umständen eine Reinigung sinnvoll ist, sei einmal dahingestellt. Ich beschließe deshalb, es mit Plan B zu versuchen. Ich lasse das Gepäck im Abteil zurück, gehe hinaus in den Gang und sehe interessiert aus dem dortigen Fenster, das mir die andere Hälfte Indiens zeigt. Dann gehe ich im Gang auf und ab und sehe immer wieder so ganz nebenbei ins Abteil. Anschließend verlängere ich allmählich die Abstände, in denen ich am Abteil vorbeikomme.
Schließlich gehe ich bis ans eine Ende des Waggons, kann aber nirgends eine Tür mit einer Doppelnull oder der Aufschrift WC entdecken. Am anderen Ende des Waggons bietet sich das gleiche Bild. Vielleicht benutzen die Inder ja auch eine andere Aufschrift. Das wäre nicht weiter tragisch, denn auf der ganzen Welt hat man sich darauf geeinigt, die Toiletten durch standardisierte Duftstoffe zu markieren. Ich brauche also nur der Nase nach zu gehen. Vielleicht werde ich im nächsten Waggon fündig.
Nach einem weiteren kurzen Besuch meines Abteils öffne ich die Tür am Waggonende. Dabei kann ich feststellen, dass bei den indischen Zügen nicht nur die Loks etwas anders sind. Es gehört anscheinend nicht zum Service in der zweiten Kaste der indischen Züge, die Zwischenräume zwischen den Waggons vor Zugluft zu schützen. Stattdessen werden nur zwei Eisenbleche von beiden Seiten heruntergeklappt. Die Bleche überschneiden sich in der Mitte und erlauben somit eine, nun ja, sichere Passage. Auf den Seiten befindet sich eine geländerartige Konstruktion, die das seitliche Herabfallen der Passagiere verhindern soll. Um die Spannung etwas zu erhöhen, verläuft das Geländer allerdings nicht durchgehend, sondern lässt in der Mitte genügend Platz, um den Zug vorzeitig zu verlassen.
Da versuche ich es doch lieber auf der anderen Seite meines Waggons. Aber dort ist die Tür verschlossen und meine Alternativen werden stark eingeschränkt. Na schön. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als die Hängebrücke zu nehmen.
Wider erwarten finde ich gleich hinter der Tür im anderen Waggon ein einigermaßen sauberes, nur schwach mit Duftstoffen markiertes WC, das sich seinen Namen WC (für Worst Case) eigentlich nicht verdient hat.
Der Weg zurück ist schon etwas einfacher. Mein Gepäck liegt noch am selben Platz und anscheinend bin ich der Einzige, der sich erleichtert hat.
Schüttelachsen
Langsam und rüttelnd wird Indien an mir vorbeigezogen. Ich verbringe die Zeit, indem ich aus dem Fenster schaue und die vollkommen andere Welt dort draußen betrachte oder mich in eine vollkommen andere Welt versetze. Gott sei Dank funktioniert dieser Trick, der von vielen angewandt wird, um sich in eine fremde Welt zu versetzen, auch in umgekehrter Richtung: Man kann sich in einer fremden Welt auch in die gewohnte Umwelt zurückversetzen. Dadurch ist die Anpassung an die fremde Welt viel leichter, da man die Geschwindigkeit, mit der man die andere Kultur aufnimmt, selbst bestimmt. Kleine schwarze Symbole auf Papier, die sich – getrennt durch kleine Leerstellen – hintereinander aufreihen, ermöglichen dieses erstaunliche Kunststück.
Die Zeit vergeht und ab und zu geht außen und innen ein sporadischer Regen nieder – außen aus Wasser, innen aus Asche. Asche auf mein Haupt.
Wir nähern uns langsam dem Höhepunkt der Zugfahrt. Das ist nicht die Stadt Lucknow, sondern das Mittagessen. Schon der Typ vom indischen Reisebüro hat mir vom Essen vorgeschwärmt. Da ein separater Speisewagen in Zügen mit Dampfloks prinzipiell nicht mitgeführt wird, wird das Essen im Abteil gereicht und man hat eine Auswahl aus mehreren Gerichten. Als der Ober auftaucht, werden die anderen Inder frisch und geben jeweils eine längere Bestellung auf. Schließlich bin ich an der Reihe. Ich weiß nicht, was Speisekarte auf Englisch heißt, aber das ist weiter kein Problem, denn es gibt sowieso keine. Damit habe ich aber schon gerechnet und es geht auch ohne Karte, denn der Ober zählt mir nun die ganzen Speisen, die er im Angebot hat, auf.
So weit, so gut. Er ist ein freundlicher Herr, der sichtlich bemüht ist, seinen Gästen einen guten Service zu bieten. Was die Angelegenheit etwas erschwert, ist dass er kein Wort Englisch, dafür aber viele Worte Hindi kann. Als er mein fragendes Gesicht sieht, macht er unaufgefordert noch einmal, diesmal im langsamen Gang, eine Fahrt durch die einzelnen Gänge, die er im Angebot hat. Als besonderen Service, damit sich der Tourist auch wie in einem exotischen Urlaub in einem exotischen Land fühlt, spricht er wieder nur Hindi. Eine Sprache, die er eindeutig besser spricht als ich. Meinen Hindi-Wortschatz kann ich an den Fingern einer Hand abzählen und dabei wird ein Großteil der Finger nicht benötigt. Das macht zwar das Abzählen zu einer ziemlich kurzen und übersichtlichen Angelegenheit, ist aber bei der Bestellung des Mittagessens nicht wirklich hilfreich.
Nach dem zweiten Durchgang durch die Speiselandschaft Indiens sehen mich der Ober und auch die mitreisenden Inder fragend an. Sie sind gespannt, wie sich der Weißling, der offenbar kein Wort Hindi spricht, nun aus der Affäre ziehen will. Obwohl es ziemlich sinnlos ist, muss nun auch ich ein paar Worte sagen. In meinem besten Englisch (eine hochgestochene Umschreibung für meine minimalen Englischkenntnisse, die aber zumindest über meine Einhand-Hindi-Kenntnisse weit hinausgehen – ich möchte sogar soweit gehen, zu behaupten, dass ich Englisch zweihändig spreche) gebe ich meine Bestellung auf. Natürlich könnte ich genauso gut auf Bayerisch einen Schweinsbraten oder zumindest – in Anlehnung an die Lok – Dampfnudeln bestellen. Das Ergebnis wäre dasselbe: Niemand versteht mich.
Es entsteht eine Diskussion unter den Indern und nach einer längeren Zeit richtet der Ober wieder das Wort, diesmal unterstützt durch seine Hände, an mich. Auch er spricht zweihändig. Es geht ihm wie mir. Die Höflichkeit gebietet es, dass man die Sprache benutzt, auch wenn man genau weiß, dass es sowieso für die Katz ist. Unterstützt wird der Strom seiner Worte durch einen Strom von Gesten. Aus dem Gestenstrom kann ich die Hand, die er zum Mund führt, eindeutig zuordnen. Diese Geste ist auf der ganzen Welt bekannt und wird auch von den Zugereisten beziehungsweise zugreisenden Gästen verstanden: Essen beziehungsweise in Indien: Reis. Eines der wenigen Worte, die ich in Hindi halbwegs kann, ist die Übersetzung des im westlichen Raum bestätigenden Nickens. Ich schüttle deshalb bestätigend den Kopf. Eine Reaktion, die wahrscheinlich bei den meisten Lesern nur Kopfschütteln auslöst und die deshalb näher erklärt werden muss:
Das im Westen übliche Schütteln des Kopfes, das so viel wie Nein bedeutet, wird durchgeführt, indem man den Kopf um die Zehen-Kopf-Achse in einem Winkel von rund 20 Grad schwingen lässt. Über die Frequenz der Schwingung, in Verbindung mit einem variierenden Schüttelwinkel, kann man die Intensität des Neins verändern. Je höher die Frequenz ist, desto kürzer wird der Schüttelwinkel und desto höher der Grad der Ablehnung. Das westliche Schütteln des Kopfes in einer zur Nein-Achse um 90 Grad gedrehten Achse wird auch als Nicken bezeichnet und als Ja interpretiert. Rein mathematisch bleibt noch eine dritte Achse übrig, die orthogonal, also im rechten Winkel, sowohl auf der deutschen Ja-Achse als auch auf der deutschen Nein-Achse steht. Da die beiden anderen Achsen schon besetzt waren, haben sich die Inder logischerweise diese Achse ausgesucht und sie kulturintern mit einem Ja verknüpft. Beim indischen Ja wird, ausgehend vom deutschen Ja oder Nein, die Schüttelachse um 90 Grad beziehungsweise im Bogenmaß1 um u/2 gedreht. Die Inder sind ja bekanntlich eng mit den Indianern verwandt und bevorzugen deshalb die Winkelangaben im Bogenmaß, was die Sache nicht gerade vereinfacht und automatisch erklärt, warum die indische Sprache für Nichtindianer so kompliziert ist.
Das Ja-Sagen in Indien erfordert etwas Übung. Am besten beginnt man auf einem schüttelfreien Untergrund mit einer deutschen Schüttelbewegung, dreht die Achse um 90 Grad – und wenn man dann wieder bei einer deutschen Schüttelbewegung ankommt, hat man irgendetwas falsch gemacht. Wenn man sich schüttelmäßig zur nächsthöheren Kaste vorgearbeitet hat, kann man langsam versuchen, das Ganze auch auf einem bewegten Untergrund machen, zum Beispiel in einem fahrenden Fahrzeug. Dieser Schritt führt erfahrungsgemäß zunächst einmal zu größeren Schwierigkeiten, da einerseits die Schüttelbewegungen des Kopfes und des Fahrzeuges überlagert werden, andererseits die Anzahl der Achsen zunimmt. Dies kann zu ernsthaften Missverständnissen führen.
Ich hoffe, dass mein orthogonales, um 90 Grad gedrehtes und vom sich schüttelnden Zug überlagertes deutsches Schütteln vom Ober als indisches Ja, vermutlich mit starkem Akzent, interpretiert wird.
Anscheinend hat es geklappt, denn der Inder schüttelt bestätigend den Kopf.
In der nun folgenden Diskussion geht es anscheinend um die Auswahl des Getränkes, wie aus der Geste des Trinkens hervorgeht. Eines der wenigen Worte in Hindi, das ich kenne, ist das Wort für Wasser: Pani. Man kann es sich leicht merken, da allein der Anblick von indischem Wasser bei vielen Touristen nicht nur rhythmische Darmbewegungen, sondern auch Panikattacken beziehungsweise Pani-Attacken auslöst; eine Reaktion, die angesichts der vielen Zusätze im original indischen Wasser nur allzu verständlich ist. Der Darminhalt zeigt angeblich bereits eine gewisse Neigung zur Verflüssigung, wenn man auch nur den Finger hineintaucht. Diese Eigenschaft des indischen Wassers kann bei unerfahrenen Touristen übrigens das Gefühl hervorrufen, dass sie langsam aber sicher überflüssig werden. Deshalb bevorzugen die Touristen das indische Wasser ohne Zusätze in Form von Mineralwasser, serviert in verschlossenen Flaschen. Ich bestelle kopfschüttelnd Panik, der Ober bestätigt dies schüttelnd und zieht, geschüttelt vom Zug, von dannen.
Nach einer Weile taucht er mit mehreren Tabletts wieder auf. Eines davon ist für mich bestimmt. Es enthält eine Menge Reis, einige Soßen und riecht sehr gut. Auch das bestellte Wasser wird gebracht. Die Flaschen mit Mineralwasser sind normalerweise aus Plastik und nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Viele werden nach Gebrauch von Landschaftsarchitekten zur Dekoration der Straßenränder und Felder eingesetzt. Meine Flasche ist sogar aus Glas, damit hätte ich in diesem Zug gar nicht gerechnet. Der Ober hat sie als besonderen Service sogar schon geöffnet. Und nicht nur das: Da ich sowieso kein Hindi lesen kann, hat er auch gleich das Etikett entfernt.
Irgendetwas sagt mir, dass dieses Mineralwasser mehr Zusätze enthält als Mineralien und dass das Essen auf dem Tablett bedeutend länger gekocht wurde, als das Wasser in der Flasche. Ein einziger Zug davon ist mit dem Risiko verbunden, dass das Zug-WC eine Stunde später seinen Namen Worst Case zu Recht verdient und nicht mehr ganz so sauber ist wie jetzt.
Ich streiche das Wasser von meiner Wunschliste und widme mich stattdessen dem Essen. Dieses wird von den Indern ohne Besteck eingenommen – Besteck gibt es nur in Touristenlokalen. Die Inder verwenden stattdessen Chapati, ein Fladenbrot. Durch Chapati und viel Geschick werden Messer, Gabel und Löffel ersetzt und man kann am fehlenden Besteck erkennen, dass man in einem original indischen Lokal ist – habe ich zumindest gelesen. Ich habe auch gelesen, dass in diesen Fällen ein Löffel für den ungeschickten Touristen nicht schaden kann. Einen Löffel mitzunehmen, macht in Indien außerdem doppelt Sinn. Da hat man doch immer gleich etwas zum Abgeben.
Ich ziehe den Löffel aus meinem Rucksack und widme mich dem leckeren Essen. Ein mit gut riechender Soße und Reis gefüllter Löffel wird in den Mund geschoben. Gleichzeitig fällt mir rein zufälligerweise wieder ein, dass ich auch gelesen habe, dass sich die indischen Lokale von anderen nicht nur dadurch unterscheiden, dass es kein Besteck gibt und man original indisch isst, sondern dass das Essen dort auch wirklich original indisch ist. Dies wiederum bedeutet, dass es nicht auf den empfindlichen westlichen Gaumen abgestimmt ist, sondern auf den eher unempfindlichen indischen Gaumen. Man benutzt in Indien zum Essen zwar keine scharfen Messer, dafür aber scharfe Gewürze und dies in einer Menge, dass es ein Wunder ist, dass sich die Gerichte nicht selbst entzünden.
Die scharfe Soße brennt wie Feuer in meinem Mund. Gott sei Dank sitze ich gleich neben dem Fenster und kann den Mist hinausspucken. Leider ist das Fenster fest verschlossen und das Öffnen des Fensters offensichtlich auch im Brandfall nicht vorgesehen. Ich überlege, ob ich das Zeug einfach auf den Teller spucken soll, aber das ginge dann doch zu weit. Es bleibt nur noch ein Ausweg übrig. Mit hochrotem Kopf und tränenden Augen sitze ich da und würge das Gemisch aus scharfen Gewürzen in kleinen Einheiten hinunter. Dabei drehe ich den Kopf zum Fenster, damit die Inder, die schon meinen Löffel neugierig bewundert haben, nicht sehen, wie dumm sich dieser Tourist anstellt.
Ich versuche, das Brennen mit dem Löffel zu lindern – natürlich mit dem indischen Löffel beziehungsweise mit dem Chapati, aber das Brennen hält sich hartnäckig über einen längeren Zeitraum. Das indische Essen ist nicht nur überraschend scharf, es sättigt auch überraschend schnell. Mir zumindest reicht ein einziger Touristen-Löffel voll, ergänzt durch einen indischen Löffel, und ich bin mit dem Essen schon fertig. Die Flasche mit dem Wasser dient lediglich als schöne Dekoration und hätte mit Etikett sicher noch ein bisschen schöner ausgesehen. Zum Trinken ist der Inhalt nicht geeignet und auch als Löschwasser wäre er nur bedingt einsetzbar.
Der Ober, der die ganze Pracht wieder mitnimmt, ist etwas erstaunt, dass ich kaum etwas gegessen und nichts getrunken habe, und verlässt kopfschüttelnd das Abteil.
1 Das Bogenmaß ist eine andere Maßeinheit für den Winkel. Statt 360° verwendet man 2•Π.
Chai pur
Langsam bekomme ich Durst. Eine Bestellung von weiterem Wasser scheidet schon deshalb aus, weil der Ober nicht mehr auftaucht. Anscheinend ist er beleidigt. Vielleicht habe ich grob gegen die indische Speise-Etikette verstoßen, weil ich nur den Löffel aufgegessen habe. Wie auch immer: Bis heute Abend werde ich das schon aushalten.
Beim nächsten Halt in einem Bahnhof sehe ich, dass hier Tee beziehungsweise Chai von fliegenden Händlern angeboten wird. Die Händler fliegen auch sporadisch an meinem Fenster vorbei. Wenn sich das Fenster öffnen ließe, könnte man den Tee kaufen, ohne aufstehen zu müssen. Tee ist heiß und, auch wenn diese Gläser ebenfalls ohne Etiketten sind, so wird doch den sonstigen Zusätzen im Teewasser durch die Hitze etwas warm ums Herz und ihre Neigung, andere Dinge zu verflüssigen, nimmt stark ab.
So weit, so gut. Was mich davon abhält aufzustehen und mir an der Tür einen Tee reichen zu lassen, ist nicht die Angst, dass mein Löffel gestohlen wird, bevor ich ihn abgeben kann, sondern diese Teegläser. Sie sind irgendwie undurchsichtig und sehen aus, als ob sie in einer Fabrik gefertigt wurden, in der tagsüber Ziegel hergestellt werden. Außerdem kann ich nicht erkennen, wie die roten Ziegelgläser eigentlich gewaschen werden. Die Vorstellung, dass sie eventuell überhaupt nicht gewaschen werden, hält mich vom Teekauf genauso ab, wie die Vorstellung, dass zwischen den jeweiligen Teefüllungen eine Zwischenspülung mit einer trüben, nur mäßig wasserähnlichen Substanz erfolgt.
Wider Erwarten geht es mit meiner Stimmung trotz der kleinen Fehlschläge oder auch gerade deswegen langsam wieder aufwärts. Ich bin in Indien, was habe ich anderes erwartet? Das Pflücken der Kalauer vor Ort ist eben doch viel anstrengender als das Erzählen derselben in Good old Germany.
Es ist inzwischen Nachmittag und ich habe mich an Indien schon etwas angepasst. Ein weiterer Inder taucht in unserem Abteil auf und setzt sich auf die Bank. Jetzt wird es noch enger, aber das ist jetzt auch schon egal. Zwischendurch gehe ich immer wieder mal auf den Gang und vertrete mir die Füße. Um mein Gepäck mache ich mir keine Sorgen mehr: Ich habe mir etwas zu essen und zu trinken bestellt und fast alles wieder zurückgehen lassen. Spätestens da war für meine Mitreisenden klar, dass ich vollkommen unberechenbar bin. Wahrscheinlich reden sie über mein Verhalten, sobald ich das Abteil verlasse, und tauschen kopfschüttelnd ihre Erfahrungen mit Touristen aus. Das könnten sie allerdings auch während meiner Anwesenheit tun, da ich kein Wort verstehe. Aber ich bin hier jetzt dieser unberechenbare Typ, der den Kopf so seltsam schüttelt, dass man nie weiß, wie das gemeint ist.
Mittlerweile ist es später Nachmittag und der Zug wird demnächst Lucknow erreichen. Es gilt nun, das nächste Problem zu lösen. Woher weiß ich, dass der Zug in Lucknow ist? Ich gehe davon aus, dass der Zug in Lucknow anhält, was für jeden daran erkennbar sein wird, dass er das Rütteln einstellt – aber das tut er in jedem Bahnhof. Ich könnte natürlich auch meine Mitreisenden fragen. Mit ein bisschen Glück beziehungsweise luck werden sie mit einem vom Zugrütteln überlagerten polygonalen Schütteln des Kopfes antworten, aber das wird mir wahrscheinlich wenig bringen. Auch das Lesen der großen Schilder in den Bahnhöfen bringt nicht so viel wie erwartet, denn sie sind nicht in Deutsch geschrieben, auch nicht in Englisch, sondern in Hindi. In Verbindung mit dem Stoppen des Schüttelns kann man die Schilder durchaus als Bezeichnung für einen Bahnhof interpretieren, aber viel mehr Informationen lassen sich aus ihnen nicht extrahieren.
Es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als meine geografischen Koordinaten an meiner Uhr abzulesen. Die Ankunft in Lucknow ist für 17: 40 Uhr geplant. Ich lege eine knappe halbe Stunde darauf. In der Hoffnung, dass die indischen Züge halbwegs pünktlich sind, werde ich im ersten Bahnhof aussteigen, in dem der Zug nach 18: 00 Uhr hält.
Gerade, als ich mich zu diesem heroischen Entschluss durchgerungen habe, taucht ein junger Inder mit Jeansjacke im Gang auf. Die Jacke lässt den Schluss zu, dass er zweihändiges Englisch spricht. Er gibt mir freundlich Auskunft und sagt mir zu meinem Erstaunen, dass der Zug ziemlich pünktlich in Lucknow ankommen wird.
Luck now
Pünktlich um 17: 40 Uhr verlasse ich den Zug in Lucknow. Ich sehe mich ein bisschen um und erblicke nur Inder. Weißlinge können wahrscheinlich schon deshalb keine aus dem Zug aussteigen, weil keine drin waren.
Kurz darauf stehe ich einsam und verlassen am Eingang zum Hauptbahnhof. Der Fahrer des Hotels, der mich abholen sollte, ist nicht da. Ich vermute, dass es nicht die Regel ist, dass der Zug so pünktlich eintrifft. Bei genauerer Betrachtung bin ich doch nicht ganz so einsam und verlassen. Ein, zwei Inder gesellen sich zu mir. Sie bemühen sich, soweit es ihr Wortschatz zulässt, mich ein wenig aufzuheitern. Allerdings sprechen sie nur einhändiges Englisch und wiederholen ständig zwei Worte: »Taxi Sir!« Eigentlich sind es ein wenig mehr als ein, zwei Inder, sie umgeben mich in einem dichten Pulk. Manche sagen sogar »Sir Taxi!.« Ich fühle mich geadelt und geschmeichelt. Aber das Sir ist im Preis sowieso enthalten. Die meisten Indienurlaube, die man buchen kann, sind Sir-inkl. Bei genauerer Betrachtung ist der Sir ein ebenso fester Bestandteil des Urlaubs wie die Vollpension in den Nationalparks.
Eine zweite Sir-Variante sorgt in Indien immer wieder für Überraschungen, sie ist als Sirprice bekannt. Es gibt sie in der englischen Version als Sirprice und in der Deutschen Version als Sir-Preis. Da ich befürchte, die netten Inder werden das Sir-Taxi mit einem Sir-Preis verknüpfen, beschließe ich, trotz der schmeichelnden Sir-Worte, noch etwas auf den Fahrer des Hotels zu warten und schüttle den Kopf – eine alte Angewohnheit, die ich nicht binnen eines Tages ablegen kann. Irgendwie schüttle ich in der falschen Achse, denn beide Inder verstehen anscheinend nicht, dass ich kein Taxi brauche.
Obwohl ich den Zug nun definitiv verlassen habe, spüre ich sporadisch immer noch einen leichten Zug. Dies hängt vielleicht auch damit zusammen, dass beide Inder beginnen, abwechselnd an mir zu ziehen. Da hilft das ganze Kopfschütteln nichts mehr und ich bin drauf und dran, einen der beiden Inder als Taxifahrer zu nehmen, als der Fahrer aus dem Hotel auftaucht.
Nach einer kurzen Fahrt kommen wir im Hotel an. Das Hotel ist edel eingerichtet und nach der Zugfahrt erscheint es mir wie ein Luxustempel. Auf dem Zimmer erwartet mich eine Flasche mit Mineralwasser. Sie entspricht voll der Touristen-Etikette: verschlossen und sogar mit Etikett. In Gedanken an das Luxuswasser im Zug leere ich sie, obwohl ich den Zug schon verlassen habe, in einem Zug. Das Finden der Toilette ist im Zimmer bedeutend einfacher als im Zug und es zieht nicht so, obwohl man mit Letzterem in einem Zug natürlich rechnen muss.
Kurz nachdem ich es mir im Zimmer gemütlich gemacht habe, läutet das Telefon. Die Rezeption teilt mir mit, dass ein Herr vom Reisebüro auf mich wartet. Ich fahre mit dem Aufzug hinunter. Es handelt sich um meinen Fahrer für die Fahrt zum Dudhwa-Nationalpark am nächsten Tag.
In Indien kann man Autos nur mit Fahrer mieten. Aus Erfahrung wissen die Inder, dass die meisten Touristen mit dem indischen Verkehr völlig überfordert wären, deshalb dürfen die Touristen auch keinen Meter fahren. Trotzdem wollen viele Touristen unbedingt selbst fahren und können sich nicht damit abfinden, auf der Beifahrerseite zu sitzen. Die Inder haben dieses Problem sehr elegant gelöst. Man lässt die Touristen auf der Fahrerseite sitzen und hat kurzerhand Steuerrad und Pedale auf der Beifahrerseite montiert.
Der Fahrer des Reisebüros, ein Mann um die 40, will nur wissen, ob alles geklappt hat, und mir mitteilen, dass wir morgen um 10: 00 Uhr losfahren. Nachdem ich mich mit dem Fahrer, der für seine Berufssparte überraschend gut Englisch spricht, über die morgige Fahrt und den Termin der Rückreise unterhalten habe, fragt er mich nach meinem weiteren Urlaubsverlauf.
Die Tour, die ich diesmal geplant habe, geht zuerst einmal zu zwei Nationalparks im Osten von Delhi. Mein erstes Ziel, der Dudhwa-Nationalpark, liegt ziemlich genau östlich von Delhi an der Grenze zu Nepal. Ziel Nummer zwei, der Corbett-Nationalpark, befindet sich nordöstlich von Delhi. Eine Rundreise hätte sich also angeboten. Das Reisebüro hat aber eine andere Variante gewählt. Die Straße von Dudhwa nach Corbett ist sehr schlecht und nicht befahrbar. Ich muss also von Dudhwa über Lucknow nach Delhi zurückfahren und kann erst von dort zum Corbett-Park fahren. Das Reisen vor Ort in Indien ist eben etwas komplizierter, als man beim Blick auf die Landkarte vermutet.
Schon meine Anreise zum Dudhwa-Nationalpark ist auf den ersten Blick etwas seltsam und auf den zweiten Blick ergibt sich keine Veränderung. Die Reise über Lucknow, südöstlich von Delhi, ist etwa so, als ob man von München nach Passau über Salzburg fahren würde. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass ich zumindest nicht von München über Passau und Salzburg nach Passau fahren muss.
Ich erzähle dem Fahrer von der Reise nach Corbett.
Er sieht mich fragend an, kann es sich wahrscheinlich gerade noch verkneifen, den Kopf zu schütteln, da er weiß, dass die Köpfe der meisten Touristen mit der Zuordnung der Schüttelachse zur jeweiligen kulturinternen Verknüpfung meistens überfordert sind, und fragt mich stattdessen: »Why do you drive back to Delhi and not straight on to Corbett?«
»The road is very bad and it is not possible.«
»The road is no problem. I can drive you to Corbett.«