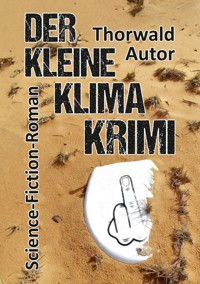4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Was passiert, wenn ein von einer Vielzahl von "Paranoia-Gedanken" heimgesuchter Liebhaber exotischer Abenteuerliteratur erstmals selbst in einem exotischen Land das echte Abenteuer sucht und zu seinem Entsetzen ungewollt und ungebucht auch noch findet? Geplant war ein beschaulicher drei Wochen dauernder Lese-Urlaub in einem indischen Nationalpark mit morgendlichen und abendlichen kontemplativen Ausritten auf Elefanten. Zwischen Tigern und Touristen vor Ort muss der Sofa-Abenteurer feststellen, dass auch in Indien die Praxis nicht immer mit der Theorie übereinstimmt. So wird ihm z. B. bei seiner Ankunft im Park mitgeteilt, dass die Reitelefanten für die Ritte im Park nicht vorhanden sind. Außerdem halten sich die Tiger irgendwie nicht an die Regeln, die in vielen Büchern schwarz auf weiß nachzulesen sind. In der Folge hat er einige intensive Erlebnisse mit dieser Hauptattraktion des Parks. Zusammenfassend muss er feststellen, dass ein Urlaub in einem indischen Nationalpark nicht nur vollkommen anders als erwartet, sondern fast schon ein wenig indisch abläuft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Thorwald Autor
Zwischen Tigern und Touristen 1
Eine satirische Safari in Indien
Behind the Yellow Stone
Copyright: © 2022 Thorwald Autor
Umschlag & Satz: Sabine Abels – www.e-book-erstellung.de
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
Softcover
978-3-347-75075-3
Hardcover
978-3-347-75076-0
E-Book
978-3-347-75077-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der kleine aber feine Unterschied
Der Tiger liegt vollkommen ruhig und entspannt in knapp 100 Metern Entfernung vor uns auf einem Feldweg in der Morgensonne und lässt sich durch uns überhaupt nicht stören. Wir, 3 Touristen, ein indischer Führer und der Mahout, befinden uns auf einem Elefanten im Corbett-Nationalpark in Indien, circa 300 Kilometer nordöstlich von Delhi. Bis auf das Klicken der Kameras dieser dämlichen Touris, die ein Foto um das andere schießen, als ob dies der erste Tiger ist, den sie jemals gesehen haben und der letzte, den sie jemals sehen werden, ist alles ruhig und beschaulich. Es ist ein kalter Dezembermorgen. Die Sonne, die den Nebel gerade vertrieben hat, wärmt mir angenehm den Pelz.
Etwas mehr Action dürfte es schon sein. Das ist ja fast wie im Zoo. Dies wird sicher ein beschaulicher, um nicht zu sagen langweiliger Urlaub. Das sind in etwa die Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Kurz darauf wird mein Wunsch nach etwas mehr Action mehr als angemessen erfüllt und der Tiger zeigt uns den kleinen aber feinen Unterschied zwischen Tigern im Zoo, Tigern in der Wildnis und wilden Tigern.
Das hatte ich so nicht gebucht und so nicht erwartet und ich sterbe halb vor Schreck und dies sollte nicht das einzige erschreckende Erlebnis mit Tigern in diesem mehr als seltsamen Urlaub werden. In Indien kann man bekanntlich nicht nur billig leben, sondern bei Bedarf auch billig sterben.
Wie kommt man überhaupt zu einer Safari in Indien? Das klassische Safariland ist schließlich Ostafrika. Jeder weiß, wie die Wildnis in Ostafrika aus der Nähe aussieht, nämlich wie das Innere eines geländegängigen Fahrzeuges mit hochklappbarem Dach, unter Insidern auch als lions-lunch-box bekannt.
In einem Beitrag im Fernsehen war ich 1991 über den indischen Nationalpark Corbett, circa 300 Kilometer nordöstlich von Delhi, gestolpert. Er bot gegenüber Afrika einige entscheidende Vorteile. Im Winter ist es zumindest im Norden Indiens vergleichsweise kalt. Zumindest so kalt, dass einerseits die Wahrscheinlichkeit auf längliches giftiges Getier sowie flugfähige malariaübertragende Insekten zu treffen, gering ist. Andererseits kann man sich in den indischen Nationalparks an vielen exotischen Tieren wie Tigern und Elefanten erfreuen. In Afrika dagegen gibt es Elefanten, Schlangen und Moskitos nur im Pauschal-Paket. Ein weiterer besonderer Leckerbissen im Corbett-Nationalpark waren die zahmen Reitelefanten. Mit ihnen konnte man täglich den Park erkunden.
Üblicherweise bucht man bei einer Safari eine „Fix-und-Fertig-Tour“, die nicht nur durch mehrere Nationalparks, sondern auch dazu führt, dass man ständig unterwegs ist und vom „Urlaub“ bestenfalls nur noch eine Reise übrigbleibt. Als Leseratte schwebte mir eher ein entspannter, kontemplativer Aufenthalt in einem einzigen Nationalpark vor, denn dann hatte ich jeden Tag genügend Zeit, mich zwischen dem bewundern von exotischem Getier in einem exotischen Land dem Lesen von einschlägiger exotischer Safariliteratur vor Ort zu widmen.
1991 gab es noch kein Internet und die Buchung gestaltete sich etwas schwierig. Erst nach vielen Anrufen wurde ich in einem kleinen Reisebüro in München fündig. „Corbett, ja das ist uns bekannt, da war ich auch schon einmal, ich würde Ihnen eine Buchung im Camp Dhikala im Zentrum des Parks empfehlen“, sagte eine freundliche Stimme am anderen Ende der Leitung. Außerdem stellte sich heraus, dass der Urlaub signifikant billiger als eine entsprechende Safari in Afrika sein würde. Na also. Ich buchte umgehend.
Bald würde es also ernst werden. Dies würde mein erster Urlaub in einem exotischen Land sein und das auch noch ohne den Schutz und den Rat einer erfahrenen Begleitperson, die dafür sorgt, dass die Mitglieder der Reisegruppe, die auf ausgetretenen Touristenpfaden in der vorgeschriebenen Reihenfolge ein Foto um das andere schießen und sich keinerlei Gedanken um irgendwelche Probleme machen müssen, vollzählig und am Stück wieder die Rückreise antreten können. Da ich allein unterwegs sein würde, machte ich mir im Gegensatz dazu viele Gedanken, was wohl alles schief gehen konnte und es fiel mir in kurzer Zeit erschreckend viel ein. Dazu gab es noch jede Menge gute und enorm beruhigende praxisnahe Tipps aus dem Bekanntenkreis. Was ist zu tun bei Sandflöhen unter den Zehennägeln, beim Sitzen auf einem Stuhl sollte man immer eine Zeitung unterlegen, weil die meisten Stühle verwanzt sind, das eigene Bettzeug wäre unumgänglich, man müsste sich unbedingt unter anderem gegen alles impfen lassen, überall lauern Diebe usw. usw. Schon eine normale Reise ist eine Gleichung mit einer unbekannten Zahl an Unbekannten. Bei einer Reise nach Indien kommt anscheinend noch eine volle Reisschale voll Unbekannter hinzu. Summa summarum hatte ich genügend Paranoia-Gedanken um nicht nur 4 Wochen, sondern 4 Monate Indien zu überstehen, ohne dass ich einen Engpass in diesem Bereich befürchten musste.
Am meisten Sorgen machten mir die ganzen Krankheiten und meine besonderen Freunde, die Schlangen. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie nicht. Mir reicht es schon, wenn ich sie im Fernsehen sehe. Der Gedanke, demnächst einem dieser Exemplare gegenüber zu stehen, war nicht gerade beruhigend.
Zu Fuß kann man ja noch selber aufpassen, wo man hintritt, aber wie war das auf dem Elefanten? Dort ist man zwar vor den Schlangen auf dem Boden sicher, aber man sollte die Schlangen in den Bäumen nicht vergessen. Man kann ihnen kaum ausweichen, wenn man auf dem Rücken eines Elefanten sitzt. Vielleicht kann man sich mit der Kamera wehren und notfalls ist ein gebrochenes Bein, das man sich beim Notausstieg vom Elefanten zuzieht, allemal einem Biss in die Nase vorzuziehen.
Landung in Delhi und Fahrt zum Park
Es ist noch früh am Morgen. Nach der letzten Kontrolle am Flughafen in Delhi sehe ich einige Inder, die Schilder mit Namen von irgendwelchen Touris in den Händen halten. Die Schilder sind sogar in Englisch und nicht in Hindi beschriftet. Das erleichtert das Lesen des Textes und vor allem des eigenen Namens doch wesentlich. Entgegen meinen Befürchtungen taucht auch mein Name auf einem der Schilder auf und ein freundlicher Herr in Anzug und Krawatte begrüßt mich auf Englisch. Da sein Englisch nicht besonders gut, mein Englisch aber besonders schlecht ist, ist die Unterhaltung etwas holprig. Er erklärt mir, dass ich hier am Flughafen die beste Gelegenheit habe, Geld zu wechseln und schickt mich zum nächsten Schalter.
Zum Wechseln ist überraschenderweise nicht nur das Vorzeigen von Geld, sondern vor allem das Vorzeigen des Passes notwendig. Man erhält eine Quittung, die man sorgfältig aufbewahren muss, weil man ohne sie die Rupien nicht mehr zurückwechseln kann. Das ganze Procedere erscheint mir etwas seltsam, aber ich lasse es einfach über mich ergehen, da ich ziemlich müde bin, denn ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Nachdem mein Pass weitaus intensiver kontrolliert wurde als die Dollarnoten, bekomme ich jede Menge Rupien. Die Rupien sind gebündelt und jedes Bündel ist zu meiner Verblüffung an einem Ende mit einer kapitalen Heftklammer geheftet. Ich nehme den gesamten Haufen ohne lange nachzuzählen und denke einen Moment darüber nach, wo ich den ganzen Segen unterbringen kann. Aufgrund der schieren Masse kommt der Geldbeutel nicht in Frage. Ich verstaue die gehefteten Bündel schließlich einigermaßen diebstahlsicher in den Tiefen meiner Handgepäcktasche.
Geldbündel in übersichtlicher gehefteter Bündelung. Geld gehört anscheinend nicht zu den Dingen, die in Indien heilig sind.
Der freundliche Herr aus dem Reisebüro hat so lange auf meine große Reisetasche aufgepasst und nun geht’s raus zum Parkplatz und mit einem Auto zum Reisebüro. Bei dem Auto handelt es sich um einen sogenannten Ambassador, angelehnt an das englische Wort für Botschafter. Eine Automarke, die modern war, als sich Indien auf den Weg nach Indien aufmachte, die aber ihre besten Zeiten schon lange hinter sich hat. Dafür hat der Amby den Vorteil, dass man überall Ersatzteile bekommt, notfalls werden sie geschmiedet.
Einen Sicherheitsgurt suche ich vergeblich und das Botschaftspersonal hat die seltsame Angewohnheit auf der falschen Seite zu fahren, was mich hinreichend verwirrt. Überhaupt ist der Verkehr, obwohl um diese frühe Stunde noch nicht zu voller Blüte erwacht, sehr gewöhnungsbedürftig. Eine Zeitlang versuche ich, die Regeln zu verstehen, sehe aber bald ein, dass ich dazu wohl länger brauche als ein paar Wochen Aufenthalt in Indien und überlasse das Fahren dem Fahrer in der Hoffnung, dass zumindest einige Jahrzehnte Fahrpraxis ausreichen, um die Grundlagen der indischen Verkehrsregeln zu durchdringen.
Nach kurzer Fahrt sind wir im Reisebüro angelangt, ich erhalte einen Kaffee und weitere Instruktionen. Der von mir gebuchte Botschafter nebst Fahrer wird mich nun nach Dhikala, einem Camp im Zentrum des Corbett-Parks, bringen. Die Strecke führt über die Stadt Moradabad, dort werden wir links abbiegen und werden kurz darauf im Park sein. Zusammengefasst kommt man also von Delhi zum Corbett-Park indem man einmal links abbiegt. Das ist leicht zu merken. Die Entfernung zwischen Delhi und Corbett ist dagegen nicht leicht zu merken, denn es scheint keine feste Größe zu sein. Zumindest machen die wenigen Reisebücher und Prospekte, die sich zu diesem Thema äußern, verschiedene Angaben. Es ist ähnlich wie mit manchen Entfernungsangaben in Europa. Auch die Entfernung Holland – Lolland fällt, je nach Buch, verschieden aus. Sie entspricht in etwa einer Strecke von 300 Kilometer und liegt damit zufälligerweise in derselben Größenordnung wie Delhi – Corbett.
Der Fahrer, der mich vom Flughafen ins Reisebüro gefahren hatte, ist anscheinend für Überlandreisen nicht geeignet und wird durch einen bärtigen Mittdreißiger ersetzt. Zusätzlich wird sicherheitshalber das Fahrzeug gewechselt.
Die beiden Taschen werden diebstahlsicher (dank der heißen Tipps aus dem Bekanntenkreis bin ich u.a. auf alles vorbereitet und rechne mindestens mit dem Schlimmsten) im Kofferraum verstaut, nur die Kamera wird mitgenommen. Auch der neue Botschafter hat keine Sicherheitsgurte, ich wähle deshalb ein lauschiges Plätzchen auf dem Rücksitz. Dort, so hoffe ich zumindest, ist die Verletzungsgefahr im Falle eines Unfalles am geringsten.
Und schon geht’s los. Der neue Fahrer will mit mir unbedingt ins Gespräch kommen, aber sein Englisch ist noch um Größenordnungen schlechter als meines. Das ist zwar einerseits schade, andererseits aber auch wieder beruhigend. Ich hatte mir neben einer langen Liste mit den unbedingt notwendigen Impfungen auch schon Ge-danken gemacht, ob ich mein Englisch in einem VHS-Kurs etwas auffrischen sollte. Ich fühle mich gleich etwas wohler. Zumindest werde ich nicht aufgrund meiner mangelnden Englischkenntnisse auffallen.
Der Fahrer ist mindestens so neugierig wie ich müde, aber nach einiger Zeit sieht er anscheinend ein, dass doch wohl besser er einen VHS-Kurs belegen sollte. Mittlerweile fahren wir durch das inzwischen erwachende Delhi. Auf den Straßen erscheinen diverse Gefährte, die ich bis jetzt nur aus dem Fernsehen kenne. Ochsenwagen, Botschafter, Rikschas, Fahrräder, Handkarren und hochbeladene Lastwagen, die sogenannten Trucks, suchen sich ihren Weg durch die Stadt. Alle fahren auf der falschen Seite. Sogar ein Elefant, der wie ein riesiger grauer Schatten auf der Straße dahinmarschiert, hält sich an den Linksverkehr. Vielleicht wird er aber auch durch den Mahout, der auf seinem Rücken sitzt, gelenkt.
An einer Kreuzung müssen wir an einer Ampel halten und eine alte Bettlerin klopft an die Scheibe. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich würde ihr ja gerne etwas Geld geben, aber die 13 Pfund Rupien sind im Kofferraum und die Dollar, die ich bei mir habe, sind in einer extra Tasche, die auf der Innenseite meiner Hose angebracht ist und an die ich nur herankomme, wenn ich die Hose etwas herunterlasse. Der Schneider, der diesen Spezialauftrag bekam, hat mich etwas schräg angesehen. Aber was soll’s. Die ganzen guten Ratschläge nutzen im Endeffekt nur etwas, wenn man sie auch umsetzt. Ich starre also die Bettlerin mit meinen müden Augen etwas hilflos an und sie starrt zurück. Es hat sich ein Patt entwickelt, das Gott sei Dank von der Ampel aufgelöst wird. Wir fahren weiter und ich mache mir allmählich Gedanken, ob sich die 150%ige diebstahlsichere Unterbringung meines Geldes mit der Verfügbarkeit vereinbaren lässt.
Wir kommen langsam in die Außenzonen von Delhi, der Verkehr wird weniger. Die Straße ist geteert, gut ausgebaut und auf beiden Seiten von Bäumen gesäumt. Das Land außerhalb von Delhi ist eben und fruchtbar und voller Felder. Obwohl es Dezember ist, sind die Felder alle bepflanzt. Eine Winterpause gibt es anscheinend nicht. Aufgrund des milden Winters sind scheinbar mehrere Ernten pro Jahr möglich. Das Wetter im Dezember ist wie bei uns im Mai: morgens ist es noch kühl und tagsüber wird es angenehm warm.
Auf der Straße haben keine zwei Fahrzeuge vollständig nebeneinander Platz. Eines der sich entgegenkommenden Fahrzeuge muss immer teilweise auf den unbefestigten Rand ausweichen. Dort gerät man in das Reich der Radfahrer und Fußgänger, die aber anscheinend gerne bereit sind, dem Botschafter Platz zu machen, auch wenn sie dies erst im letzten Moment tun.
Gefahren wird streng nach den Regeln Darwins: Es gilt das Recht des Stärkeren. Der jeweils Schwächere in der Kette weicht aus und zwar ohne zu knurren und zu murren. Der Fahrer kennt die Abmessungen seines Autos anscheinend ziemlich genau. Im Zentimeter-Abstand und weniger fährt er mit Tempo 50 km/h und mehr an den Radfahrern und Fußgängern vorbei. In Indien muss man den Begriff Nahverkehr anscheinend völlig neu definieren. Das Ganze läuft, obwohl niemand schimpft, nicht völlig lautlos ab, denn es gehört scheinbar zum guten „Ton“, alles was sich bewegt und seien es nur ein paar Kühe auf der Straße, anzuhupen. „horn please“ ist auf allen Trucks, die wir überholen, zu lesen. Eine Aufforderung, der die indischen Fahrer nur allzu gerne folgen. Vermutlich steht eine funktionsfähige Hupe beim indischen TÜV in der Prioritätenliste weit höher als eine funktionierende Bremse.
Ich weiß nicht wie mein Fahrer mit Vornamen heißt, aber Gefahr ist anscheinend der zweite Vorname aller Fahrer. Entsprechend wird gefahren. Das Einzige was noch gefährlicher ist als die Überholmanöver meines Fahrers sind die Überholmanöver der anderen Fahrer. Auch die strategischen Bremsmanöver um den in die Straße laufenden Kühen und Hunden auszuweichen, tragen dazu bei, dass die Touris trotz Müdigkeit hellwach bleiben und den Wert eines Sicherheitsgurtes nun signifikant höher einstufen als noch 24 Stunden vorher.
Vor allem die Hunde überstehen die Ausflüge auf die Straße nicht immer unbeschadet. Ich sehe einige Exemplare, die sich offenbar einem Lastwagen in den Weg gestellt hatten und denen in Folge dieser groben Missachtung der Regeln Darwins eine ganze Dimension und etwas Geschwindigkeit abhandengekommen war. Sie sind nun nur noch zweidimensional und liegen in dieser reduzierten und immobilen Form auf der Straße. Das Fell klebt sozusagen auf der Straße. In Deutschland sagt man nicht „es klebt“, sondern „es picct“. Damit wird auch sofort klar, woher der Ausdruck „picco bello“ kommt.
Die Straße ist einigermaßen gut, enthält aber doch diverse Schlaglöcher. Der Botschafter weicht den Schlaglöchern so gut es geht aus, schafft es aber nicht immer. Anscheinend sind aber die Stoßdämpfer besser als ich dachte, denn trotz des zusätzlichen Gewichtes der Rupien im Kofferraum gibt es selten harte Schläge. Angesichts der Straße verstehe ich langsam, warum viele Touristen in Indien typische Entwicklungsstadien durchlaufen. Einerseits sind sie von den vielen Armen gerührt, andererseits werden sie im Laufe des Urlaubs immer wieder im Straßenverkehr ordentlich durchgeschüttelt. Die einzelnen Eindrücke verschieben sich im Laufe der Zeit. Am Ende des Urlaubs bleibt bei vielen Touristen ein Gesamteindruck übrig, der eher dem James Bond Martini entspricht: shaken, not stirred, auf Deutsch: geschüttelt, nicht gerührt.
Zur Mittagszeit fragt mich mein Fahrer irgendetwas. Anscheinend will er eine Mittagspause machen. Ich überlasse es ihm, die Gaststätte auszusuchen und bin nicht weiter überrascht, als er ein indisches Lokal wählt. Die Einrichtung entspricht nicht ganz dem, was ich in Germany gewöhnt bin, aber das war ja auch nicht zu erwarten. Ein Ober bringt uns eine Speisekarte. Die Auswahl ist groß, aber leider sind alle Speisen in Hindi ge- beziehungsweise beschrieben. Erschwerend kommt hinzu, dass mir wahrscheinlich auch eine detaillierte Beschreibung auf Deutsch nicht viel weiterhelfen würde, da sich meine Kenntnisse der indischen Speiselandschaft auf Currywurst beschränken.
Da ist guter Rat teuer. Ich sehe meinen Fahrer etwas hilflos an. Der bärtige Bursche kutschiert öfters Touris durch die Gegend, kennt wahrscheinlich seine Pappenheimer und hat das nun Folgende wahrscheinlich schon 100-mal durchgespielt: Er wird mir zum Entre in seinem Oxford-Englisch, dem ich mit meinen beschränkten Kenntnissen kaum folgen kann, erklären, was die einzelnen Gerichte enthalten. An meinem Gesichtsausdruck wird er ablesen, dass ich ihm nach Oxford nicht folgen kann und deshalb die schwierigen Wörter zusätzlich nochmals in Hindi erklären, wobei er diese Worte mehrfach und betont langsam aussprechen wird. Eine Methode, die in der ganzen Welt bekannt ist und die auch in Deutschland bei Gesprächen mit Deutschunkundigen gerne verwendet wird.
Nachdem er den Zyklus mehrmals durchlaufen hat, ich aber nur „tren“, was auf Hindi soviel wie Bahnhof heißt, verstanden habe, wird er mir ein Gericht vorschlagen und mit Gesten unterstreichen, wie gut es ist. Dann wird er auf meine Zustimmung warten, dem Ober in besten Alt-Delhi-Hindi sagen, dass der Koch mit Gewürzen äußerst sparsam umgehen soll, da dieser Tourist schwer magenkrank ist, was man unschwer an seiner blassen Farbe erkennen kann. In dem Wissen, dass durch diese Dienste sein Trinkgeld am Ende der Reise etwas höher ausfallen wird, wird er sich das Essen schmecken lassen. Wahrscheinlich wird er sich auch den einen oder anderen Gedanken darüber machen, was wohl Deutschland für ein seltsames Land ist. Ein Land, in dem Leute, die nicht einmal Hindi sprechen, eine Sprache, die eigentlich auch der dümmste Inder spätestens im Alter von 3 Jahren beherrscht, so viel Geld verdienen, dass sie sich einen teuren Urlaub leisten können.
Nachdem wir den oben beschriebenen Zyklus zweimal durchlaufen haben, bestellt der Fahrer für mich. Nach einer Weile bringt der Ober eine Mehlspeise, die überraschend gut schmeckt, wenn sie auch mit der geliebten Currywurst überhaupt nicht vergleichbar ist. Das Essen ist angenehm gewürzt und in welcher Gerüchteküche auch immer das Gerücht entstanden ist, dass die indischen Gerichte so scharf sind, dass man keinen Bissen hinunterkriegt, es handelte sich keinesfalls um eine indische Küche.
Nach dem Essen muss ich auf die Toilette. Sie befindet sich hinter der Kneipe und man muss ein Stück über einen unbefestigten schmalen Weg gehen, der beiderseits mit Gras bewachsen ist. Ich bin zum ersten Mal in der Heimat meiner besonderen Freunde, der Schlangen. Der Gedanke, dass irgendwo aus dem Gras entlang des Weges der Kopf einer Kobra inklusive langer Giftzähne in Beiß-Erwartungshaltung auftauchen könnte, bereitet mir große Sorgen. Sorgfältig wird der Weg abgescannt. Ich kann keine verdächtige Bewegung im Gras feststellen und wage schließlich die ersten Schritte. Zu meiner Beruhigung werde ich weder auf dem Hinnoch auf dem Rückweg von irgendwelchen Schlangen belästigt.
Mein Fahrer wartet bereits auf mich. Es ist Zeit aufzubrechen. Wir beziehungsweise ich muss nur noch zahlen. Natürlich werde ich die Rechnung des Fahrers übernehmen. Leider haben mich die nicht vorhandenen Kobras so sehr abgelenkt, dass ich nicht daran dachte, auf der Toilette einige Dollar aus dem diebstahlsicheren Versteck zu holen. Diese Situation ist neu für den Fahrer. Ich stottere herum und will mich gerade nochmals auf den Kobrapfad begeben, als mein Fahrer sagt, dass er zahlen wird. Ich versichere ihm, dass er das Geld bekommt, sobald wir am Ziel angekommen sind. Eine Versicherung, die er lässig abnickt und schon geht’s weiter.
Nach dem Essen falle ich für eine halbe Stunde ins Suppen- beziehungsweise Currykoma und lege mich einfach auf die Rückbank, in der Hoffnung, dass der Fahrer, nachdem er gerade beim Bezahlen seine Klasse bewiesen hat, den Weg auch ohne mich findet.
Schlaglöcher, speed breaker und starke Krämpfe in der Huphand des Fahrers lassen jedoch eine längere Auszeit nicht zu und ich wende meine Aufmerksamkeit wieder der indischen Straße zu. So ganz ohne Gefahren wird in Indien nicht gefahren. Meistens gehen die riskanten Manöver glimpflich ab, aber ab und zu kracht es anscheinend doch. Überraschenderweise sind es anscheinend die Könige beziehungsweise Maharajas der Landstraße, die Trucks, die öfters auf der Strecke bleiben. Ich habe jetzt schon einige gesehen, die mit dem Bauch auf der Seite am Straßenrand liegen. Sie sehen aus wie gestrandete Wale. Andere haben nur kleinere Pannen und der Truck wird an Ort und Stelle repariert. Dabei wird die „Werkstatt“ an der Straßenseite mit Steinen rund um den Truck gesichert. Ich habe die Wale und die Werkstätten gezählt und allmählich zeichnet sich ein Muster ab: Etwa alle 30 Kilometer liegt beziehungsweise steht ein Truck. Man kann damit offensichtlich die Entfernung messen. Dies ist natürlich keine exakte Messung und die unterschiedlichen Entfernungsangaben Delhi – Corbett erscheinen nun in ganz anderem Licht.
Skizze Reiseroute:
Die Fahrweise meines Fahrers ist stellenweise ziemlich rasend beziehungsweise rasant. Hin und wieder kommt der Wagen beim Ausweichen der Schlaglöcher, Radfahrer, Kühe und dergleichen doch verdächtig ins Schlingern. Der Gedanke, bei einem Zusammenstoß vom Rücksitz des Botschafters wie ein Geschoss durch die Windschutzscheibe in eine der heiligen Kühe zu fliegen, bereitet mir doch etwas Sorgen. Ich lehne mich deshalb nach vorne und presse mich an die Sitzbank vor mir, um etwas Schwung aus der Sache zu nehmen. Dies nimmt der Fahrer als Aufforderung, um mit mir, soweit es sein Englisch und mein Hindi zulässt, ein ausführliches Schwätzchen zu halten. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als seine detaillierten Schilderungen vom Leben in Delhi oder was immer er mir erzählt, freundlich abzunicken.
Manchmal stranden nicht nur die Trucks, sondern es werden auch Tiere getötet. Diese werden dann anscheinend von der Straße in den Graben gezogen und dort nimmt der natürliche Gang der Dinge seinen Lauf. Dieser besteht nicht darin, dass der Kadaver wochenlang vor sich hin stinkt und sich eine Armee von Maden daran so mästet, dass es fraglich ist, ob die aus den Maden entstehenden Fliegen ihrem Namen wirklich jemals gerecht werden können. Die Inder haben das Problem anders gelöst. Ein dichtes Netz von ehrenamtlich arbeitenden mobilen Aufräumkommandos durchzieht das Land. Noch bevor der ahnungslose und über die Verfügbarkeit seines Geldes nachdenkende Tourist durch die Scheibe fliegt und sich in den nächsten Wasserbüffel bohrt, ahnen die Späher in der Luft bereits das Geschehen und nähern sich dem Fahrzeug. Der Unfall und die Landung der Geier auf den Bäumen, die die Straße säumen, laufen annähernd simultan ab. Kaum dass der Kadaver des Büffels, aus dem der Tourist meistens vorher herausgezogen wird, im Graben liegt, beginnt das große Fressen. Unterstützt vom Bodenpersonal in Form von wilden Hunden, wird der Tierkörper, noch bevor die erste Made ein Stück abbeißen kann, komplett verspeist.
Inzwischen haben wir Moradabad passiert und sind links abgebogen. Die Straße wird nun enger und schlechter. Ein Dorf reiht sich an das nächste. Ganz Nordindien scheint aus lang gezogenen Dörfern und fruchtbaren Feldern zu bestehen, gesprenkelt mit vereinzelten Bäumen. Außer Kühen und Hunden gibt es anscheinend keine Tiere, vor allem keine Wildtiere. Nicht einmal Rehe oder zumindest das indische Pendant dazu sind zu sehen, geschweige denn Elefanten oder Tiger. Ich habe allmählich Zweifel, ob der Park überhaupt existiert. Wo immer die Aufnahmen gemacht wurden, die ich im Fernsehen gesehen habe, sie wurden offensichtlich nicht in dieser Gegend aufgenommen. Wahrscheinlich wird mich der Fahrer in irgendeinem Hotel absetzen, in dessen Hinterhof einige Gehege mit Tieren, vielleicht sogar mit Tigern, zu sehen sind. Oder in dem man zumindest den Film über den ominösen Park, so oft man will, eventuell sogar kostenlos, auf Video anschauen kann.