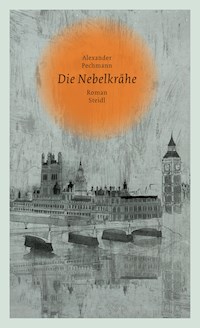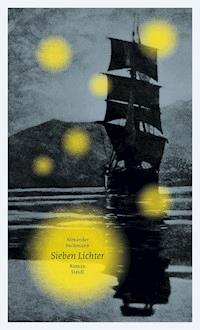Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl GmbH & Co. OHG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
David Van Roon arbeitet südlich von Rhode Island an der Karte einer Insel, als er Zeuge eines Unglücks wird: Die Princess Augusta erleidet Weihnachten 1738 vor der Küste Schiffbruch. Obwohl Van Roon einer der wenigen ist, die kurzentschlossen hinausrudern, um zu helfen, plagen ihn Albträume und Gewissensbisse, nachdem er aufs Festland zurückgekehrt ist. Seine Erinnerung an die Katastrophe bleibt merkwürdig lückenhaft. Als ein Jahr später Gerüchte über ein vor der Insel aufgetauchtes Geisterschiff kursieren, fühlt er sich gezwungen, der Sache auf den Grund zu gehen. Die Überlebende Long Kate berichtet ihm von der monatelangen Überfahrt, von den Leiden der Passagiere, den Verbrechen der Crew und von einem Unheil, das in der Alten Welt seinen Anfang nahm. Doch erst als Van Roon selbst das brennende Schiff vor Block Island sichtet, erkennt er das Ausmaß seiner eigenen Schuld. Alexander Pechmanns historisch-phantastischer Roman basiert auf den zahlreichen Geschichten und Balladen um das Geisterschiff The Palatine Light, sowie auf der Inselchronik von Block Island und der historischen Fahrt der Princess Augusta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexander Pechmann
DIE INSEL DES KLEINEN GOTTES
Roman / Steidl
Sei dein eigener Palast, sonst wird dir die Welt zum Gefängnis.
John Donne
Inhalt
Prolog
Erster Teil: Die Insel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Zweiter Teil: Das Schiff
Die erste Karte: Die Drei der Schwerter
Die zweite Karte: Der Mond
Die dritte Karte: Die Acht der Kelche
Die vierte Karte: Der Gehängte
Die fünfte Karte: Die Fünf der Scheiben
Die sechste Karte: Der Turm
Die siebte Karte: Der Ritter der Stäbe
Die achte Karte: Die Zehn der Schwerter
Die neunte Karte: Der Teufel
Die zehnte Karte: Die Vier der Stäbe
Dritter Teil: Das Feuer
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Zum Weiterlesen
Dank
Impressum
Prolog
Ich leide weder Hunger noch Durst. Da ist kein Herz mehr, das schlagen könnte, und das kalte Feuer ersetzt mir die Atemluft. Während das Schiff im Schattenmeer kreuzt, spüre ich nichts außer einem schwachen Sehnen nach etwas, das ich nicht benennen kann, obwohl ich weiß, dass es da ist. Ich warte reglos wie eine kleine Spinne im dunklen Winkel einer verlassenen Welt. Im Geiste wiederhole ich endlos meine Geschichte, suche nach Bedeutungen und Erklärungen, die mir bislang entgangen sind. Manchmal blitzt etwas auf und ich glaube zu verstehen, dann wieder erscheint mir das Ganze beliebig oder völlig absurd. Sind wir nur Puppen in der Hand eines launischen Gottes? Um die Antwort zu finden, will ich noch einmal von vorne beginnen …
DIE INSEL
Die Zauberinnen sollst du nicht am Leben lassen.
2 Mose 22,17
1
Ein Jahr nach dem Untergang der Princess Augusta begannen seltsame Gerüchte zu kursieren. Das Einwandererschiff aus Rotterdam war im Dezember 1738 vor Block Island verbrannt und gesunken, nun schien es als grelles Phantom vom Meeresgrund aufzusteigen: Männer der Küstenwache hatten in einer stürmischen Winternacht den brennenden Dreimaster erneut gesichtet und entsetzliche Schreie gehört. Sie waren mit dem Rettungsboot hinausgerudert, um der Crew und den Passagieren zu helfen, doch bevor sie nahe genug herankommen konnten, war das Schiff lautlos verschwunden, ohne eindeutige Spuren eines Unglücks zu hinterlassen. Keinerlei Wrackteile, Beiboote oder Überlebende. Nach wenigen Minuten war der unheimlich lodernde Brand wie eine kümmerliche Talgkerze erloschen, ohne die geringste Rauchschwade oder zumindest den Geruch von verbranntem Holz und Tauwerk zu hinterlassen.
In den Zeitungen Neuenglands las man in den folgenden Monaten hin und wieder von weiteren Sichtungen der rätselhaften Erscheinung. Skeptiker lachten darüber und scherzten über gewisse Leute, die gern zu tief ins Glas schauten. Fromme Menschen hielten die Sichtung jedoch für ein göttliches Zeichen, ängstliche für ein böses Omen und abergläubische für ein Geisterschiff, das an irgendein entsetzliches Verbrechen gemahnte. Jemand, so munkelte man, habe damals das geplünderte Wrack der Princess Augusta in Brand gesteckt, um von einer weit schlimmeren Tat abzulenken, und nun sorgten viele Monate später gespenstische Flammen dafür, dass nichts vergessen und niemandem vergeben wurde.
Ich hätte das alles gern als blühenden Unsinn abgetan, der nur dazu diente, Zeitungsspalten zu füllen, wenn ich nicht selbst in jener Nacht, als die Princess auf Grund lief, am Strand von Sandy Point gewesen und zu dem Schiff hinausgerudert wäre. Die Vorstellung, dass dort immer noch etwas umging, das die Erinnerung an diese Schande wachhielt, erschütterte mich zutiefst. Niemand konnte wirklich Interesse daran haben, die Vergangenheit zurückzuholen, weder die Lebenden noch die Toten. Zumindest niemand, der damals das echte Feuer gesehen und die echten Schreie gehört hatte.
Zuweilen kehrte ich in meinen Träumen dorthin zurück, und mir war, als hörte ich das Meer selbst schreien, als wäre das Tosen der Brandung ein Chor der Verdammten und jede Welle eine Hand, die sich verzweifelt zum Himmel reckte, um ein kleines Stück von dieser lebenspendenden Kuppel aus Luft und Licht zu ergattern.
Die Zeit heilt alle Wunden, so sagt man, aber es war sinnlos, mir etwas vorzumachen. Ich wusste nur zu gut, dass mich die Ereignisse jener Nacht ein Leben lang verfolgen würden, obwohl ich noch nicht einmal einen Bruchteil der ganzen Geschichte kannte und mir vieles verborgen geblieben war. Damals, in den letzten Tagen des Jahres 1738, hatte ich nur eine Möglichkeit gesehen: Block Island zu verlassen, so schnell wie möglich und ohne je zurückzublicken. Nun erschien mir eine baldige Rückkehr zwingend notwendig. Ich musste endlich die Wahrheit erfahren, und die neuen Zeitungsartikel, so sensationslüstern und phantastisch sie auch anmuteten, bestärkten mich in meiner Absicht.
Ich kannte flüchtig jemanden, der hin und wieder für die Pennsylvania Gazette schrieb; ein alter Federfuchser mit Tinte an den Fingern und abgewetzten Rockärmeln, ebenso gebildet wie eingebildet. Menschen mit sauberen Hemden mieden ihn wie der Teufel das Weihwasser. Wenn man ihm einen Whiskey spendierte, begann er jedoch selig von alten Zeiten zu schwadronieren, und nach dem zweiten Glas wurde er hochpolitisch und flüsterte verschwörerisch von der baldigen Unabhängigkeit der Kolonien. Wir saßen beim dritten Glas, als ich ihn nach der angeblichen Wiederkehr der Princess Augusta fragte.
»Ach, dieses vermaledeite Geisterschiff«, sagte er, als wären die Gerüchte um den Spuk auf hoher See gar nicht so außergewöhnlich. »Jeder spricht von diesem Geisterschiff, um nicht über das eigentliche Übel sprechen zu müssen.«
»Wie meint Ihr das, Mr. Fryer?« Ich füllte sein Glas zum vierten Mal nach.
Fryer rollte ungeduldig mit den Augen, strich eine fettige Haarsträhne aus der faltigen Stirn, lehnte sich zurück und trank den starken Fusel in einem Zug aus. »Kennt Ihr die Eigentümer der Princess? Die Brüder Hope? Nun, die verdienen sich eine goldene Nase, indem sie Einwanderer über den großen Teich bringen. Deutsche, Pfälzer vor allem, und Holländer. Ihre Schiffe pendeln zwischen Rotterdam und Philadelphia. Sie bringen Siedler in die Kolonien und Tagelöhner nach Pennsylvania, Massachusetts und Rhode Island.«
Ich nickte. Die Reederei der Hope-Brüder war bekannt wie ein bunter Hund, und jeder hatte schon einmal diese totenbleichen, zerlumpten Einwanderer gesehen, die nach vielen Wochen in dunklen Frachträumen auf See zum ersten Mal einen Fuß auf den Boden ihres Gelobten Landes setzten.
»Jawohl, Sir. Sie bringen neue Nahrung für die große Knochenmühle namens Amerika. Vierhundert Passagiere pro Fahrt, die Kinder nicht mitgezählt.«
Er schwieg und starrte mich herausfordernd an. Ich zuckte mit den Achseln. »Und weiter?«
»Soviel ich weiß, wurden rund sechzig Passagiere von der Princess Augusta gerettet, zwei oder drei Dutzend tot geborgen. Nun frage ich Euch, mein lieber Freund, wo sind die anderen geblieben? Die Rechnung geht nicht auf. Dreihundert Menschen sind einfach so verschwunden.« Er schnippte mit den Fingern. »Aber niemand interessiert sich dafür. Niemand wollte meinen Artikel drucken. Und jetzt ergötzt man sich an kindischen Gespenstergeschichten über brennende Schiffe und Strandpiraten!«
Ich zuckte unwillkürlich zusammen, als er die Zahl der Vermissten erwähnte. Dreihundert! Ich hatte einige der Überlebenden gesehen, doch sie waren zu schwach gewesen, um irgendwelche Fragen zu beantworten. Zwei Frauen waren am winterlichen Strand gestorben, gleich nachdem sie aus dem Wrack entkommen waren. Sogar die Stärksten waren zusammengebrochen, hatten geweint oder mit starrem Blick wirre Gebete gemurmelt.
Die Erinnerung schmerzte so sehr, als hätte ich selbst gelitten, nur war es in meinem Fall das Gewissen, das mich plagte. Denn ich war nicht nur unfähig gewesen, einem Einzigen dieser Schiffbrüchigen zu helfen, ich fühlte mich auch immer noch verantwortlich für ihr trauriges Schicksal. Diese Bürde konnte ich nicht abschütteln, und sie schien mit jedem Tag schwerer auf meinen Schultern zu lasten. Fryers Worte erhöhten meine Last um Hunderte Menschenleben. Ich schüttelte unwillkürlich den Kopf. Nein! Unmöglich! Es musste mehr dahinterstecken. »Habt Ihr mit Archibald Hope über das Unglück gesprochen?«, fragte ich hastig.
»Nur mit Mr. Shoemaker, seinem Konsignatar in Philadelphia. Das Büro der Hopes hat nie eine Stellungnahme zu dem Schiffsunglück abgegeben, und die Brüder selbst lassen sich selten in den Kolonien blicken. Die haben ein Schiff verloren und stecken die Versicherungssumme in die Tasche. Alles andere interessiert sie nicht. Ihr hiesiger Geschäftspartner Ben Shoemaker hat jedoch einiges investiert. Er hat etlichen deutschen Hungerleidern die Überfahrt bezahlt, als Vorschuss für ein paar Monate harter Arbeit, und jetzt steht er mit leeren Händen da.«
»Ein Kaufmann mit leeren Händen«, sagte ich nachdenklich.
Fryer lachte höhnisch: »Klingt das nicht unglaublich? Fast wie ein Schreiberling mit vollen Taschen … Oder wie ein Säufer mit trockener Leber!«
»Und die überlebenden Passagiere sind inzwischen wohl in alle Windrichtungen verstreut?« Ich wusste noch, dass man sie in den leerstehenden Sklavenhütten in Corn Neck untergebracht hatte, bis man sie aufs Festland bringen konnte.
Er nickte und starrte triefäugig in sein leeres Glas. »Würde mich nicht wundern. Einige sind wohl auf der Insel geblieben. In Newport erzählt man sich, eine der deutschen Frauen hätte doch wahrhaftig einen Sklaven geheiratet. Eine Hexe, so sagt man, eine Gefährtin des Teufels!«
2
Mr. Fryers Worte wurden von einem übel stinkenden Atem begleitet, der die absurden Gerüchte über Hexen und Teufel passend zu untermalen schien. Nach dem fünften oder sechsten Glas Whiskey hatte ich aufgehört, ihm zuzuhören, und war stattdessen in meinen eigenen Erinnerungen versunken. Ich dachte zurück an die Wochen und Monate, die ich auf Block Island verbracht hatte. Manisse, in der Sprache der Ureinwohner, »Insel des kleinen Gottes«, aber niemand hatte mir erklären können, was dieser seltsame Name eigentlich bedeutete. Die Manisseer selbst, die wenigen, die nicht vertrieben, ermordet oder an Blattern gestorben waren, reagierten auf Fragen mit einem ernsten, trübseligen Kopfnicken und blieben die Antwort schuldig. Mr. Ray, einer der Inselpatriarchen und ältester Vertreter der ersten sechzehn Familien, die vor einem halben Jahrhundert von Massachusetts hierhergezogen waren, spekulierte, dass die korrekte Übersetzung »kleine Insel des Manitu« lautete, während das amerikanische Festland »große Insel des Manitu« hieß. Wahrscheinlich hatte der alte Knabe Recht, aber mir gefiel die andere Interpretation dennoch besser. Ich empfand die Vorstellung, dass es nicht nur große, sondern auch kleine Götter gab, als befreiend und tröstlich. Ein gewöhnlicher Sterblicher mochte bei Letzteren eher Gehör finden. Freilich durfte man dergleichen gegenüber Mr. Ray, einem strenggläubigen Quäker, nicht erwähnen. Er und die meisten anderen Siedler verstanden keinen Spaß, wenn es um religiöse Dogmen ging, und sie sahen mitleidig auf mich herab, da ich ihren Glauben nicht teilte.
Sie hatten mich immer höflich behandelt, aber nicht sonderlich herzlich. Meinen Auftrag, die Insel zu vermessen und erste Skizzen für eine Karte der gefährlichen Klippen und Sandbänke zu fertigen, nahmen sie scheinbar gleichgültig hin. Skeptisch, fast schon feindselig wurden sie erst, als sie erfuhren, dass ich zudem auch noch geeignete Standorte für einen Leuchtturm prüfen sollte. Einige Kaufleute aus Newport und Providence, die schon Erfahrungen mit Schiffsunglücken vor der tückischen Küste von Rhode Island gesammelt hatten, waren auf die naheliegende Idee gekommen, dass ein oder zwei Leuchtfeuer kostengünstiger wären als etliche verlorene Schiffsladungen. Ein Bauwerk wie der berühmte Pharos von Alexandria war ihnen freilich zu kostspielig, und in der alten Heimat hatte man erst begonnen, mit Feuerbaken und Blüsen zu experimentieren. Doch es galt als ausgemacht, dass eine schlichte Kohlenpfanne auf einem Holzgerüst oder auf einem steinernen Turm manch ein Schiff vor Gefahren warnen und manch eine kostbare Fracht retten könnte.
Simon Ray Jr., der Sohn des Patriarchen, hatte mit ernster Miene versucht, mir das Misstrauen der Inselbewohner gegenüber technischen Neuerungen verständlich zu machen: »Die meisten Leute hier leben vom Meer«, hatte er gesagt, »vom Fischfang und vom Seetang, den sie als Dünger für ihre Felder verwenden. Das Meer gibt ihnen alles, und sie wollen nicht seinen Zorn wecken, indem sie ihm ein Opfer entreißen.«
Es war eine höfliche Umschreibung dafür, dass die Schiffe, die regelmäßig vor Block Island auf Grund liefen, eine weitere wichtige Einnahmequelle darstellten. Denn laut Gesetz durften diejenigen, die das angeschwemmte Strandgut eines Schiffswracks bargen, ein Drittel davon behalten – oder sogar mehr, falls niemand Anspruch erhob. Der Verlust der Schiffseigner war der Verdienst der Insulaner, die natürlich nicht das geringste Interesse daran hatten, Seefahrer von ihrer gefährlichen Küste fernzuhalten.
Die neuen Karten, die ich anfertigen sollte, würden ebenfalls den Profit der Strandräuber schmälern, indem sie auf gefährliche Untiefen hinwiesen, wenn auch nicht in dem Maße wie ein Leuchtfeuer. So hatte es immer wieder mehr oder minder auffällige Versuche gegeben, mir die Arbeit so schwer wie möglich zu machen. Das reichte von vorgeblich arglosen Einladungen auf ein, zwei Gläschen Wacholderschnaps bis zu falschen oder irreführenden Informationen. Mir war klar, dass sie Angst hatten. Angst vor Veränderung. Deswegen konnte ich ihnen kaum übelnehmen, dass sie sich gegen alles sträubten, was ihr Leben aus den gewohnten Bahnen zu werfen drohte, auch wenn dies zu lästigen Verzögerungen führte und ich meinen Aufenthalt immer wieder verlängern musste. Obwohl es nicht leicht war, mit den Insulanern und ihren Vorurteilen zurechtzukommen, gefiel mir die Arbeit, die Nähe des grau wogenden Ozeans, die einfachen Menschen mit ihren schlichten Vorstellungen von Glück, die friedliche Eintönigkeit der Tage. Die Zeit, so kam es mir zumindest vor, verlor an Bedeutung, und das Ticken der Uhr wurde stets vom Tosen der Brandung übertönt.
In Philadelphia sind die Träume der Siedler und Neuankömmlinge größer als an abgelegenen Orten wie Block Island, also auch die Enttäuschungen. Mit den Enttäuschungen wächst die Wut, aus Armut wird Elend, aus Elend Verzweiflung. Dass jeden Tag Schiffe mit neuen Einwanderern ankommen, sorgt für eine gereizte Atmosphäre, die sich nicht selten in einem Gewitter entlädt. Dergleichen hatte ich in allen größeren Küstenstädten Neuenglands erlebt. Doch auf Block Island herrschte, zumindest dem Anschein nach, eine ganz andere Stimmung. Sie glich eher der gespannten Ruhe in den Grenzgebieten von Rhode Island und Massachusetts, wo man nur selten auf kleine Ansiedlungen traf und die Menschen gottesfürchtig und gastfreundlich, aber auch wortkarg und misstrauisch waren.
Die Siedler auf Block Island schienen vom selben Schlag zu sein; Bauern, Hirten und Fischer, die in rußigen Blockhütten hausten und ihre Kinder so gut es ging selbst unterrichteten, ohne ein anderes Schulbuch als die allgegenwärtige Bibel für nötig zu halten. Einige hielten Sklaven und fanden nichts Unrechtes dabei, obwohl die Kolonie von Rhode Island die Sklaverei abgeschafft hatte. Als ich um einen ortskundigen Gehilfen gebeten hatte, stellte man mir einen Mann von den Bermudas zur Verfügung, der offensichtlich Eigentum eines Mr. Littlefield war, aber umstandslos von den anderen Siedlern »ausgeliehen« wurde, wenn man eine starke Hand brauchte. New Port, so hieß der Mann, sollte mich wohl daran hindern, Großtaten zu vollbringen, denn er hatte wenig Ahnung von den hiesigen Ortsbezeichnungen, musste laut Gesetz spätestens um neun Uhr abends in seinem Quartier sein und humpelte stark, da er sich bei der Feldarbeit verletzt hatte und vorübergehend für Littlefield nutzlos war.
New Port erwies sich also eher als Ballast denn als tatkräftige Hilfe. Das hinderte mich nicht daran, seine Gesellschaft zu schätzen, zumal er ein erstaunlich sonniges Gemüt und scharfe Augen besaß. Er verhielt sich keineswegs unterwürfig, sondern zeigte ein aufrichtiges Interesse an meiner Arbeit und lernte rasch, obwohl er sich in Gegenwart seines Herrn gern einfältig stellte. Dies war wohl eine Überlebensstrategie, die er sich auf den Zuckerrohrplantagen der Karibik angeeignet hatte. Narben bedeckten seine Arme und Hände wie Zeichen einer unbekannten Keilschrift, doch ich wagte nicht, ihn zu fragen, woher diese Zeichen stammten. Eigentlich war das auch völlig überflüssig, denn jede Narbe erzählte dieselbe blutige Geschichte von Demütigung und Schmerz.
Sobald er merkte, dass ich mich für sein Schicksal interessierte, begann er von sich aus zu reden. Allerdings nicht über seine entsetzliche Vergangenheit oder seine triste Gegenwart, sondern über die Zukunft, die er sich erträumte. Er sprach lang und breit über seine Tochter Cradle, und es dauerte lange, bis ich begriff, dass sie noch nicht geboren, ja nicht einmal gezeugt worden war. Sie war ein Wunschkind, das er im Traum gesehen hatte, und dieses Traumbild gab ihm Kraft und Hoffnung. Ansonsten machte er sich keine Illusionen. Als ich ihn einmal arglos fragte, was er tun würde, wenn er ein freier Mann wäre, runzelte er die Stirn und spuckte auf den Boden. »Frei?«, sagte er. »Selbst wenn ich nach Recht und Gesetz frei wär, würd’ euresgleichen mich als Sklaven ansehen, als Packesel, dessen Wert man daran misst, wie viel Arbeit er zwischen Morgengrauen und Einbruch der Nacht leisten kann.«
Während ich mit meinem Gehilfen die Insel durchstreifte, deren Wälder fast vollständig abgeholzt waren, so dass man vom Beacon Hill weit über die hügeligen Wiesen und Felder schauen konnte, folgte uns oft ein junger Kerl mit flammend rotem Haar und einem seltsam herausfordernden Grinsen, der sich offensichtlich nach Aufmerksamkeit sehnte. New Port kannte ihn als Mark Dodge, eines Fischers Sohn, der bei einem Unglück auf hoher See den Verstand verloren hatte und das Leben eines Ausgestoßenen führte. Man erzählte mir, er sei aus dem Fischerboot seines Vaters unbemerkt ins Meer gefallen und habe eine ganze Nacht allein im dunklen Wasser verbracht, ohne Hoffnung auf Überleben. Ein anderes Gerücht besagte, der Vater habe ihn mit eigenen Augen über Bord fallen sehen, aber sich geweigert, ihm zu helfen oder ihm auch nur ein Tau zuzuwerfen. Er habe schweigend an der Reling gelehnt und kaltblütig den Todeskampf seines Sohnes beobachtet. Ich wusste nicht, was wirklich vorgefallen war, aber ich stellte mir vor, was in Marks Kopf vorgegangen sein musste, als sein leiblicher Vater ihm jede Hilfe verweigerte. Es war zumindest eine glaubwürdige Erklärung für den zerrütteten Verstand des Jungen, und es entsprach der verbreiteten Ansicht der Inselbewohner, dass man dem Meer kein Opfer verweigern darf.
3
Die Reise nach Block Island konnte ein, zwei Tage in Anspruch nehmen, je nachdem, ob günstige Winde herrschten und ob man in Newport einen Kapitän fand, der bereit war, einen Passagier mitzunehmen und abzusetzen. Das Gleiche galt für die Rückfahrt, auch wenn man viel länger auf eine Transportmöglichkeit warten musste, denn die rund dreißig Meilen vom Festland entfernte Insel wurde nicht regelmäßig von Postschiffen angelaufen. Damals, im Winter 1738, hatte ich meine Triangulationen längst beendet und alle Zahlen notiert, die der Kartenzeichner benötigte. Doch es war ein überaus stürmisches Jahr, und ein Sturm nach dem anderen verhinderte meine Abreise. Keiner der ansässigen Fischer wollte die Überfahrt riskieren, ganz gleich, wie viel Geld ich dafür bot. Der kleine Gott wollte mich noch nicht gehen lassen, so dachte ich schicksalsergeben und nutzte die Zeit, um an meinem Bericht über die geeigneten Standorte für das geplante Leuchtfeuer zu feilen. Durch die trüben Fenster von Mr. Rays großem Haus konnte ich beobachten, wie die von niedrigen Steinmauern durchzogene Hügellandschaft allmählich unter einer weißen Schneedecke verschwand.
Wenn es stärker schneite, blieb der Schnee sogar auf den vielen großen und kleinen Pechtümpeln liegen, die man hier überall fand und die für Mensch und Tier gefährlich waren. Zumindest erzählte man mir allerlei Schauergeschichten über einsame, unachtsame Spaziergänger, die in der zähen, klebrigen Masse steckengeblieben und versunken waren, um Jahre später als leblose schwarze Statuen wieder aufzutauchen. Ich wusste nicht recht, ob man derlei ernst nehmen oder als gutmütige Neckerei verstehen sollte, aber das natürliche Pech, das anscheinend in unerschöpflichen Mengen vorhanden war, interessierte mich sehr. Die Insulaner waren dazu übergegangen, es in ihren Öfen zu verheizen, da Holz inzwischen zur Mangelware geworden war. Sie schöpften das Material aus den Tümpeln und formten daraus große Kugeln, die sie trockneten und zu Pyramiden stapelten. In allen Häusern von Block Island hatte sich inzwischen der beißende Geruch dieses Brennmaterials festgesetzt, und ich hatte nach all den Monaten immer noch Schwierigkeiten, mich daran zu gewöhnen.
An den langen Winterabenden diskutierte ich mit Mr. Ray und seinen erwachsenen Söhnen die Möglichkeit, das Pech im großen Stil abzuschöpfen und entweder als natürlichen Brennstoff oder zum Kalfatern von Schiffen in die Kolonien oder sogar nach Europa zu verkaufen. Die Männer waren von meiner Idee wenig begeistert, und die Frauen der Familie sahen nicht einmal von ihren Handarbeiten auf. Als ich dann vorschlug, man könne mit dem Pech vielleicht auch ein Leuchtfeuer füttern, um keine teure Kohle importieren zu müssen, schüttelten Männer wie Frauen den Kopf. Der Aufwand würde sich nicht lohnen, meinten sie, aber ich kannte bereits ihre konservative Einstellung und hatte das Thema nur aufgegriffen, um das winterliche Schweigen meiner wortkargen Gastgeber zu brechen.
Um dieser zuweilen bedrückend wirkenden Stille zu entkommen, die nur von langen, monotonen Lesungen aus der Bibel unterbrochen wurde, ging ich ein- oder zweimal am Tag spazieren und streifte oft stundenlang über die Felder zur Küste, selbst wenn das Wetter noch so schlecht und der anhaltende Nordwestwind noch so unangenehm war. Ich vermisste New Ports Gesellschaft, doch hatte ich keine Ausrede mehr, mir den guten Mann »auszuleihen«, der nun wieder auf Littlefields Farm schuftete. Mark Dodge war mir hingegen treu geblieben und folgte mir weiterhin in geringem Abstand, wann immer ich das Haus verließ. Freilich konnte man mit ihm kein vernünftiges Gespräch führen. Sprach man ihn an, gab er meist zusammenhangloses Geschwätz von sich. Manchmal amüsierte er mich mit einer hanebüchenen Geschichte über Kapitän Kidds Piratenschatz, den er bald finden werde, woraufhin jeder Mann auf der Insel seinen Hut vor ihm ziehen und ihn »Mr. Dodge« nennen müsse.
Über die Pechtümpel wusste er zu sagen, dass darin der schwarze Holzfäller wohnte, eine sonderbare Gestalt, die in den Altweibergeschichten der Siedler die Rolle des Teufels und satanischen Verführers übernommen hatte. »Nein, Sir«, kicherte Dodge und bleckte seine fauligen Zähne, »dieses Pech bringt niemandem Glück, niemandem außer mir!«
»Seid Ihr ihm je begegnet, diesem schwarzen Holzfäller?«
»Ich werde ihm gewiss eines Tages begegnen, wenn ich geduldig warte. Es ist nämlich so, dass er der Einzige ist, der einem den richtigen Weg zu dem Schatz zeigen kann. Jawohl, Sir.«
Ob der Hüter des Schatzes denn nichts für seine Hilfe verlangen werde, fragte ich den verwirrten Jungen, und er schüttelte grinsend den Kopf. Später erfuhr ich, dass dieser gespenstische Holzfäller nicht schwarz war wie der Sklave New Port, sondern bleich, mit leuchtend blauen Augen, schwarzem Haar und schwarzem Kittel. Eine von Mr. Rays Töchtern, Alba, hatte mir alles über ihn erzählt. Man erwähnte ihn gern, um ungehorsamen Kindern einen Schrecken einzujagen, und es hieß, er könne einem jeden, wirklich jeden Herzenswunsch erfüllen, verlange dafür aber einen hohen Preis: Man müsse zunächst den Menschen töten, den man am meisten liebe, erst dann gehe der Wunsch – manchmal war auch von drei Wünschen die Rede – in Erfüllung.
Das interessierte mich. War nicht der handelsübliche Preis eines Geschäfts mit dem Teufel die Seele? Seine Seele opfert man gerne für eine Truhe voll Gold und Edelsteinen, für Reichtum und Macht. Denn so eine Seele wiegt nicht viel, und die meisten Leute glauben, gut darauf verzichten zu können. Das Liebste zu töten, um eine Sehnsucht zu stillen, schien mir hingegen kein sonderlich verlockendes Angebot zu sein. Aber vielleicht sieht das jemand, der sein karges Erdendasein in der Hoffnung auf eine bessere Welt fristet, anders.
Ich fragte mich, warum Dodge den Preis des schwarzen Holzfällers verheimlichte und ob er wirklich bereit war, einen geliebten Menschen für ein bisschen Gold umzubringen. Gab es denn überhaupt jemanden, den er liebte? Für mich war er der einsamste Mann, den ich je getroffen hatte, aber im Grunde kannte ich ihn kaum und wollte ihn nicht nach den Geschichten beurteilen, die über ihn im Umlauf waren. Er galt als Dieb, Brandstifter, Kinderschreck und Tierquäler, und man ließ gerne durchblicken, dass er der kleinen Gemeinde als Ertrunkener lieber gewesen wäre denn als lebendiger Plagegeist.
Aus reiner Neugier bat ich ihn einmal um seine ehrliche Meinung zu dem geplanten Leuchtfeuer, wohl wissend, dass er von den rückständigen Ansichten seiner Landsleute wenig hielt und ihnen oft aus Prinzip widersprach. »Nein, Sir«, sagte er mit übertrieben vernünftiger Miene und dem Tonfall eines überheblichen Schulmeisters, »meinethalben könnte man gut und gern auf solchen Schabernack verzichten. Schließlich gibt es weitaus praktikablere Methoden, um Schiffen nächtens den Weg zu weisen. Man binde eine Laterne an den Schweif eines schwarzen Pferdes und lasse es fürderhin nachts am Meeresufer entlangtraben.«
Ich hielt dies für eine ähnlich absurde Wahnidee wie den großen Piratenschatz und den schwarzen Holzfäller, doch das Pferd mit der Laterne existierte tatsächlich, und ich habe es an jenem Dezemberabend des Jahres 1738 mit eigenen Augen gesehen.
4
Alba Ray hatte mich immer wieder vor Dodge gewarnt. Sie sagte, sein Wahnsinn sei nicht von der harmlosen Sorte. Seit er beinahe ertrunken war, sei er besessen vom Tod, und jedes Mitgefühl sei in ihm verkümmert und verdorrt wie eine abgerissene Brombeerranke am Straßenrand, von der im Herbst nur die Stacheln blieben. »Liegt jemand im Sterben«, erzählte Alba, »scheint er es auf unheimliche Weise zu wittern. Er nähert sich dem Haus des Todgeweihten und hockt sich in respektvoller Entfernung auf den Boden. Dort harrt er aus, manchmal Stunden, manchmal Tage, bei Regen, Sturm, Schnee oder Sommerhitze, bis jemand ihn verscheucht oder bis er mit einem triumphierenden Grinsen fortschleicht.«
Alba war kein furchtsames, abergläubisches Mädchen, sondern bodenständig und tatkräftig wie alle Söhne und Töchter von Simon Ray. Ihr roter Haarschopf ließ sich kaum von der züchtigen Haube bändigen, und ihre grünen Augen blitzten oft schalkhaft, doch wenn sie von Dodge sprach, wurde ihre Stimme leise und ihre von Sommersprossen bedeckten Wangen erbleichten. Man sah es ihr deutlich an, dass sie ihre Warnung ernst meinte, und ich hätte besser auf ihre Worte achten sollen, anstatt bloß immerzu auf ihre vollkommenen Lippen zu starren.
Damals nahm ich das alles auf die leichte Schulter. Vielleicht, weil ich Dodge besser zu kennen glaubte als die Leute, die ihn wie einen Aussätzigen behandelten, da er die Frechheit besessen hatte, gegen sein vorbestimmtes Schicksal aufzubegehren. Ich hatte sogar das Gefühl, dass er mir in dieser Hinsicht ähnlich war. Denn ich galt weithin als eigensinnig und widerspenstig, hatte immer schon Schwierigkeiten, mich anzupassen, und wollte mich nie mit dem abfinden, was meine Mitmenschen als notwendig ansahen. Manch einer hielt mich schon deshalb für verrückt, weil ich gern allein durch die Wälder streifte und nie davon sprach, eine Familie zu gründen und endlich sesshaft zu werden, obwohl ich hin und wieder wehmütig daran dachte – besonders in Gegenwart einer liebenswürdigen Schönheit wie Alba. Mein großzügiger Onkel Solomon van Roon hätte mir jederzeit einen ruhigeren Posten in seinem See- und Landkartenverlag angeboten, den ich eines Tages von ihm übernehmen sollte, doch ich arbeitete lieber weiter als einfacher Feldmesser für ihn, auch wenn es mir nicht viel einbrachte. Wenn ich zu lange in einem geschlossenen Raum blieb, glaubte ich ersticken zu müssen; frei atmen konnte ich nur unter dem weiten Himmelszelt, und diese rastlose Art von Freiheit ließ mich manchmal vergessen, dass die Einsamkeit allmählich meine Tugenden und Talente überwucherte und einen Schatten auf alles warf, was andere Menschen für wertvoll halten.
Dass Mark Dodge nicht dasselbe wollte wie ich und nicht bloß ein freiheitsliebender Sonderling war, sondern bis auf den Grund seiner armen Seele zerrüttet, krank und verdorben, hielt ich für eine maßlose Übertreibung. Bis mir ein Stück weit die Augen geöffnet wurden.
In der Nacht des 27. Dezember 1738 hatte ich zunächst nicht die geringste Ahnung, was vor sich ging. Während der Feiertage hatte ich mir die Zeit damit vertrieben, mehr zu trinken, als gut für mich war, und trübsinnigen Gedanken nachzuhängen, während ich kleine Geschenke, Pferdchen für die Kleinen und einen Ring für Alba, aus Treibholz schnitzte. Wahrscheinlich hatte ich auch in jener Nacht zu viel von Littlefields selbstgebranntem Wacholderschnaps gebechert, aber ich kann mich noch deutlich erinnern, wie laute Rufe und Glockengeläut die ganze Familie Ray aus dem Haus lockten, trotz des eisigen Windes und des Schneetreibens. Ich folgte ihnen neugierig auf etwas wackligen Beinen; einen solchen Aufruhr hatte ich auf Block Island noch nie erlebt. Die Rays wohnten im südwestlichen Teil der Insel. Wir eilten auf der verschneiten Straße nach Norden. Bald trafen wir auf andere Inselbewohner, die mit Öllampen und lodernden Fackeln ausgerüstet waren. Es hieß, ein Schiff sei auf der Sandbank zwischen Sandy Point und der vorgelagerten kleinen Insel The Hummock auf Grund gelaufen. Die schmale Landspitze im Norden war von Simon Rays Hof ungefähr zehn Kilometer entfernt, ein recht langer Fußmarsch bei Kälte und Sturm. Also scheuchte der alte Patriarch die Frauen und Kinder zurück ins Haus und ließ den Wagen anspannen.
Ich saß neben Mr. Ray und seinem ältesten Sohn auf dem Kutschbock. In der Dunkelheit und dem Schneegestöber kamen wir nur langsam voran, und wir trafen immer wieder Leute, die zu Pferd oder zu Fuß dieselbe Richtung eingeschlagen hatten, als hätten die Trompeten des Jüngsten Gerichts sie nach Norden gerufen. Ja, sie glichen in ihren dicken Wintermänteln und mit ihren Biberfellmützen wirklich verlorenen Seelen, die mit dem eisigen Wind zwanghaft und wortlos auf dasselbe Ziel zutrieben. Ich sah auch einige Indianer, die sich in schäbige Wolldecken hüllten, und Sklaven, unter ihnen mein ehemaliger Gehilfe New Port, die sich halblaut in ihrem kreolischen Patois unterhielten und mit bloßen Füßen durch den Schnee stapften, obwohl sie zu dieser späten Stunde ihre Unterkünfte eigentlich nicht verlassen durften.
Auf mich wirkte das alles wie ein verwirrender Traum, der groteske oder sogar erschreckende Bilder und Perspektiven vorgaukelt, aber stets den Trost baldigen Erwachens bereithält. Trotz der Kälte spürte ich noch die Hitze des Alkohols in den Adern, und ich betrachtete meine Umgebung aus einer neugierigen Distanz, als wäre ich nur Gast in einem fremden Körper. Als würde ich ein fesselndes Stück im Theater verfolgen.
Ich weiß nicht, wie lange es dauerte, bis wir den schmalen Küstenstreifen erreichten, aber ich erinnere mich deutlich an das große, krängende Schiff, an dessen Fockmast die Reste eines zerfetzten Segels im Sturmwind flatterten. Unser Wagen hatte auf einer Böschung über dem Strand gehalten, und ich sah, wie die dort bereits versammelten Leute versuchten, ein Pferd einzufangen, das sich immer wieder in Panik aufbäumte – ein schwarzes Pferd, dem jemand eine Laterne an den Schweif gebunden hatte.