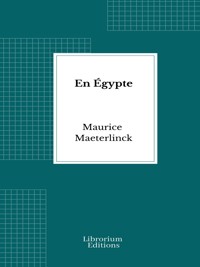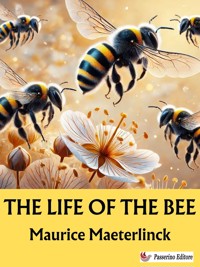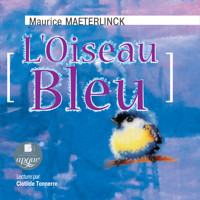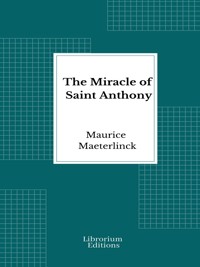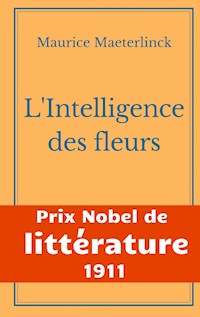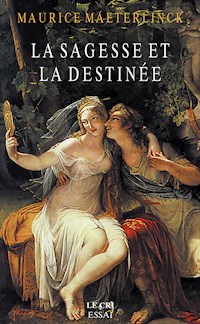Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Wenn es Pflanzen und Blumen gibt, die ungeschickt und unglücklich sind, so ist doch keine vorhanden, die ohne jede Klugheit und Erfindungsgabe wäre. Alle streben danach, ihre Aufgabe zu erfüllen; alle haben den prächtigen Ehrgeiz, die Erdoberfläche zu überziehen und zu erobern, indem sie die Daseinsform, die sie darstellen, unendlich vervielfältigen. Zur Erlangung dieses Zieles haben sie infolge des organischen Gesetzes, das sie an die Scholle kettet, weit größere Schwierigkeiten zu überwinden, als die, welche die Tiere bei ihrer Vermehrung finden. Und darum nimmt auch die Mehrzahl unter ihnen seine Zuflucht zu Listen und Kombinationen, zu einem Mechanismus und zu Fallen, die unter dem Gesichtspunkt der Mechanik, der Ballistik, des Fluges, der Beobachtung der Insekten, u.a.m. den Erfindungen und Kenntnissen des Menschen oft vorausgewesen sind. Inhaltsverzeichnis I. Die Intelligenz der Blumen II Wohlgerüche III. Das Zeitmaß IV. Die moralische Krisis V. Das Faustrecht VI. König Lear VII. Die Götter des Krieges VIII Beleidigung und Vergebung IX. Zur Psychologie der Unglücksfälle X. Unsere soziale Pflicht XI. Die Unsterblichkeit Anmerkungen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Intelligenz der Blumen
Maurice Maeterlinck
Für fachmännische Durchsicht des botanischen Aufsatzes „Die Intelligenz der Blumen“ spricht der Übersetzer Fräulein Dr. E. Eisenberg in Meiningen auch an dieser Stelle seinen wärmsten Dank aus.
Impressum
2022 ©Verlag Heliakon
Umschlaggestaltung: Verlag heliakon
Titelbild: Pixabay (Myriams-Fotos)
Druck und Herstellung: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Übersetzer: Friedrich von Oppeln-Bronikowski
Überarbeitete und korrigierte Fassung
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Impressum
I. Die Intelligenz der Blumen
II. Wohlgerüche
III. Das Zeitmaß
IV. Die moralische Krisis
V. Das Faustrecht
VI. König Lear
VII. Die Götter des Krieges
VIII. Beleidigung und Vergebung
IX. Zur Psychologie der Unglücksfälle
X. Unsere soziale Pflicht
XI. Die Unsterblichkeit
I. Die Intelligenz der Blumen
1.
Ich will hier nichts als an einige, allen Botanikern geläufige Tatsachen erinnern. Ich habe keine neue Entdeckung gemacht und mein bescheidener Beitrag beschränkt sich auf einige Elementar-Beobachtungen. Ich habe natürlich nicht die Absicht, alle Beweise von Intelligenz, die uns die Pflanzen geben, zu wiederholen. Diese Beweise sind unzählig und wiederholen sich fortwährend, namentlich in der Welt der Blumen, in denen sich das Trachten des vegetabilischen Lebens nach Licht und Geist am stärksten verkörpert.
Wenn es Pflanzen und Blumen gibt, die ungeschickt und unglücklich sind, so ist doch keine vorhanden, die ohne jede Klugheit und Erfindungsgabe wäre. Alle streben danach, ihre Aufgabe zu erfüllen; alle haben den prächtigen Ehrgeiz, die Erdoberfläche zu überziehen und zu erobern, indem sie die Daseinsform, die sie darstellen, unendlich vervielfältigen. Zur Erlangung dieses Zieles haben sie infolge des organischen Gesetzes, das sie an die Scholle kettet, weit größere Schwierigkeiten zu überwinden, als die, welche die Tiere bei ihrer Vermehrung finden. Und darum nimmt auch die Mehrzahl unter ihnen seine Zuflucht zu Listen und Kombinationen, zu einem Mechanismus und zu Fallen, die unter dem Gesichtspunkt der Mechanik, der Ballistik, des Fluges, der Beobachtung der Insekten, u.a.m. den Erfindungen und Kenntnissen des Menschen oft vorausgewesen sind.
Es ist überflüssig, die großen Systeme der Blumenbefruchtung noch einmal zu schildern: das Spiel der Staubblätter und des Stempels, die Verführung der Düfte, den Lockruf der harmonischen und leuchtenden Farben, die Bereitung des der Pflanze völlig unnötigen Honigsaftes, den sie nur zum Anlocken und Festhalten des fremden Befreiers und Liebesboten hervorbringt: der Biene, Hummel und Fliege, des Schmetterlings oder Nachtfalters, der ihr den Kuss des fernen, unsichtbaren, unbeweglichen Geliebten bringen soll ...
Die Pflanzenwelt, die uns so friedlich, so resigniert dünkt, in der alles Ergebung, Schweigen, Gehorsam, Sammlung scheint, ist im Gegenteil eine Welt, in der die Auflehnung gegen das Schicksal am heftigsten und hartnäckigsten ist. Ihr wesentlichstes Organ, das Nahrungsorgan der Pflanze, die Wurzel, kettet sie unlöslich an die Scholle. Wenn es schwierig ist, unter den großen Gesetzen, die auf uns lasten, das zu entdecken, das am schwersten auf unsere Schultern drückt, so ist hei der Pflanze kein Zweifel darüber möglich: es ist das Gesetz, das sie von ihrer Geburt bis zum Tode zur Unbeweglichkeit verdammt. Darum weiß sie auch besser als wir, die wir unsere Kräfte zersplittern, wogegen sie sich zuerst aufzulehnen hat. Und die Energie ihrer fixen Idee, die aus dem Dunkel ihrer Wurzeln emporsteigt, um sich im Licht ihrer Blüte zu organisieren und zu entfalten, bietet ein unvergleichliches Schauspiel. Sie ist ganz auf ein einziges Ziel eingestellt: dem Schicksal ihrer Wurzel durch ihre Blüte zu entrinnen, das drückende und düstere Gesetz zu übertreten und seiner zu spotten, sich freizumachen und die enge Sphäre zu zerbrechen, sich Flügel zu erfinden oder sie anzulocken, so weit wie möglich zu entkommen, den Raum zu besiegen, worin das Schicksal sie gefangen hält, sich einem anderen Naturreich zu nähern, in eine lebende und bewegte Weit einzudringen ... Und dass ihr das gelingt, ist das nicht ebenso erstaunlich, als ob wir uns zusammentäten, um außerhalb der Zeitschranken zu leben, die ein anderes Geschick uns gezogen hat, oder uns in eine Welt aufzuschwingen, die von den lastendsten Gesetzen der Materie befreit ist? Wie wir sehen werden, gibt die Pflanze dem Menschen ein wundersames Beispiel der Unbotmäßigkeit, des Mutes, der Beharrlichkeit und Erfindsamkeit. Hätten wir nur halb so viel Energie aufgewandt, wie irgendeine kleine Gartenblume, um den Druck mehrerer schwerer Notwendigkeiten, z. B. den des Schmerzes, des Alters und des Todes zu erleichtern, so ist es verstattet zu glauben, dass unser Schicksal von dem, was es jetzt ist, sehr verschieden wäre.
Dieses Bedürfnis nach Bewegung, dieser Hunger nach Raum betätigt sich bei der Mehrzahl der Blumen sowohl in, der Blüte wie in der Frucht. In der Frucht erklärt er sich leicht oder verrät hier doch nur eine minder komplizierte Erfahrung und Voraussicht. Im Gegensatz zu den Vorgängen im Tierreich hat das Samenkorn — dank dem furchtbaren Gesetz der völligen Unbeweglichkeit — seinen ersten und schlimmsten Feind in seinem Heimatboden. Wir sind hier in einer wunderlichen Welt, wo die Eltern unfähig sind, sich vom Fleck zu rühren, und wissen, dass sie dazu verdammt sind, ihre Sprösslinge verhungern zu lassen oder ersticken zu müssen. Jeder Same, der zu Füssen des Baumes oder der Pflanze niederfällt, ist verloren oder muss elendiglich verkümmern. Daher die ungeheure Anstrengung, um das Joch abzuschütteln und den Raum zu erobern. Daher die wunderbaren Systeme der Ausstreuung, Verbreitung und Beflügelung der Samenkörner, die wir allerorten in Wald und Flur finden. So, um nur einige der merkwürdigsten Beispiele zu streifen, die Luftschraube des Ahornsamens, die Flügelschraube der Linde, die Schwebevorrichtung der Distel, des Löwenzahns und des Bocksbartes, die knallenden Sprungfedern der Wolfsmilch, den außerordentlichen Spritzball der Spritzgurke (Ecballium), die Wollhäkchen der Eriophilen und Abertausend andere unerwartete Mechanismen, die uns in Verwunderung setzen, denn es gibt sozusagen keinen Samen, der nicht ein ganz besonderes Verfahren erfunden hat, um dem Schatten seiner Mutter zu entgehen.
Wenn man nie Botanik getrieben hat, glaubt man es in der Tat nicht, welche Fülle von Erfindungskraft und Geist von all diesen Pflanzen ausgegeben wird, deren Grün unser Auge erlabt. Man betrachte doch nur die reizende Kapsel voller Samenkörner bei dem roten Gauchheil (Anagallis arvensis), die fünf Samenfächer der Balsamine, die fünf Springkapseln des Geraniums. Man übersehe auch nicht den gewöhnlichen Kopf des Mohns, den man bei allen Kräutersammlern findet. Dieser gute dicke Kopf besitzt eine Voraussicht, eine Klugheit, die das größte Lob verdient. Bekanntlich enthält er tausende von winzigen schwarzen Körnchen. Dieser Same muss so geschickt und soweit wie möglich verstreut werden. Wenn die Samenkapsel platzte, auf den Boden fiele oder sich nach unten öffnete, so würde das kostbare schwarze Pulver nur einen unnützen Haufen am Fuß des Stängels bilden. Nun aber kann es nur durch Löcher in der Spitze der Kapsel hinausgelangen. Sobald diese reif ist, neigt sie sich über ihren Stängel, stäubt beim geringsten Windhauch und sät die Körner buchstäblich in den Raum, mit der gleichen Gebärde wie ein Sämann.
Soll ich noch von den Samenarten reden, die ihre Ausstreuung durch die Vögel voraussehen und um diese anzulocken, sich in einer zuckrigen Hülle verbergen, wie Mistel, Wachholder und Vogelbeerbaum? Hier herrscht eine solche Überlegung, eine solche Einsicht in den Endzweck, dass man nicht gern weiter folgert, aus Furcht, in die naiven Irrtümer von Bernardin de Saint-Pierre zurückzufallen. Trotzdem lassen sich die Tatsachen nicht anders erklären. Die zuckrige Hülle ist dem Samenkorn ebenso wenig vonnöten, wie der Honigsaft, der die Biene anlockt, der Blume. Der Vogel frisst die Frucht, weil sie zuckrig ist, und verschluckt gleichzeitig das unverdauliche Samenkorn. Er fliegt fort und scheidet allmählich die Samenkörner wieder aus, so wie er sie aufgenommen hat, nur ihrer Hülle beraubt und imstande, fern von den Gefahren der unfreiwilligen elterlichen Selbstsucht zu keimen.
Doch kehren wir zu einfacheren Vorrichtungen zurück. Man braucht nur am Wegrain im ersten besten Grasbüschel ein Hälmchen zu pflücken, und man belauscht eine kleine selbstständige, unermüdliche, unverhoffte Intelligenz in ihrem Wirken. Da gibt es z. B. zwei armselige Kletterpflanzen, die schon ein jeder auf seinen Spaziergängen getroffen hat, denn sie wachsen allerorten bis in die undankbarsten Winkel, in die sich ein bisschen Humus verirrt hat. Es sind zwei Spielarten der wilden Luzerne (Medicago), beide Unkraut im bescheidensten Sinne des Wortes. Die eine hat eine rötliche Blüte, die andere eine gelbe Quaste von der Größe einer Erbse. Sieht man sie sich kriechend unter den stolzen Gräsern verstecken, so ahnt man nicht, dass sie — lange vor Archimedes — die erstaunlichen Eigenschaften der Schraube entdeckt und verwertet haben, nicht zwar zur Hebung von Flüssigkeiten, wohl aber zur Beflügelung des Samens. Sie bewahren den ihren in leichten, viermal gewundenen Spiralen von bewundernswerter Bauart, mit der klugen Absicht, seinen Fall dadurch zu verlangsamen und folglich — mithilfe des Windes — seine luftige Reise zu verlängern. Die gelbe Spielart hat die Vorrichtung der roten sogar vervollkommnet, indem sie die Ränder der Spirale mit einer doppelten Reihe kleiner Stacheln versehen hat, in dem augenscheinlichen Bestreben, dass sie an den Kleidern der Vorübergehenden oder am Fell der Tiere hängen bleibt. Sie hofft offenbar die Vorteile der Aerophilie, d. h. die Ausstreuung des Samens durch Schafe, Ziegen, Kaninchen usw. mit denen der Anemophilie oder Samenverbreitung durch den Wind zu vereinen.
Das rührendste an diesem ganzen Bemühen ist seine Vergeblichkeit. Die arme gelbe und rote Luzerne hat sich geirrt. Ihre hervorragenden Schrauben dienen zu nichts. Sie könnten nur dann funktionieren, wenn der Same aus beträchtlicher Höhe herabfiele, vom Wipfel eines hohen Baumes oder von einem hochragenden Grashalm. Jetzt, wo sie sich fast am Boden befinden, hat er noch keine Viertelsumdrehung gemacht, wenn er schon die Erde berührt. Es ist dies ein seltsames Beispiel von Irrtum, Tasten, Experimentieren und kleinen Verrechnungen, die in der Natur nicht zu selten sind; denn nur die, welche sie nie studiert haben, behaupten, sie irre sich nie.
Nebenbei gesagt besitzen andere Spielarten der Luzerne diese Flugapparate nicht, gar nicht zu reden von dem eigentlichen Klee, einem anderen hülsentragenden Schmetterlingsblütler, der mit der Luzerne vielfach verwechselt wird. Alle diese halten sich an die primitive Methode der Hülse oder Schote. Bei einer von ihnen, Medicago aurantiaca, kann man ziemlich deutlich den Übergang von der gewundenen Hülse zur Schraube beobachten; bei einer anderen Varietät, Medicago scutellata, rundet sich die Schraube zur Kugel, usw. Wir wohnen hier also anscheinend dem aufregenden Schauspiel einer Art bei, die noch beim Erfinden und Versuchen ist, einer Familie, die ihr Schicksal also noch nicht fest bestimmt hat und eine bessere Methode sucht, um die Zukunft sicher zu stellen. Vielleicht hat die gelbe Luzerne während dieser Versuche, als sie sich in der Spirale verrechnet hatte, die Spitzen oder Häkchen hervorgebracht, indem sie sich nicht ohne Grund sagte, dass die Schafe, die ihre Blätter anlocken, die Sorge für ihre Nachkommenschaft gerechter und unvermeidlicherweise übernehmen müssen. Und dankt die gelbe Luzerne es dieser neuen Anstrengung und diesem guten Einfall nicht, dass sie ungleich verbreiteter ist als ihr robusterer rotblühender Vetter?
Aber nicht allein in Blüte und Samenkorn, sondern in der ganzen Pflanze, in ihren Blättern, Stielen und Wurzeln, entdeckt man, wenn man ihre bescheidene Arbeit belauscht, manche Spuren eines gewitzigten und lebendigen Verstandes. Man denke nur an die prächtigen Versuche, zum Licht zu gelangen, die unterdrückte Äste machen, oder an den erfindungsreichen und mutigen Kampf bedrohter Bäume. Ich für mein Teil werde nie das bewundernswerte Beispiel von Heldenmut vergessen, das mir eines Tages in der Provence, in den wilden und veilchendurchdufteten Schluchten des Loup, ein prächtiger hundertjähriger Lorbeerbaum gab. Auf seinem gequälten und krampfhaft gekrümmten Stamme stand gleichsam das Drama seines zähen und schwierigen Lebens geschrieben. Ein Vogel oder der Wind, die Herren seines Geschicks, hatten das Samenkorn an den Abhang eines Felsens getragen, der senkrecht hinabstürzte wie ein eiserner Vorhang. Dort war der Baum entstanden, zweihundert Meter über dem Bergwasser, unzugänglich und einsam, zwischen glühendem, unfruchtbarem Gestein. In der ersten Zeit hatte er seine blinden Wurzeln auf die lange und mühsame Suche nach dem unsicheren Wasser und nach Humus ausgesandt. Aber dies war nur die angeerbte Gewohnheit einer Pflanzenart, welche die Dürre des Südens kennt. Das Bäumchen hatte ein viel ernsteres und unverhoffteres Problem zu lösen: es stand auf einer senkrechten Wand, sodass sein Wipfel, statt in den Himmel zu wachsen, sich über den Abgrund neigte. Es musste also, trotz der zunehmenden Schwere der Zweige, in seinem ersten Schuss innehalten, den verblüfften Stamm hartnäckig an den Fels anlehnen und derart seine schwere Blätterkrone, wie ein Schwimmer mit zurückgebogenem Kopf, durch unaufhörliche Willensanspannung und Selbstbezwingung in den Äther emportreiben.
Und fortan hatte sich um diesen Lebensknoten alles Streben, alle Energie, all der freie und bewusste Geist des Baumes konzentriert. Die riesige, hypertrophische Krümmung offenbarte die ganze Reihe der Besorgnisse einer Art von Denken, das die Ratschläge, die Sturm und Regen ihm gaben, zu benutzen wusste. Von Jahr zu Jahr wurde die Blätterkrone schwerer, ohne ein anderes Streben, als sich in Licht und Wärme zu entfalten, während ein dunkler Brand sich tief in den verkrümmten Arm einfraß, der sie über dem Abgrund hielt. Nun sandte er, ich weiß nicht, von welchem Instinkt beseelt, zwei starke Wurzeln, zwei haarige Taue, mehr als zwei Fuß über der Krümmung aus, um sich an der Granitwand zu verankern. Waren sie wirklich durch seine Besorgnis hervorgerufen, oder sahen sie wohl seit den ersten Tagen die Stunde der großen Gefahr voraus, und warteten sie ab, um doppelt hilfreich zu sein? War es nur ein glücklicher Zufall? Kein menschliches Auge wird je diesen stummen und für unser kurzes Leben zu langen Dramen beiwohnen.1
Unter den Pflanzen, die die auffälligsten Beweise von Initiative geben, verdienten die, welche man lebendig oder sensibel nennen könnte, eine Sonderstudie. Ich will mich damit begnügen, hier auf das köstliche Zusammenschrecken der Sensitiven in der Blumenwelt, der schamhaften Mimose, hinzuweisen, die wir alle kennen. Andere Pflanzen mit spontanen Bewegungen sind unbekannter, so die Hedysareen, unter denen namentlich der bewegliche Süßklee (Hedysarum gyrans) ganz erstaunliche Bewegungen macht. Dieses kleine Hülsengewächs, aus Bengalen stammend, das oft in unseren Treibhäusern gezogen wird, führt eine Art von fortwährendem und kompliziertem Tanze zu Ehren des Lichtes auf. Seine Blätter teilen sich in drei Blättchen, das mittelste breit und gipfelständig, die anderen schmal und an der Blattwurzel des ersteren ansetzend. Jedes dieser drei Blättchen hat eine eigene und verschiedene Bewegung. Sie leben in rhythmischen, unaufhörlichen, fast chronometrischen Schwingungen. Sie sind so empfindlich gegen das Licht, dass ihr Tanz sich verlangsamt oder beschleunigt, je nachdem Wolken den Himmelsausschnitt, in den sie hinaufschauen, bedecken oder freilassen. Es sind, wie man sieht, wahre Fotometer und natürliche Otoskope lange vor Crooks Erfindung.
Aber diese Pflanzen, zu denen man auch noch die Drosera und die Dionäa und manche andere rechnen müsste, sind bereits nervöse Wesen, welche die geheimnisvolle und vermutlich imaginäre Grenzscheide, die Tier- und Pflanzenreich trennt, wahrscheinlich etwas überragen. Aber man braucht gar nicht so weit zu gehen; man findet ebenso viel Intelligenz und fast ebenso viel sichtbare Spontaneität am anderen Ende der Welt, die uns beschäftigt, in den Niederungen, wo die Pflanze sich noch kaum vom Schlamm oder vom Stein unterscheidet. Ich meine den fabelhaften Stamm der Kryptogamen, die man nur mit dem Mikroskop studieren kann. Darum wollen wir sie auch stillschweigend übergehen, wiewohl das Spiel der Sporen beim Pilz und Farnkraut, vor allem aber beim Schachtelhalm oder Katzenwedel von einer Feinheit und Genialität ohnegleichen ist. Aber unter den Wasserpflanzen, den Bewohnerinnen des Urschlamms, geschehen minder verborgene Wunder. Da die Befruchtung ihrer Blüten nicht im Wasserschoss stattfinden kann, so hat jede von ihnen ein verschiedenes System erfunden, damit sich der Pollen trocken verstreuen kann. So halten die Zosteren, d. h. das gemeine Seegras, aus dem man Matratzen macht, ihre Blüten sorgfältig in einer wahren Taucherglocke verborgen, die Wasserrosen senden die ihren an die Wasseroberfläche, um sie zu entfalten, sie erhalten und ernähren sie dort an einem endlosen Stängel, der länger wird, sobald der Wasserspiegel steigt. Die falsche Wasserrose (Villarsia nymphaeoides) hat keinen sich verlängernden Stil und so lässt sie ihre Blüten einfach fahren; sie steigen auf und platzen wie Seifenblasen. Die schwimmende Wassernuss (Trapa natans) versieht die ihren mit einer Art luftgefüllter Blase; sie tauchen empor, öffnen sich, und sobald die Befruchtung vollzogen ist, füllt sich der Luftraum in der Blase mit einer schleimigen Flüssigkeit, die schwerer ist als das Wasser; und die ganze Vorrichtung taucht wieder unter in den Schlamm, wo die Früchte reifen.
Noch komplizierter ist das System der Utricularia. H. Boquillon beschreibt es folgendermaßen in seiner „Vie des Plantes“. »Diese Pflanzen, die in Teichen, Gräben, Morästen und Torfmoorlachen häufig vorkommen, sind im Winter unsichtbar; sie ruhen in ihrem Schlamm*) Ihr langer, schmaler kriechender Stängel ist anstelle der Blätter mit verästelten Fasern besetzt. Am Blattstiel der so verwandelten Blätter bemerkt man einen kleinen birnenförmigen Schlauch, dessen oberes Ende spitz ausläuft und eine Öffnung besitzt. Diese Öffnung hat eine nur nach innen sich öffnende Klappe, deren Ränder mit verästelten Haaren besetzt sind; das Innere des Schlauches ist mit anderen kleinen Drüsenhaaren besetzt, die ihr ein samtartiges Aussehen geben. Sobald die Blütezeit naht, füllen sich diese kleinen Schläuche mit Luft, und je mehr diese zu entweichen drängt, desto fester schließt sich die Klappe. So erhält die Pflanze schließlich ein sehr geringes spezifisches Gewicht, durch das sie an die Wasseroberfläche kommt. Nun erst blühen die reizenden kleinen gelben Blüten auf, die wie seltsame kleine Mäuler mit mehr oder minder geschwollenen Lippen aussehen und deren Gaumen mit orangefarbenen oder ockerfarbenen Streifen geziert ist. In den Monaten Juni, Juli und August zeigen sie ihre frischen Farben mitten zwischen Pflanzenresten und erheben sich anmutig über das Pfützenwasser. Aber die Befruchtung ist vollzogen, die Frucht entwickelt sich, die Rollen wechseln; das Wasser drückt auf die Klappe der Schläuche, dringt in die Höhlung, beschwert die Pflanze und zwingt sie, wieder in den Schlamm hinabzutauchen.“ Ist es nicht seltsam, in dieser kleinen uralten Vorrichtung einige der neuesten und fruchtbarsten menschlichen Entdeckungen vorweggenommen zu sehen: das Spiel der Klappen, den Druck der Luft und der Flüssigkeiten, das Prinzip des Archimedes, studiert und nutzbar gemacht? Wie der eben zitierte Autor bemerkt, „ahnte der erste Ingenieur, der an einem gesunkenen Fahrzeug eine Vorrichtung zum Flottmachen anbrachte, gewiss nicht, dass ein ähnliches Verfahren seit Jahrtausenden im Gebrauch war“. In einer Welt, die wir für unbewusst und aller Intelligenz bar halten, wähnen wir zuerst, dass unsere geringsten Ideen neue Kombinationen und Beziehungen schaffen. Sieht man näher zu, so ist es höchst wahrscheinlich, dass wir überhaupt nichts schaffen können. Als Spätgeborene dieser Erde finden wir einfach wieder, was stets bestanden hat, und legen wie verwunderte Kinder den Weg, den das Leben schon vor uns gemacht hatte, noch einmal zurück. Überdies ist es sehr natürlich und tröstlich, dass es so ist. Doch wir kommen hierauf noch zurück.
Wir können die Wasserpflanzen nicht verlassen, ohne noch kurz das Leben der romantischsten unter ihnen, der Vallisneria, einer Hydrocharidee zu berühren, deren Befruchtung die tragischste Episode in der Liebesgeschichte der Pflanzenwelt bildet.
Die Vallisneria ist ein ziemlich unansehnliches Gewächs, ohne die seltsame Grazie der Wasserrose oder gewisser Seegräser. Aber man möchte sagen, dass die Natur sie zur Trägerin eines schönen Gedankens erwählt hat. Ihr ganzes Dasein vollzieht sich im Wasser in einer Art Halbschlaf, bis zu der hochzeitlichen Stunde, wo sie zu neuem Leben erwacht. Dann rollt die weibliche Blüte langsam die Spirale ihres Stiels auf, steigt und taucht empor, schwimmt auf der Oberfläche des Teiches umher und entfaltet ihren Kelch. Die männlichen Blüten einer benachbarten Staude, die sie durch das sonnige Wasser erblicken, steigen hoffnungsvoll zu ihr empor, die sich auf der Flut wiegt, sie erwartet und in eine Wunderwelt hinaufruft. Aber auf halbem Wege sehen sie sich plötzlich festgehalten; ihr Stängel, der Quell ihres Lebens, ist zu kurz. Sie werden nie das Licht des Tages erblicken, das einzige, in dem die Vereinigung des Stempels mit den Staubfäden stattfinden kann!
Gibt es in der Natur eine grausamere Unachtsamkeit oder Prüfung? Man vergegenwärtige sich die Tragödie dieses Verlangens, das Unerreichbare, das doch fast berührt wird, das durchsichtige Verhängnis, die Unmöglichkeit ohne sichtbares Hindernis! Sie wäre unlöslich wie das Drama unseres eignen Erdenlebens, hätten die männlichen Blüten nicht vielleicht ein Vorgefühl ihrer Enttäuschung. Jedenfalls umschließen sie mit ihrem Kelche eine Luftblase, wie man in seinem Herzen einen Gedanken an verzweifelte Befreiung hegt. Sie zaudern anscheinend einen Augenblick, dann machen sie eine prächtige Kraftanstrengung, die übernatürlichste, die ich in der Geschichte der Insekten und Blumen kenne, um sich zum Glück zu erheben: sie zerreißen freiwillig das Band, das sie ans Dasein kettet. Sie reißen sich von ihrem Stiel los und mit unvergleichlichem Aufschwung, von Perlen des Frohsinns umgeben, durchbrechen ihre Blütenblätter die Wasseroberfläche. Zu Tode getroffen, aber strahlend und frei, schwimmen sie eine kurze Weile neben ihren sorglosen Bräuten; die Vereinigung vollzieht sich und die Geopferten gehen unter, während die Gattin, die bereits Mutter ist, ihren Kelch, in dem ihr letzter Hauch fortlebt, schließt, ihre Spirale zusammenrollt und wieder in die Tiefen hinabsteigt, um dort die Frucht des heroischen Kusses zu zeitigen.
Soll man dies reizende Bild trüben, das von strenger Wahrhaftigkeit, aber nur von der Lichtseite gesehen ist, indem man es auch von der Schattenseite betrachtet? Warum nicht? Auf der Schattenseite findet man oft ebenso bedeutsame Wahrheiten wie auf der Lichtseite. Diese herrliche Tragödie wird erst vollkommen, indem man die Intelligenz, das Streben der Art, ins Auge fasst. Wenn man aber die Individuen betrachtet, wird man sie sich in diesem Idealplan ungeschickt und widersinnig benehmen sehen. Bald tauchen die männlichen Blüten empor an die Oberfläche, wenn noch keine stempeltragenden Blüten in der Nähe sind. Bald, wenn der niedrige Wasserstand ihnen gestattete, ihre Gefährtinnen mühelos zu erreichen, zerreißen sie trotzdem mechanisch und unnütz ihre Stängel. Auch hier sehen wir wieder einmal, dass aller Genius in der Art, im Leben oder in der Natur liegt und dass das Individuum nahezu stumpfsinnig ist. Nur beim Menschen herrscht ein wirklicher Wetteifer zwischen den beiden Intelligenzen, ein immer deutlicheres und tatkräftigeres Streben nach einer Art von Gleichgewicht, welches das große Geheimnis unserer Zukunft ist.
Die Schmarotzerpflanzen bieten uns ähnliche seltsame und bösartige Schauspiele, so z. B. die erstaunliche Flachsseide (Cuscuta epilinum) im Volksmund Mönchsbart genannt. Sie ist blätterlos und kaum ist ihr Stängel ein paar Zentimeter lang, so verlässt sie mit Vorbedacht ihre Wurzeln, um ihr erwähltes Opfer zu umspinnen und ihre Saugwurzeln hineinzusenken. Fortan lebt sie fast ausschließlich auf Kosten ihrer Beute. Es ist unmöglich, ihren Scharfsinn zu täuschen, sie weist jede ihr nicht zusagende Stütze ab und sucht, unter Umständen ziemlich weit, nach dem Hanf-, Hopfen-, Leinoder Luzernenstängel, der ihrem Temperament und Geschmack zusagt.
Die Flachsseide lenkt unsern Blick unwillkürlich auf die Kletterpflanzen, die sehr merkwürdige Gewohnheiten haben und ein Wort der Beachtung verdienen. Überdies haben die unter uns, die ein wenig auf dem Lande gelebt haben, gewiss oft Gelegenheit gehabt, zu beobachten, mit welchem Instinkt oder welcher Art von Vision die Ranken des wilden Weins oder der Winde nach einem Harkenstiel streben, den man an eine Mauer gelehnt hat. Man stelle die Harke, wo anders hin ― und am nächsten Tage hat, sich die Ranke umgedreht und sie wiedergefunden. Schopenhauer fasst in seiner Betrachtung „Über den Willen in der Natur“ bei dem Kapitel, das der Pflanzenphysiologie gewidmet ist, eine Menge von Beobachtungen und Experimenten über diesen wie über mehrere andre Punkte zusammen. Es würde mich zu weit führen, darauf einzugehen; ich bitte den Leser, das Kapitel nachzulesen: er findet dort zahlreiche Quellen und Nachweise angeführt. Ich brauche nicht hinzuzufügen, dass diese Quellen sich seit fünfzig Jahren seltsam vermehrt haben und dass der Stoff nahezu unerschöpflich ist.
Unter diesen zahllosen Beispielen der List und der mannigfachen Vorsichtsmaßregeln möchte ich noch das des Schweinssalats (Hyoseris radiata) anführen, einer kleinen, gelb blühenden Pflanze, die dem Löwenzahn ähnlich ist. Man findet sie häufig an alten Mauern an der Riviera. Um sowohl die Samenausstreuung wie die Stabilität ihrer Rasse zu sichern, trägt sie gleichzeitig zwei Samenarten: die einen fallen leicht ab und haben Flügel, um im Winde zu fliegen, während die anderen flügellos sind und Gefangene des Blütenstands bleiben, sodass sie erst frei werden, wenn die Pflanze verfault.
Bei der Choleradistel (Xanthium spinosum) sehen wir, wie fein durchdacht gewisse Systeme der Samenausstreuung sind und wie glücklich sie funktionieren. Die Choleradistel ist ein scheußliches Unkraut, mit furchtbaren Stacheln gespickt; sie war bis vor Kurzem in Westeuropa unbekannt und natürlich hatte niemand daran gedacht, sie hier einzuführen.
Sie verdankt ihre Verbreitung ihren mit Häkchen besetzten Fruchtkapseln, die sich in die Tierfelle festkrallen. In Russland heimisch, ist sie zu uns in Wolleballen gekommen, die aus den russischen Steppen stammten. Man kann die Etappen ihrer Wanderschaft und Welteroberung auf der Karte verfolgen.
Das italienische Leimkraut (Silene italica), ein harmloses weißes Blümchen, das man massenhaft unter den Ölbäumen findet, hat sein Denken in einer anderen Richtung betätigt. Anscheinend sehr ängstlich, sehr besorgt, dass keine unliebsamen und unsauberen Insekten seinen Kelch besuchen, hat es seine Stängel mit drüsigen Haaren besetzt, die einen klebrigen Leim ausschwitzen. Durch diese werden die Schmarotzer so gut gefangen, dass die Bauern sie im Süden als Fliegenfalle in ihren Häusern benutzen. Gewisse Leimkrautgewächse haben das System übrigens sinnreich vereinfacht. Da sie vor allem die Ameisen fürchten, so haben sie es zu deren Abwehr für ausreichend gefunden, einen breiten klebrigen Ring unter dem Knoten jedes Stängels anzubringen. Genau dasselbe machen die Gärtner, wenn sie die Stämme der Obstbäume mit einem Teerring umgeben, um zu verhindern, dass Raupen hinaufkriechen.