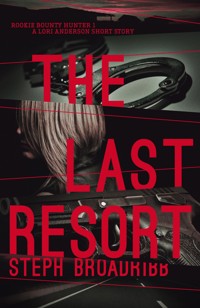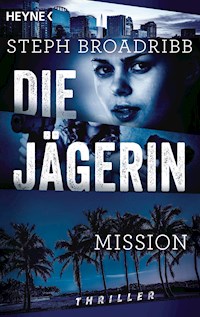9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lori-Anderson-Serie
- Sprache: Deutsch
Lori Anderson ist eine toughe Frau, die versucht ihre Karriere als unerschrockene Kopfgeldjägerin in Florida von ihrer Rolle als alleinerziehende Mutter der leukämiekranken Dakota zu trennen. Doch als ihr die Krankenhausrechnungen über den Kopf wachsen, ist sie dazu gezwungen, ihre Tochter mit auf einen Job zu nehmen, der ihr einen guten Verdienst einbringt. Von nun an laufen die Dinge schief. Der Flüchtige, den sie vor Gericht bringen muss, ist niemand anderes als JT, Loris früherer Mentor – der Mann, der ihr alles beigebracht hat, was sie weiß; und auch der Mann, der die Geheimnisse ihrer düsteren Vergangenheit kennt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Noch während ich ins Zimmer trat, wusste ich, dass mein Gefühl richtig gewesen war und ein Kind hier definitiv nichts zu suchen hatte. Konnte sein, dass Quinn tatsächlich von einem einfachen Job ausgegangen war, aber jetzt fand ich mich in einer Schlangengrube wieder, für deren Bewohner die Bezeichnung »heimtückisch« viel zu harmlos war. Zwei wahre Brocken bauten sich vor mir auf. Nicht gerade der Menschenschlag, mit dem unsereins normalerweise Umgang hat. Unter ihren Gürteln steckten Messer und in ihren Augen flackerte die Brutalität des Schnapses. Mit dem Bubi, der hinter mir mit seiner Semiautomatik den Ausgang blockierte, waren sie zu dritt. Nirgends eine Spur von Merv Dalton, dem Kopfgeldjäger, oder seiner alten Tante, deren Haus das hier doch sein sollte. Ich war das einzige Mädchen auf der Tanzfläche.
Nicht gerade angenehm, aber ich hatte einen Job zu erledigen. Gehen oder bleiben: Mein Gefühl sagte mir, dass diese Jungs mir weder das eine noch das andere leicht machen würden. »Ich suche nach einem Flüchtigen, Robert James Tate. Ich bin hier, um ihn festzunehmen.«
Die Autorin
Steph Broadribb, geboren in Birmingham, hat ein Studium in Kreatives Schreiben von der City University London und eine Ausbildung zur Kopfgeldjägerin in Kalifornien absolviert. Heute lebt sie in Buckinghamshire.
Lieferbare Titel
DIE JÄGERIN:
Auftrag – Mission – Übergabe
STEPH BROADRIBB
DIE JÄGERIN AUFTRAG
Thriller
Aus dem Englischen übersetzt von Sven Scheer
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die englische Originalausgabe Deep Down Dead erschien 2017 bei Orenda Books.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständige deutsche Erstausgabe 04/2020
Copyright © 2016 by Steph Broadribb
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, in der
Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Steffi Korda, Hamburg
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München,
unter Verwendung von Motiven von © FinePic®, München
Satz: Fotosatz Amann, Memmingen
ISBN: 978-3-641-25087-4V001
www.heyne.de
Für Pod
Prolog
Heute
Ich öffne meine Augen. Das Erste, was ich sehe, sind die Handschellen.
Vorsichtig bewege ich die Handgelenke und versuche, den dumpfen Schmerz in der rechten Hand auszublenden, wo sich rötlichbrauner Schorf auf der tiefen Wunde gebildet hat. Die blauen Flecken auf meinen Unterarmen haben sich dunkellila verfärbt. So, wie sich meine Rippen anfühlen, sehen sie genauso aus. Ich atme flach, um die Schmerzen ein bisschen erträglicher zu machen. Dann blicke ich auf.
Er sitzt mir mit verschränkten Armen gegenüber, die Beine unterm Tisch ausgestreckt. Wartet. In dieser fensterlosen Schachtel lässt sich nicht sagen, wie viel Zeit vergangen ist. Ich kann ihm nicht in die Augen sehen, noch nicht, also schaue ich auf die dunklen Schatten darunter. Mein Herz rast, und in meinem Kopf ruft eine Stimme: Lauf! Lauf weg! Nichts lieber als das … Aber es geht nicht. Jemand muss den Kopf hinhalten für das, was passiert ist. Genau deshalb sitze ich hier.
»Sehen Sie mich jetzt an? Gut. Dann antworten Sie auf meine Frage.«
Der Kentucky-Akzent klingt vertraut, aber den Mann dazu habe ich mir ganz anders vorgestellt. Kann passieren, wenn man jemanden nur am Telefon gehört hat. Ich zwinge mich, seinen Blick zu erwidern, und versuche, meinen aufgeregten Magen zu beruhigen und die Angst aus meiner Stimme rauszuhalten, als ich sage: »Sie sollten nicht alles glauben, was Ihnen erzählt wird.«
»Erklären Sie das.«
Jetzt, wo der Moment gekommen ist, weiß ich nicht, ob ich es kann. War er in die Sache verwickelt? Kann ich ihm vertrauen? Das Äußere jedenfalls stimmt, er sieht smart und erfolgreich aus in seiner Uniform aus schwarzem Anzug und lässig in die Brusttasche geschobener Sonnenbrille. Ein bisschen älter ist er, knapp fünfzig, würde ich sagen. Die halblangen Haare sind nach hinten gegelt. Jetzt bändigt er mit einer Hand ein paar widerspenstige Strähnen. Ob er nervös ist? Ich jedenfalls bin es. Verdammt nervös.
Er mustert mich ausdruckslos, überzeugt, dass ich früher oder später reden werde. Dass er nur warten muss, weil mir die Zeit wegläuft. Mit jeder Sekunde entferne ich mich weiter von den Menschen, die ich liebe. Wir wissen beide, dass all das hier aufhört und niemand mehr von der Todeszelle redet, wenn ich den Mund aufmache. Aber unser Tänzchen muss einer festgelegten Choreografie folgen. Auch das wissen wir beide.
Er stellt einen Plastikbecher auf den Tisch und schiebt ihn mir rüber. In dem Becher schwappt eine Flüssigkeit in der Farbe von verdünntem Blut. »Trinken Sie. Den Untersuchungen zufolge sind Sie dehydriert.«
Stimmt. Mein Mund ist trockener als Alligatorenhaut im August. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal etwas Vernünftiges gegessen oder getrunken habe. Für etwas so Unwichtiges hatte ich in den letzten Tagen keine Zeit. Ich bin versucht zuzugreifen. Aber erst muss er etwas für mich tun. Hier geht es nur um Macht. Hilfst du mir, helfe ich dir.
Ich blicke auf die Handschellen. Hebe den Kopf. Schaue ihn an. Warte.
Er begreift, beugt sich über den Tisch, die Schlüssel in der linken Hand. Ich rieche sein Parfüm. Zitrone, rein und schnörkellos. Wie er, hoffe ich. Ich muss ihm vertrauen, für etwas anderes haben wir keine Zeit.
Ich schiebe meine Hände mit den Handflächen nach oben über die Furnierplatte. Meine Schulter brennt höllisch. Um mir nichts anmerken zu lassen, beiße ich auf die Zähne. Er nimmt mir die Handschellen ab und verstaut sie und den Schlüssel in seiner Jacke. Macht es sich auf seinem Stuhl bequem. Fixiert mich erneut.
Der erste Schritt ist getan.
Also trinke ich, als Zeichen meines guten Willens. Ich brauche die Flüssigkeit, darf nicht austrocknen. Nicht, dass ich nicht mehr klar denken kann und bei der Geschichte durcheinanderkomme. Ich muss sie richtig erzählen. Das Getränk ist Wasser mit Himbeeraroma. Es schmeckt süß, zu süß, und brennt im Mundwinkel, wo ich einen Schlag zu viel abgekriegt habe. Ich verziehe das Gesicht. »Und, wie geht’s jetzt weiter?«
Er schaut mich ungerührt an. »Sie erzählen mir alles.«
Ich zucke zusammen. Versuche, mir den stechenden Schmerz in den Rippen nicht anmerken zu lassen. Er ist zu schnell. Es geht nicht, den zweiten Schritt vorm ersten zu machen. Das kann ich ihm nicht durchgehen lassen.
Die Schmerzen lassen nicht nach. Ein plötzlicher Brechreiz überfällt mich, Galle steigt mir die Kehle hoch. Ich huste. Meine geprellten Rippen tun höllisch weh. Ich beiße mir auf die Lippe und presse einen Arm fest an den Körper. Keine Schwäche zeigen. »Ich muss hier raus, meine Tochter nach Hause bringen.«
Er schüttelt den Kopf und beugt sich vor, Ellbogen auf dem Tisch, das Gesicht auf Augenhöhe. »Keine Chance. Die Situation ist verflucht ernst. In Ihrer Lage können Sie definitiv keine Forderungen stellen.«
Ein Test. Er will sehen, wie verzweifelt ich bin. Die Antwort? Völlig verzweifelt. Aber ich bin nicht so blöd, mich zu verraten. In diesem Spiel geht es um das richtige Timing. Was ich sage – und ob er es mir abnimmt –, entscheidet über Leben und Tod. »Und was dann?«
Er starrt mich unverwandt an. Beugt sich weiter vor. »Erzählen Sie mir die Wahrheit. Mehrfacher Mord und was sonst noch dazukommt. Außer mir kann niemand etwas für Sie tun. Sie müssen mich überzeugen. Hier und jetzt.«
Der Raum scheint zu schrumpfen. Die Luft ist stickig. Ich hasse ihn für das, was er gerade gesagt hat. Es ist so ungerecht, dass ich am liebsten nur schreien und auf ihn einprügeln möchte, bis er dieselben Schmerzen spürt wie ich. Aber ich lasse es. Weil er recht hat. Ich habe keine andere Wahl, als ihm zu vertrauen.
Ich stelle den Becher ab, beobachte, wie das Wasser sich kräuselt und nach ein, zwei Wellen wieder zur Ruhe kommt. Ich zähle in Gedanken bis zehn, dann hebe ich den Blick und schaue ihn an. Ich darf keine Zeit mehr verlieren, muss den zweiten Schritt machen, die Situation entschärfen. »Ich werde Ihnen antworten. Sobald wir einen Deal haben.«
Er rutscht auf seinem Stuhl nach unten und schlägt entspannt die Beine übereinander. Hält Augenkontakt. »Hängt davon ab.«
Seine Entschlossenheit ist verdammt anziehend. Er spielt die Rolle des Unnahbaren ziemlich überzeugend, und eigentlich habe ich eine Schwäche für so was. Aber ich reiße mich zusammen. Unnahbar bedeutet undurchschaubar. Und ich kann mir kein falsches Wort erlauben, sonst verliere ich die einzigen Menschen, die ich liebe. »Ich höre.«
»Sie erzählen mir, was passiert ist. Keinen Scheiß, einfach nur die ganze Wahrheit, von Anfang bis Ende. Wenn Sie das machen, sage ich Ihnen, ob wir einen Deal haben.«
Das ist keine Garantie, aber mehr ist vermutlich nicht drin. Also nicke ich, und wir gehen gemeinsam den dritten Schritt. Allerdings tu ich so, als würde ich ihn führen. Ich schlucke meine Angst hinunter und zwinge mich zu lächeln. »Sie sollten es sich bequem machen, wir haben eine lange Reise vor uns.«
Er nickt. Jetzt kommt es drauf an: Ich muss die Geschichte richtig erzählen, einen Deal aushandeln.
Er stellt das Aufnahmegerät mit einem Klick an, beugt sich vor und platziert es genau in der Mitte des Tisches. Sieht mir geradewegs in die Augen. »Sie können loslegen.«
Und dann erzähle ich ihm alles.
1. Kapitel
Drei Tage zuvor
Die Büroräume von CF Bonds liegen zwei Minuten entfernt vom West Colonial Drive, der Hauptgeschäftsstraße. Nichts Besonderes, ein geduckter Flachbau auf der Franklin, nur wenige Hundert Meter von einem noblen Hundesalon und einem Chicken-Take-away – nicht dass Quinn, ihr bester Kautionsagent, jemals irgendwas Frittiertes zu sich nehmen würde. Er ist ein Gesundheitsfreak mit einer Vorliebe für Proteinshakes, Feuchtigkeitscremes und Achtzig-Dollar-Haarschnitte. Das Ergebnis überzeugt, sofern man auf enthaarte, gelackte Männer steht. Und die Quälerei im Fitnessstudio wirkt Wunder.
Ich parkte am Straßenrand und schlenderte mit Dakota, meiner kleinen Tochter, zum Eingang. Als wir eintraten, klingelte das kleine silberglänzende Glöckchen über der Tür. Im Gegensatz zu den meisten Kunden von Quinn und seinen Kollegen war der Klang fast lieblich, trotzdem schreckte er von seinem Stuhl auf. Mit großen Schritten kam er nach vorn, um uns in Empfang zu nehmen.
Ich atmete auf. Der kleine Wartebereich am Eingang war durch eine kugelsichere Scheibe vom Büro getrennt, sodass man sich dort nach einiger Zeit zwangsläufig wie ein Goldfisch im Glas vorkam. Und ich konnte es noch nie ertragen, mich eingesperrt zu fühlen.
Quinn schüttelte mir begeistert die Hand. »Lori, wie schön, dich zu sehen.«
»Gleichfalls«, gab ich zurück und entzog ihm meine Hand. Wenn er derart auffällig freundlich war, hatte er vermutlich einen dringenden Job. Gut. Meine Miete war fällig, und ich war drei Monate im Rückstand mit den Zahlungen für Dakotas Behandlung, kurz gesagt, ich brauchte dringend Kohle. »Können wir reden?«
Er nickte, lächelte Dakota an und wuschelte ihr durch die rotblonden Haare. »Hallo, Samtpfötchen. Meine Güte, bist du groß geworden. Du musst inzwischen mindestens schon zehn sein, stimmt’s?«
Sie verdrehte die Augen, stemmte die Hände in die Hüften und reckte ihr Kinn nach vorn – eine Haltung, bei der ich jedes Mal an ihren Vater denken muss. »Ich bin neun, und ich bin kein Samtpfötchen, ich bin ein Tiger.«
Quinn lachte. »Alles klar. Möchte der Tiger vielleicht ein Glas Milch?«
Dakota lachte und nickte.
Quinn sah mich an. »Einen Kaffee?«
Ich schüttelte den Kopf. Quinns Kaffee war reichlich schwach auf der Brust. »Tee.«
Während er sich um die Getränke kümmerte, ging ich mit Dakota durch die Glastür nach hinten ins Büro. Es war nicht gerade geräumig, nur zwei Schreibtische mit Besucherstühlen standen darin. Hinter Quinns Platz hing eine Florida-Karte an der Pinnwand. Der Schreibtisch war so aufgeräumt wie in der Ausstellung eines Möbelhauses: die Papiere in Ablagen, die Stifte in Reih und Glied, die Maus auf ihrem Pad. Freie Aufträge bewahrte er in der roten Ablage direkt vor mir auf, das wusste ich. Also riskierte ich einen Blick. Sie quoll nicht gerade über, vielleicht zwei oder drei Akten. Mist.
Quinn kam zurück. Nachdem er sich hinter dem Schreibtisch niedergelassen hatte, deutete er einladend auf den Stuhl gegenüber. Ich folgte der Aufforderung, dann drehte ich mich zu Dakota, die es sich auf dem anderen Stuhl bequem machen wollte. Ihre nackten Beine schmatzten auf dem Kunstleder. »Willst du nicht mal nachgucken, was Mrs. Valdez gerade macht?«
Sie verzog das Gesicht. »Kann ich nicht hierbleiben?«
»Tut mir leid, Süße. Das hier ist geschäftlich.«
Quinn beugte sich über den Schreibtisch. »Mrs. Valdez ist hinten im Aktenraum. Wie mir zu Ohren gekommen ist, versteckt sie da eine Schachtel Kekse.« Er kramte ein leeres Kautionsformular aus der Schublade, notierte etwas darauf und hielt es Dakota hin. »Wenn du ihr das hier von mir bringst, ist bestimmt ein Keks als Belohnung drin.«
Dakotas Augen leuchteten auf. Sie sprang vom Stuhl, nahm ihre Milch und griff nach dem Formular. »Cool. Bin schon weg.«
Wir sahen ihr nach, wie sie ins Hinterzimmer hüpfte.
»Sie sieht gesund aus.«
»Im Moment.« Langsam und gleichmäßig rührte ich Honig in den Tee. Schaute nicht zu Quinn. Ich deutete mit dem Kopf auf die Akten in der roten Ablage. »Und, was hast du für mich?«
Quinn schüttelte den Kopf. »Nicht viel.«
»Shit. Ich muss meine Miete zahlen, Quinn. Und die Krankenhaus-Raten sind verdammt hoch.«
Er zuckte mit den Schultern. »Ich kann auch nichts aus dem Hut zaubern.«
Das Problem war, dass ich als Kopfgeldjägerin nur auf Honorarbasis für CF Bonds arbeitete, sie mit Walt Bailey aber auch einen fest angestellten Ermittler hatten. Für sie war es billiger, wenn Walt einen Auftrag erledigte. Quinn war mir nichts schuldig.
»Wie ich dir schon letzten Monat und den Monat davor gesagt habe: Das Geschäft läuft ziemlich ruhig im Moment.«
»Ach ja?« Ich starrte ihn an. Seine Wangen liefen leicht rot an. »Weißt du, was passiert, wenn ich diesen Monat nicht zahle? Sie streichen die Nachuntersuchung. Und weißt du, was das bedeutet? Falls der Krebs zurückkommt, kriegen sie es nicht mit und können ihn nicht sofort behandeln.«
»Das verstehe ich ja, aber ich …«
»Quinn, du musst mir etwas geben.« Ich sah den Brief in meiner Küche vor mir, auf dem oben fett in Rot LETZTEMAHNUNG stand. Irgendwie musste ich das Geld auftreiben. Die Alternative wollte ich mir nicht ausmalen. Meine Kleine durfte nicht noch einmal krank werden.
»Also gut, vielleicht kann ich dir einen oder zwei von Baileys Fällen zuschustern. Zwei Typen, die untergetaucht sind, jeder ein paar Hundert Dollar wert.«
Ich schüttelte den Kopf. »Danke, aber damit komme ich nicht weit. Ich brauche was Fettes.«
Sein Blick wanderte zu den Akten in der roten Ablage. »Es gäbe da noch diesen einen Job, aber der wäre außerhalb, und du hast immer gesagt …«
»Was ist drin?«
»Fünfstellig.«
Das klang schon besser. »Was heißt außerhalb?«
»West Virginia.«
Allerdings außerhalb. Aber konnte ich bei der Summe Nein sagen? Ich schenkte ihm mein charmantestes Lächeln. »Ich höre.«
Falls Quinn erstaunt war, zeigte er es nicht. »Der Gerichtstermin ist in drei Tagen, du müsstest also fix sein. Interesse?«
»Nicht ausgeschlossen.« Ich nahm den Löffel aus dem Tee. An der Spitze wölbte sich ein Honigtropfen. Ich steckte den Löffel in den Mund, um Quinn noch ein bisschen zappeln zu lassen.
Denn wenn eine Kautionssache so dringend war, hieß das nur eins: dass es noch niemand geschafft hatte, den Flüchtigen dingfest zu machen. Dabei hatte Quinn mit Sicherheit Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, als der Kerl nicht zum ursprünglichen Gerichtstermin aufgetaucht war. In einem solchen Fall betrug die gesetzliche Frist in Florida dreißig Tage, danach verfiel die Kaution. Wenn CF Bonds den Typen nicht bis zum nächsten Termin ablieferte, würde die Firma eine Menge Geld verlieren. Und nichts hassten diese Leute mehr. Wenn der Flüchtige also noch auf freiem Fuß war, musste er ziemlich clever oder ziemlich schnell sein. Wahrscheinlich beides. »Wie viel ist drin?«
»Zehntausend.«
Verdammt. Zehn Riesen. Ich bemühte mich um ein Pokerface. Als Kopfgeldjägerin standen mir zehn Prozent der Kautionssumme zu, wenn ich den Flüchtigen rechtzeitig zum Gerichtstermin ablieferte. Die meisten meiner Fälle brachten sehr viel weniger ein. Drei-, höchstens vierstellige Summen, nichts mit vier Nullen. »Eine Kaution von hunderttausend?«, fragte ich. »Was hat er angestellt?«
Quinn ging den dünnen Aktenstapel durch und fand eine Mappe mit dem Vermerk Juli auf einem Post-it. Er schlug sie auf und überflog den Inhalt. »Er hat sich im Winter Wonderland danebenbenommen, diesem Vergnügungspark bei Fernandina Beach. Ist mit dem Besitzer aneinandergeraten, einem Randall B. Emerson. Der Sicherheitsdienst ist dazwischen und hat die Cops gerufen.«
»Schwere Körperverletzung?«
Quinn überflog die schmale Akte und schüttelte den Kopf. »Vermutlich nur ein bisschen Rumgeschubse.«
»Waffen?«
»Werden zumindest nicht erwähnt.«
Ich runzelte die Stirn. War ich übertrieben misstrauisch, oder hielt Quinn tatsächlich mit was hinterm Berg? Er brauchte den Flüchtigen schnell zurück, also nahm er es mit der Wahrheit möglicherweise nicht ganz so genau. Damit ich den Job auf jeden Fall übernahm. »Und wieso dann die hohe Kaution?«
»Du kennst doch die Vergnügungsparks. Wir brauchen die Touristen, und Läden wie das Winter Wonderland ziehen Leute von überallher an. Gut möglich, dass der Mann gar nicht wirklich gefährlich war. Dass sie nur ein Exempel statuieren wollen.«
Das klang nachvollziehbar. Die Leute strömen in die heile Welt der Parks, weil ihnen dort nichts Schlimmes passiert. Wenn irgendwas an diesem Zuckerguss kratzt, hat das Folgen für die Wirtschaft des gesamten Staats. »Und weshalb sucht Bailey ihn nicht?«
Quinn seufzte. »Hat er ja. Bis er vorgestern einen Unfall hatte. Wollte über eine Mauer springen, als er hinter einem jungen Burschen her war.«
Ich unterdrückte ein Grinsen. Bailey war eher der Typ fürs Sofa, nicht für eine Verfolgungsjagd. »Echt, das hat er versucht? Verdammt, da wär ich gern dabei gewesen. Ich hätte sogar Eintritt bezahlt.«
»Jedenfalls hätte er es lieber sein lassen sollen. Er ist gestürzt und hat sich das Handgelenk gebrochen.«
Ein Knochenbruch war natürlich keine lustige Angelegenheit, andererseits: Seit ich für CF Bonds arbeitete, machte Bailey sich über mich lustig, riss immer wieder dieselben faden Witzchen auf meine Kosten. Vielleicht war das einfach mal die Quittung dafür. »Wie kommt es eigentlich, dass die Sache so eilig ist?«
Quinns Gesicht wurde ernst. »Tja, was soll ich sagen? Der Kerl ist nicht von hier. Wir haben die Kaution nur gestellt, um einem alten Geschäftspartner vom Boss einen Gefallen zu tun. Eigentlich lebt der Flüchtige in Georgia, aber als Bailey dort hinkam, hatte er sich schon aus dem Staub gemacht. Seitdem sind wir hinter ihm her. Gestern hat Bailey endlich rausgekriegt, wo er ist: in einem Kaff in West Virginia. Also habe ich Bucky Dalton angerufen, ob er ihn für uns einkassieren kann. Leider musste ich erfahren, dass Bucky von einem Dealer zusammengeschossen wurde und jetzt im Krankenhaus in einen Beutel pinkelt. Buckys älterer Bruder Merv hat sich bereit erklärt, unseren Flüchtigen festzuhalten, bis wir ihn abholen.«
Ich zog eine Augenbraue hoch. »Soweit ich weiß, hat Merv keine Lizenz für Florida. Wenn er jemanden an dich ausliefert, ist das illegal.«
»Na ja, schon …« Quinn stierte in das braun gefärbte Wasser in seinem Becher, als gäbe es da irgendwas zu entdecken. »Also, du musst nur Ja sagen, dann gehört der Job dir.«
Wollte ich ihn überhaupt? Natürlich brauchte ich die Kohle, aber Dakota hatte gerade Ferien, und meine Nachbarin Krista, die normalerweise auf sie aufpasste, wollte zu ihrer Familie nach Tennessee. Also würde ich Dakota mitnehmen müssen, wenn ich aus Florida rausmusste.
Durch die Tür sah ich meine Tochter, die im hinteren Büro neben Mrs. Valdez saß und ihr half, Briefe zu falten und in Umschläge zu stecken. Sie plapperte fröhlich, und ihre Zöpfe hüpften, als sie der älteren Frau bei irgendwas mit einem Kopfnicken zustimmte. Plötzlich sah sie auf, als hätte sie meinen Blick gespürt, und lächelte mich an.
Ich wandte mich wieder Quinn zu. Schüttelte den Kopf. »Ich habe gerade niemanden für Dakota. Also müsste ich sie mitnehmen, und der Gedanke, dass sie mit einem Flüchtigen in Kontakt kommt, gefällt mir nicht.«
Quinn hob die Schultern. »Verstehe ich, Lori. Aber du hast nach einem lukrativen Job gefragt, und das ist der einzige. Sollte kinderleicht sein, völlig unproblematisch, nur eine kleine Taxifahrt. Dein Fahrgast ist ein Profi, dem im Eifer des Gefechts die Gäule durchgegangen sind. Bailey hat ihn aufgestöbert und Merv ihn einkassiert.«
Das klang in der Tat ziemlich einfach. Und eine Taxifahrt, was sollte daran schon schlimm sein? Trotzdem hatte ich meine Zweifel, ob es auch für meine Kleine ausreichend ungefährlich war.
»Du musst den Kerl nur noch abholen und zum Gerichtstermin in drei Tagen abliefern«, fuhr Quinn fort. »Dein Silverado ist doch mit Fesseln und einer Transportzelle ausgestattet, oder nicht?«
Ich nickte. »Jepp.«
Er lächelte und entblößte Zahnarztkunst im Wert von mehreren Tausend Dollar. »Also kann der Kerl deiner Tochter gar nicht nahekommen, oder? So wie ich es sehe, ist das leicht und schnell verdientes Geld. Verdammt, ich würde selbst hinfahren, wenn ich nicht hier gebraucht würde.«
Ich konnte ein amüsiertes Schnauben nicht unterdrücken. Die größte Gefahr, der Quinn sich mal ausgesetzt hatte, war ein Box-Kurs in seinem Fitnessstudio gewesen. »Ach ja?«
Sein Lächeln verschwand. »Und ob.«
Vermutlich hatte ich seinem Ego einen kleinen Stich versetzt. Ich sah ihn aufmerksam an und ließ mir das Angebot durch den Kopf gehen. Er hatte recht, es klang nach einem einfachen Job. Und die Bezahlung stimmte. Dakota würde keinen Kontakt mit dem Flüchtigen haben.
Da kam mir eine Idee. Krista wollte erst am Nachmittag zu ihrer Familie aufbrechen. Ich würde ihr tausend Dollar bieten, damit sie ihre Reise um drei Tage verschob und sich um Dakota kümmerte. Mit drei Kindern und einem arbeitslosen Mann war sie immer knapp bei Kasse, also würde sie sich bestimmt überreden lassen.
»Was ist, machst du es?« Quinn sah mich hoffnungsvoll an. Er brauchte den Mann dringend, und er wusste, dass er sich auf mich verlassen konnte. Anscheinend war ich mehr oder weniger seine letzte Hoffnung.
Das brachte mich auf einen Gedanken. Konnte es nicht sein, dass CF Bonds ein bisschen auf die normale Provision drauflegen würde? Jedes noch so kleine Extra würde mir helfen. »West Virginia liegt nicht gerade um die Ecke. Ein paar Prozent mehr, dann kann ich bestimmt etwas deichseln.«
»Da sollte was drin sein«, sagte Quinn und lächelte steif. »Ich könnte auf elf Prozent hochgehen.«
Ich schüttelte den Kopf. »Allein das Benzin kostet mich schon mehr als dieses eine Prozent. Ich hatte eher an zwanzig gedacht.«
»Verdammt, Lori. Ich bin keine Weihnachtsgans, die du ausnehmen kannst.« Er zog die oberste Schublade seines Schreibtisches auf, holte einen Taschenrechner raus und tippte ein paar Zahlen ein. »Mit fünfzehn könnte ich leben. Letztes Angebot. Was sagst du?«
Fünfzehn Prozent, das hieß bei einer Kaution von hunderttausend Dollar fünfzehntausend für mich. Eine Menge Geld. Genug für die offenen Krankenhausrechnungen und die Miete für ein paar Monate im Voraus. Jetzt musste nur noch Krista ihre Reise verschieben und ich mich durchringen, Dakota zurückzulassen. Seit Ausbruch ihrer Krankheit vor einem Jahr hatte ich sie nicht mehr so lange allein gelassen. Nicht ein einziges Mal war ich über Nacht weggeblieben, hielt immer Ausschau nach dem kleinsten Hinweis, dass der Krebs wieder ausgebrochen war, um sie gleich ins Krankenhaus zu bringen. Drei Tage. Konnte ich mich so lange von ihr trennen? Hatte ich eine Wahl? Die Nachsorge musste weitergehen.
Während ich noch grübelte, hörte ich die Toilettenspülung, gefolgt von schweren, schleppenden Schritten, die sich aus dem hinteren Büroraum näherten. Bailey.
»Ach nee, unsere Kopfgeld-Barbie«, begrüßte er mich spöttisch.
Er kam auf mich zugewatschelt und streckte mir die unverletzte Hand zu einem schlaffen, klammen Händedruck entgegen. Dabei kam er mir zu nahe, stupste mich mit seinem ausladenden Bauch an der Hüfte an. Das Aroma von Chili-Hotdogs stieg mir in die Nase.
Ich löste meine Hand aus seiner und unterdrückte den Impuls, sie an der Hose abzuwischen. »Du warst also ein paar Wochen hinter dem Kerl her? Was kannst du mir berichten?«
Bailey reagierte nicht, sondern watschelte zu seinem papierübersäten Schreibtisch und ließ sich auf seinen Stuhl plumpsen. Das Holzgestell ächzte unter der Last. Er schaute wütend zu Quinn, schüttelte den Kopf. »Du schickst sie los, um meinen Flüchtigen abzuholen?«
Ich lächelte zuckersüß bei der Vorstellung, wie meine Faust in Baileys schwabbeligem Dreifachkinn-Gesicht landete. »Brauchst keine Angst zu haben, Herzchen. Ich bin keine Jungfrau mehr.«
»Dann machst du es also?«, fragte Quinn.
Ich zwinkerte Bailey zu, dessen Wangen puterrot angelaufen waren, und sah dann zu Quinn. »Natürlich.«
Quinn lächelte erleichtert. Er deutete mit dem Kopf auf die Mappe. »Haftbefehl und Vollstreckungsvollmacht sind da drin. Du …«
»Hat er dir schon erzählt, dass der Flüchtige einer von uns ist?«, funkte Bailey dazwischen. »Die Hinweise, denen ich nachgegangen bin, sind alle in der Akte. Nach dem, was die Leute so sagen, muss er in Georgia der Star der Kopfgeldjäger sein. Eine Legende.«
Ich runzelte die Stirn. »Ja, und jetzt ist er ein Mann auf der Flucht.«
»Einer, der mit allen Wassern gewaschen ist.« Bailey zog den Bauch ein und streckte die Brust raus. »Einen Monat war er wie vom Erdboden verschluckt. Dann hab ich ihn gefunden.«
Armer Bailey. Musste sich immer beweisen. Er ertrug es einfach nicht, dass ich die höhere Erfolgsquote hatte. »Glückwunsch, Schätzchen.«
Vielleicht wollte Bailey mich beeindrucken, vielleicht seine Überlegenheit beweisen, vielleicht beides – auf jeden Fall breitete er jetzt alles ausführlich vor mir aus: seine Recherchen im Internet, die Akten, die er aufgetrieben hatte, mit wem er gesprochen hatte. All das würde auch in der Fallakte stehen, unnötig also, dass er es mir vorkaute. Bailey jammerte, als hätte er jeden bis hin zum Cousin des Nachbarhunds befragt, um an eine Adresse zu kommen.
»… arbeitet für einen Victor Accorsi, genannt Pops, einen Kautionsagenten in Savannah …«
Pops kannte ich. Er hatte mir meinen ersten Job verschafft, als ich vor knapp zehn Jahren ins Business eingestiegen war. Den Kontakt hergestellt hatte der Mann, der mir alles über den Beruf beigebracht hatte. Mein Herzschlag wurde schneller. »Hast du einen Namen, ein Polizeifoto?«
Quinn suchte das Bild in der Akte. »Das ist er«, sagte er und reichte es mir.
»Heilige Scheiße.« Ich ließ das Foto wie eine heiße Kartoffel fallen. Es landete mit dem Bild nach oben auf dem Tisch.
Ich starrte das Foto an. Mein Herz raste, mein Mund war trocken.
Er war es.
Der Mann, der mich seit fast zehn Jahren in meinen Albträumen heimsuchte. Der einzige Mensch außer mir, der wusste, was vor all den Jahren wirklich geschehen war.
2. Kapitel
Robert Tate. Robert James Tate. Der Mann, den ich nur als JT kannte.
Ich warf noch einmal einen Blick auf das Polizeifoto. Ich hatte mal jeden Zentimeter von JT gekannt. Zehn Jahre war es her, seit er mir die oberste Regel des Gewerbes beigebracht hatte: Vertraue niemandem. Niemals. Das Foto war nicht besonders gut, aber er hatte ganz offensichtlich nichts von seiner herben Schönheit eingebüßt; seine Augen, die je nach Licht azurblau oder kobaltblau leuchteten, waren so eindrucksvoll wie eh und je, auch wenn er sie ein wenig zusammengekniffen hatte. Und seine dunkelblonden Haare waren wie immer ein bisschen zu lang.
Quinn musterte mich und hob eine Augenbraue. »Ein Freund von dir?«
Ich nickte. »Könnte man sagen.«
Bailey stieß einen langen Pfiff aus. »Scheiße, Mädchen. Wen du nicht alles kennst.«
Ich sah ihn finster an. »Er war mein Lehrer. Hat mich ins Business eingeführt. Mir alles gezeigt. Mir bei der Lizenz geholfen, bevor ich nach Florida gekommen bin.«
Bailey musterte mich anzüglich, und ein spöttisches Grinsen entblößte seine gelben Zähne. »Ach ja? Und wieso bist du nicht in Georgia geblieben?«
Eine einfache Frage, deren komplizierte Antwort ich Bailey kaum auf die Nase binden würde. »Er hat immer allein gearbeitet. Meinte, dass das sicherer sei. Er könne klarer denken, wenn er keine Angst um jemand anderen haben müsse. Ich habe das respektiert. Nach dem Training sollte Schluss sein, das war so ausgemacht.«
Quinn schüttelte den Kopf. »Klingt nach ’nem echten Charmebolzen.«
Sarkasmus. Und wenn schon. Trotzdem hatte Quinn recht. JT war charmant. Aber auch hart. Ich erinnerte mich noch an seine Predigt, immer konzentriert zu bleiben, als wir einmal zum Pick-up zurückgetrottet waren – nach einem Job, der um ein Haar in die Hose gegangen wäre. Ich hatte gezögert, einer Frau mit Babykörbchen Handschellen anzulegen. Sie hatte das Körbchen umklammert und gebrüllt, sie könne ihr Baby nicht zurücklassen. Als ich sie zu beruhigen versuchte, war ich ihr viel zu nahe gekommen. Dabei hatte JT mir wieder und wieder eingebläut, dass Mitgefühl eine Schwäche sei und Gefühle nur dazu führten, dass man in Gefahr geriet. Er hatte recht gehabt. Es gab kein Baby. Unter der Korbdecke hatte die Frau einen langläufigen Revolver gehabt, mit dem sie auf mich feuerte. Hätte sie besser gezielt und JT mich nicht zur Seite gerissen, wäre das mein Aus gewesen. Bleib immer objektiv, hatte er mich in unserer Nachbesprechung ermahnt. Konzentrier dich auf den Job. Geh keine engen Bindungen ein. Lass niemanden an dich ran.
Das war nicht die einzige seiner Regeln, gegen die ich verstoßen hatte.
Quinn musterte mich. »Willst du den Job immer noch?«
Ich nickte. Zögerte keinen Moment. Fünfzehntausend Dollar würde ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen, ganz egal, wie die Geschichte mit JT geendet war. Ich hatte einen hohen Preis gezahlt. Aber deswegen würde ich bestimmt nicht die Gesundheit meiner Tochter riskieren.
»Gut.« Quinn füllte ein Formular in seinem Computer aus und druckte den Auftrag aus, ein schriftliches Dokument, das mich autorisierte, JT für CF Bonds festzunehmen. Als er mir das Papier gab, streiften sich unsere Finger. Mich ließ die kurze Berührung kalt, aber Quinn schien plötzlich noch irgendetwas Weltbewegendes sagen zu wollen.
Darauf konnte ich gut verzichten. Also wandte ich schnell den Blick ab, nahm das Foto und schob es mitsamt der Auftragsbestätigung in die Aktenmappe. »Drei Tage also.«
Quinn seufzte. »Genau.«
Ich winkte Dakota durch die Tür zu. »Komm, Süße.«
Sie verabschiedete sich von Mrs. Valdez und kam angehüpft. Ich nahm sie an die Hand. Bevor ich die Eingangstür öffnete, drehte ich mich noch einmal zu Quinn um. »Ich schreib dir ’ne Nachricht, wenn ich ihn habe.«
Die Fahrt nach Yellow Spring, West Virginia, würde rund vierzehn Stunden dauern, also sollte ich kurz vor Mitternacht dort ankommen, wo Merv JT festhielt. Selbst bei wenig Verkehr würde ich für den Trip hin und zurück an die zwei Tage brauchen. Vorher musste ich noch Verpflegung und Klamotten zum Wechseln holen, außerdem Krista überzeugen, ihre Reise zu verschieben und sich um Dakota zu kümmern.
Unser Zuhause ist eine Zweieinhalbzimmerwohnung im Clearwater-Village-Komplex. In der Anlage wohnen Dauermieter, keine Feriengäste, und die Nachbarschaft ist für den Preis in Ordnung. Dennoch fielen mir auf dem Weg in den zweiten Stock einige frische Zigarettenkippen auf dem Absatz der Betontreppe auf. Vermutlich hatte dort mal wieder Jamie-Lynns halbwüchsiger Sohn mit seinen Freunden abgehangen. Nach meiner Rückkehr würde ich mit ihnen reden.
Vom Treppenhaus aus ist unsere Wohnung die zweite, direkt neben Kristas. Ihre Jalousien waren unten, kein gutes Zeichen. Ich klingelte trotzdem und betete, dass sie zu Hause wäre.
Vergebens. Vielleicht war sie nur einkaufen, so unwahrscheinlich das vor einer längeren Reise auch war. Ich wartete.
Nichts. Während Dakota noch einmal auf die Klingel drückte, schloss ich bei uns auf, erst das Sicherheitsschloss, dann die Türriegel oben und unten. Ich stieß die Tür auf und lauschte.
Da fiel mein Blick auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Es musste während unserer Abwesenheit unter der Tür durchgeschoben worden sein. Ich faltete es auseinander und las. Shit. Ich drehte mich zu Dakota um. »Bringt nichts, Süße. Sie ist nicht da.«
Dakota sah mich enttäuscht an. »Dann kann ich also nicht bei ihr bleiben?«
»Leider nein.« Krista schrieb, dass sie die nächsten drei Wochen bei ihrer Familie verbringen würde, und bat mich, ihre Pflanzen zu gießen.
»Und deine Arbeit, Mama?«
Verdammt gute Frage. Es gab niemanden, dem ich Dakota sonst anvertrauen würde – keine Freunde und erst recht niemanden aus meiner Familie. Den Auftrag hatte ich bereits angenommen. Ein Rückzieher würde mich in einem ziemlich schlechten Licht dastehen lassen, außerdem würde ich Bailey damit nur neue Munition für seine Sticheleien liefern. Vor allem aber müsste ich die fünfzehntausend Dollar abschreiben, ohne die Dakotas Behandlung nicht weitergehen konnte.
Mir fiel wieder ein, was Quinn gesagt hatte: Nimm sie mit, du hast doch eine Transportzelle. Die hatte ich, aber wenn ich Dakota mitnahm, würde sie unweigerlich JT kennenlernen – den Mann, der mein schlimmstes, dunkelstes Geheimnis kannte und das Leben zerstören konnte, das ich uns hier in Florida aufgebaut hatte. Den Mann, der niemals von Dakota erfahren sollte, das hatte ich mir geschworen. Ich ertrug den Gedanken nicht, dass er die Wahrheit herausfinden würde. Aber was hatte ich für eine Wahl? So oder so war sie in Gefahr. Ich lächelte gezwungen und streckte ihr die Hand entgegen. »Ich weiß es nicht, Kleines.«
Dakota löste sich von Kristas Tür und kam zu mir, schob ihre Hand in meine. Sah mich aus ihren großen blauen Augen an: »Ich könnte dir helfen.«
Ich dachte an die erste Zeit, als die Krankheit bei ihr ausgebrochen war. An die schlaflosen Nächte an ihrem Bett im Krankenhaus, an die ganzen Medikamente, die in ihren geschwächten Körper gepumpt worden waren, an ihre Schmerzen und meine Machtlosigkeit. Mit der Angst zu leben war nie leichter geworden. Selbst als es ihr wieder besser ging, hatten die Ärzte nur von einer Remission gesprochen und gesagt, dass der Krebs jederzeit erneut ausbrechen könne. Bisher war das nicht passiert, aber trotzdem hielt ich immer noch Ausschau nach dem kleinsten Anzeichen.
Meine Entscheidung stand fest. JT war zu vielem fähig, aber niemals würde er einem Kind etwas antun. »Weißt du was, Schatz? Dieses eine Mal könntest du vielleicht wirklich mitkommen.«
»Echt?« Dakota strahlte. Sie umarmte mich, dann schlüpfte sie durch den Spalt zwischen mir und Türrahmen. »Das wird super. Ich mach uns ein Picknick.«
»Stopp!« Meine Stimme klang strenger als gewollt, auch wenn Dakota nichts dafürkonnte. Meine Angst ging mir an die Nieren. Die Angst, ob es die richtige Entscheidung war, und die Angst, JT nach so vielen Jahren wiederzusehen. Die Angst vor der Erinnerung daran, was ich – und was er – gemacht hatte. Die Angst davor, noch einmal die furchtbare Sache mit Sal durchleben zu müssen.
Ich versuchte zu lächeln und hätte es sogar fast geschafft. Zwang mich zu einem heiteren Tonfall. »Die Sneaker, Schatz.«
Sie trippelte zurück zur Tür, streifte ihre Turnschuhe ab und stellte sie ordentlich nebeneinander auf die Matte unter den beiden Metallhaken für unsere Jacken. Sie schaute betreten hoch zu mir. »Tut mir leid, Mama.«
Ich lächelte – ein echtes Lächeln diesmal. »Na los, und jetzt bereitest du unser Picknick vor.«
Unsere kleine Wohnung war vielleicht nichts Besonderes, trotzdem achtete ich auf Sauberkeit. Ich hatte sie für eine niedrige Miete bekommen, weil beim Hurrikan ein Jahr zuvor das Dach beschädigt worden war. Es war ausgebessert worden, aber das halbe Zimmer hatte schlimm ausgesehen, voller großer Wasserflecke, wo es reingeregnet hatte und man die feuchten Wände einfach hatte trocknen lassen. Aber das hatte ich wieder hingekriegt und den kleinen Raum mit ein paar Dosen Farbe und ein wenig Schweiß in Dakotas Zimmer verwandelt. Die hartnäckigsten Flecken hatte ich mit fröhlichen Bildern verdeckt und das Zimmer mit zwei süßen Perlenlampen und lila Vorhängen aus einem Secondhandladen gemütlich eingerichtet. Nach zehn Monaten war die Wohnung zu einem Zuhause geworden, anders als das Loch davor. Hoffentlich würde ich sie mir weiterhin leisten können.
Ich legte meine Tasche und die Akte von CF Bonds auf den Tresen der offenen Küche und ließ meine Schlüssel in die blaugrüne Schale fallen, die wir in Celebration auf dem Straßenmarkt gefunden hatten. Neben der Schale thronte Dakotas Jahresabschlussprojekt in Naturwissenschaft: ein Vulkan aus Pappmaschee, der beim Ausbruch rot glühte und eine eindrucksvolle Dampfwolke ausstieß. Dakota hatte wochenlang an den elektrischen Schaltkreisen und der Fernbedienung gebastelt. Keine Frage, sie hatte sich den ersten Preis redlich verdient.
Ich hielt den Blick auf das schlafende Modell gerichtet und widerstand der Versuchung, die von der Akte daneben – oder vielmehr dem Polizeifoto darin – ausging. Ich wollte nicht an JT denken. Warum einem Menschen nachtrauern, den man seit Jahren nicht gesehen hat? Sentimentale Gefühle würden mir nicht helfen, Miete und Krankenhausrechnungen zu bezahlen. Ich musste praktisch denken, mich konzentrieren: Hol ihn ab, bring ihn nach Clermont zurück, und liefere ihn bei der Polizei ab. Fertig.
Dakota suchte im Kühlschrank das Essen für uns zusammen und kommentierte ihre Auswahl, während sie die Kühlbox bepackte. »… Ein paar Erdnussbutter-Törtchen, den Kirschjoghurt hier und einmal Cheesestrings …«
»Und die Pfirsiche und einmal Salat«, sagte ich, holte die Sachen aus dem obersten Fach und packte sie auf den Joghurt.
Sie verzog das Gesicht und nahm den Plastikbeutel mit dem Salat wieder heraus. »Salat, Mama? Ehrlich?«
Ich nahm ihr den Salat ab und legte ihn zurück in die Kühlbox. »Ehrlich. Ist gesund.«
Dakota seufzte dramatisch. Sie öffnete das Eisfach, holte vier Kühlakkus heraus und platzierte sie an den Seiten der Kühlbox. »Ich finde, wir sollten Eis mitnehmen.«
»Schatz, das Eis wird schmelzen.«
Sie holte vier kleine Eisbecher aus dem Gefrierfach. »Nein, wird es nicht. Ich tue es direkt neben die Kühlakkus.«
Ich nickte. »Also gut. Und jetzt los, pack deine Tasche.«
Während sie in ihr Zimmer flitzte, öffnete ich den Schrank unter der Spüle und holte eine Metallkiste heraus. Ich stellte die Zahlenkombination ein und sah meine Ausrüstung durch. Ich erwartete keinen Ärger. JT kannte das Geschäft, und wenn er sich von Bailey hatte aufspüren und von Merv festsetzen lassen, dann wollte er wohl gefunden werden, jede Wette. Dennoch wäre es einfach nur dumm, unvorbereitet loszuziehen.
In der Kiste steckte meine braune Ledertasche, abgegriffen, aber praktisch. Meine Allzeit-bereit-Tasche, die ich hatte, seit ich im Business war. Ich holte sie raus, öffnete den Reißverschluss des abgetrennten vorderen Fachs und ging den Inhalt durch: mein Schultergurt aus Leder, zwei Dosen extrastarkes Pfefferspray, drei Paar Plastikhandfesseln, eine Rolle mit Zwanziger-Scheinen – insgesamt zweihundert Dollar, meine eiserne Reserve, die ich ohne diesen Job dem Krankenhaus als Geste des guten Willens angeboten hätte –, und mein X2-Taser. Das war im Grunde alles, was ich brauchte.
Ganz unten in der Kiste lag meine Wesson Commander Classic Bobtail. Ich betrachtete die Pistole lange und dachte daran, dass mein Lehrmeister mir immer gepredigt hatte, in unserem Geschäft würde nur ein Idiot ohne Waffe losziehen.
Ich streckte meine Hand nach der Pistole aus. Meine Finger begannen zu zittern, erst ganz leicht, dann immer unkontrollierter, je näher meine Fingerspitzen dem Holzgriff kamen. Ich konnte es nicht. Immer noch nicht. Auch nach fast zehn Jahren hatten die Bilder jener Nacht nichts von ihrer Kraft verloren. Mich fröstelte. Um die Erinnerung zu verdrängen, kniff ich die Augen zusammen. Es brachte nichts. Von einem Moment zum anderen fühlte ich mich dorthin zurückversetzt und erlebte alles noch einmal.
Ich sehe das Blut. Es quillt aus ihrer Brust, das Rot breitet sich in dem rosa Stoff ihres Shirts aus, und eine Lache bildet sich auf dem Boden. So viel Blut, viel zu viel, nicht zu stoppen. Ich muss es versuchen, muss alles geben. Presse meine Fäuste auf die Wunde. Sie liegt auf dem Rücken, das bleiche Gesicht zum Himmel gerichtet, ihr Blick geht ins Leere. Ich glaube, dass ich weine, aber ich kann nur dieses andere Geräusch hören, ein Keuchen und Röcheln. Sie versucht etwas zu sagen, schafft es nicht. Versucht zu atmen. Schafft es nicht.
Ich öffnete die Augen und riss die Hand von der Pistole zurück. Richtete mich auf, hielt mich schwer atmend an der Arbeitsfläche fest. Ich musste mich beherrschen, meine Panik überwinden. Diesmal war es anders als sonst. Dakota würde dabei sein. Ich musste sie beschützen.
Ich nahm das Geschirrtuch vom Haken neben der Spüle und faltete es einmal. Dann beugte ich mich hinab, nahm meine Tasche aus der Kiste und öffnete den Reißverschluss des Seitenfachs. Ich atmete tief durch, und bevor ich noch länger darüber nachdenken konnte, wickelte ich die Pistole und eine Schachtel Munition in das Geschirrtuch, packte das Ganze ein und zog den Reißverschluss wieder zu. Ich beruhigte mich damit, dass ich sie nur zur Vorsicht mitnahm, sie nicht verwenden würde. Wie hohl das klang: eine schlechte Lüge, mit der ich nicht einmal mich selbst hinters Licht führen konnte.
Ich rief Dakota in ihrem Zimmer zu: »Liebes, bist du fertig?«
»Gleich, Mama.«
Mit meiner Tasche in der Hand ging ich ins Schlafzimmer, wo ich sie auf die Patchwork-Tagesdecke des Bettes legte. Die Tasche war immer fertig gepackt, falls ich plötzlich losmusste, mit Klamotten und Wäsche zum Wechseln: praktische Sachen, keine Spitzenwäsche. Wofür auch? Weshalb also fragte ich mich jetzt, ob ich etwas Schickeres mitnehmen sollte? Ich machte zwei Schritte auf den Schrank zu, blieb stehen. Verflucht, es ging um einen Job, nicht ein Date! Ich rang noch einen Moment mit mir, dann öffnete ich die Tür, zog ein schwarzes Spitzenhöschen mit passendem BH aus dem Wäschefach und warf beides in die Reisetasche. Sei jederzeit bereit. Auch das war eine Regel meines Lehrers.
Ich ging rüber in Dakotas Zimmer, um nach ihr zu sehen. Sie saß auf dem rosafarbenen Teppich vor ihrem Bett und kramte Nagellackfläschchen aus ihrer Schminkbox hervor.
»Hey, Süße. Wie viele hast du da?«
»Fünf.«
»Meinst du, das reicht?«
Sie neigte den Kopf zur Seite. »Glaub schon. Vielleicht können wir uns gegenseitig die Nägel lackieren?«
Ich lächelte. »Das wäre toll, Schatz, aber ich werde die nächsten drei Tage ganz schön beschäftigt sein. Außerdem werden wir ziemlich viel Zeit im Auto verbringen. Kann sein, dass es ein bisschen langweilig wird.«
Dakota lächelte. »Egal. Ich will mit dir fahren, Mama. Sonst muss ich immer zu Hause bleiben, und du hast versprochen, dass wir in diesen Ferien mehr Zeit zusammen verbringen.«
Sie hatte recht. Ich hatte es versprochen. Allerdings war das vor der letzten Mahnung des Krankenhauses gewesen. »Okay, Süße, aber du musst mir auch etwas versprechen.«
»Und was?«
»Dass du genau das tust, worum ich dich bitte. Ohne Murren. Ich muss mich auf dich verlassen können.«
»So wie beim Aufpassspiel?«
Ich lächelte. Das Aufpassspiel hatte ich erfunden, um ihr beizubringen, wachsam zu sein, auf sich selbst achtzugeben. Ich wünschte ihr nicht, dass sie in dieselben Schwierigkeiten geriet wie ich als Kind. Aber wenn doch, sollte sie verdammt noch mal wissen, wie sie da wieder rauskam. »Genau, wie beim Aufpassspiel.«
Dakota sah mich mit ernster Miene an. »Versprochen, Mama.«
Ich nickte. »Also gut. Hast du deine Zahnbürste?«
Dakota wühlte in ihrem Rucksack und zog ihre lila Zahnbürste hervor. »Hier.«
»Sehr schön.« Ich nahm ihren Schlafsack von der dicken lila Rüschendecke und deutete mit dem Kopf auf den Rucksack. »Bist du fertig?«
Sie packte die Nagellackfläschchen in die Seitentasche ihres Rucksacks, warf ihn sich über die Schulter und lächelte mir zu. »Fertig.«
Ich sperrte die drei Schlösser der Wohnung ab, und wir gingen runter zum Parkplatz. Dakota summte vor sich hin, während sie immer zwei Stufen auf einmal nach unten sprang, als wären wir unterwegs in den Urlaub, nicht um einen Kautionsflüchtling abzuholen.
Ich konnte ihre Freude nicht teilen. Ich hatte den Job nur wegen des Geldes angenommen. Zugegeben, die Bezahlung war mehr als gut. Doch seit ich wusste, dass JT der Flüchtige war, nagten Zweifel an mir. Je mehr ich über den Fall nachdachte, desto unwohler wurde mir. Dem JT, den ich gekannt hatte, war es nur um Gerechtigkeit gegangen. Klar, Gerechtigkeit um jeden Preis, egal ob brutal oder legal. Aber er hatte immer zu dem gestanden, was er getan hatte. Sich aus dem Staub zu machen passte nicht zu ihm. Sollte er wirklich eine Straftat begangen haben, ohne sich den Folgen zu stellen, musste die Geschichte weit komplizierter sein, als Quinn, Bailey und die dünne Akte in meiner Tasche mir verrieten. Ich musste herausfinden, was ihn so verändert hatte.
Verflucht, ich hoffte nur, dass es nichts mit mir zu tun hatte.
Natürlich hätte ich mir überlegen können, was meine Neugierde anrichten würde. Aber in dem Moment hatte ich noch keine Ahnung, dass das neue Leben, das ich für mich und meine Tochter aufgebaut hatte, binnen vierundzwanzig Stunden in seine Einzelteile zerlegt werden würde.
3. Kapitel
Yellow Spring, West Virginia. Ein Nest irgendwo in der tiefsten Provinz, so weit weg von meinem Heimatrevier Florida, dass mich normalerweise keine zehn Pferde hierherbringen würden.
Wir hatten die neunhundert Meilen in dreizehn Stunden runtergerissen, was selbst für meine Verhältnisse schnell war. Allerdings hatte die Fahrerei mich ziemlich mitgenommen. Zum Glück waren wir fast am Ziel.
Nach dem, was seinem Bruder Bucky zugestoßen war, würde Merv ziemlich nervös sein und einen lockeren Abzugsfinger haben. Falls er also eine Wache aufgestellt hatte, musste ich die auf jeden Fall glauben lassen, dass ich allein kam. Auch wenn Dakota protestieren würde. Der sicherste Platz für sie war hinter den getönten Scheiben der mit allen Schikanen ausgerüsteten Transportzelle meines Pick-ups. Zusammengekauert in einer der Kunststoffsitzschalen wäre sie von außen nicht sichtbar, während ich sie durch die Plexiglasscheibe im Auge behalten konnte.
Das Navi zeigte noch drei Meilen an, als ich rechts ranfuhr. Es war kurz vor Mitternacht; dem letzten Zeugnis menschlichen Lebens waren wir vor mehr als einer halben Stunde begegnet. In einer scharfen Kurve waren meine Scheinwerfer über eine Lücke im Wald gestreift, und ich hatte eine alte, nachts geschlossene Tankstelle mit zwei Zapfsäulen und einem rostigen Hinweisschild entdeckt.
Der Motor des Silverados blubberte im Leerlauf, während ich mein Handy aus der Halterung am Armaturenbrett nahm und die Nummer der örtlichen Polizeistation wählte. Normalerweise arbeitete ich auf eigene Faust, doch in dieser abgelegenen Gegend erschien es mir ratsam, ein oder zwei Polizisten an meiner Seite zu haben. Falls die Situation eskalierte.
Die Leitung blieb stumm. Kein Signal. Verdammt.
Also musste ich es so wie immer machen und hoffen, dass es keine Probleme gab. Aber schließlich holte ich nur einen Gefangenen ab, den Merv in Verwahrung hatte. Um mich zu beruhigen, sagte ich mir, dass ich nur wegen Dakota so angespannt war. Nicht, dass mich das restlos überzeugt hätte. Seit Stunden hatte ich immer wieder versucht, Merv anzurufen. Sein Handy war ausgeschaltet. Vielleicht war so weit in den Bergen auch nur der Empfang schlecht. Aber auch unter der Festnetznummer hatte niemand abgenommen. Eigentlich sollte er auf meinen Anruf warten. Das gefiel mir überhaupt nicht. Es roch nach Ärger.
Ich sah Dakota an. »Ab nach hinten, Süße.«
Sie verdrehte die Augen. »Aber ich hasse den Käfig. Die Sitze sind so hart. Kann ich nicht einfach bei dir vorne …«
»Nein. Du hast versprochen zu tun, was ich dir sage.« Sie hatte auf der Fahrt kaum geschlafen, und wenn sie müde war, fing sie an zu quengeln.
»Also los. Bitte.«
»Darf ich dann Goldrush Galaxy auf deinem Telefon spielen?«
Sie durfte sich nicht langweilen. Ein maulendes Kind wäre nicht gut für meine Konzentration, und ohne Empfang nutzte mir das Handy sowieso nichts. Ich nahm es vom Ladegerät und gab es ihr. »Klar. Aber nur ohne Ton, okay?«
Während sie nach hinten kletterte, holte ich meine Tasche aus der Kiste unterm Beifahrersitz. Ich nahm den Schultergurt, zog die Jacke aus und legte die Riemen an. Routinemäßig ging ich meine Ausrüstung durch: Plastikfesseln, Taser, Pfefferspray. Die Pistole ließ ich in der Tasche. Zufrieden streifte ich meine Jacke wieder über, drehte mich um und verriegelte die Plexiglasscheibe zwischen Dakota und mir.
Durch die Trennscheibe kam ich mir auf den letzten Meilen wie in einer Einzelzelle vor. Nur mein Radio leistete mir Gesellschaft. Die klassische Countrymusik mit den sentimentalen Texten, den Gitarren und dem ganzen Mist erschien mir irgendwie passend. Außerdem bekam ich in dem dichten Wald keinen anderen Sender rein. Also lauschte ich auf den letzten Meilen den Klängen der Grand Ole Opry, während ich die Kurven der ramponierten Straße bergauf nahm und die Temperatur immer weiter sank. Die Dunkelheit, die verlorene Stimmung der Musik und meine Traurigkeit bei der Vorstellung, schon bald meinen Lehrer verhaften zu müssen, trugen alle ihren Teil dazu bei, dass ich plötzlich bei diesem Job mit jeder Menge Ärger rechnete.
Das letzte Stück verlief die Straße direkt neben einem breiten Gebirgsfluss. Endlich teilte mir mein Navi mit, dass ich mein Ziel erreicht hatte. Links von mir ging das angenagte Asphaltband in eine Böschung über, die steil sechs Meter nach unten zum Wasser abfiel. Der breite und flache Fluss hatte mehr Kraft, als man auf den ersten Blick denken mochte. So wie die weiße Gischt über die aus dem Flussbett ragenden Steine spritzte, musste die Strömung erbarmungslos sein. Es lief mir kalt den Rücken hinunter. Wie viele Menschen die wilde Schönheit des Wassers wohl schon ins Verderben gelockt hatte?
Die Ranch zu meiner Rechten sah aus wie jedes beliebige Gehöft in den Bergen. Nur dass das Äußere nicht immer die ganze Wahrheit erzählte. Mich befiel ein ungutes Gefühl, als würde mir die Kehle zusammengeschnürt, immer enger, bis mich eine Mischung aus Angst und Erregung erfasste. Ich sagte mir, dass es ganz einfach sein würde: Ich würde einen Kautionsflüchtling in Empfang nehmen und wieder zurückfahren. Einfach genug. Aber wieso war JT überhaupt hierhergekommen, so weit weg von seiner Heimat Georgia? Wollte er gefunden werden?
Ich stoppte und schnappte mir die Akte vom Armaturenbrett. Darin lag ein loses gelbes Blatt mit der Adresse: Yellow Rock Ranch, Yellow Spring. Die Handschrift war Quinns, akkurat, schmal, ökonomisch. Das Haus von Mervs Tante, hatte er gesagt. Und dass Merv JT dort in Gewahrsam halte. Nach einem Moment des Zögerns lenkte ich den Pick-up in die Zufahrt. Zeit, es hinter mich zu bringen.
Im Scheinwerferlicht sah ich, dass das ehemals weiße Holztor seine besten Zeiten hinter sich hatte: In den Scharnieren hängend wurde es für alle Ewigkeit von einem großen Feldstein offen gehalten. Ich fuhr weiter und holperte über die Zufahrt, die von dem passenden schmutzig-weißen Zaun gesäumt wurde. Ich nahm an, dass der Weg einmal gepflastert gewesen war, aber Wind und Wetter hatten die Steine unter einer Dreckschicht begraben. Das Gelände stieg zu unserer Linken an, während es rechts ein paar Hundert Meter weit abschüssig verlief.
Vor der Ranch standen zwei Fahrzeuge: ein Ford mit dem Kennzeichen MERV und ein schwarzer SUV. Konnte heißen, dass acht Leute drinnen waren, konnte aber auch einen Scheiß heißen. Auf dem Weg hinauf zum Haus waren mir hölzerne Pferdeställe aufgefallen, genügend Platz für noch mehr Autos. Von dem Hof ging eine undefinierbare, schwer zu fassende Energie aus. Irgendwie komisch.
Ich parkte ein Stück weg vom Haus, stellte die Scheinwerfer aus und kletterte aus dem Pick-up.
Stille.
Kein Insektenchor wie bei uns zu Hause und auch kein Geräusch von Kühen, Pferden oder was für Tiere auch immer hier gehalten wurden. Auch vom Haus selbst kam nichts. Das war nicht normal. Meine Kehle schnürte sich noch mehr zusammen.
Ich schob meine Handtasche unter den Fahrersitz und wisperte Dakota mit gesenktem Kopf zu: »Pass auf, dass dich niemand sieht.«
Ich verriegelte den Silverado und steckte den Schlüssel in die Hosentasche. Mit einem Griff in die Jacke versicherte ich mich, dass ich Quinns Unterlagen dabeihatte. Sie gaben mir das Recht, das fremde Eigentum zu betreten und JT zu verhaften. Alles da, wo es sein sollte.
Bis zur Veranda waren es etwas mehr als zwanzig Schritte, schätzte ich. Also los. Beim sechsten Schritt war ich überzeugt, dass das Klacken meiner Stiefelabsätze auf dem knochenharten Boden einen Riesen aus dem Schlaf aufschrecken musste; beim elften spürte ich geradezu körperlich den Abstand zwischen meiner rechten Hand und dem X2-Taser, der unter meiner abgewetzten Lederjacke eng am Körper anlag. Beim siebzehnten Schritt hörte ich sie.
Auch wenn ich kein Greenhorn mehr war, wurde die ganze Situation durch Dakota sehr viel komplizierter.
Ich verlangsamte meine Schritte. Spitzte die Ohren. Zählte drei Stimmen, alle drei männlich. Keine davon JTs. Beim zwanzigsten Schritt bemerkte ich, dass das große Fenster im Vorderzimmer offen stand, sodass nur das Fliegengitter drinnen und draußen trennte. Ich bekam mit, dass die Männer Karten spielten, dass ein gewisser Gunner gerade gewann und dass er gerne schummelte. Den klirrenden Gläsern nach tranken sie außerdem und waren bestimmt nicht beim ersten Drink des Abends.
Ein Zweig zerbrach knackend unter meinem Stiefel. Ich erstarrte instinktiv, egal, wie überflüssig das war. Die Männer würden durch das offene Fenster sowieso mein Auto gehört haben. Aber es schien sie nicht zu interessieren. Entweder kümmerten sie sich aus Dummheit nicht um mich, hielten es aus Übermut nicht für nötig, oder ein vierter Mann schob Wache.
Ich wettete auf die ersten beiden Möglichkeiten. Klar, mit einer Wache in den Bäumen hätten sie mich den ganzen Weg von der Straße aus im Blick gehabt. Aber wieso? Schließlich wusste Merv, dass ich kam. Trotzdem kapierte ich nicht, weshalb die Männer nicht auf meine Ankunft reagierten. Am besten sollte ich einfach hineingehen und JT abholen.
Als ich auf die Veranda trat, knarzten die Dielen, und die Bretter bogen sich unter meinen Schritten. Ein schiefes Klirren erschreckte mich: nur ein Windspiel, das vom Gestänge einer alten Holzschaukel herabhing. Rechts von mir stand eine dreisitzige Bank, daneben zwei Hundeschüsseln aus Ton. In der einen waren algengrüne Wasserränder, in der anderen Fleischreste, deren Verwesungszustand keine Identifizierung mehr zuließ. Ein gutes Zeichen, zumindest für mich. Hunde würden diese Leute schon eine ganze Weile nicht mehr haben.
Ich öffnete das Fliegengitter und pochte dreimal an die innere Tür. Die Stimmen im Haus verstummten. Ich spürte das vertraute Sirren, mit dem mir das Adrenalin durch den Körper schoss. Begann, langsam und gleichmäßig zu zählen, im Rhythmus meines Atems.
Bei vierzehn wurde die Tür geöffnet. Ein junger Mann, vielleicht Mitte zwanzig, stand vor mir. Verblichene Jeans, kariertes Arbeitshemd, abweisender Gesichtsausdruck. Sein Blick tastete mich einmal von oben bis unten ab, dann noch einmal zurück, bevor er haarscharf rechts neben meinem Stiefel Tabaksaft auf die Holzdielen spuckte. »Was?«
Ich streckte mich ein wenig, das Gewicht gleichmäßig auf die Ballen beider Füße verteilt. »Ich bin Lori Anderson, Kautionsagentin von CF Bonds. Ich bin hier, um Robert James Tate festzunehmen.«
Er runzelte die Stirn. Ob er nun wusste, dass JT seine Frist hatte verfallen lassen oder nicht – auf jeden Fall hatte er nicht mit einer weiblichen Kopfgeldjägerin gerechnet. Da war er nicht der Erste.
Ich setzte meinen Stiefel auf die Türschwelle. »Ich bin mit Merv verabredet.«
Er kicherte. »Ach ja? Pech gehabt, würde ich sagen. Merv ist los, was vom Take-away holen.«
Nicht gerade glaubwürdig, schließlich stand sein Pick-up vor dem Haus. Wenn es allerdings stimmte, würde Merv eine Weile unterwegs sein, zumindest war ich an keinerlei Lokal vorbeigekommen.
Ich zog die Papiere aus der Tasche und schwenkte sie vor dem Bubi. »Ich habe Grund zu der Annahme, dass Tate unter dieser Adresse anzutreffen ist. Er hat in Florida eine Frist verstreichen lassen. Wenn Sie mich bitte durchlassen würden.«
Der Bubi regte sich nicht. Ich nahm sein Schweigen als Einladung und schob mich an ihm vorbei ins Haus. Er drückte sich mit dem Rücken an die Wand und ließ mich durch den Flur zum Vorderzimmer marschieren, während er mir wie ein anhänglicher Welpe hinterherdackelte. Trotz all seiner Mühe, die Semiautomatik in seinem Hosenbund vor mir zu verstecken, hatte ich sie entdeckt.
Noch während ich ins Zimmer trat, wusste ich, dass mein Gefühl richtig gewesen war und ein Kind hier definitiv nichts zu suchen hatte. Konnte sein, dass Quinn tatsächlich von einem einfachen Job ausgegangen war, aber jetzt fand ich mich in einer Schlangengrube wieder, für deren Bewohner die Bezeichnung »heimtückisch« viel zu harmlos war. Zwei wahre Brocken bauten sich vor mir auf. Nicht gerade der Menschenschlag, mit dem unsereins normalerweise Umgang hat. Unter ihren Gürteln steckten Messer, und in ihren Augen flackerte die Brutalität des Schnapses. Mit dem Bubi, der hinter mir mit seiner Semiautomatik den Ausgang blockierte, waren sie zu dritt. Nirgends eine Spur von Merv Dalton, dem Kopfgeldjäger, oder seiner alten Tante, deren Haus das hier doch sein sollte. Ich war das einzige Mädchen auf der Tanzfläche.
Nicht gerade angenehm, aber ich hatte einen Job zu erledigen. Gehen oder bleiben: Mein Gefühl sagte mir, dass diese Jungs mir weder das eine noch das andere leicht machen würden. »Ich suche nach einem Flüchtigen, Robert James Tate. Ich bin hier, um ihn festzunehmen.«
Der größte der drei kam einen Schritt näher. Auf seinem linken Unterarm prangte das Tattoo eines bluttriefenden Dolches und seine strähnigen braunen Haare steckten unter einem roten Bandana. »Ach ja?«
Ich erkannte die Stimme des Typen, der beim Kartenspiel gewonnen hatte, Gunner. Ich nickte. »Geben Sie mir Tate, dann bin ich weg.«
Hinter mir kicherte Bubi.
Der wieselgesichtige Mann neben Gunner starrte mich aus dunklen Augen an. Ein lüsternes Grinsen breitete sich auf seinen Lippen aus. »Wer wird denn so schnell gehen wollen?«
Mir war klar, dass er mich für leichte Beute hielt. Nur dass er sich da irrte. Ich wich nicht zurück. »Ich will keinen Ärger. Bloß Tate.«
Wieselgesicht strich sich über die Stoppeln auf seinem Schädel. »Meine Fresse, Mädchen. Mach dich mal ein bisschen locker.«
Die Männer kamen näher wie ein Rudel Kojoten, das seine Beute einkesselt. Ich ließ meinen Blick von einem zum andern wandern; keiner von ihnen schaute mir in die Augen. Sie taxierten mich wie ein Stück Vieh.
Meine Kehle schnürte sich noch mehr zusammen. Das hier nahm entschieden den falschen Verlauf. Unter den Blicken der Männer kam ich mir nackt vor. Sie waren Raubtiere, nichts anderes. Baileys Informationen mussten falsch sein. Auf gar keinen Fall wohnte eine ältere Witwe hier. Dem Haus fehlte jede Wärme, nackte Glühbirnen warfen ihr Licht auf rissige Gipswände. Dazu kam, dass Mervs Jungs JT offensichtlich nicht widerstandslos rausrücken wollten. Ich sah zwei Möglichkeiten, wie die Geschichte weitergehen konnte. Und mit Dakota im Auto mussten beide für mich gut ausgehen.
Gunner schaute an mir vorbei zu Bubi. Nickte.
Dann ging es schnell. Eifrig wollte der Kleine seinem Boss gehorchen und packte mich mit seinen schmierigen Fingern von hinten an den Schultern, riss mich an sich.
Ich stürmte rückwärts und brachte Bubi mit meinem Schwung aus dem Gleichgewicht. Er stolperte nach hinten. Vorteil bei mir. Ich wirbelte herum und knallte ihm die Unterseite meiner Faust an die Schläfe, direkt gefolgt von einer Rechten gegen die Kehle. Eins-zwei, und Bubi plumpste zu Boden, noch bevor er die Schläge überhaupt wahrgenommen hatte. Die Semiautomatik glitt ihm aus der Hand. Offensichtlich war er nicht der starke Macker, den er markiert hatte. Seinen aufgerissenen Augen und dem rasselnden Keuchen zu meinen Füßen nach war ihm das auch gerade aufgegangen.
Mit einem Tritt beförderte ich seine Waffe außer Reichweite und fuhr gleich wieder zu den anderen beiden Männern herum.
Gunner warf dem Kleinen einen ehrlich enttäuschten Blick zu. »Von einem scheiß Mädchen besiegt. Was für eine Blamage.« Er schaute zu dem wieselgesichtigen Mann. »Zeig dem Jungen, wie man’s macht.«
Wieselgesicht stürzte auf mich los. Ich wehrte seinen Angriff mit dem linken Unterarm ab, schlug ihm in den Magen. Er stöhnte, stürmte aber weiter vorwärts und versuchte, mich an den Haaren zu packen. An seinem linken Daumen blitzte ein Totenkopfring auf. Ich täuschte links an und duckte mich rechts weg, doch er war zu schnell. Er riss mich an sich und wirbelte mich herum, presste mir von hinten seinen linken Unterarm an die Kehle, während er mich mit seinen Fettmassen erdrückte. Er stank nach ranzigem Schweiß und Tequila. »Bist ’ne ganz Mutige, was?«, knurrte er mir ins Ohr. »Ich liebe Frauen mit Mumm.«
Gunner lachte. »Scheint, dass sie noch nicht eingeritten ist.«
Wieselgesicht ließ seine freie Hand von meiner Hüfte nach oben gleiten, über meinen Bauch zu den Brüsten. Brutal kniff er mir in die Brustwarzen. »Dann wird es höchste Zeit.«
Niemals! Konzentration. Ich musste hier weg. Diese Männer durften nicht einmal in die Nähe von Dakota kommen. Ich atmete tief ein und trat so fest ich konnte nach hinten. Der Absatz meines Cowboystiefels landete genau an Wieselgesichts Kniescheibe. Ich hörte das Knacken, als der Knochen unter der Wucht des Trittes brach. Wieselgesicht heulte. Sein Würgegriff lockerte sich, löste sich aber nicht ganz.
Ich drehte mich nach links, schlug mein Kinn in seine Ellbogenbeuge und schob meine Hüfte seitwärts. Mit einem Aufwärtshaken rammte ich ihm meinen Ellbogen unter die Rippen. Noch während er zusammensackte, traf ihn mein zweiter Schlag zwischen den Beinen. Er wich zurück und belastete sein kaputtes Knie. Fehler. Ich hörte es knirschen und sah ihn wie eine gefällte Kastanie zu Boden krachen.
Das Blatt hatte sich zu meinen Gunsten gewendet: zwei von dreien erledigt, blieb noch einer.
Gunner, ganz offensichtlich der Anführer des Packs, grinste mich gelbzahnig an. Winkte mich heran. »Zeit, dass dir mal jemand scheiß Manieren beibringt.«
»Oder dir.«
Ich griff nach meinem X2-Taser. Zu langsam. Noch während ich am Holster rumfummelte, sprang Gunner auf mich zu und rammte mich mit der Schulter krachend zu Boden. Ich keuchte und wand mich, doch er beugte sich über mich und griff nach meinen Handgelenken.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: