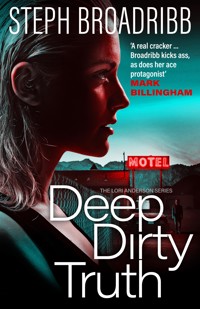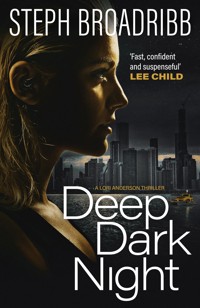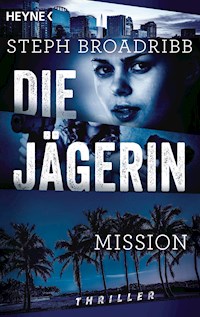9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lori-Anderson-Serie
- Sprache: Deutsch
Lori Anderson ist es endlich gelungen, ihre Familie wieder zu vereinen. Doch als Kopfgeldjägerin in Miami hat sie viele tödliche Feinde. Um in Frieden leben zu können, muss sie einen letzten Job annehmen: Lori hat 48 Stunden Zeit, um einen abtrünnigen Gangster im Zeugenschutzprogramm aufzuspüren. Gelingt es ihr, ist sie eine freie Frau. Scheitert sie, werden sie und ihre Familie sterben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
»Erneut gehe ich die Strecke durch, die wir von Dakotas Schule aus zurückgelegt haben, und konzentriere mich darauf, in welche Richtung wir auf dem Freeway gerade unterwegs sind. Ich denke an die Feinde, die ich mir als Kopfgeldjägerin gemacht habe, und an die Drohungen, die ich wegen meines Jobs erhalten habe.
Die Erkenntnis, wer hinter meiner Entführung stecken könnte, windet sich wie eine Schlange an meiner Wirbelsäule zu meinem Kopf empor. Ich balle meine Hände zu Fäusten und beiße hinter dem Klebeband auf die Zähne.
Ich habe die Gesichter der beiden Männer mit den kahl rasierten Schädel gesehen und weiß, wozu sie fähig sind. Falls die Männer tatsächlich für die Person arbeiten, die ich hinter der Sache vermute, dann ist das hier sehr viel schlimmer als eine Entführung. Wenn ich am Leben bleiben will, muss ich es schaffen, mich zu befreien. Muss vorbereitet sein. Nach einer günstigen Gelegenheit Ausschau halten. Denn eins ist sicher: Mit diesen Typen ist nicht zu spaßen.
Wenn alles nach ihren Vorstellungen läuft, werde ich das hier nicht überleben.«
Die Autorin
Steph Broadribb, geboren in Birmingham, hat ein Studium in Kreativem Schreiben von der City University London und eine Ausbildung zur Kopfgeldjägerin in Kalifornien absolviert. Heute lebt sie in Buckinghamshire.
Lieferbare Titel
Die Jägerin – Auftrag (1)
Die Jägerin – Mission (2)
Die Jägerin – Übergabe (3)
STEPH BROADRIBB
DIE JÄGERIN ÜBERGABE
Aus dem Englischen übersetzt von Frank Dabrock
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe Deep Dirty Trutherschien 2019 bei Orenda Books.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 04/2021
Copyright © 2021 by Steph Broadribb
Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Steffi Korda, Hamburg
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München,
unter Verwendung von Motiven von © FinePic®, München
Satz: Fotosatz Amann, Memmingen
ISBN: 978-3-641-25651-7V001
www.heyne.de
Im Gedenken an meinen wunderbaren Dad – Jim Broadribb
Ich vermisse dich jeden Tag.
In ewiger Liebe.
1
Ich habe es nicht kommen sehen. Die Sache traf mich völlig unvorbereitet. Das ist die reine Wahrheit.
Inzwischen haben wir eine gewisse Routine entwickelt –JT, Dakota und ich. Wir leben zusammen in meiner Zweizimmerwohnung im Clearwater-Village-Komplex und spielen unsere Version von Vater-Mutter-Kind. Das fällt uns zwar immer noch ein wenig schwer, weil jeder von uns etwas Zeit braucht, um im täglichen Miteinander seinen eigenen Rhythmus zu finden. Doch allmählich fühlen sich die häuslichen Aktivitäten richtig gut, sogar irgendwie normal an. Allerdings hätte ich wissen müssen, dass hinter der nächsten Ecke etwas Böses lauert, dass das Unheil über uns hereinbrechen und alles zunichtemachen würde.
Denn genau das passiert, wenn es in deiner Vergangenheit ein schmutziges Geheimnis gibt und Old Man Bonchese – der Mafiaboss von Miami – ein Kopfgeld auf dich aussetzt, weil er herausgefunden hat, was du vor zehn Jahren getan hast. Dass du einen verlogenen, hinterhältigen und blutrünstigen Gangster getötet hast. Thomas »Tommy« Ford, diesen gewalttätigen Dreckskerl von einem Ehemann.
Zunächst glaubte die Mafia, JT sei dafür verantwortlich gewesen. Deswegen wäre er vor zwei Monaten fast gestorben. Er trug mehrere Stichverletzungen, gebrochene Rippen und eine punktierte Lunge davon und erlitt einen Herzinfarkt. Aber er ist ziemlich robust. Eine echte Kämpfernatur. Und seine Genesung schreitet gut voran.
Doch die Mafia ließ die Angelegenheit nicht auf sich beruhen. Angeblich hatte sie neue Informationen bekommen und setzte alles daran, mich zur Strecke zu bringen. Sie erhöhten das Kopfgeld, sodass jedes zwielichtige, nichtsnutzige Arschloch der Meinung war, es könne sein Glück doch mal versuchen.
Ofensichtlich wartete die Mafia bis zum 19. September, um selbst die Initiative zu ergreifen. Wir begannen den Tag bei einem gemeinsamen Frühstück bestehend aus Bagels mit Frischkäse. Anschließend brachte ich Dakota zur Schule, und JT erledigte den Abwasch, bevor er zu seiner Physiotherapie aufbrach. Es schien ein ganz normaler Tag zu werden, genauso wie der Tag zuvor. Aber dann wurde unser Tagesablauf brutal unterbrochen. Um 08:29 Uhr an diesem Morgen ging alles den Bach runter.
2
Mittwoch, 19. September, 08:24
Vor der Schule herrscht Hochbetrieb, und da ich es nicht schaffe, mich mit meinem Jeep in die Haltezone zu quetschen, fahre ich ein Stück weiter, bis ich einen freien Platz gefunden habe. Ich werfe im Rückspiegel einen Blick auf Dakota und bringe den Schalthebel der Automatik in die Parkstellung. Sie beißt sich mit gerunzelter Stirn konzentriert auf die Unterlippe, während sie auf ihrem Handy irgendein angesagtes Game spielt.
»Los, Schätzchen. Du willst doch nicht zu spät kommen.«
Sie nickt, ohne aufzuschauen. Ich springe aus dem Wagen, renne zu ihrer Seite und öffne die Tür. Sie steckt das Handy in ihren Rucksack, und ich fordere sie mit einer Geste auf auszusteigen.
Sie macht ein verschämtes Gesicht, was meistens bedeutet, dass sie irgendetwas von mir will. Langsam löst sie ihren Sicherheitsgurt und nimmt im Zeitlupentempo ihren Rucksack. Dann räuspert sie sich. »Also, JT hat gesagt, dass er einverstanden ist, Mom, und du weißt doch, wie sehr ich auf die Tampa Bay Rays stehe.«
Ihr Begeisterung für die Tampa Bay Rays hat sie erst kürzlich entdeckt. Als JT meinte, dass sie nach den Yankees seine Lieblingsmannschaft seien.
Ich hole das Pappmaché-Modell von den Planeten des Sonnensystems, das sie für den Naturwissenschaftsunterricht gebastelt hat, aus dem Kofferraum. »Beeil dich, Süße.«
Sie lässt die Beine aus dem Jeep baumeln. Ihre Kniestrümpfe hängen schlabberig über die Fußknöchel, und obwohl ihre Schuhe neu sind, ist der rechte über dem großen Zeh bereits abgewetzt. »Also, darf ich?«
Die beiden haben in den letzten drei Wochen ständig davon geredet. JT will sich mit ihr im Tropicana Field ein Baseballspiel ansehen, und sie ist ganz wild darauf. Obwohl wir ihr noch nicht gesagt haben, dass JT ihr Vater ist, möchte ich natürlich, dass sie Zeit mit ihm verbringt, aber ich habe Angst, dass es noch zu früh sein könnte. Nicht wegen ihrer Beziehung – die ist bestens –, sondern wegen JTs Gesundheit. Er erholt sich immer noch von seinen Verletzungen, und auch wenn seine Blutergüsse inzwischen verblasst sind, ist er noch lange nicht wieder ganz bei Kräften. Wenn er längere Zeit steht, wird er hundemüde, und er kann zu Fuß noch keine größeren Strecken zurücklegen.
»Vielleicht, Schätzchen.«
Dakota hockt sich auf die Sitzkante, streicht sich ihre erdbeerblonden Strähnen aus dem Gesicht und schaut durch ihre langen Wimpern zu mir hoch. »Warum nur vielleicht? Warum nicht ja?«
Ich lächle. Sie ist wirklich hartnäckig. Zielstrebig wie ihre Mutter. »Wie wär’s mit bald?«
Sie runzelt die Stirn. »Das ist wohl besser als ein Nein.«
Ich lache. »Allerdings. Und jetzt zisch ab.«
Dakota grinst und hüpft aus dem Jeep. Sie wirft sich ihren Rucksack über die Schulter, nimmt ihr Modell und trottet Richtung Schultor. Ich stehe, gegen den Kofferraum gelehnt, im Sonnenlicht auf dem Gehweg und sehe dabei zu, wie sie sich den anderen Kindern anschließt, die in die Schule eilen. Sie wurde entführt, hat Menschen sterben sehen und musste um ihr Leben fürchten. Kein neunjähriges Mädchen sollte so etwas erleben. Doch obwohl sie letztes Jahr so viel durchgemacht hat, scheint sie glücklich zu sein.
Als Dakota das Schultor erreicht, dreht sie sich noch einmal um, winkt mir zu und betritt dann den Hof.
Während ich ihr hinterherschaue, hoffe ich, dass die seelischen Wunden langsam verheilen. Die Schuldgefühle, dass ihr all das meinetwegen, wegen meines Jobs, passiert ist, lasten immer noch schwer auf mir, und ich werde mir das nie verzeihen. Aber ich muss das jetzt hinter mir lassen. Weiter machen und den Blick nach vorn richten. Wie wir alle.
In diesem Moment legt hinter mir auf der Straße ein Fahrzeug eine Vollbremsung hin und reißt mich aus meinen Gedanken. Als ich höre, wie eine Tür aufgeschoben wird, werfe ich einen Blick über die Schulter und erkenne flüchtig einen Lieferwagen mit getönten Scheiben, der vor dem Heck meines Jeeps zum Stehen gekommen ist und mich zugeparkt hat.
Ich drehe mich um. »Hey, was machen Sie …?«
Zwei Männer mit kahl rasierten Schädeln springen aus dem Wagen und mehrere Hände ziehen mich nach hinten. Ihre Finger bohren sich in meine Schultern und Hüften, umklammern meine Arme. Ich setze mich heftig zur Wehr, aber die beiden Männer zerren mich von den Beinen, sodass ich nicht richtig zuschlagen kann.
»Wenn du weiter so rumhampelst, bist du einfach nur müde, wenn du stirbst«, sagt eine tiefe, bedrohliche Stimme neben meinem rechten Ohr.
Ich schenke der Warnung keine Beachtung, und während die Männer mich über den Asphalt schleifen, kreische und brülle ich und halte verzweifelt Ausschau nach Hilfe. Aber da ist niemand; die anderen Eltern stehen hinter dem Schultor außer Sichtweite und bekommen nichts mit. Ich bin zu weit weg.
»Lasst mich gehen … Nehmt eure dreckigen Hände von …«
Ein Stück Klebeband wird auf meinen Mund geklatscht, meine Rufe verstummen und die unterdrückten Schreie und Flüche hallen durch meinen Kopf. Ein raues Händepaar zieht mir eine schwarze Kapuze über den Kopf, und um mich herum wird es dunkel.
Dann werde ich hochgehoben und rückwärts fortgetragen. Ich wehre mich immer noch, schlage um mich, stemme mich gegen die Männer. Doch sie sind zu zweit und zu stark, sodass ich das Nachsehen habe. Wenige Sekunden später lassen sie mich wieder los, und die Schwerkraft befördert mich auf den Boden des Lieferwagens. Schmerzen jagen mir durch Hüfte, Knie und Ellbogen. Ich knalle mit dem Gesicht gegen etwas Hartes und höre meinen Kiefer knacken. Schmecke Blut in meinem Mund.
Die Tür wird zugeschoben, der Motor heult auf und wir setzen uns in Bewegung.
Das Ganze hat weniger als fünfzehn Sekunden gedauert.
Bestimmt hat niemand gemerkt, dass ich verschwunden bin.
3
Mittwoch, 19. September, 08:31
Panik hat noch nie geholfen, und ich werde nicht zulassen, dass sie die Oberhand gewinnt.
Während mein Herz im Brustkorb heftig hämmert, verschaffe ich mir einen Überblick über meine Situation. Ich liege auf dem Rücken – keine günstige Position, denn mein Bauch ist ungeschützt, sodass lebenswichtige Organe leicht verletzt werden könnten. Also krümme ich meinen Rücken und wälze mich herum.
Doch meine Entführer haben etwas anderes im Sinn. Einer von ihnen packt mich und schleift mich über den Boden des Lieferwagens. Ich trete mit voller Wucht blind um mich. Spüre, wie mein Fuß irgendetwas trifft, höre ein Stöhnen. Aber der Moment des Triumphes währt nicht lange. Erneut spüre ich die Hände auf meinem Körper. Sie rollen mich auf die Seite und halten mich fest. Meine Arme werden auf den Rücken gezerrt, und ich fühle, wie mir Klebeband um Handgelenke und Fußknöchel gewickelt wird. Anschließend werde ich an allen vieren zusammengebunden. Die beiden Männer gehen dabei schnell, routiniert und systematisch vor. Offensichtlich tun sie das nicht zum ersten Mal.
Also höre ich auf, mich zu wehren. Um meine Kräfte zu schonen. Aber ich werde ganz bestimmt nicht aufgeben. Ich sammle Informationen; jedes Geräusch, jede Unebenheit in der Straße, jede Steigung liefert mir einen Hinweis auf den Ort, zu dem sie mich bringen.
Ich schließe die Augen. Lausche angestrengt. Zunächst höre ich nur das Pochen meines Herzschlags, der laut wie Pistolenschüsse in meinen Ohren dröhnt, aber als ich mich zwinge, langsamer zu atmen, nehme ich weitere Geräusche wahr.
Das Knattern des Auspuffs und die voll aufgedrehte Klimaanlage. Außerdem leise Stimmen im vorderen Bereich. Ich verstehe zwar nicht, was sie sagen, aber ich kann zwei Männer identifizieren. Ich frage mich, wie viele Leute sich noch im Wagen befinden, während ich meinen Körper über den Boden des Lieferwagens wälze und versuche, mich mit dem Ellbogen nach oben zu stemmen. Doch ein raues Händepaar drückt meine Schultern und Hüften brutal nach unten. Ich knalle mit dem Gesicht auf den Boden und spüre auf der Stirn einen stechenden Schmerz.
Eine weitere Hand presst mich nach unten, und dieselbe Stimme wie eben brummt mir ins Ohr: »Beruhig dich, du Schlampe.«
Mir gefällt zwar sein Tonfall nicht, aber jetzt weiß ich Bescheid: Bei mir im Heck sind zwei Männer, und zusammen mit den beiden vorn sind es insgesamt vier Personen. Man hat vier Männer geschickt, um eine Frau zu entführen!
Das bedeutet, dass diese Leute auf Nummer sicher gehen.
Der Wagen hält an, vermutlich an einer Kreuzung, und das Gebläse der Klimaanlage wird von einem Song übertönt. Die Stimme von Miley Cyrus dringt von links zu mir, offensichtlich aus einem anderen Fahrzeug. Dann heult der Motor des Lieferwagens laut auf, wir biegen nach links ab, und die Musik verstummt wieder.
Ich muss mich orientieren, was ohne sichtbare Anhaltspunkte ziemlich schwierig ist. Ich rufe mir die Strecke, die wir bisher gefahren sind, ins Gedächtnis und gehe jede Kurve durch, die wir seit der Abfahrt von Dakotas Schule genommen haben. Obwohl ich den Eindruck habe, dass wir im Kreis fahren, bewegen wir uns wahrscheinlich Richtung Nordosten. Raus aus der Stadt. Fragt sich nur, warum.
Momentan gibt es keine Möglichkeit, das herauszufinden.
Meine Entführer geben keinen Laut von sich. Die Fahrbahn ist eben, es gibt kaum Kurven. Der Lieferwagen fährt in einem gemäßigten Tempo, sodass er vermutlich keine Aufmerksamkeit erregt.
Ich konzentriere mich auf meinen Atem. Versuche, den muffigen Gestank der Kapuze zu ignorieren, den Knebel aus Klebeband und den Schweiß, der an meinem Rücken runterläuft. Ich vertreibe meine Gedanken an Dakota und JT, und die Angst, dass ich sie nie wiedersehe werde. Im Wagen sind zwar vier Männer, aber ich bin nicht so leicht kleinzukriegen. Ich werde einen geeigneten Moment abwarten, um mich zur Wehr zu setzen.
Ein paar Minuten später bremst der Lieferwagen ab, und wir werden langsamer.
Als mich eine Hand am Nacken packt, zucke ich zusammen. »Keinen Mucks und keine Tricks.«
Wir kommen zum Stehen, und ich höre das Summen einer Fensterscheibe, die heruntergelassen wird, dann das Klimpern von Münzen auf Metall. Die Hand in meinem Nacken drückt jetzt fester zu.
»Einen schönen Tag«, sagt eine Frau außerhalb des Lieferwagens. Nach einer kurzen Pause ertönt ein elektronisches Piepen. Dann setzt sich der Wagen erneut in Bewegung. Das Fenster wird wieder hochgefahren, und die Hand lässt meinen Hals los.
Ich weiß, wo wir sind. Die Frau saß in einem Kassenhäuschen. Wir haben gerade eine Mautstelle passiert.
Meine Entführer haben bar bezahlt. Sie besitzen also keine Karte, mit der sie die Fahrspur für die elektronische Gebührenabbuchung benutzen können, was bedeutet, dass sie wahrscheinlich nicht von hier sind.
Als der Lieferwagen wieder seine Fahrtgeschwindigkeit erreicht hat, wird mir klar, dass wir uns jetzt auf dem Freeway und nicht mehr in Clermont befinden.
Das hier ist kein Raubüberfall.
Und auch keine Vergewaltigung, jedenfalls noch nicht.
Was zum Henker wollen diese Typen von mir?
Erneut gehe ich die Strecke durch, die wir von Dakotas Schule aus zurückgelegt haben, und konzentriere mich darauf, in welche Richtung wir auf dem Freeway gerade unterwegs sind. Ich denke an die Feinde, die ich mir als Kopfgeldjägerin gemacht habe, und an die Drohungen, die ich wegen meines Jobs erhalten habe.
Die Erkenntnis, wer hinter meiner Entführung stecken könnte, windet sich wie eine Schlange an meiner Wirbelsäule zu meinem Kopf empor. Ich balle meine Hände zu Fäusten und beiße hinter dem Klebeband auf die Zähne.
Ich habe die Gesichter der beiden Männer mit den kahl rasierten Schädel gesehen und weiß, wozu sie fähig sind. Falls die Männer tatsächlich für die Person arbeiten, die ich hinter der Sache vermute, dann ist das hier sehr viel schlimmer als eine Entführung. Wenn ich am Leben bleiben will, muss ich es schaffen, mich zu befreien. Muss vorbereitet sein. Nach einer günstigen Gelegenheit Ausschau halten. Denn eins ist sicher: Mit diesen Typen ist nicht zu spaßen.
Wenn alles nach ihren Vorstellungen läuft, werde ich das hier nicht überleben.
4
Mittwoch, 19. September, 12:54
Wir fahren rechts vom Highway ab, die Räder ruckeln über eine holprige Fahrbahn und das Knattern des Auspuffs wird lauter. Als ich mit den Rippen gegen den Boden knalle, zucke ich erneut zusammen. Die Männer vorn wechseln leise ein paar Worte. Offensichtlich haben wir unser Ziel erreicht.
Einige Minuten später kommen wir zum Stehen. Die Türen werden geöffnet, heiße Luft strömt ins Wageninnere. Ein paar andere Stimmen rufen irgendetwas, dann spüre ich, wie mich mehrere Hände an den Knöcheln packen. Ich werde über den Boden des Lieferwagens gezerrt und draußen auf die Erde geworfen.
Man durchschneidet das Klebeband an meinen Armen und Beinen, aber Handgelenke und Knöchel bleiben gefesselt. Als man mich auf die Beine hievt, spüre ich, wie das Gefühl in meine Gliedmaßen zurückkehrt. Meine Muskeln beginnen zu kribbeln, und die Nerven, die gefühlt seit Stunden abgestorben sind, erwachen wieder zum Leben. Mein Mund ist ausgedörrt wie ein Gully in der Trockenzeit. Ich könnte dringend etwas zu trinken vertragen.
Aber ich bekomme nichts. Meine Entführer nehmen mir weder den Knebel noch die Kapuze ab. Ich bin immer noch hilflos. Desorientiert. Die Männer bleiben vorsichtig und gehen kein Risiko ein. Da ich durch die Kapuze nichts erkennen kann, weiß ich nicht, wo sich die beste Fluchtmöglichkeit bietet.
»Scheune zwei«, sagt ein Mann. Er hat einen leichten New Yorker Akzent. Ich durchforste mein Gedächtnis, doch ohne Ergebnis. »Kommt zum Haus, wenn ihr fertig seid.«
Ich hole tief Luft. Wenn ihr fertig seid – was soll das heißen?
Die Hände, die meine Arme umklammern, heben mich hoch und zerren mich über den Boden. Ich würde mich am liebsten zur Wehr setzen, aber das wäre nicht klug. Ich muss meine Kräfte schonen, den richtigen Moment abpassen. Also entspanne ich mich, sodass die Männer noch schwerer zu tragen haben. Ich muss einen geeigneten Augenblick abwarten und hoffe inständig, dass ich dazu noch Gelegenheit bekomme. Der Typ zu meiner Rechten brummt, dass ich schwerer sei, als ich aussehe, und der zu meiner Linken stöhnt zustimmend. Selbst durch die Kapuze kann ich sein billiges Rasierwasser riechen; es hat eine säuerliche Note, und er hat viel zu viel davon aufgetragen. Es verströmt den Geruch eines unbedeutenden Fußsoldaten, der einen Stil anstrebt, der ihm fremd ist.
Die beiden zerren mich weiter über den Boden.
In der Ferne höre ich das Dröhnen von Maschinen. Die Sonne, die hoch am Himmel steht, ist unglaublich heiß. Die Sonnenstrahlen brennen auf meiner Haut. Es ist vollkommen windstill, kein Lüftchen regt sich. Offensichtlich ist es kurz vor Mittag. Ich frage mich, ob JT sich inzwischen Sorgen macht.
»Hier lang?«, fragt der Typ mit dem Rasierwasser.
»Ja.«
Ich kann sie riechen, bevor ich sie höre. Der Geruch ist sehr viel penetranter und unangenehmer als der des Rasierwassers. Dann höre ich das Getrampel von Hufen auf vertrockneter Erde, und das Grunzen und Schnuppern wird lauter.
Schweine.
Ich spanne meinen Körper an und setze mich zur Wehr, während ich schwer schlucke. Wenn man mich in den Schweinestall wirft, bin ich erledigt. Mit der Kapuze und den Fesseln an Armen und Beinen habe ich gegen eine Horde hungriger Schweine nicht die geringste Chance, und ihren Lauten nach zu urteilen sind sie verdammt hungrig.
Der Typ rechts von mir beginnt zu lachen und versetzt mir mit dem Ellbogen einen Stoß in die Rippen. »Kannst du sie riechen, unsere kleinen Haustiere?«
Ich versuche, meinen Herzschlag zu beruhigen und logisch zu denken. Es wäre Schwachsinn, mich zu entführen und stundenlang durch die Gegend zu kutschieren, um mich dann an diese Tiere zu verfüttern. Wenn man mich hätte töten wollen, hätte ein Kopfschuss genügt. Die Männer spielen zwar ein Spielchen mit mir, aber ich glaube nicht, dass sie mich töten werden, jedenfalls nicht sofort. Ich gebe meinen Widerstand auf, zwinge meinen Körper, sich zu entspannen, und warte, was passiert.
Wir laufen, vorbei an den Schweinen, ein paar hundert Meter weiter. Kurz darauf merke ich selbst durch die Kapuze aufgrund des Lichtwechsels, dass wir uns vom Sonnenlicht in den Schatten begeben haben. Der Gestank der Schweine weicht dem lieblichen Duft von Heu. Offensichtlich befinden wir uns in einer Scheune.
Siebzehn Schritte später drehen die Männer mich herum und schubsen mich mit dem Rücken gegen einen Stützpfeiler. Das Holz ist rau, und die Splitter kratzen über meine Haut. Der Typ mit dem Rasierwasser hält mich aufrecht und drückt mich möglichst dicht gegen den Pfeiler, während der andere Mann mich festbindet. Diesmal benutzen sie ein Seil. Ich spüre, wie der Mann es mir eng um Hals, Taille und Beine schlingt. Meine Handgelenke und Fußknöchel sind immer noch gefesselt, die Kapuze lassen sie auf meinem Kopf.
Brummbär schlägt mir auf die Schulter. »Wir sehen uns später, Blondie.«
»Wenn du Glück hast«, fügt der Typ mit dem Rasierwasser hinzu.
Ich erwidere nichts, denn das Klebeband auf meinem Mund hindert mich daran. Ich höre, wie ihre Schritte sich entfernen und eine Tür zugeknallt wird. Dann bin ich allein.
Es dauert nicht lange, bis es ungemütlich für mich wird. Meine Muskeln fangen an zu brennen, weil ich mich nicht bewegen kann. Mein Schädel hämmert wie verrückt. Außerdem habe ich einen trockenen Mund und mir ist übel – ein sicheres Zeichen dafür, dass ich dehydriert bin.
Die Männer haben mich unglaublich fest angebunden. Ich betaste das Seil an den Stellen, die ich mit den Händen erreichen kann, aber dort sind keine Knoten, die ich lockern könnte, und das Klebeband an meinen Händen befindet sich zu weit oben, um einen Finger durchzustecken. Ich krümme die Knie und versuche, am Pfeiler nach unten zu rutschen, doch ich hänge fest; die Schlinge um meinen Hals bewegt sich nicht.
Da es sonst keine Möglichkeit gibt, bleibt mir nichts anderes übrig, als zu warten.
Mit der Zeit wird das Brennen in meinen Muskeln immer stärker. Die Temperaturen steigen weiter an, und der Schweiß läuft in Strömen an mir herunter, sodass meine feuchten Klamotten an der Haut kleben. Außerdem muss ich dringend pinkeln.
Aber es kommt niemand.
Ich blende meine Umgebung aus und lenke mich mit verschiedenen Erinnerungen von den Schmerzen ab. Ich denke daran, wie mein heutiger Morgen begonnen hat, und habe das Gefühl, das alles ist schon eine Ewigkeit her: wie ich an JT geschmiegt aufgewacht bin und das Licht durchs Fenster gefallen ist; sein schiefes Lächeln, als ich ihn mit einem Kuss geweckt habe; das Gefühl, ihn beim Sex unter der Dusche in mir zu spüren, während wir uns gleichzeitig eingeseift und schmutzige Dinge getan haben; wie JT, Dakota und ich danach zusammen gefrühstückt – Bagels mit Saft und Kaffee – und die beiden sich über das Tropicana Field unterhalten haben. Ich musste lächeln, weil sie so ungezwungen miteinander scherzten. JTs konzentrierter Gesichtsausdruck, als er versuchte, Dakota Zöpfe zu flechten; wie sie sich bei ihm bedankte, obwohl das Ergebnis, selbst wenn er sich größte Mühe gibt, stets unbeholfen und armselig aussieht. Wie ich darauf lachend zu ihm sagte, Übung macht den Meister, und er mich mit seinen blauen Augen völlig ernst ansah und sagte, er werde weiter daran arbeiten. Und wie ich in diesem Moment wusste, dass er nicht nur die Zöpfe meint.
In den zwei Monaten, die wir jetzt als Familie leben, haben wir uns nie irgendwelche Versprechen gegeben. Denn ein Versprechen ist nichts weiter als eine Enttäuschung auf Pump. Aber das heißt nicht, dass ich unserer Zukunft nicht mit Neugier und vielleicht sogar ein wenig Zuversicht entgegenblicke. Ich will uns eine Chance geben. Nach allem, was wir durchgemacht haben, sind wir uns das selbst schuldig.
Ich balle meine Hände zu Fäusten. Und beiße die Zähne zusammen.
Was auch immer passieren wird, eins weiß ich mit Sicherheit: Ich werde mich weigern, hier zu sterben.
5
Mittwoch, 19. September, 16:58
Ich komme unsanft wieder zu mir.
Ich muss würgen. Bin orientierungslos und kann nichts sehen. Ich versuche zu husten, doch meine Lippen sind verschlossen. Ich will mir an den Hals greifen, aber meine Hände bewegen sich nicht. Mein ganzer Körper ist taub, und meine Gliedmaßen fühlen sich schwer und merkwürdig an. Ich werde von Panik ergriffen. Mein Puls dröhnt mir in den Ohren. Und ich bekomme nicht genug Luft.
Eine Tür wird geknallt, und zwei Männerstimmen kommen näher.
»Bist du immer noch hier, Blondie?«, brummt einer von ihnen.
Sein Begleiter lacht.
Beim strengen Geruch des säuerlichen Rasierwassers fällt mir alles wieder ein. Ich befinde mich in einer Scheune und werde von diesen Leuten gefangen gehalten; mein Mund ist mit Klebeband geknebelt, und ich habe eine Schlinge um den Hals. Offensichtlich sind meine Beine unter mir weggesackt, und ich bin nach vorn auf die Schlinge gesunken, sodass ich von ihr gewürgt werde. Ich spanne meine Muskeln an und drücke mich gegen den Pfeiler, ohne den Splittern, die sich dabei in meine Haut bohren, Beachtung zu schenken. Der Druck der Schlinge lässt ein wenig nach, und ich hole durch die Nase Luft. Während ich spüre, wie sich mein Herzschlag wieder beruhigt, frage ich mich, wie lange ich bewusstlos war. Und was zum Henker als Nächstes passieren wird.
Ich muss nicht lange warten, um das herauszufinden.
Die Männer entfernen die Schlinge und schneiden das Klebeband an meinen Knöcheln los, worauf ich zu Boden sinke, weil meine verkrampften Beine zu taub sind, um mich zu tragen. Da meine Hände immer noch hinter dem Rücken gefesselt sind, kann ich meinen Sturz nicht abfangen und lande mit dem Gesicht auf dem Lehmboden. Der Aufprall raubt mir den Atem.
Die Männer lachen.
Der Typ mit der brummigen Stimme versetzt mir mit seinem Stiefel einen Stups. »Hoch mit dir.«
Arschloch. Ich rühre mich nicht. Denn ich habe nicht vor, mich vor ihnen auf dem Boden abzuquälen. Mit den gefesselten Händen bin ich nicht in der Lage aufzustehen, aber das kann ich ihnen nicht sagen, weil ich geknebelt bin. Das müssen sie schon selbst herausfinden.
Eine Minute später haben sie begriffen. Der Geruch, der mir in die Nase steigt, verrät mir, dass es der Typ mit dem Rasierwasser ist, der mich auf die Beine hievt. Er verpasst mir einen Stoß in den Rücken und sagt: »Beweg dich.«
Ich taumle vorwärts, und diesmal falle ich nicht hin. Mühsam setze ich einen Fuß vor den anderen und schwanke dabei wie ein frisch geborenes Fohlen. Einer der beiden Männer packt mich am Arm und zerrt mich weiter.
Wir treten aus der Dunkelheit der Scheune ins Licht. Inzwischen scheint die Sonne nicht mehr so stark wie vorhin, und die Hitze hat ebenfalls nachgelassen. Ich würde gern fragen, wohin wir gehen, doch ich kann nicht. Mir bleibt nichts anderes übrig, als in die Richtung, in die man mich führt, weiterzuschlurfen, obwohl ich es hasse, dass ich nichts unternehmen kann.
Der Mann links von mir brummt: »Heb die Füße an.«
Ich tue, was er sagt, und spüre Holz unter den Füßen. Während die Absätze meiner Cowboystiefel über die Bretter hämmern, frage ich mich, ob wir uns auf einer Veranda befinden. Ein paar Schritte später höre ich, wie sich eine Tür quietschend öffnet. Und die beiden stoßen mich ins Innere.
Es riecht nach frischem Brot und Gardenien. Wo zum Teufel bin ich hier? Der Typ mit dem Rasierwasser, der immer noch hinter mir steht, versetzt mir einen Stoß, und ich laufe weiter.
»Stehen bleiben«, sagt Brummbär und packt mich am Ellbogen.
Eine weitere Tür wird geöffnet, und der Mann zerrt mich nach links. Die Tür schließt sich wieder, und ich höre einen Riegel über Holz kratzen.
Der Mann lässt meinen Arm los. »Nicht bewegen.«
Ich tue, was er verlangt.
Er nimmt mir die Kapuze vom Kopf. Das Licht ist unerträglich hell, und ich schließe die Augen, dann blinzle ich heftig, um mich an die Helligkeit zu gewöhnen. Der Mann reißt mir das Klebeband vom Mund.
Ich hole tief Luft und öffne die Augen. Ich befinde mich in einem Badezimmer, das in Rosatönen dekoriert ist, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe. »Was zum …?«
»Nicht fluchen.« Brummbär neigt den Kopf zur Seite. »Das wird hier nicht geduldet.«
»Du verarscht mich, oder?« Meine Stimme klingt heiser. Meine Kehle ist trocken wie Wüstensand. »Ihr findet es okay, mich zu entführen und hier gefangen zu halten, aber ihr macht mir die Hölle heiß, weil ich den Namen des Herrn …«
Der plötzliche Schlag trifft mich mit voller Wucht seitlich am Kopf. Normalerweise kann ich im letzten Moment ausweichen, aber ich bin zu schwach und benommen dafür, sodass ich zu Boden sinke und mit dem Hintern auf der flauschigen Badematte lande.
Der Mann schaut zu mir herunter. »Ich habe dich gewarnt. Das hier ist kein Ort, an dem geflucht wird.« Er reibt sich die Fingerknöchel und schüttelt den Kopf. Es scheint fast, als wollte er sich entschuldigen. »Das tut mir genauso weh wie dir. Ich hasse es, Frauen Schmerzen zuzufügen.«
Ich funkle ihn wütend an und taste mit meinen gefesselten Händen hinter mir auf der Matte nach irgendetwas, das ich als Waffe benutzen kann. »Glaub mir, mein Freund. Ich habe schon Schlimmeres einstecken müssen. Du schlägst wie ein Mädchen.«
Er betrachtet mich einen Moment lang und zuckt dann mit den Schultern. »Dann war das wohl okay.«
Ich kann keinen brauchbaren Gegenstand finden und starre den Mann weiter an, taxiere meinen Gegner. Er ist etwa eins achtzig groß, von mittlerer Statur, dunkelbraun gebrannt und hat kurz geschorene schwarze Haare. Er ist älter, als ich vermutet habe – eher fünfzig als dreißig –, trägt eine Cargohose und über einem weißen Unterhemd ein kariertes Hemd. Darunter, in einem Schulterhalfter, steckt eine Pistole, und an seinem linken Knöchel zeichnet sich unter der Hose eine Beule ab. Garantiert hat er dort eine zweite Waffe befestigt.
»Und jetzt?«
Der Mann antwortet nicht. Stattdessen tritt er hinter mich und geht in die Knie. Ich spanne meinen Körper an. Bereit, nach vorn zu stürzen. Doch dann höre ich, wie das Klebeband zerrissen wird, und meine Hände sind frei. Ich lasse meine Arme vorsichtig kreisen, und als ich meine Handgelenke an den Stellen massiere, wo das Klebeband in die Haut geschnitten hat, zucke ich zusammen.
Ich werfe einen Blick über die Schulter zu dem Typen. »Du fügst Frauen also nicht gerne Schmerzen zu, was?«
»Mach dich ein wenig frisch. Im Schrank sind saubere Handtücher, und im Regal ist Waschzeug.«
»Es wäre mir lieber, ihr würdet mich nach Hause bringen.«
»Das habe ich nicht zu entscheiden. Ich will, dass du dich jetzt wäschst und in einen vorzeigbaren Zustand bringst.«
Ich schüttle den Kopf. »Wofür?«
Er läuft um mich herum zur Tür und klopft in kurzer Folge zweimal dagegen. Als sie entriegelt wird, dreht er sich noch einmal um und schaut mich an. »Tu, was ich dir gesagt habe, und versuch keine Dummheiten.« Er nickt Richtung Fenster. »Es ist von außen vergittert. Es gibt hier keine Fluchtmöglichkeit.«
Ich warte, bis er das Zimmer verlassen und die Tür wieder verriegelt hat, bevor ich mich bewege, weil ich nicht will, dass er sieht, wie wacklig ich auf den Beinen bin. Ich rapple mich vorsichtig wieder auf, wanke vorwärts und halte mich am Waschbecken fest. In meinem Kopf dreht sich alles, und ich kann nur verschwommen sehen. Ich habe den Mann angelogen; sein Schlag war ziemlich heftig.
Ich spritze mir etwas kaltes Wasser ins Gesicht, und da ich wahnsinnigen Durst habe, beuge ich den Kopf hinunter, lasse das Wasser über meine Lippen laufen und nehme einen Schluck. Aber als die Flüssigkeit über meine ausgetrocknete Kehle rinnt, muss ich husten und spucke sie wieder aus. Ich versuche es erneut, doch auch diesmal muss ich würgen. Erst als ich ein paar kleinere Schlucke nehme, schaffe ich es, etwas Wasser bei mir zu behalten.
In diesem Moment klopft es an die Tür. »Beeil dich, verstanden? Und dusch dich.«
Die beiden belauschen mich. Ich frage mich, ob sie mich auch beobachten, und lasse meinen Blick durch das Badezimmer wandern, aber ich kann nirgends eine Kamera entdecken. Es ergibt keinen Sinn, dass sie mich plötzlich so anders behandeln. Warum binden sie mich in einer Scheune mit einer Kapuze über dem Kopf in einer unbequemen Position stundenlang fest, ohne mich zu befragen, und bringen mich dann in ein Haus, damit ich dusche? Eine merkwürdige Art von Entführung ist das.
Ich muss nachdenken. Mittlerweile verfüge ich über jede Menge neuer Informationen, und es gibt einiges, das mich jetzt sehr viel mehr beunruhigt als die Tatsache, dass mich die Männer vorhin schlecht behandelt haben. Dieses Badezimmer hat ein vergittertes Fenster und eine Tür mit einem Riegel auf der Außenseite. Falls man ihn nicht nur meinetwegen dort angebracht hat, verfrachten diese Leute ihre Gefangenen offensichtlich immer hierher. Die Bemerkung vom Brummbär, dass er nicht gerne Frauen schlägt, könnte darauf hindeuten, dass die Männer Frauen verschleppen, um sie zur Prostitution zu zwingen. Dass ich aufgrund meines Geschlechts und nicht aus persönlichen Gründen entführt wurde. Aber ich halte das für unwahrscheinlich. Falls ich mit meiner Vermutung hinsichtlich unseres Aufenthaltsorts richtigliege, betreiben die Leute, die mich gefangen halten, nebenher zwar Sex- und Drogenhandel und andere dubiose Geschäfte, aber der Grund für meine Entführung und meinen Aufenthalt hier ist offensichtlich persönlich. Absolut persönlich.
Mich schaudert. Ich kann das nur in Erfahrung bringen, wenn ich dieses Spielchen bis zum Ende mitspiele.
Ich trete an den Schrank und öffne die Türen. Darin befinden sich, nach Größe und Farbe geordnet, mehrere Stapel Handtücher. Ich nehme zwei rote heraus und schließe den Schrank wieder. Dann gehe ich in die Ecke neben der Tür, ziehe mich aus, lege meine Klamotten in einem Bündel auf einen Korbstuhl, steige in die Dusche und ziehe die Milchglastür hinter mir zu.
Die Dusche hat einen kräftigen Strahl. Ich lasse das Wasser über meinen Körper rinnen und spüle damit Schweiß und Dreck ab. Mit einem Shampoo aus der Ablage wasche ich mir die Haare. Gerade, als ich den Schaum abbrause, höre ich eine Tür knallen. Ich fahre herum und spähe durch das Glas, aber durch die getönte Scheibe kann ich nichts erkennen. Mit klopfendem Herzen drehe ich das Wasser ab und greife nach dem Handtuch, wickle es mir um den Körper und öffne die Duschtür.
Das Badezimmer ist leer, aber es ist jemand hier gewesen.
Meine Kleidung und meine Stiefel sind nicht mehr da. Stattdessen stehen auf dem Korbstuhl ein Glas mit orangefarbener Flüssigkeit und ein Kosmetiktäschchen. Außerdem hängt am Spiegel ein Kleid, ein luftiges, bezauberndes Chiffonkleid mit blauen Blümchen auf cremefarbenem Untergrund. Daran ist ein Zettel befestigt. Ich strecke meine Hand danach aus, reiße den Zettel ab und lese die Nachricht.
Zieh das hier an und mach dich hübsch. Du hast zehn Minuten.
6
Mittwoch, 19. September, 17:26
Zieh das Kleid an. Mach dich hübsch.
Diese Art von sexistischem Schwachsinn macht mich rasend. Ich hämmere gegen die Badezimmertür. »Gebt mir meine Klamotten zurück. Ich werde kein verdammtes Kleid tragen.«
Ich höre, wie der Typ mit dem Rasierwasser kichert. »Das Kleid oder gar nichts.«
Scheißkerl. Ich bin versucht, mich für Letzteres zu entscheiden, um die beiden auf diese Weise abzulenken, doch das könnte alles nur noch schlimmer machen, und das sollte ich in meiner Lage lieber vermeiden. Also trockne ich mich ab und streife widerwillig das Kleid über. Es ist ein rückenfreies Ding mit tiefem Ausschnitt und reicht fast bis zum Boden, sodass man damit kaum rennen kann. Das ist ein Problem, denn ich muss rennen können.
Ich nehme einen schwarzen Kajalstift aus dem Täschchen und lasse ihn über meine Lider gleiten, während ich versuche, das Zittern meiner Hand zu ignorieren. Ich starre in den Spiegel und zwinge mich, den Tatsachen ins Auge zu blicken. Brummbär hat mir die Kapuze abgenommen, obwohl er wusste, dass ich dann sein Gesicht sehen kann. Außerdem habe ich einen Blick auf die beiden Gorillas erhascht, die mich vor der Schule gepackt haben. Leute, die so viel Aufwand betreiben – die eine Entführung planen und gewissenhaft durchführen –, machen keine Anfängerfehler. Ich habe ihre Gesichter gesehen, weil sie das wollten oder es keine Rolle spielt. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass sie nicht vorhaben, mich am Leben zu lassen.
Ich hole tief Luft und werfe den Kajalstift in das Kosmetiktäschchen.
Ich habe mein Leben gelebt, sogar mehrere Leben. Ich war die Tochter eines gewalttätigen Vaters und die Frau eines gewalttätigen Ehemanns. Ich wurde von Männern tyrannisiert, die sich nur mit ihren Fäusten ausdrücken konnten. Jetzt, mit meinen zweiunddreißig Jahren, führe ich ungefähr das Leben, das ich mir erhofft habe. Ich bin beruflich erfolgreich und unabhängig, ich bin die Mutter von Dakota und JTs Geliebte. Ich will nicht, dass das jetzt aufhört. Nicht auf diese Weise.
In diesem Moment klopft es an der Tür, und ich zucke zusammen.
»Hast du was an?«, ruft der Typ mit dem Rasierwasser. »Ist egal, ich komm jetzt rein.«
Als ich höre, wie der Riegel zur Seite geschoben wird, blinzle ich mir die Feuchtigkeit aus den Augen, schnappe mir die flache Seifenschale aus Glas und stecke sie mir hinten in den Slip. Das ist nicht viel, aber immerhin etwas. Egal, was sie mit mir vorhaben, ich werde mich auf keinen Fall kampflos ergeben.
Die Tür öffnet sich.
Der Typ mit dem Rasierwasser stößt einen lang gezogenen Pfiff aus. »Jetzt sieh mal einer an.«
»Es reicht.« Der andere Mann schiebt sich an ihm vorbei und blickt mir direkt in die Augen. »Streck die Hände aus.«
Er hält ein Paar Handschellen aus Metall in der Hand. Verdammt. Er legt sie mir an, was meine Handlungsmöglichkeiten gewaltig einschränkt. Vielleicht sollte ich jetzt sofort etwas unternehmen. Zwei gegen einen, und beide tragen sie eine Pistole. Ich hingegen habe nur die Seifenschale. Selbst wenn das Glück auf meiner Seite ist, stehen meine Chancen nicht gut.
Also tue ich, was man von mir verlangt, und sehe dabei zu, wie der Mann die Handschellen um meine Handgelenke zuschnappen lässt. »Wo bringt ihr mich hin?«
Der Typ mit dem Rasierwasser kichert.
Der andere Mann wirft ihm einen Blick zu und schaut dann wieder zu mir. »Das wirst du noch früh genug erfahren. Und jetzt setz dich in Bewegung.«
Die beiden führen mich aus dem Badezimmer durch einen langen Flur in eine Küche. Sie ist ordentlich, sauber und in einem traditionellen Farmhaus-Stil eingerichtet, mit frei stehenden Holzschränkchen und einem riesigen Esstisch, der für bestimmt fast zwanzig Personen gedeckt ist. Auf der Mitte des Tisches steht eine Vase mit Gardenien.
Es ist ein Wohnhaus: An den Wänden hängen Familienfotos, und auf einer Tafel neben dem Herd steht eine Einkaufsliste mit Lebensmitteln. Im Vorbeigehen werfe ich einen Blick auf die Fotos. Die Personen darauf sagen mir nichts. Allerdings erkenne ich eine Menge der Orte wieder: Sie liegen alle in Miami.
Die beiden Männer führen mich durch die Hintertür nach draußen. Im Hof stehen mehrere Fahrzeuge – Pick-ups, Geländewagen und Jeeps –, und an einem hohen Tor auf dieser Seite der langen Auffahrt sind vier Männer postiert. Sie alle tragen Maschinengewehre.
Ein gutes Stück von uns entfernt, entlang eines Feldwegs, stehen vier riesige Scheunen. Die Männer laufen mit mir nach links über den Hof und weiter um das Haus herum zu einer gepflasterten Terrasse, die von einem weißen Lattenzaun und einer hohen Hecke abgeschirmt wird. Ich spüre, wie die beiden Typen neben mir verkrampfen.
Seltsam. Ich werfe einen Blick zu Brummbär. »Bist du sicher, dass das der richtige Weg ist?«
»Sei still.«
Schweigend laufen wir weiter. Ich inspiziere die Gegend und halte Ausschau nach einer Fluchtmöglichkeit. Abgesehen von der Gartenanlage, sind wir von Weideland und dichtem Waldgebiet umgeben, soweit das Auge reicht. Es ist sonst kein anderes Grundstück zu sehen. Es wäre Wahnsinn, jetzt einen Fluchtversuch zu unternehmen, und ich wette, meine Entführer wissen das. Mit den Handschellen und ohne Fahrzeug bliebe mir nichts anderes übrig, als in den Wald zu rennen. Mit all den Fahrzeugen und Waffen könnten sie mich wahrscheinlich leichter erschießen als einen Waschbären in einer Falle. Ich schätze, dass ich noch eine Weile warten muss.
Als wir das hintere Ende der Terrasse erreichen, öffnet der Typ mit dem Rasierwasser ein Tor und fordert mich mit einer Geste auf durchzugehen. Aber nur Brummbär begleitet mich. Wir laufen um das hintere Ende des Hauses, und dann kann ich es sehen. Ihn sehen. Und alles fügt sich zusammen.
Ich bleibe abrupt stehen.
»Weitergehen«, sagt Brummbär, packt mich am Ellbogen und zerrt mich weiter. »Er wartet nicht gern.«
Mag schon sein, aber ich habe es garantiert nicht eilig.
Auf der anderen Seite des riesigen Swimmingpools, am hinteren Ende der Veranda, steht ein für zwei Personen gedeckter Tisch mit einer weißen Decke, Silberbesteck und Porzellantellern. Während wir uns dem Tisch nähern, hebt der Mann, der dort sitzt, den Blick.
Ich balle meine Hände zu Fäusten. Obwohl wir uns nie persönlich begegnet sind, ahne ich, wer das ist.
Der Mann ist in seinen Siebzigern, hat eine aufrechte, staatsmännische Körperhaltung und schwarze Haare, die an den Schläfen leicht ergraut sind. Er trägt einen dunklen Anzug und ein weißes kurzärmeliges Hemd, doch als Zugeständnis an die Hitze hat er das Jackett ausgezogen und über seine Stuhllehne gehängt. Er nickt meinem Begleiter zu, worauf dieser mir die Handschellen abnimmt, und beobachtet, wie Brummbär sich umdreht und verschwindet. Erst als wir allein sind, schaut er in meine Richtung. Er nimmt seine Serviette vom Schoß, faltet sie akkurat zusammen, erhebt sich und fixiert mich mit seinem Blick. »Hallo Jennifer Lorelli Ford.«
Ich runzle die Stirn, weil ich keine Ahnung habe, was das hier zu bedeuten hat; da ist einerseits der gedeckte Tisch, andererseits der drohende Unterton in seiner Stimme. »Es ist lange her, dass man mich so genannt hat.«
»Dann wird es Zeit, sich der Vergangenheit zuzuwenden.« Er deutet auf den Stuhl ihm gegenüber. »Nehmen Sie bitte Platz.«
Ich rühre mich nicht von der Stelle. Da meine Hände nicht mehr gefesselt sind, könnte ich ihn wahrscheinlich mühelos überwältigen. »Und wenn ich es nicht tue?«
Der Mann lächelt dezent und setzt sich wieder. Er nimmt die Serviette, breitet sie wieder auf seinem Schoß aus und streicht sie glatt, bevor er demonstrativ zu dem Tor rüberschaut, durch das ich gekommen bin, und dann zu einem weiteren auf der anderen Seite des Hauses. Ich folge seinem Blick und bemerke, dass hinter jedem Tor ein Mann mit einer Kalaschnikow steht. »Dann wäre ich enttäuscht, weil Sie sich entschieden hätten, dass die Sache hier einen äußerst unschönen Verlauf nehmen wird.«
Also trete ich an den Tisch und setze mich.
Er nickt. »Braves Mädchen.«
Herablassender Scheißkerl. Ich beuge mich vor und umklammere mit meiner Hand eines der Silbermesser. »Niemand nennt mich Mädchen. Sie haben mich auf der Straße entführen lassen, in ihrer Scheune angebunden und mich gezwungen, dieses verdammte Kleid zu tragen.«
Als ich fluche, zuckt er zusammen und schließt die Augen, als hätte er Schmerzen.
»Ich will wissen, warum zum Teufel ich hier bin!«
Beim Wort »Teufel« beginnt er zu zittern, dann öffnet er die Augen, und für einen Moment schaut er mich mit unverhohlenem Zorn an. Doch kurz darauf ist das Gefühl wieder verflogen, und seine Wut weicht einem neutralen Gesichtsausdruck. Mit leiser, todernster Stimme ergreift er erneut das Wort. »Nun, Jennifer, ich denke, es ist längst überfällig, dass wir uns mal darüber unterhalten, wie Sie einen meiner Jungs in die Falle gelockt und ermordet haben. Thomas Ford.«
Er lächelt mich an, und in diesem Moment begreife ich, dass ich eine tote Frau bin.
7
Mittwoch, 19. September, 18:01
Es ist nicht immer leicht, ein Mitglied der Mafia zu erkennen. Sie sehen nicht alle wie typische Gangster aus, und sie tragen auch keine Buttons, auf denen in großen Buchstaben steht, wem ihre Loyalität gilt. Die Fußsoldaten sind zwar oft überall tätowiert, aber bei den Männern weiter oben in der Nahrungskette sieht das völlig anders aus. Man würde sie für ehrenwerte Bürger halten, wenn man ihnen begegnet. Ich habe gehört, dass die Leute das auch über den Mann sagen, der mir jetzt gegenübersitzt. Old Man Bonchese soll ein freundlicher, ehrenwerter Mann sein. Aber sie wissen nichts über seine Geschäfte.
Ich allerdings schon, und sie widern mich an: die Drogen und Mädchen, die Clubs, Casinos und Massagesalons. Er ist seit über dreißig Jahren der Boss der Bonchese-Familie, seit sein Vater vor einem ihrer Clubs von Gangstern umgebracht wurde. Unter seiner Führung ist das Imperium der Mafia in Miami noch größer geworden und das Geschäft, das sie betreibt, noch abstoßender. Egal, was für einen Eindruck er macht: Er ist ein Monster. Und so, wie er mich behandelt, genießt er es offensichtlich, mit seiner Beute zu spielen, bevor er sie tötet.
Er deutet auf die Platte mit Shrimps, die auf dem Tisch steht. »Greifen Sie zu.«
Ich tue so, als hätte ich keinen Hunger, obwohl mein Magen beim Anblick des Essens zu knurren beginnt. Ich möchte, dass er zur Sache kommt. »Warum das Kleid? Findet Sie nicht, dass Frauen auch Hosen tragen dürfen?«
Der Alte nimmt einen Shrimp und starrt ihn eine Weile an, bevor er mit einer schnellen, brutalen Bewegung den Kopf abreißt. Dann sieht er mich erneut an. »Ich bin absolut für Gleichberechtigung, aber ich wollte, dass Sie sich bei diesem Essen wie eine Frau fühlen, für den Fall, dass es ihr letztes ist. Das Kleid ist ein Geschenk. Eine kleine Aufmerksamkeit. Von mir.«
»Ich fühle mich immer wie eine Frau, egal, was ich anhabe.« Er redet Schwachsinn. Ich trage das Kleid, weil es in meinen Klamotten sehr viel leichter wäre, von hier zu entkommen. Er benutzt das Kleid, um Kontrolle über mich zu haben. Genau wie mein Ehemann es getan hat. Er will die Person, die ich geworden bin, auslöschen und mich wieder in das Mädchen verwandeln, das von Thomas Ford ständig verprügelt wurde. Aber das wird nicht funktionieren. »Was wollen Sie mir also sagen?«
Erneut flackert in seinen Augen Wut auf. »Ihr Tommy war wie ein Sohn für mich, und für meinen ältesten Sohn, Luciano, wie ein Bruder. Er hat der Familie viel bedeutet.«
Ich habe Bilder von dem gesehen, was mein Mann für die Bonchese-Familie getan hat; von den Leuten, die er verprügelt hat, weil sie ihre Spielschulden nicht bezahlen konnten, und von der Leiche eines Mannes, den er für sie getötet hat. JT war der Kopfgeldjäger, der Tommy aufspüren sollte, als dieser vor seinem Prozess wegen des Mordes die Kaution hat verfallen lassen. Bei diesem Auftrag haben wir uns kennengelernt, und die Bilder haben mich überzeugt, JT zu helfen. Aber Tommy fand es heraus und kam, um sich für meinen Verrat zu rächen.
»Tommy hat meine Freundin Sal getötet«, sage ich. »Er hat sie aus kürzester Entfernung erschossen, weil sie die Cops angerufen hat, als er anfing, mich zu verprügeln. Sie war erst siebzehn – noch ein Kind –, aber er hat ohne zu zögern den Abzug gedrückt.«
»Das ist sicher bedauerlich, aber eigentlich geht mich das nichts an.«
Ich spüre in meinem Brustkorb Wut aufsteigen und balle meine Hände zu Fäusten. Ich habe mich von JT ursprünglich zur Kopfgeldjägerin ausbilden lassen, um Tommy aufspüren und ins Gefängnis stecken zu können. »Er musste für seine Tat bezahlen.«
»Sie haben ihn also kaltblütig ermordet.«
Ich erschauere und muss daran denken, wie ich hinter der Hütte stand, in der wir Tommy gefunden hatten. JT verschaffte sich durch die Vordertür Zugang, doch die Sache lief aus dem Ruder. Tommy konnte durch die Hintertür entkommen, und ich versperrte ihm den Weg. Als er mich sah, lachte er nur und meinte, es sei ihm völlig egal, dass er Sal getötet habe. Er stürzte sich auf mich und sagte, dass ich jetzt sterben müsste.
»Es hieß, er oder ich. Ich habe ihn in Notwehr erschossen.«
Bonchese kneift die Augen zusammen. »Ich habe gehört, dass Sie Ihr ganzes Magazin geleert haben.«
Ich halte seinem Blick stand, während ich vor meinem geistigen Auge sehe, wie Tommys blutüberströmter, durchsiebter Körper zu Boden sackt. Ich falte die Hände, um zu verbergen, dass sie zittern. »Ich musste auf Nummer sicher gehen.«
Bonchese schließt die Augen und atmet laut aus. »Es stimmt also, was mein Sohn mir erzählt hat: dass Sie Tommy getötet haben. Und nicht der Kopfgeldjäger, der das von sich behauptet hat.«
Ich nicke. JT hat die Schuld auf sich genommen, worauf die Mafia von Miami einen Preis auf seinen Kopf ausgesetzt hat. Allerdings habe ich das erst zehn Jahre später erfahren. Vor Kurzem hat die Mafia herausgefunden, dass ich diejenige war, die geschossen hat. »Ja.«
»Dann sehe ich die Sache so, wie unser Herrgott gesagt hat – Auge um Auge. Das will ich haben.«
Auge um Auge. Mein Leben aus Rache für Tommys. Ich lasse meine rechte Hand über die Tischdecke gleiten und umklammere mit den Fingern das Messer. Ich muss an meine kleine Dakota denken, die mit JT zu Hause auf mich wartet. Egal, wie meine Chancen stehen: Ich muss versuchen, von hier zu entkommen.
Der Alte seufzt. »Ich hoffe, dass Sie das Messer genommen haben, um ihr Brötchen mit Butter zu bestreichen.« Er wirft einen Blick Richtung Haus. »Abgesehen von den Wachen an den beiden Toren, hat mein Enkel Angelo von seinem Schlafzimmerfenster im ersten Stock aus sein Gewehr genau auf Ihren Rücken gerichtet. Tommy war sein Held. Es hat ihn schwer getroffen, als er nicht mehr da war. Auge um Auge.«
Ich halte das Messer immer noch in der Hand. »Warum habt ihr mich dann nicht längst getötet?«
Der Alte seufzt erneut. »Mein Sohn Luciano sieht die Sache anders.«
Während ich ihm weiter in die Augen schaue, lasse ich meine Füße aus den Sandalen gleiten, weil ich barfuß wahrscheinlich besser rennen kann als mit diesen Absätzen. »Wieso?«
»Luciano hat weniger traditionelle Ansichten, er nimmt die Dinge nicht ganz so wörtlich.« Er greift nach dem kopflosen Shrimp auf seinem Teller, zieht den Schwanz ab und tunkt den fleischigen rosafarbenen Körper in Cocktailsoße. »Er glaubt, dass man seine Schulden auch auf andere Weise begleichen kann.«
»Ich höre.«
Der Alte steckt sich den Shrimp in den Mund und kaut bedächtig darauf herum. Ich warte ab, das Messer fest umklammert.
Seelenruhig schluckt er den Shrimp hinunter und tupft sich mit der Serviette den Mund ab. »Finden Sie Carlton North und bringen Sie ihn zurück.«
Ich runzle die Stirn. »Wer ist das?«
»Jemand, der sich an einem Ort aufhält, an dem er nicht sein sollte. Finden Sie ihn. Luciano glaubt, dass Sie dazu in der Lage sind.«
Mir fallen die Fotos ein, die zeigen, wie Tommy diesen Spieler zu Tode prügelt. Wenn ich tue, was der Alte verlangt, erwartet Carlton North wahrscheinlich dasselbe Schicksal. »Ich soll einen Typen aufspüren, damit Sie ihn töten können?« Ich schüttle den Kopf. »Guter Mann, daraus wird nichts. Ich will mit so einer Sache nichts zu tun haben.«
Der Alte schaut mich an, als wäre ich ein zurückgebliebenes Kind. »Ich will North nicht töten, er ist für meine Geldgeschäfte zuständig. Ich brauche ihn. Aber das FBI hat ihn verhaftet und will ihn wegen Unregelmäßigkeiten in der Buchführung zu einer Aussage gegen unsere Cousins in Tallahassee zwingen. Sie haben zwar Mist gebaut, aber North darf trotzdem nicht gegen sie aussagen. Das würde uns in eine unangenehme Lage bringen und zu einem Bruch innerhalb der Familie führen. Das kann ich nicht zulassen.«
»Sie wollen ihn also aufhalten?«
»Wenn ich jemanden aufhalten will, dann das FBI. Und ich will North wieder dort haben, wo er hingehört. Hierher. Er ist für mich wie ein Sohn.«
Ich starre ihn an und versuche herauszufinden, ob das die wahren Gründe für die Suche nach Carlton North sind oder ob er mir einen Bären aufbindet. »Offensichtlich sind viele Menschen wie ein Sohn für Sie.«
»Wir sind eine Familie, loyal bis in den Tod.« Er nimmt einen weiteren Shrimp, entfernt Kopf und Schwanz, tunkt ihn in die Soße und steckt ihn sich in den Mund. Während er darauf herumkaut, macht er eine Geste in meine Richtung. »Wir halten zusammen, koste es, was es wolle. Das können Sie sich offensichtlich nicht vorstellen.« Er klingt ehrlich, aber so etwas kann man vortäuschen.
»Und wenn ich ihn gefunden habe, was dann?«
»Dann befreien sie ihn aus dem FBI-Gewahrsam und bringen ihn hierher. Der Prozess, bei dem er aussagen soll, beginnt Freitag. Bis dahin muss er auf freiem Fuß sein.«
»Das ist nicht viel Zeit.«
»Lassen Sie sich was einfallen.«
»Wissen Sie, wo er festgehalten wird?«
»Wenn ich das wüsste, bräuchte ich Sie nicht.«
Ich schüttle den Kopf. »Ich glaube nicht …«
Der Alte greift hinter sich in die Tasche seines Jacketts, zieht ein Foto heraus und legt es auf den Tisch.
Ich hole tief Luft. Das Foto zeigt Dakota und JT vor unserer Wohnung. Dakota trägt ihren Schulrucksack, JT hat das Planeten-Modell unter seinen gesunden Arm geklemmt.
Ich schaue zu Bonchese auf. »Das wurde heute aufgenommen.«