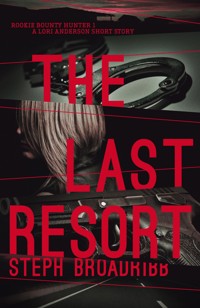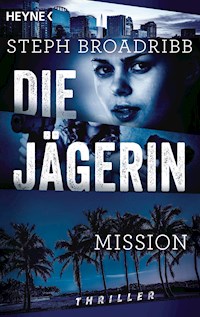
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lori-Anderson-Serie
- Sprache: Deutsch
Alles oder nichts
Die alleinerziehende Kopfgeldjägerin Lori Anderson muss mit einigen Schwierigkeiten zurechtkommen. JT, der Vater ihrer Tochter, sitzt in der Todeszelle. In dem verzweifelten Versuch, ihn zu retten, handelt Lori einen Deal mit dem dubiosen FBI-Agenten Alex Monroe aus: Wenn es ihr gelingt, den flüchtigen Verbrecher Gibson Fletcher ausfindig zu machen, kommt JT frei. Wenn nicht, wird sie alles verlieren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
»Also gut, genug gequatscht«, sagte ich. »Bringen wir es hinter uns. Muss ich irgendwo unterschreiben?«
Monroe schob sich die Sonnenbrille ins Haar. »Nein. Sie finden unseren Mann, und ich sorge dafür, dass Tate freikommt. Wenn Sie in die Scheiße geraten, müssen Sie selbst sehen, wie Sie da rauskommen.«
Bei unserem Mann handelte es sich um Gibson »the Fish« Fletcher, der noch bis vor einer Woche dreimal lebenslänglich im Hochsicherheitsknast abgesessen hatte. Als er mit Blinddarmdurchbruch ins Krankenhaus verlegt worden war, hatte er fliehen können – nachdem er drei Wachleute umgelegt hatte. Ich hatte Fletcher schon einmal gefasst, als er trotz Kaution nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen war. Deshalb hielt Monroe mich auch jetzt für die Richtige. Und vielleicht hatte er recht. Allerdings hatte ich damals gedacht, dass Fletcher nur wegen schweren Diebstahls angeklagt war. Auf der Kautionsvereinbarung war nirgends von Doppelmord die Rede gewesen.
Die Autorin
Steph Broadribb, geboren in Birmingham, hat ein Studium in Kreatives Schreiben von der City University London und eine Ausbildung zur Kopfgeldjägerin in Kalifornien absolviert. Heute lebt sie in Buckinghamshire.
Lieferbare Titel
DIEJÄGERIN:
Auftrag
Mission
Übergabe
Steph Broadribb
DIE JÄGERIN Mission
Thriller
Aus dem Englischen übersetzt von Sven Scheer
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Die englische Originalausgabe
Deep Blue Trouble
erschien 2017 bei Orenda Books.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständige deutsche Erstausgabe 07/2020
Copyright © 2017 by Steph Broadribb
Copyright © 2020 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Printed in Germany
Redaktion: Steffi Korda
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München, unter Verwendung von Motiven von © FinePic®, München
Satz: Fotosatz Amann, Memmingen
ISBN: 978-3-641-25088-1V001
www.heyne.de
Prolog
Sie trafen sich kurz vor Tagesanbruch auf dem Parkplatz eines unscheinbaren Vorstadtmotels.
Dodge war um Punkt 5:45 Uhr da, der Mann im Cabrio kam ein paar Minuten später. Sie hielten Fahrertür an Fahrertür, Motorhaube neben Kofferraum. Keiner von beiden hatte vor auszusteigen.
Der Mann in dem schicken Cabriolet lehnte sich lässig mit dem Ellbogen auf der Türkante zu Dodge rüber. Seine Körperhaltung verriet, dass er sich hier für den Boss hielt. Er trug einen gut geschnittenen Anzug und eine Designer-Sonnenbrille und sprach in dem selbstsicheren Tonfall eines Mannes, der bekam, was er wollte. »Haben Sie sich entschieden?«
Dodge kaute betont langsam auf seinem Kaugummi herum. Nickte. Er sprach nie mehr als notwendig. Für Small Talk war er zu schlau und zu vorsichtig. Den Job hatte er nur übernommen, weil er ihm das Vierfache des Üblichen einbrachte. Aber das hieß noch lange nicht, dass er dem Mann mit der Sonnenbrille vertraute. Ganz bestimmt nicht.
»Gut.« Mr. Wichtig holte einen Umschlag aus dem Jackett und streckte ihn Dodge hin. »Die Hälfte im Voraus, wie vereinbart.«
Dodge nahm den Umschlag und verstaute ihn in seiner Jackentasche. Als Mann alter Schule hatte er nichts übrig für Überweisungen oder Online-Geschichten. Nur Bares war Wahres. Man lief weniger Gefahr, aufgespürt zu werden. In seinem Business kam es auf Anonymität an, und er tat alles, um seine zu wahren.
»Wollen Sie nicht nachzählen?«
Dodge bearbeitete weiter langsam und gleichmäßig seinen Kaugummi. Schüttelte den Kopf. Das musste er nicht. Mr. Wichtig hatte im Gegensatz zu ihm nicht ausreichend auf Anonymität geachtet und E-Mails an eine der zahllosen Kontaktadressen geschickt – viele E-Mails, mit vielen Informationen. Er wusste alles über den Mann und würde ihn im Nu finden. Wenn dieser Typ ihn bescheißen wollte, würde er nicht lange fackeln.
»Sie reden nicht viel, kann das sein?«
»Mhm«, erwiderte Dodge.
»Passen Sie auf, dass die Ihnen nicht zu nahekommen«, sagte Mr. Wichtig. Er rutschte auf seinem Sitz herum und zog den Ellbogen von der Cabriotür zurück. Unauffällige Signale, dass er unruhig wurde.
Das überraschte Dodge nicht. Nach der Geldübergabe wurden die meisten nervös. In dem Moment wurde ihnen auf einmal das ganze Ausmaß der Angelegenheit bewusst, und sie bekamen plötzlich ein schlechtes Gewissen.
Aber nicht dieser Typ. Vermutlich wurde Mr. Wichtig einfach ungeduldig. Dodge bezweifelte nämlich, dass der ansonsten überhaupt etwas fühlte. Trotz der dunklen Brillengläser entging Dodge nicht der leere, hohle Blick des Mannes. Ein Ausdruck wie von jemandem, der einen anderen Menschen umgebracht hatte. Dodge dachte an die Aufnahmen aus der Jachtkajüte, an die frischen Blutspritzer auf der aufgeschlagenen Vogue, die blutigen Fingerabdrücke auf dem halb gelösten Sudoku-Rätsel, die von Kugeln durchlöcherten Körper des Mannes und der Frau, die blutgetränkte Stoffpuppe.
»Zeitrahmen?«, fragte der Cabriofahrer.
Dodge hasste diese Frage – zu viele Variablen, um sie verlässlich zu beantworten. »Es dauert so lange, wie es dauert.« Sein Blick wanderte zum Horizont. Die Sonne war aufgegangen. Zeit zum Aufbruch. Er sah sein Gegenüber an. »Inzwischen ist auch noch eine Frau an der Sache dran, ein Profi. Sie könnte zum Problem werden.«
Der Mann verzog das Gesicht. Seine Stimme klang hart wie Stahl. »Behalten Sie sie im Auge. Wenn nötig, legen Sie sie um.«
Dodge wirkte unbeteiligt. Mahlte weiter monoton auf dem Kaugummi herum. Nickte noch einmal. »Klar.«
1. Kapitel
»Wenn er tatsächlich unschuldig ist, wieso hat er dann die Morde gestanden?«
Immer wieder stellte Special Agent Alex Monroe mir diese Frage. Man sah ihm an, wie genervt er war. Als würde ich ihn verarschen. Dabei wusste er von Anfang bis Ende alles über meinen letzten Job. Eigentlich sollten wir die Einzelheiten eines inoffiziellen Auftrags besprechen, den ich für ihn übernehmen würde. Aber er schien sich nicht von den letzten Ereignissen losreißen zu können.
»Das habe ich Ihnen doch schon erzählt«, sagte ich zum wiederholten Male.
Monroe strich sich über seine widerspenstigen braunen Haare. »Sie haben mir Ihre Version der Geschichte geschildert. Aber die von Tate klingt ganz anders.«
»Er lügt.«
»Einer von Ihnen lügt, das ist schon mal klar.« Monroe musterte mich über den Rand seiner Sonnenbrille und runzelte die Stirn. »Sind Sie noch an unserem Deal interessiert? Dann überzeugen Sie mich, dass ich nicht einen Mörder kriege und einen anderen dafür freilasse.«
Mein Blick ging durch das Café zu meiner neunjährigen Tochter Dakota, die im Schneidersitz auf einem Sitzsack ein Pferdebuch studierte und dabei am Strohhalm ihres Erdbeer-Milchshakes nuckelte. Der blauschwarze Bluterguss auf ihrer linken Wange war zu einem gelbrandigen Lila verblasst. Aber bis auch die Erinnerung an die schrecklichen Ereignisse der letzten Woche verblasste, würde es noch sehr viel länger dauern. Immerhin war sie – waren wir – noch am Leben. Dank James Robert Tate. Ohne JT würde jetzt niemand irgendeine Version der Geschichte erzählen können.
»JT darf sich nicht schuldig bekennen«, sagte ich. »Er hat diese Menschen nicht umgebracht.«
»Überzeugen Sie mich.«
Ich seufzte. »Ich hatte Tate zehn Jahre nicht gesehen, bis ich den Auftrag angenommen habe, ihn aus West Virginia nach Florida zu bringen. Das hörte sich nach leicht verdientem Geld an.«
Monroe nickte. »Das weiß ich alles. Aber eine Frage: Vor zehn Jahren waren Sie und JT sehr eng miteinander. Was ist passiert?«
Ich erwiderte seinen Blick. Natürlich, er wollte wissen, wie meine Beziehung zu JT war. Um sie zu beschreiben, reichten zwei Wörter: verdammt kompliziert. JT hatte mir damals alles beigebracht, was man als Kopfgeldjägerin wissen musste. Und wir hatten eine Affäre gehabt. Bis alles den Bach runtergegangen war.
Monroe räusperte sich und fragte ungeduldig: »Gab es Krach?«
Ich blickte in meinen Kaffeebecher und schwenkte die Reste meines Americanos. Old Man Bonchese, der Boss vom Miami Mob, gab JT die Schuld am Verschwinden meines Mannes, Thomas »Tommy« Ford – nicht nur der Vollstrecker des Old Man, sondern auch so etwas wie ein Sohn für ihn. Aber Old Man irrte sich: Ich war dafür verantwortlich, dass Tommy nie wieder aufgetaucht war. Tommy hatte meine beste Freundin umgebracht, und als ich ihn deswegen hatte festnehmen wollen, hatte er mich nur ausgelacht und mich bedroht. Ich hatte ihn aus kurzer Entfernung erschossen. JT hatte mir geholfen, die Leiche zu entsorgen, und kurz darauf hatten sich unsere Wege getrennt. Erst seit einer Woche wusste ich, dass er damals die Schuld auf sich genommen hatte und von Old Man eine Kopfprämie auf ihn ausgesetzt worden war – die allerdings geruht hatte, solange JT sich nicht in Florida hatte blicken lassen. In all den Jahren hatte ich mich nicht bei ihm gemeldet, noch nicht einmal, um ihm von seiner Tochter zu erzählen.
Ich sah Monroe an. »Nur eine berufliche Meinungsverschiedenheit.«
»Aber jetzt verteidigen Sie ihn. Wieso?«
Ich antwortete nicht. Ich hatte keine Lust mehr, das durchzukauen. Für mich zählte nur noch, dass JT freikam, damit ihm nichts passieren konnte. In der Three Lakes Detention Facility war er ein viel zu leichtes Ziel für den Miami-Mob.
Monroe war sauer. »Sie wollen etwas von mir, nicht vergessen.«
Er hatte recht. Mein vermeintlich so einfacher letzter Auftrag hatte sich als Intrige gegen JT herausgestellt. Verantwortlich war ein gewisser Randall Emerson gewesen, ein Vergnügungsparkbesitzer, der seinen Kunden Kinder nach ihren Wünschen besorgte. Als Emersons Helfer Dakota gekidnappt hatten, war JT und mir nichts anderes übrig geblieben, als die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Es hatte Tote und Verletzte gegeben. Und damit nicht genug, hatte auch noch der Miami-Mob zur Jagd auf JT geblasen.
»Wir haben getan, was getan werden musste.«
Monroe hob eine Augenbraue. »Wir?«
Mir war klar, was er damit meinte: dass JT nicht die ganze Zeit mein Gefangener gewesen war. In der Tat waren wir uns wieder nahegekommen – emotional und körperlich. Ich hatte JT vertraut, gemeinsam hatten wir Dakota befreit, und Emerson hatte seine gerechte – wenn auch drastische – Strafe bekommen. Der Mann würde nie wieder einem Kind etwas antun. Aber am Ende hatte ich JT der Polizei übergeben müssen, um mit meinem Anteil an der Kaution die gewaltigen Behandlungskosten für Dakotas Leukämie bezahlen zu können. Und gegen JT war Anklage wegen mehrfachen Mordes erhoben worden.
Monroe hatte mir einen Vorschlag gemacht, wie ich JT von allen Vorwürfen reinwaschen könnte. Und da der Staatsanwalt auf jeden Fall die Todesstrafe fordern wollte, musste ich JT irgendwie aus dem Gefängnis holen. Außer Monroe gab es nur eine andere Möglichkeit: dass der von Emersons Helfer angeschossene State Trooper aus dem Koma erwachte und JTs Unschuld bezeugte. Aber das schien nicht so bald zu passieren.
Ich schaute Monroe in die Augen. Zuckte mit den Schultern. »Heißt es nicht so?«
Monroe schüttelte den Kopf. »Er hat gestanden, und alles deutet auf seine Schuld hin.«
»Aber das stimmt nicht.« Ich ballte die Fäuste. JT und ich hatten ausgemacht, dass er jede Aussage verweigerte, nicht, dass er das Opferlamm spielte. Aber mir war klar, warum er gestanden hatte. Damit ich ungeschoren davonkam und seine Tochter bei ihrer Mutter bleiben konnte. Indem er sich unschuldig schuldig bekannte, wollte er uns schützen.
Aber genau das tat er damit nicht.
Seit unserer Trennung hatte ich nur unabhängig sein und allen beweisen wollen, dass ich keinen Mann brauchte. Deshalb hatte ich ihm nichts von Dakotas Krebs erzählt und mich noch nicht einmal während ihrer Krankheitsschübe bei ihm gemeldet. Ich hatte es aufgeschoben, bis sie einen Knochenmarkspender brauchen würde. Falls sie überhaupt jemals einen brauchen sollte. Also wusste er nichts von alledem. Auch nicht, dass ich bereits ergebnislos getestet worden war und jetzt er als ihr Vater am ehesten infrage kam. Erst in dem Moment ging mir auf, wie egoistisch ich gewesen war. Aber ich war in den Klauen der Liebe und der Angst gewesen. Hatte mich verletzlich gefühlt, und nichts war schlimmer als das. Trotzdem hätte ich JT von Dakotas Zustand erzählen müssen. Er musste am Leben bleiben. Für sie. Für mich. Er durfte nicht auf dem elektrischen Stuhl landen.
Ich hatte keine Wahl. Das war die bittere Wahrheit, nachdem ich sämtliche Möglichkeiten durchgegangen war. Monroe und ich mochten in dem Moment ganz zivilisiert in dem grell erleuchteten Café sitzen, aber im Grunde hatte er mich wie einen Mustang in einen winzigen Pferch getrieben, um meinen Willen zu brechen. Er hatte mir jeden Spielraum genommen. Ich brauchte den Deal.
»Also gut, genug gequatscht«, sagte ich. »Bringen wir es hinter uns. Muss ich irgendwo unterschreiben?«
Monroe schob sich die Sonnenbrille ins Haar. »Nein. Sie finden unseren Mann, und ich sorge dafür, dass Tate freikommt. Wenn Sie in die Scheiße geraten, müssen Sie selbst sehen, wie Sie da rauskommen.«
Bei unserem Mann handelte es sich um Gibson »the Fish« Fletcher, der noch bis vor einer Woche dreimal lebenslänglich im Hochsicherheitsknast absaß. Als er mit Blinddarmdurchbruch ins Krankenhaus verlegt wurde, konnte er fliehen – nachdem er drei Wachleute umgelegt hatte. Ich hatte Fletcher schon einmal gefasst, als er trotz Kaution nicht zur Gerichtsverhandlung erschienen war. Deshalb hielt Monroe mich auch jetzt für die Richtige. Und vielleicht hatte er recht. Allerdings hatte ich damals gedacht, dass Fletcher nur wegen schweren Diebstahls angeklagt war. Auf der Kautionsvereinbarung war nirgends von Doppelmord die Rede gewesen.
»Ziemlich riskant.«
Monroe zuckte mit den Schultern. »Es ist, wie es ist.«
Ich musterte ihn einen langen Moment. Sosehr er sich bemühte, hart zu klingen: Er wirkte nervös. Seine übliche Kentucky-Coolness war wie weggeblasen. Anscheinend brauchte er mich für den Job. Vielleicht hatte ich doch noch etwas Spielraum.
Ich sah ihn aus zusammengekniffenen Augen an. »Bevor ich mich auf den Weg mache, möchte ich ihn noch mal sehen.«
Monroe sagte nichts. Er nahm einen großen Schluck Kaffee, schluckte langsam. Uns war beiden klar, dass er Zeit gewinnen wollte. »Können Sie sich abschminken.«
»Sie kommen hier mit einem Deal an, der noch nicht mal auf einem Stück Papier steht. Einem Deal, für den ich mein Leben aufs Spiel setzen soll.« Ich warf Dakota einen Blick zu. Sie war immer noch in das Pferdebuch versunken. Ihr Milchshake war so gut wie leer. »Für den Deal werde ich meine Tochter zurücklassen müssen, und das direkt nach dem ganzen Scheiß in letzter Zeit. Da können Sie mir zumindest ein kurzes Treffen mit JT gewähren.«
Monroe presste die Zähne aufeinander. »Fletcher ist seit drei Tagen unterwegs. Sie müssen sofort mit der Suche anfangen.«
»Gleich morgen. Wenn ich vorher JT besuchen kann.«
»Verdammt noch mal, Lori.«
Ich erwiderte seinen Blick, gab nicht nach. Blinzelte nicht einmal.
Monroe atmete schwer aus. Schob sich die Sonnenbrille wieder vor die Augen und erhob sich. »Also gut. Ich kann nichts versprechen, aber ich tue, was ich kann.«
»Eines sollten Sie noch wissen.«
Monroe sah mich fragend an.
»Ich glaube, ich werde beschattet.«
2. Kapitel
Ich schaute in den Rückspiegel. Der schwarze SUV war immer noch da. Ich atmete langsam ein und aus, um meinen Puls gleichmäßig zu halten, und lächelte Dakota zu, die neben mir auf dem Beifahrersitz saß. Sie sollte nichts von meiner Sorge mitkriegen.
Aber tatsächlich war ich ziemlich beunruhigt. Der SUV folgte uns jetzt schon seit sieben Meilen. Als wir aus unserer Tiefgarage gekommen waren, hatte ich ihn am Straßenrand bemerkt. Er hatte sich fünf Autos hinter uns in den Verkehr eingefädelt und die ganze Zeit den Abstand gehalten – ohne schneller oder langsamer zu werden und ohne irgendwelche Überholmanöver zu starten. Genau das machte ihn so verdächtig.
Monroe hatte meine Befürchtungen abgetan, aber das hieß noch lange nicht, dass ich mich irrte. Der schwarze SUV verfolgte uns. Die Frage war, was er wollte. Die Angst schnürte mir die Kehle zu. Ich durfte meine Kleine nicht schon wieder einer Gefahr aussetzen.
Ich wechselte die Spur und beschleunigte. Ich musste unsere Verfolger loswerden, bevor wir in die Nähe von Camp Gilyhinde kamen. Während ich Gibson Fletcher jagte, würde Dakota in dem Summercamp in Sicherheit sein. Aber vorher musste ich unseren Schatten abschütteln.
Fünf Autos hinter uns zog der SUV in unsere Spur rüber und beschleunigte ebenfalls. Mein Magen krampfte sich zusammen. Ich musste mir etwas anderes einfallen lassen.
Ich studierte das Navi auf dem Armaturenbrett. Dann sah ich Dakota an und erklärte in bemüht unbefangenem Ton: »Ich habe eine Abkürzung zum Camp entdeckt.«
Sie antwortete nicht, lümmelte weiter auf dem Beifahrersitz. Die Arme verschränkt, den Blick starr geradeaus gerichtet, ignorierte sie mich demonstrativ. Sie wollte nicht dorthin.
»Ach komm, Schatz, sind doch nur ein paar Wochen. Drei höchstens.« In Wahrheit hatte ich keine Ahnung, wie lange ich brauchen würde, um Fletcher zu finden. Es war schwer genug gewesen, Dakota noch in dem schon laufenden Camp unterzubringen. Und die Sache war nicht gerade leichter geworden, als ich von ihren blauen Flecken erzählt hatte und woher die kamen. Um die Leute vom Camp zu beruhigen, hatte ich mich auf Monroe und seine Position als FBI-Agent berufen müssen. »Glaub mir, du wirst Spaß haben, und ehe du dich versiehst, bin ich schon wieder da.«
Dakota beugte sich vor und drehte das Radio lauter.
Ich presste die Zähne zusammen und schaute in den Rückspiegel. Der SUV war unverändert fünf Wagen hinter uns.
Ich umklammerte das Steuer fester und gab Gas, bis wir mit dem Sattelzug neben uns auf einer Höhe waren. Ich kalkulierte die Entfernung zur nächsten Ausfahrt. Ich hatte genau einen Versuch, der musste sitzen. Alles eine Frage des Timings.
Ich drehte das Radio leiser und blickte zu Dakota. Wies sie wegen meiner Anspannung harscher als beabsichtigt zurecht: »Setz dich gerade hin.«
Dakota schaute finster und verdrehte die Augen. »Warum holst du JT nicht aus dem Gefängnis? Er ist doch gar nicht böse.«
Noch dreihundert Meter bis zur Ausfahrt. Ich warf Dakota einen Blick zu. »Weil ich einen Fall habe.«
»Scheiße.«
Weil sie recht hatte, ließ ich ihr den Fluch ausnahmsweise durchgehen. »Ich würde nicht fahren, wenn es nicht superwichtig wäre.«
»Aber ich kapier nicht, wieso du wegfährst. Ist er dir egal?«
»Ist er nicht.« Noch zweihundert Meter bis zur Ausfahrt. Der SUV weiter hinter uns. Neben uns der Sattelzug. Ich musste mich konzentrieren.
Dakota drehte sich schmollend zu mir. »Aber wieso fährst du dann?«
Ich antwortete nicht. Noch hundert Meter. Ich gab Gas und schob mich eine halbe Länge vor den Laster. Achtete nur auf die Geschwindigkeit und den richtigen Winkel. Atmete gleichmäßig.
»Mama?«
»Festhalten«, sagte ich und trat das Gaspedal durch. Wir schossen nach vorn, und als der Sattelzug hinter uns war, riss ich das Steuer herum. Wir schnitten den riesigen Laster und rasten direkt auf die Ausfahrt zu. Die Reifen quietschten auf dem Asphalt. Dakota schrie auf. Der Brummifahrer stieg auf die Hupe, als wir ohne Vorwarnung und ohne zu blinken kaum eine Handbreit vor ihm rüberrauschten.
Ich schaute in den Rückspiegel. Der Lkw und ein Pick-up versperrten dem SUV den Weg, sodass er nicht rechtzeitig vor der Ausfahrt die Spur wechseln konnte.
Wir hatten ihn abgeschüttelt.
Ich atmete schwer aus.
»Mama … was … wieso hast du …?«
»Entschuldige, aber ich hätte fast unsere Ausfahrt verpasst.«
Dakota kniff die Augen zusammen. Sie glaubte mir nicht. Traurig fragte sie: »Willst du mir nicht sagen, warum du wirklich fährst?«
Der Abschied vom eigenen Kind ist immer schwer, noch mehr aber, wenn man es gerade erst wieder zurückbekommen hat. Ich wollte mich nicht von Dakota trennen, wollte sie nicht einen Moment aus den Augen lassen. Aber das ging nicht. Während ich Gibson »the Fish« Fletcher jagte und mich mit meinem mysteriösen Verfolger herumschlug, würde sie im Camp sehr viel sicherer sein als bei mir.
Von meinen Gefühlen überwältigt, konnte ich ihr nicht antworten. Ein Blick in den Spiegel: kein schwarzer SUV.
Sie legte mir eine Hand auf den Arm, drückte sanft zu. »Bitte?«
Ich sah sie an und nickte. Als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war, hatte ich ihr versprochen, immer ehrlich zu ihr zu sein. Ich wusste nur allzu gut, wie viel Schmerz Geheimnisse verursachen konnten, wie schädlich und gefährlich sie waren. »Also gut, ich erzähle dir jetzt die Wahrheit: JT steckt in großen Schwierigkeiten. Die Polizei hält ihn für einen Mörder, und ich kann ihm nur helfen, indem ich für einen wichtigen Mann diesen Job mache. Der Mann kann etwas für JT tun.«
Dakotas Augen weiteten sich, ihre Unterlippe zitterte. »Mord? Dann kriegt er vielleicht die –«
»Das werde ich verhindern«, unterbrach ich sie. »Aber deshalb muss ich weg.«
3. Kapitel
Der Ort unseres Treffens war nicht gerade besonders romantisch, aber ich war noch nie der Typ für Kerzenschein und Rosen gewesen. Bewaffnete Wachen, Metalltüren und Überwachungskameras sorgen ohne Frage für eine ganz spezielle Atmosphäre, aber durch meinen Job war ich daran gewöhnt. Als Kopfgeldjägerin lernt man die Polizeiwachen und Gefängnisse seines Countys kennen. Trotzdem war es etwas ganz anderes, JT hier zu besuchen. Es kam mir persönlich näher, und ich hatte Angst.
Durch Monroes Einfluss hatte ich nicht die üblichen sieben Tage auf eine Besuchserlaubnis für die Three Lakes Detention Facility warten müssen. Wie ich dankbar feststellte, hatte er uns ein separates Besuchszimmer besorgt. JT und ich hatten viel zu besprechen, und ich erwartete kein einfaches Gespräch.
»Kümmere dich gut um unsere Tochter.« Das waren JTs letzte Wörter gewesen, bevor ich ihn den Cops übergeben hatte. Mit diesen paar Wörtern hatte er mich wissen lassen, dass er die Wahrheit über Dakota kannte. Vier Tage war das jetzt her – mehr als genügend Zeit, um über all das nachzudenken, was ich ihm längst hätte sagen sollen.
Aber immer noch wusste ich nicht, wie. Ja, er hatte eine Tochter. Wir hatten eine neunjährige Tochter, und ich hatte es ihm verschwiegen. Schon bevor sie überhaupt geboren worden war, hatte ich mich entschlossen, dass ich ihm nie von ihrer Existenz erzählen würde. Und wenn wir uns nicht durch meinen letzten Auftrag nach zehn Jahren wiederbegegnet wären, hätte er immer noch nichts von ihr geahnt.
Das Geräusch, als hinter mir die Tür aufgeschlossen wurde, riss mich aus den Gedanken. Ich drehte mich um und sah den Wachmann reinkommen – ein junger Kerl von JTs Größe, aber rund zwanzig Pfund schwerer. Er deutete mit einem Nicken auf den Tisch und die beiden Stühle, die mitten im Raum am Boden festgeschraubt waren. »Wenn Sie sich bitte setzen wollen, Ma’am.«
Ich folgte seiner Aufforderung. Er stieß die Tür weiter auf und nickte. JT kam ins Zimmer gehinkt.
Er trug einen grauen Sweater und graue Jogginghosen. Gelblich verblassende Blutergüsse erinnerten daran, wie wir Dakota aus den Klauen von Emerson und seinen Helfershelfern befreit hatten. Aber es waren einige frische, pflaumenfarbene Blutergüsse dazugekommen.
»Was ist mit deinem Gesicht …?«
»Nichts«, sagte er und setzte sich.
Ich streckte meine Hand nach JTs Gesicht aus. »Sieht nach einer ordentlichen Portion von diesem Nichts aus.«
Der Aufseher räusperte sich. »Keine Berührungen, Ma’am.«
Ich legte meine Hand zurück auf den Tisch.
JT machte es sich auf seinem Stuhl bequem und vermied Blickkontakt. Er hatte schon wieder mächtig Ärger, so viel stand fest. Old Man Boncheses Prämie auf JTs Kopf war immer noch aktuell, also schwebte er im Gefängnis in ständiger Gefahr. Es saßen genügend Männer ein, die dem Old Man treu ergeben waren.
»Wieso bist du hergekommen, Lori?« Überrascht stellte ich fest, dass er eher resigniert als wütend klang.
»Ich musste dich sehen.«
»Mir geht es gut.«
»Klar«, sagte ich und deutete auf sein Gesicht und seinen in Schutzhaltung vor dem Brustkorb liegenden Arm. »Das sieht man.«
Er starrte mich schweigend und nicht gerade freundlich an. Es schnürte mir die Kehle zusammen. Ich hatte gedacht, wir wären uns in den drei Tagen unserer Jagd auf Dakotas Entführer nähergekommen. Die alte Leidenschaft hatte uns gepackt, und in dem Moment hatte ich den Eindruck gehabt, es würde uns beiden etwas bedeuten. Hatte ich mich geirrt?
»Ich habe einen Deal gemacht.«
Er runzelte die Stirn. »Und zwar?«
Ich schilderte ihm Monroes Forderung und erklärte ihm, warum ich mich darauf eingelassen hatte – auch wenn ich ihm nicht sämtliche Gründe nannte. Er starrte mich die ganze Zeit mit undurchdringlicher Miene an.
»Das ist also der Deal: Ich finde Fletcher. Monroe holt dich hier raus.«
JT kämmte sich mit den Fingern seine dunkelblonden Haare nach hinten, um sie sich gleich darauf wieder in die Stirn fallen zu lassen. Er schüttelte den Kopf. »Lass es sein, Lori.«
»Ganz bestimmt nicht.«
»Denk an Dakota. Du darfst dich nicht in Gefahr bringen. Nicht jetzt. Nicht wegen mir.«
»Und ob ich das darf.«
»Aber ich will das nicht.«
»Das ist nicht deine …«
»Du hast sie gerade erst zurück«, sagte er bestimmt. »Sie ist durch die Hölle gegangen – Emersons Männer haben sie entführt, sie musste mitansehen, wie ein Mann stirbt, und wäre fast mit Emersons Boot im Sumpf untergegangen.« Er fixierte mich. »Und dann die Begegnung mit mir.«
Ich blickte auf den Tisch. Studierte die Risse in der Kunststoffplatte. »Der Staatsanwalt sagt, er wird die Todesstrafe fordern. Der will auf deinem Rücken Karriere machen, und das werde ich nicht zulassen. Ich musste Monroe …«
»Ich habe dich nicht darum gebeten.«
»Das war auch nicht nötig.«
Er seufzte.
»Ich kapier nicht, wieso du dich opfern willst. Wir hatten einen Plan, warum also gestehst du diesen ganzen Mist? Warum lügst du?«
JT warf dem Aufseher einen kurzen Blick zu, dann schüttelte er kaum wahrnehmbar den Kopf.
Traue niemandem. Niemals. Seine erste Regel. Entweder wollte er einfach nicht mit mir darüber reden, oder manche der Aufseher gehörten ebenfalls zu den Getreuen des Old Man. JTs Verhalten nach traf beides zu.
Ich war sauer, und ich hatte Angst. Mein Magen spielte verrückt. Ich knallte die Hände auf den Tisch. Ich hatte genug von diesem einsilbigen Gespräch, brauchte eine eindeutige Antwort von JT. Für irgendwelche Unklarheiten stand viel zu viel auf dem Spiel. »Genug geschwiegen.«
Er schob seine Hände über den Tisch, bis seine Fingerspitzen fast meine berührten. »Wie geht es Dakota?«, fragte er sanfter.
Ich schnaufte durch. »Die Wahrheit? Nicht so gut. Sie spricht nicht über das, was passiert ist.«
»Versteh ich. Die drei Tage hätte keiner einfach so weggesteckt. Und sie ist noch ein Kind.« Er wirkte nachdenklich. »Aber sie ist stark, wie ihre Mutter. Lass ihr Zeit. Sie wird schon sprechen, sobald sie bereit ist.«
Ich nickte. Er hatte recht. Aber das machte es nicht leichter. Ich sah ihm in die Augen. »Was du gesagt hast, dass Dakota deine …«
»Nicht, Lori. Okay? Nicht hier, nicht jetzt.«
Ich starrte ihn an. Nur allzu gern hätte ich ihm erklärt, warum ich ihm nie von seiner Tochter erzählt hatte: dass ich nur mir selbst traute, weil Männer einen meiner Erfahrung nach immer enttäuschten und man sich deswegen besser gar nicht erst auf sie einließ. Ich musste ihm von ihrer Krebserkrankung erzählen und ihm sagen, dass der Krebs jederzeit wieder ausbrechen konnte, auch wenn Dakota momentan keine Symptome zeigte. Dass er am ehesten für eine Knochenmarkspende infrage kam. Aber so konnte ich dieses Gespräch nicht führen, nicht, wenn er mauerte und ich deswegen wütend und verwirrt war. Also sagte ich nichts.
Er atmete schwer aus. »Du solltest gehen.«
»Ich bin doch gerade erst …«
»Du hättest gar nicht kommen sollen«, unterbrach er mich bestimmt. »Geh, Lori. Bitte.«
Die Zurückweisung versetzte mir einen Stich. Ich biss mir auf die Zunge, um mir nichts anmerken zu lassen. »Ich mache das nur, damit du hier schnell rauskommst. Damit sie nicht …«
Er schüttelte den Kopf. »Ich will nicht, dass du dich auf den Deal einlässt.«
»Ich hab’s kapiert.« Wütend stützte ich mich mit den Händen auf dem Tisch ab und sprang hoch. »Aber deswegen höre ich noch lange nicht auf dich.«
Ich marschierte davon und ließ JT zurück in diesem trostlosen Kabuff mit festgeschraubtem Tisch und Stühlen. Der Aufseher nickte mir zu, als ich an ihm vorbeirauschte. Ich ignorierte seinen mitleidigen Blick.
Wie in Trance passierte ich die Kontrollen und Sicherheitsschleusen. JT konnte sagen, was er wollte, ich würde den Deal annehmen. Das war das einzig Richtige, ich musste es tun. Natürlich hätte ich ihm von Dakotas Krankheit erzählen sollen, aber dazu hatte ich mich viel zu sehr über ihn aufgeregt. Für diesen Quatsch hatte ich keine Zeit. Er musste überleben, schon für unsere Tochter, und verdammt noch mal, genau dafür würde ich sorgen. Alles andere lag in den Händen des Schicksals.
Die letzten beiden Tore fielen hinter mir zu und entließen mich in das grelle Sonnenlicht. Ich atmete die frische, warme Luft ein, die sehr viel angenehmer war als der Gefängnismief. Mir stand noch einmal der übel zugerichtete JT in seinen Gefängnisklamotten vor Augen. Aber dann schluckte ich Erinnerung und Mitleid hinunter. Ich musste stark bleiben. Die Arbeit wartete.
Ich war so versunken in meine Gedanken, dass ich es erst kurz vorm Pick-up bemerkte. Mir stockte der Atem, und ich blieb wie angewurzelt stehen. Sah mich um.
Die Fahrertür stand offen.
Ich holte den Taser aus dem Holster und trat zum Pick-up. Ließ den Blick schweifen, ob sich irgendetwas regte.
Nichts.
Verdammte Scheiße, was hatte das zu bedeuten?
4. Kapitel
Am zweiten Tag im Gefängnis hatte JT die Geschichten das erste Mal gehört. Nichts Konkretes, nur Gerüchte, die ihm beim Ausgang zugetragen wurden, und zwar immer von einem dieser nervösen Typen, die bei einem harten Kerl unterkriechen wollten.
»Jemand hat eine Prämie auf deinen Kopf ausgesetzt.«
Ach nee. Erzähl mir was Neues.
»Sie wurde gerade verdoppelt.«
Dann werden die Dummen unter euch also bald ihr Glück versuchen.
»Es heißt, du hast Thomas Ford nicht umgebracht. Dass das eine Frau war.«
JT antwortete nicht. Drehte sich weg, Ober- und Unterkiefer so fest aufeinandergepresst, dass ihm die Zähne wehtaten.
Schon bald wandten die nervösen Angsthasen sich von ihm ab. Sie hatten erkannt, dass er sie nicht beschützen würde. Von Günstlingen hielt er nichts, blieb für sich.
Er fing keinen Streit an. Diesem Grundsatz blieb er drinnen so treu wie draußen. Aber wenn ein anderer Streit suchte, würde er sich ganz bestimmt nicht wegducken. Das hatte er auch den beiden Typen klargemacht, die es probiert hatten. Aber sie hatten ihm nicht geglaubt.
Er musterte seine Fingerknöchel. Lila und schwarz lagen sie auf der schiefergrauen Jogginghose. Er dachte an Loris verletzten und verwirrten, aber auch wütenden Gesichtsausdruck, als er ihre Frage nach den Blutergüssen ins Leere hatte laufen lassen. Aber wenn er ihr auf diese erste Frage geantwortet hätte, wären unweigerlich weitere Fragen gefolgt. Und die Antworten darauf hätte er ihr nicht in dem Besuchsraum geben können, die waren nur für ihre Ohren bestimmt. Deshalb war es klüger gewesen, gar nichts zu sagen.
Er beugte die Finger. Zuckte zusammen. Es würde einige Tage dauern, bis die Schwellungen abgeklungen sein würden.
Der Ärger war zwei Stunden vor Loris Besuch losgegangen. Kaum dass die Zellen für den Morgenausgang geöffnet worden waren, hatte sich sein abgesehen vom donnernden Schnarchen durchaus erträglicher Zellengenosse verdrückt.
Gleich darauf kamen zwei Kahlrasierte in die Zelle spaziert, der eine groß und sehnig, der andere schwer und massig. Beide zum Kampf bereit.
»Was gibt’s?«, fragte JT. Er blieb auf seinem Bett hocken und tat völlig unbeteiligt.
Der Sehnige erklärte mit leicht weinerlichem Näseln: »Hamm gehört, du hast unsere Brüder gekillt. Erst Thomas Ford.«
JT erwiderte nichts, verzog keine Miene bei dem Namen von Loris Ex-Mann.
Der Sehnige fuhr fort: »Dann Gunner Zamb. Richie Royston. Johnny Matthews.«
JT kannte alle drei Namen. So hatten die Fußsoldaten des Miami-Mobs geheißen, die ihn die Woche zuvor in West Virginia gefangen gehalten hatten, weil Ugo Nolfi, einer von Old Man Boncheses Top-Vollstreckern, ihn hatte abholen sollen. Nur dass Lori ihn vorher da rausgeholt hatte. Als sie gefahren waren, hatten sie die drei gefesselt, aber lebendig zurückgelassen.
»Als ich von der Ranch weg bin, haben sie noch geatmet.«
Der Sehnige warf seinem kräftigen Kumpan einem Blick zu, bevor er wieder JT fixierte. »Was ist mit Ugo Nolfi? Hab gehört, du hast ihn in einem Vergnügungspark abgeknallt? Das ist doch pervers.«
JT presste die Zähne zusammen. Ugo Nolfi war ein guter Kerl gewesen. Sie hatten sich auf einen Handel geeinigt, aber bevor Ugo dem Old Man davon hatte erzählen können, war er von Emersons Lakaien abgeknallt worden. »Das war ich nicht.«
Der kräftige Typ neigte den Kopf zur Seite. »So, so, das war er also nicht? Dann spuck was aus über die Schlampe.«
JT ballte die Hände. Einen Scheiß würde er ihnen über Lori erzählen. »Fangt nichts an, was ihr nicht zu Ende bringen könnt.«
Sie pfiffen auf seine Warnung. Grinsend ließ der Sehnige die Knöchel knacken. Spätestens in dem Moment war klar, dass es auf einen Kampf hinauslief.
Zwei Gegner waren kein großes Problem. Nicht viel anstrengender als ein Sonntagsspaziergang im Park, auch wenn er von der Emerson-Sache angeschlagen und die Schusswunde in seinem Oberschenkel noch nicht verheilt war. Egal. Er allein gegen zwei: Mit einer schnellen Eins-Zwei-Kombination knockte er den Kräftigen an, bevor er den Sehnigen mit einem Aufwärtshaken und einem Roundhouse-Kick zu Boden brachte. Der Erste bettelte nach mehr, und mit drei rechten Haken erledigte JT ihn endgültig.
JT schätzte, dass beide höchstens einen Schlag gelandet hatten, aber deswegen ein schlechtes Gewissen? Wieso? Hatte er sie etwa nicht gewarnt? Sein Motto war: Wenn du zuerst zuschlägst, schlag ich zuletzt.
Er hatte immer schon auf sich selbst aufpassen können und würde es immer können. Aber Old Man Boncheses Männer hatten Loris Namen ins Spiel gebracht, hatten sie mit den toten Mafiosi in Verbindung gebracht, und das bereitete ihm Kopfzerbrechen. Diese Typen würden die Sache kaum auf sich beruhen lassen. Und aus einer Gefängniszelle heraus konnte er nichts für Lori tun.
5. Kapitel
»Haben sie viel gestohlen?« Monroe ließ sich neben mir auf die Parkbank sinken und hielt mir einen Eistee hin. Es wirkte wie ein Friedensangebot, als wollte er mir auf diese Weise sagen, dass er meine Sorgen wegen der Beschattung endlich ernst nahm. Aber jetzt war es verdammt noch mal zu spät.
Ich nahm den Plastikbecher entgegen und schüttelte den Kopf. »Meine Sachen wurden durchwühlt, aber es hat nichts gefehlt.«
»Wir haben den Wagen nach Wanzen durchsucht. Und haben das hier gefunden.« Er reichte mir ein schwarzes Kästchen, fünf Zentimeter lang und gut einen Zentimeter breit. »War ganz hinten unterm Armaturenbrett versteckt.«
»Ein GPS-Tracker?« Das erklärte, warum ich keine Verfolger entdeckt hatte, als ich am Morgen zu Hause aufgebrochen war. Sie konnten am Bildschirm an mir dranbleiben, auch ohne mich zu sehen. »Wieso haben sie den Wagen aufgebrochen? Statt einfach einen magnetischen Tracker unterm Kotflügel zu befestigen?«
Er zuckte mit den Schultern. »Vielleicht dachten sie, dass Sie den Tracker im Wagen nicht so leicht bemerken. Diese Typen haben wohl nicht damit gerechnet, dass Sie so schnell zurückkommen. Und dann mussten sie vom Wagen verschwinden, obwohl sie noch nicht fertig waren.«
»Sie wissen, dass mein Besuch kurz war?«
»Meinem Kontakt zufolge sind Sie nicht einmal eine halbe Stunde geblieben …«
»Stimmt.«
»Und, waren Sie zufrieden mit dem Treffen?«
Ich nahm einen Schluck Eistee. Ob ich mit dem Treffen zufrieden war? Alles andere als das. Nicht, dass mich das überrascht hätte. Es war sinnlos, von einem Mann zu träumen. Das wusste ich, und trotzdem war ich dem Moment erlegen und hatte mir ein Happy End ausgemalt. Dabei waren Happy Ends reine Fantasie, ein Blödsinn, den hoffnungslose Romantiker und Grußkartenhändler sich ausgedacht hatten. Ich würde mich damit zufriedengeben müssen, wenn JTs Leben – und damit möglicherweise auch Dakotas – nicht jetzt schon zu Ende ginge. Von einem Happy End konnte keine Rede sein.
Ich erwiderte Monroes Blick. »Ich habe ihm von unserem Deal erzählt.«
Monroe nickte. »Dann sind Sie bereit?«
Ich taxierte ihn. Er hatte seine unvermeidliche Sonnenbrille auf, sodass ich seine Miene nur schwer einschätzen konnte. Sein Anzug schien ein wenig zerknitterter als sonst. Ich fragte mich, wieso er den Ort hier am Rand des Palatlakaha River National Parks vorgeschlagen hatte. Mir persönlich war es durchaus lieber, draußen in der Hitze zu schwitzen als mich irgendwelchen Dresscodes und Klimaanlagen auszusetzen. Aber er hätte vermutlich lieber irgendwo drinnen gehockt.
»Wie kommt’s, dass wir uns nicht in Ihrem Büro treffen?«
»Weil das hier keine offizielle Operation ist – Sie sind so was wie eine freie Mitarbeiterin, keine Agentin.«
Natürlich. Ich war entbehrlich, ein Mittel zum Zweck, das hatte er mir von Anfang an klargemacht. Seine Offenheit war mir sympathisch. Immerhin wusste ich so, woran ich war. »Dann lassen Sie mal hören, was Sie mir von Gibson Fletcher zu erzählen haben.«
»Sie haben ihn ja schon mal zurückgeholt, also wissen Sie, dass er immer als kleiner Gelegenheitsdieb galt, der bei Jachtbesitzern und Touristen an Floridas Küsten mitnimmt, was er kriegen kann. Bis zu dem Einbruch auf der Jacht von Patrick Walker aus Chicago, der mit seiner Frau Alisa und seinen achtjährigen Zwillingstöchtern Hayley und Ana auf den Keys im Urlaub war. Fletcher hat einen Fehler gemacht und wurde von der zurückkommenden Familie überrascht. Er verlor die Nerven, knallte Mr. und Mrs. Walker ab und ließ die blutbeschmierten und schockstarren Mädchen zurück.« Monroe nahm einen Schluck Eistee. »Das Innere der Jacht glich einem gottverdammten Schlachthof.«
Ich senkte den Kopf und dachte an die beiden Mädchen, die den brutalen Mord an ihren Eltern hatten miterleben müssen. Sie waren damals ein Jahr jünger gewesen als Dakota jetzt. Kein Wunder, dass sie in Schockstarre gefallen waren.
»Was ist mit den Mädchen passiert?«
Monroe winkte ab, als würde ihn ihr Schicksal nicht groß kümmern. »Sie wurden von Mrs. Walkers Eltern aufgenommen. So wie ich gehört habe, fiel ihnen die Eingewöhnung schwer. Hatten bis dahin wohl nicht viel Kontakt zu ihren Großeltern.«
Als Zwillingskinder hatten die beiden Mädchen immerhin einander, trotzdem: War es nicht grausam, sie gleich nach einer solchen Tragödie zu mehr oder weniger Fremden zu schicken? Mir wurde ganz übel, als mir klar wurde, dass ich nichts anderes gemacht hatte, indem ich Dakota ins Camp gesteckt hatte. Sie hatte noch nicht einmal eine Schwester, sondern war in einer fremden Umgebung allein unter Fremden.
Ich unterdrückte mein schlechtes Gewissen und beruhigte mich damit, dass sie ja nicht lange dortbleiben musste. Nach dem letzten Auftrag durfte ich sie auf gar keinen Fall noch einmal mitnehmen, egal, wie leicht ein Job erscheinen mochte. Was den Abschied von ihr nicht einfacher gemacht hatte. Ihre Unterlippe hatte gebebt, als sie mir zugeflüstert hatte: »Pass auf dich auf, Mama.« Ich hatte mich gefühlt, als würde mein Herz zusammengequetscht.
Ich holte tief Luft und schob die Erinnerung ganz weit weg. Nur mein Job zählte, ich musste ihn schnell erledigen, um dann zu Dakota zurückzukehren.
Ich sah Monroe an. »Weswegen ist er so ausgetickt? Er ist noch nie wegen Gewalttaten aufgefallen. Das habe ich beim letzten Mal gecheckt.«
»Wir wissen es nicht. Er hat weder vor Gericht noch danach irgendetwas gesagt. Aber Fletcher war mehr als ein Gelegenheitsdieb, und von seinem anderen Geschäftszweig steht nichts in den Akten.«
»Ach ja?«
Monroe wartete, bis eine sich über den richtigen Weg streitende Wandergruppe vorbei war, bevor er fortfuhr: »Er hatte sich auf Antiquitäten spezialisiert. Er hat besondere Stücke gefunden und besorgt.«
Das war mir neu. »Zum Beispiel?«
»Die Liste ist lang, aber aufmerksam wurden wir auf ihn wegen eines Sets von Schachfiguren, die in den Achtzigern beim Spiel zweier heutiger Legenden in Vegas zum Einsatz kamen. Das damals aktuelle Wunderkind forderte den alten Herrscher heraus. Die Partie fand im Herbst 1989 statt: Christophe Lenon und Bradley Eston. Erst durch seinen damaligen Triumph wurde Eston zu der Berühmtheit, die er heute ist. Die Partie war zu ihrer Zeit die glamouröseste und kostspieligste, die die Welt je gesehen hatte. Die Figuren waren wahre Kunstwerke.«
Ich nickte. Erinnerte mich vage. »Das Milliarden-Duell?«
Monroe nickte. »Jepp.«
»Und was ist mit den Schachfiguren passiert?«
»Ein Privatsammler hat sie bei einer Auktion ersteigert, dann hat man nichts mehr von ihnen gehört, bis sie aus der Sammlung verschwanden – zehn Tage, bevor Fletcher wegen kleinerer Diebstähle aus den Kabinen der Touristenjacht Sunsearcher verhaftet wurde. Die Figuren sind nicht wieder aufgetaucht.«
»Ich verstehe schon, das Spiel war eine Menge wert. Trotzdem: Was interessiert das FBI ein Diebstahl?«
»Sorry. Aber das ist Need-to-know: Sofern Sie es nicht unbedingt wissen müssen, darf ich Ihnen das nicht verraten.«
Er wirkte tatsächlich so, als würde es ihm leidtun, trotzdem würde ich diesen FBI-Quatsch nicht einfach so hinnehmen. »Soll heißen, dass ich es nicht unbedingt wissen muss?«
»Für Ihren Job ist das ohne jede Bedeutung.«
»Ach ja? Da bin ich anderer Meinung.« Genervt unternahm ich einen weiteren Vorstoß. »Warum haben Sie ihn nicht verhaftet, wenn Sie wussten, dass er diesen wertvollen Kram klaut?«
Monroe atmete aus. Schob sich die Sonnenbrille auf der Nase nach oben. »Wir hatten keine Beweise. Nichts, wodurch sich Fletcher eindeutig mit den gestohlenen Antiquitäten in Verbindung bringen ließ.«
Ich nahm einen Schluck von meinem Eistee. Runzelte die Stirn. »Aber Sie waren mit dem Fall beschäftigt, bevor Fletcher festgenommen wurde, stimmt’s?«
Monroe rutschte neben mir auf der Bank hin und her. Antwortete nicht.
»Stimmt also.«
Er kippte den Rest seines Eistees hinunter. Leerte das Eis auf den Rasen aus und zerknüllte den Plastikbecher. »Ich darf Ihnen nichts über den Fall erzählen, an dem ich dran war. Nur so viel: Meine Spur wurde kalt, kaum dass Fletcher verhaftet war.«
Ich schaute ihn von der Seite an. »Dann geht es also nicht nur darum, einen gefährlichen Verbrecher wieder hinter Gitter zu bringen?«
Fletcher schwieg einen langen Moment, dann schüttelte er den Kopf. »Bevor er zurück in den Hochsicherheitsknast wandert, will ich ein Tête-à-Tête mit ihm. Eine kurze Auszeit, von der niemand etwas weiß.«
Hier ging es nicht nur um etwas Berufliches, das verriet mir sein Tonfall. Dahinter musste etwas Persönliches stecken. »Warum?«
Monroe starrte mich an, schweigend und mit bis auf die tiefen Stirnfalten unbewegter Miene. Durch seine dunklen Brillengläser konnte ich seine Augen nicht sehen.
»Schon gut, Sie müssen nichts sagen. Need-to-know, richtig?«
Er nickte, sein Ausdruck nach wie vor undurchdringlich.
Um herauszufinden, was er hinter seiner Sonnenbrille verbarg, würde ich behutsam vorgehen müssen. Ich kannte Monroe seit einer Woche, und ich schätzte ihn nicht nur als clever ein, sondern auch als vorsichtig – eine schwer zu knackende Mischung. Ich hätte ihn gerne härter angefasst, aber in dem Moment erschien es mir nicht ratsam, auch wenn eine persönliche Beziehung zwischen Flüchtigem und Ermittler alles nur noch komplizierter machte.
Also wechselte ich das Thema. »Sie haben erzählt, dass Fletcher nach einer Operation floh?«
»Genau. Nach einer Prügelei auf dem Hof wurde festgestellt, dass sein Blinddarm geplatzt war. Der Arzt in der Anstalt bekam die Komplikationen nicht in den Griff, also wurde er zur Notversorgung ins Krankenhaus gebracht. Die OP verlief erfolgreich. Und ein paar Stunden später hat Fletcher erst drei Wachleute getötet und dann die Marshals abgeschüttelt.«
»Wie hat er die Wachleute umgebracht?«
»Er hat einen Zusammenbruch simuliert. Als der erste Wachmann seine Atmung kontrollieren wollte, hat er ihm die Waffe abgenommen und ihn aus kürzester Entfernung erschossen. Dann hat er sich von den Handschellen befreit und die beiden anderen abgeknallt, kaum dass sie ins Zimmer gestürmt kamen. Das ganze Magazin hat er leer geballert. Eine Riesensauerei.«
»So wie auf der Walker-Jacht?«
»So in etwa.«
»Schon bemerkenswert für jemanden, der gerade eine schwere Operation hinter sich hat. Sicher, dass er keine Hilfe hatte?«
Monroe schüttelte den Kopf. »Die Cops haben nichts gefunden, was darauf hinwies. Und auch keine Spur von ihm.«
Ich sah ihn scharf an. »Die Cops vielleicht nicht. Und Sie?«
»Wir wurden erst spät hinzugezogen. Fast vierundzwanzig Stunden nach der Tat. Das übliche Kompetenzgerangel. Die örtliche Polizei wollte den Fall nicht abgeben.«
»Aber?«
»Fletcher hatte definitiv die Staatsgrenze überquert. Und damit wurde es zu einem FBI-Fall.«
Ich nickte. »Wissen Sie, in welche Richtung er den Staat verlassen hat?«
Monroe lächelte verhalten. »Noch besser. Ich habe einen genauen Ort.«
»Wofür brauchen Sie dann mich? Holen Sie ihn doch selbst.«
Das Lächeln verschwand von seinen Lippen. »So einfach ist das nicht.«
Das ist es nie. Aber je komplizierter etwas ist, desto größer ist die Gefahr, dass es schlecht ausgeht. Mein Magen krampfte sich zusammen. Ich fixierte Monroe. »Schon klar, Sie wollen eine kurze Auszeit. Wenn Sie ihn selbst festnehmen, müssen Sie ihn direkt abliefern, ohne Umweg und inoffizielle Plauderstunde. Aber durch mich können Sie den Zeitrahmen ein bisschen flexibler gestalten. Für Sie bin ich eine nützliche Idiotin, oder?«
»Lori, es ist …«
»Einfach ekelhaft. Sie setzen mich mit JTs Lage unter Druck, damit Ihre Hände schön sauber bleiben.« Meine Finger schlossen sich fester um den Eisteebecher, und ich hörte das Plastik knacken. »Das gefällt mir nicht, und ich mache alles andere als gern mit. Eins jedenfalls müssen Sie mir versprechen, ganz egal, was Sie noch für eine Rechnung mit Fletcher offen haben: dass Sie nicht plötzlich Selbstjustiz üben, wenn ich ihn bei Ihnen abliefere. Ich will nicht noch einmal Blut an den Händen haben. Verstanden?«
»Es ist nicht, wie …«
»Ich habe Sie um etwas gebeten. Entweder Sie geben mir Ihr Wort oder ich bin weg.«
Monroe starrte mich an, wollte wahrscheinlich rausfinden, ob ich bluffte. Er strich sich über seine eigensinnigen Haare – ein nervöser Tick – und atmete tief durch. »In Ordnung, ich geben Ihnen mein Wort. Fletcher kehrt in einem Stück ins Gefängnis zurück. Ich will nur mit ihm sprechen.«
Ich fixierte ihn noch ein paar Augenblicke, dann nickte ich. »Also gut.«
Der Bluff hatte sich gelohnt – falls Monroes Wort etwas wert war. Denn das war meine einzige Garantie dafür, dass er die Vorwürfe gegen JT tatsächlich aus der Welt schaffen und die Sache zwischen ihm und Fletcher nicht blutig enden würde. Man sollte niemals so viel von einem Versprechen abhängig machen, aber in dem Fall musste ich das Risiko eingehen. Denn außer uns gab es nur noch einen einzigen lebenden Zeugen dafür, dass JT nicht auf den State Trooper geschossen hatte: das Opfer selbst. Nur, dass der Mann im Koma lag und es den Ärzten zufolge nicht gut aussah. Sollte er sich nicht erholen oder sich nicht mehr erinnern können, was passiert war, wäre der Deal mit Monroe die einzige Möglichkeit, um JT aus dem Gefängnis rauszuholen.
»Also, wo ist Fletcher?«, fragte ich.
»Wo er im Augenblick ist, weiß ich nicht. Aber vor zwei Tagen wurde er bei einem kleinen Flugplatz unweit von San Diego gesehen. Dort endet die Spur.«
Vermutlich war Fletcher zur Grenze unterwegs. Aber weshalb ein Zwischenstopp in Kalifornien? »Erzählen Sie mir von Ihrem Informanten in San Diego.«
Monroe erwiderte nichts.
»Wie, auch das ist Need-to-know? Schluss mit dem Quatsch! Wenn ich den Job machen soll, müssen Sie mir etwas geben!«
Monroe schien angestrengt nachzudenken. Schließlich nickte er. »Mein Informant ist ein junger Kerl und arbeitet bei der Luftfracht am Flugplatz. Er hat ihn mit dem Handy fotografiert.«
»Schicken Sie mir das Bild. Und den Namen des Mannes.«
Monroe stand Schweiß auf der Stirn. Nach einer langen Pause sagte er: »Okay.«
»In den letzten zwei Tagen ist er dort nicht mehr gesehen worden?«
Monroe schüttelte den Kopf. »Genau. Damit endet die Geschichte.«
»Und ich soll die Fortsetzung schreiben?«
»So in etwa. Und, machen Sie es?«
Ich hatte Dakota sicher im Camp abgeliefert und JT von dem Deal erzählt. Meine Einsatztasche war fertig gepackt. Taser und Handfesseln waren bereit. In meinem Magen kribbelte die übliche Vor-Einsatz-Nervosität. Ich hatte gar keine Wahl, ich musste das durchziehen. Konnte es mir nicht leisten, Monroe zum Teufel zu wünschen und zu verschwinden. Ich musste den Job machen, für JT und meine Tochter.
»Aber sicher doch.«
Er nickte. Reichte mir ein Ticket. »Sie fliegen ab Tampa. Abflug 17:15 Uhr. Seien Sie nicht zu spät. Wir haben ein Zimmer für Sie reserviert.« Er gab mir eine ausgedruckte Buchungsbestätigung für das Carlsbad North Inn. »Ein Hotel in der Nähe vom Flugplatz. Sauber, nett, unauffällig. Ein guter Stützpunkt, denke ich.«
»Danke.«
Aus seiner Sakkoinnentasche holte er ein Burner Phone – ein nicht registriertes, altmodisches Prepaid-Tastengerät. »Melden Sie sich hiermit bei mir. Halten Sie mich täglich zweimal auf dem Laufenden, um acht Uhr morgens und acht Uhr abends. Meine Nummer finden Sie in den Kontakten. Ist die einzige, die gespeichert ist.«
»Was ist mit der Nummer des Informanten in San Diego?«
Monroe wirkte leicht gereizt. »Ich schicke Ihnen seine Kontaktdaten.«
Ich nickte.
»Sollten Sie sich nicht zur verabredeten Zeit melden, gehe ich davon aus, dass Sie in Schwierigkeiten stecken.«
»Und in dem Fall muss ich sehen, wie ich zurechtkomme?«
»Fassen Sie Fletcher für mich, Lori. Schnell.«
Ich steckte Unterlagen und Telefon ein. »Ich melde mich, wenn ich angekommen bin.«
Monroe nickte und ließ den Blick über die Wiese zum See schweifen. Ich verstand das als Zeichen, dass unser Treffen beendet war. Also erhob ich mich und ging zum Parkplatz, während ich über meinen nächsten Schritt nachdachte.
Irgendjemand beschattete mich, und ich wusste weder wer noch warum. Ich hatte einen Flüchtigen und einen Ausgangspunkt für meine Suche, aber keine weiteren Hinweise. Warum war Fletcher nach San Diego? Wieso hatte er es riskiert, in einen anderen Staat zu fliegen, und war nicht direkt aus Florida nach Mexiko, seinem vermutlichen Ziel? Ich hatte keine Ahnung. Noch nicht. Aber wenn ich den Grund für seinen Zwischenstopp in Kalifornien herauskriegte, wäre das schon mal ein großer Schritt.
Als ich das erste Mal hinter Fletcher her gewesen war, hatte ich mit einem pensionierten Privatdetektiv zusammengearbeitet. Wenn mir irgendjemand helfen konnte herauszufinden, was Fletcher in Kalifornien wollte, dann er.
Mein Flugzeug ging in sechs Stunden. Sollte das Schicksal es ausnahmsweise einmal gut mit mir meinen, würde ich den alten Detektiv dort finden, wo er auch beim letzten Mal gewesen war: in der Deep Blue Marina in Tampa.
6. Kapitel
In der Marina herrschte eine friedliche Atmosphäre.
Die Fahrt dorthin war problemlos verlaufen, immer die I-4 entlang, an Polk City vorbei und schließlich durch Brandon von unten nach Tampa rein. Keine Spur von dem schwarzen SUV. Gegen Mittag kam ich in der Stadt an. Die Sonne brannte erbarmungslos vom Himmel.
Ein Stück vor mir machte ich am Straßenrand das Schild der Deep Blue Marina aus: Ein grinsender Fisch zeigte auf einen orangefarbenen Schriftzug vor leuchtend blauem Hintergrund. Ich bog über die Gegenfahrbahn zum offenen Tor ab und fuhr direkt dahinter scharf links auf den Parkplatz.
Ich stellte den Motor aus und ließ den Blick über die an den Anlegestellen schaukelnden Bootsreihen hinaus aufs Meer gleiten. Alles war so, wie ich es in Erinnerung hatte. Die Marina war sauber und gepflegt, aber nicht so herausgeputzt wie manch andere – hier fanden sich eher Hausboote und die kleinen Jachten von Ortsansässigen, nicht die großen Ausflugsboote und Millionärskähne wie im touristischen Stadtzentrum. Die entspannte Atmosphäre entsprach mehr meinem Geschmack.