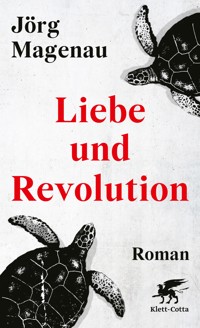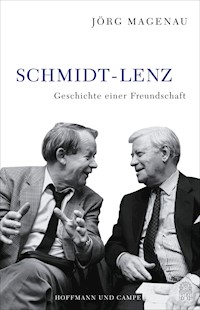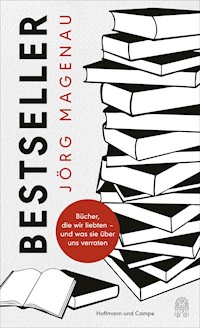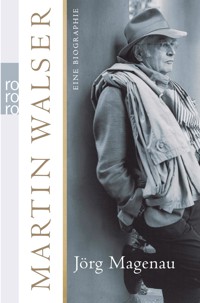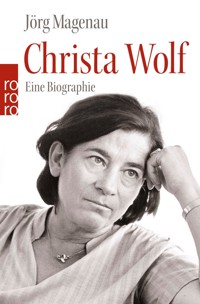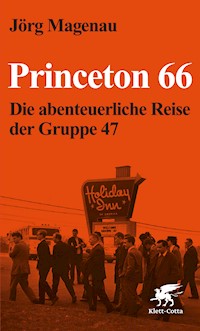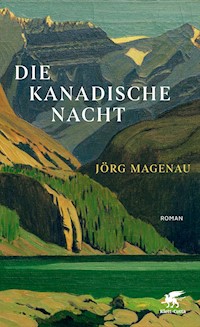
15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Shortlist Buch des Jahres des Jahres 2021 Belletristik-Couch.de »Jörg Magenau hat einen modernen, einen klugen Künstlerroman geschrieben, einen Roman einer unruhigen Biografie in einer unruhigen Familie.« Saša Stanišic Ein tief berührendes Buch über Abschiede und den Trost des Neubeginns. In seinem ersten Roman blickt Jörg Magenau auf das Leben eines Mannes, der erzählend zu sich selbst reist. Aus einer inneren Enge in ein weites, wildes Land. In Kanada liegt der Vater im Sterben. Die Nachricht trifft seinen Sohn in einer Krise. Hinter ihm liegt ein gescheitertes Buchprojekt. Seit Jahrzehnten hat er den fernen Vater nicht gesehen, nun überquert er Atlantik und Rocky Mountains, um ihn hoffentlich noch lebend anzutreffen. Doch was ist überhaupt ein Leben? Was weiß man von einem fremd gebliebenen Vater, von der Liebe der anderen und der eigenen? Und wie schreibt man darüber? Die Fahrt durch die kanadische Nacht führt den Erzähler immer tiefer in die eigene Herkunft und hinaus ins Offene. Als er den Vater erreicht, geht etwas zu Ende, aber etwas Neues beginnt auch: die Suche nach dem, was trotz aller Vergänglichkeit bleibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jörg Magenau
Die kanadische Nacht
Roman
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: ANZINGER UND RASP Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung eines Fotos von © akg-images
Datenkonvertierung: C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98403-3
E-Book: ISBN 978-3-608-12082-0
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Für meine SchwesternBettina und Anne
Nämlich zu Haus ist der GeistNicht im Anfang, nicht an der Quell. Ihn zehret die Heimat.Kolonien liebt, und tapfer Vergessen der Geist.
Friedrich Hölderlin
Von seinen Wahlverwandtschaften sagt er,dass darin kein Strich enthalten, der nicht erlebt,aber kein Strich so, wie er erlebt worden.
Eckermann, Gespräche mit Goethe
Hinter mir lag ein schlechtes Ende und vor mir ein Abschied. Dazwischen nur noch die Berge. Seit einer Stunde fuhr ich meinem sterbenden Vater entgegen, auf dem Highway 1 westwärts, wo am Horizont als graublauer Streifen die Rocky Mountains zu erkennen waren, doch ich hatte nicht den Eindruck, ihnen wenigstens schon ein kleines bisschen näher gekommen zu sein. Schmutzige Schneereste lagen rechts und links der Fahrbahn, die sich sanft gehügelt durch eine braune, trostlose Prärielandschaft zog. Ab und zu ein paar Pferde auf unermesslichen Weiden. Hin und wieder geduckte Häuser mit rauchendem Schornstein oder kleine, weit verstreute Siedlungen. Kein Grün, nirgends. Der Winter hatte die Erde verwüstet, und er hatte noch lange nicht genug. Mit Schnee und Eis könnte er in diesen Höhen bis in den Mai hinein jeden Tag zurückkehren, grimmig wie eine marodierende Soldatenhorde.
Natürlich hätte mir klar sein müssen, dass mein Buch nie erscheinen wird. Man schreibt nicht ungestraft über zwei Liebende, ob tot oder lebendig, sei es eine Tragödie wie bei Romeo und Julia, ein Idealbild wie bei Hyperion und Diotima, ein Politikum wie bei John Lennon und Yoko Ono oder Hollywood wie bei Richard Burton und Liz Taylor. Auch wenn sich das irdische Leben und Lieben nicht in solchen Götterhimmeln abspielt, findet sich eine Sehnsuchtsprise davon in jeder Geschichte. Ich war naiv genug gewesen, mich darauf einzulassen, obwohl es immer ein Gewaltakt ist, Menschen in Figuren, ihr Leben in Text und ihre Liebe in etwas so Fragwürdiges wie eine Erzählung zu verwandeln. Wer über jemanden schreibt, nimmt ihm etwas weg, nicht zuletzt seine Wahrheit. Dass meine Malerin sich dringend eine Biographie ihres Dichters wünschte, um ihn dem Vergessen zu entreißen, änderte daran nichts. Ich benutzte ihrer beider Leben als Stoff, und schon das war unredlich, verkehrt. Ich hatte mit dem Buch Schiffbruch erlitten und mit ihr, der Malerin, erst recht.
Die Zeit drängte, ich hatte mindestens sechs Stunden Fahrt vor mir und war schon jetzt so müde, wie ich es auch zu Hause mitten in der Nacht gewesen wäre. Der Flughafenzubringer in Frankfurt hatte auf dem Display »Calgary. Letzter Bus« angekündigt, als ob man vor dem Weltuntergang noch rasch die ganze Strecke stehend in diesem unförmigen Vehikel zubringen müsste, auf langer Fahrt übers Meer und den angrenzenden Kontinent. Der Flug war um 15 Uhr Ortszeit in Calgary gelandet, die Uhr war einfach stehen geblieben unterwegs, auch die Sonne hatte sich hinter den Fenstern der Maschine kaum bewegt, bis die Crew auf künstliche Nacht umschaltete und alle Scheiben schwarz anliefen. Die Übergabe des Mietwagens hatte nicht lange gedauert, nachdem ich all die Upgrade-Vorschläge des Verleihers abgelehnt hatte, der dringend zu einem Jeep mit Vierradantrieb riet, indem er nachdrücklich auf die Unberechenbarkeit der Witterung und den Zustand der Gebirgsstraßen verwies. Kurz nach 16 Uhr saß ich in einem schwarzen Golf mit landesüblichem Automatikgetriebe und fuhr aus dem Flughafengelände auf den Highway, der mit seinem Betonband die letzten Ausläufer der Stadt, triste Wohnblocks und Reihenhäuser, vom leeren Umland abschnitt.
Ich hatte mich als Außenstehender in die Geschichte gedrängt, nur um mich jetzt, zwei Jahre später, über das finale Veto der Malerin zu wundern, nachdem sie mein fertiges Manuskript so lange mit ihren Anmerkungen, Korrekturen, Umschriften und Streichungen traktiert hat, bis nichts mehr übriggeblieben ist. Traumsegler sollte das Buch heißen, doch der Traum schien ausgeträumt, ich musste befürchten, dass zwei Jahre Arbeit mit Gesprächen, Lektüren, Archivbesuchen und der Zeit des Schreibens schließlich umsonst geblieben sein würden. Dabei hatte sie ein paar Wochen zuvor noch bei mir angerufen, um mir zu sagen, wie glücklich sie jetzt sei mit dem Text. Sie spüre die grundsätzliche Sympathie, mit der ich mich dem Dichter nähere. So war ich guter Dinge und umso erstaunter darüber, wie entschieden sie das Manuskript plötzlich ablehnte. Irgendetwas, das ich nicht verstand, musste in diesen Wochen bei wiederholter Lektüre in ihr vorgegangen sein, so dass sie nun glaubte, ich hätte den Dichter nieder-, ja, verächtlich machen wollen, indem ich mich ganz und gar und die Wirklichkeit verzerrend auf fragwürdige Teilaspekte fixiert hätte, auf dessen angebliche Erfolglosigkeit, seinen Alkoholismus, seine Armut und seine Vorliebe für weibliche Formen.
An ihren Randbemerkungen ließ sich ablesen, wie sie vergeblich versucht hatte, sich den Text zu eigen zu machen und ihm ihre Perspektive einzupflanzen, da sich die Bedeutungen zwangsläufig verschieben, wenn das eigene Leben mit fremden Augen betrachtet wird. Ihre Schrift zitterte geradezu vor Empörung, wenn sie an den Rand schrieb: »Herr Biograph, woher wissen Sie das?« Sie verweigerte sogar Einzelheiten die Zustimmung, die sie mir selbst berichtet hatte und worin ich fast wörtlich ihrer Erzählung gefolgt war. Jedes kleinste Detail nahm sie wichtig, doch es ging ihr ums große Ganze, um die Würde des Dichters, die zu behüten sie als ihre kostbarste Aufgabe begreift. »Gesperrt!«, schrieb sie über Passagen, die ihr besonders missfielen, sogar über Verse des Dichters, die ich zitierte, die sie aber, obwohl längst in der Werkausgabe veröffentlicht, nicht zitiert wissen wollte. In einem dieser Gedichte stand die Malerin nackt vor dem Spiegel für sich selbst Modell, malte die Brüste und den schimmernden Leib, als der Dichter sich ihr näherte, seine Jacke und seine Hose öffnete und sie miteinander schliefen. Es roch nach Melone und süßem Fisch, im Hinterhof wurden ein paar türkische Worte geschrien, doch der Akt diente zugleich der Vollendung des Gemäldes, das so aussehen sollte, wie es sich anfühlte. Liebe und Körper und Kunst wurden eins. Der Dichter beschrieb den intimsten Moment, in dem das Paar ganz bei sich ist und Obszönitäten stammelt, die niemanden etwas angehen, bis sie endlich nichts mehr sagen können als bloß »Ja!«. Und das ist das Heiligste, was sie haben. Er setzte es ins Wort und sie ins Bild.
Es waren jedoch immer die falschen Gedichte, die ich zitierte, als hätte ich sie nur ausgesucht, um zu zeigen, dass sie nichts taugen. Oder als gehe es mir dabei immer nur um Sex. Die Malerin übertrug die Obsessionen des Dichters auf mich, als wären es meine Lüste, die in seinen hymnischen Anrufungen von Brüsten und Geschlechtsteilen zum Ausdruck kamen. So war er gereinigt, indem sie mir vorwarf, ich wolle etwas Schmutziges, Zwanghaftes aus ihm machen. Dabei hatte sie ihn mir mehrfach als »sexuell unerzogen« geschildert, jedenfalls hatte ich ihre Schilderungen so gedeutet, eine Unerzogenheit, die er sich aus der Kindheit bewahrt habe, wo er alle Freiheit genossen und sich kaum jemand um ihn gekümmert habe, und ich fand gerade seine unverklemmte Direktheit attraktiv – vielleicht, weil sie mir selber fehlt, der ich »erzogen« worden bin, was bei uns zu Hause hieß, dass man über sexuelle Dinge nur raunend und hinter verschlossenen Türen sprach. Meine Mutter nahm mich dann in der Küche ins Gebet, um mir besorgt nahezulegen, dass dieses rothaarige Mädchen aus der 7 b, das ich nachmittags auf der Straße traf, um es schüchtern zu küssen, nichts für mich sei.
Sicher kann man Fakten so zusammensetzen, dass aus lauter Richtigem etwas Fragwürdiges entsteht und aus lauter Einzelheiten kein Ganzes. Doch wer entscheidet darüber, was richtig ist und was falsch? Welchen Fakten darf man folgen? Welcher Blick wäre frei von Projektionen? Welche Lebensgeschichte wäre keine nachträgliche Konstruktion? Viel zu wenig hatte ich darüber nachgedacht, woraus sich das Bedürfnis speist, den Lebensgefährten postum in eine Ikone zu verwandeln. Oder ist diese Verschönerungsarbeit der Erinnerung ein ganz natürlicher Vorgang, der das Weiterleben und gelassenes Altern ermöglicht? Dabei hatte ich den Dichter durchaus geschönt, die Liebesgeschichte überhöht und war darin weitgehend den Darstellungen der Malerin gefolgt, weil es mir nicht um eine wie auch immer geartete Wahrheit ging. Ich wollte nichts enthüllen und nichts beweisen, sondern vom Leben dieses Künstlerpaares erzählen – und war deshalb so gutgläubig gewesen.
Ihr entsetzter, zehnseitiger Brief, auf den sie einen Vogel mit traurigem Blick und hängenden Flügeln getuscht hatte und der mit dem Satz begann: »Wie enttäuscht ich bin!«, hatte mich am selben Tag erreicht wie die Nachricht aus Kanada mit der Mitteilung, mein 91 Jahre alter Vater sei in seinem Haus auf der Treppe gestürzt, ins Krankenhaus gebracht, dann aber wieder entlassen worden – oder vielmehr habe er sich selbst entlassen, weil er es nicht ertrug und nie ertragen hatte, krank in einem Bett neben fremden Menschen zu liegen. Nichts war ihm je so zuwider wie Hilflosigkeit. Ein paar Tage später sei er jedoch erneut eingeliefert worden, weil er nicht mehr aufstehen und sich kaum noch bewegen konnte, er habe keinen Lebenswillen mehr und habe aufgehört zu essen und zu trinken.
Die Steuerberaterin meines Vaters und meiner Stiefmutter, die sich dort seit Jahren um alle Belange der beiden Alten kümmerte, hatte mich übers Internet ausfindig machen müssen, weil er ihr eine unbrauchbare Mailadresse gegeben hatte, ein paar hingekritzelte Buchstaben, die nichts bedeuteten. Seltsam vertraut duzte mich die Unbekannte, als wären wir Teil einer Familie, die sich um den Vater versammelt. Zwei Wochen zuvor sei er noch mit dem Auto zum Einkaufen gefahren und habe am Abend den Hund ausgeführt. Der Zusammenbruch sei nicht absehbar, seine Frau immer die Gefährdetere gewesen. »Es kann schon sein, dass er sich wieder erholt«, meinte die Steuerberaterin, was ich dankbar aufnahm, weil ich mich nicht auf den weiten Weg machen wollte. »Wenn er nur will!«, fügte sie hinzu. Also beschloss ich abzuwarten, warum sollte ich ausgerechnet jetzt zu ihm reisen, wo ich ihn noch nie besucht und er mich in drei Jahrzehnten nur einmal eingeladen und dann gleich wieder ausgeladen hatte, nachdem seine Frau – womöglich angesichts des bevorstehenden Besuchs – in Depressionen verfallen war.
Kanada war ein vollkommen fiktives Land für mich, ein großer Fleck auf der Landkarte, und irgendwo in British Columbia gab es einen Punkt an der Stelle, wo mein Vater lebte, einen Punkt, den ich mir auf Google Maps genauer anschaute. Auf die Idee war ich in all den Jahren zuvor nie gekommen, es hatte mich nie interessiert, wie es dort aussieht. A., meine Liebste, mein Mensch, meine Frau, die eine enge Beziehung zu ihren Eltern unterhält und sich deshalb meine Vaterferne gar nicht vorstellen konnte, hatte mich, schon kurz nachdem sie so überraschend und unerwartet wie jede Liebe in mein Leben trat, ermuntert, endlich zu ihm zu fahren, bevor es zu spät wäre, und falls er davon nichts wissen wolle, einfach unangemeldet dort zu erscheinen, wenigstens für einen Kaffee oder einen kleinen, wortlosen Spaziergang, ganz egal, dann würde ich mir zumindest nicht vorwerfen müssen, etwas versäumt zu haben. Aber ich wollte nicht. Es hatte mich nie zu ihm gezogen, er war mir so fremd wie fern. Warum einen Sterbenden aufsuchen, wenn man sich das ganze Leben lang verpasst hat? All die vermeintlichen Dringlichkeiten des Lebens drängten sich vor, auf dem Schreibtisch häufte sich die Arbeit, die Osterferien im Sommerhaus in der Uckermark hatten gerade begonnen, bald würde auch A. ankommen, ich freute mich auf eine Woche nur mit ihr, ohne Verpflichtungen, eine Woche, in der wir sehr viel lesen, reden und zwischendurch zum See gehen würden, eine Woche aus Liebe, Landschaft und Lektüren, so stellte ich es mir vor, wie wir sie viel zu selten hatten. Zugleich steckte mir das sogenannte Veto der Malerin in den Knochen, auch wenn ich vorsichtig hoffte, dass das nicht ihr letztes Wort gewesen sein würde. Ich trauerte um all die schönen Geschichten, um das darin festgehaltene Leben und die eigene Lebenszeit. Der Vater in Kanada fügte sich in diese Stimmung ein.
So vergingen Tage, kostbare Zeit, und ich weiß noch, dass ich am Fenster stand und über den Acker schaute, auf dem sich die Kraniche und ein paar Rehe versammelten, als die Steuerberaterin mir über WhatsApp zusammen mit der Telefonnummer der Station und der passenden Uhrzeit die Bitte meines Vater übermittelte, ich möge ihn anrufen. Bei mir war es Abend, bei ihm Vormittag, man hatte ihn gewaschen und versorgt, ich hörte Türenklappern und die Schritte der Krankenschwester, die leise zu ihm sagte: »It’s your son«, während sie – so stellte ich es mir vor – sich dem Bett näherte und ihm den Apparat in die Hand drückte, in den er mit schwerer Zunge und allerletzter Kraft hauchte: »Danke, dass du anrufst. Kannst du kommen?« Dann, nach einer schier endlosen Atempause: »Du kannst mich doch hier nicht so liegen lassen!« Als ich ihm zuzureden versuchte, er werde doch bestimmt bald wieder auf die Beine kommen, und Sätze sagte, die man so sagt als einer, der nichts begreift, antwortete er mit einem röchelnden Laut und mit den mühsam geformten Worten: »Ich bin Arzt, ich weiß, wann es vorbei ist.«
Sein breites Schwäbisch irritierte mich. Es war in der Fremde noch viel breiter geworden, als wäre die ferne Heimat dort zu einer Macht herangewachsen, die ihn von innen heraus besetzte. Oder es war die Todesnähe, die ihn zurückwarf an den Ursprung, der immer dort ist, wo wir einmal zu sprechen begonnen haben. Die Muttersprache saugen wir mit der Muttermilch ein und lauschen ihr schon im Mutterleib, die ersten Laute, mehr Geschmack, mehr Klang als Wort. Ich hatte ihn eine Ewigkeit nicht gehört. Wir hatten niemals telefoniert, ich hatte nicht einmal seine Telefonnummer, und ob er meine besaß, weiß ich nicht. Jahrelang hatte völlige Funkstille zwischen uns geherrscht, eigentlich bis zur Verbreitung des Internets, denn zu telefonieren wäre uns schon zu intim gewesen, und so begannen wir, uns hin und wieder per Mail auf dem Laufenden zu halten, indem er mir im Winter von der Kälte und der Schneehöhe, im Sommer von Hitze, Waldbränden und Bärenbegegnungen berichtete. Er hatte auf seinen Wanderungen immer ein pressluftbetriebenes Schiffshorn dabei, dessen Tuten die Bären verjagen sollte. Das blieb sich über Jahre in schöner, zyklischer Verlässlichkeit gleich, einmal kam der Bär sogar in den Garten und plünderte den Kirschbaum, und da auch ich Vater immer nur schrieb, dass es mit der Arbeit voran und mir ganz gut gehe, bestand die zentrale Botschaft unserer Mitteilungen darin, noch vorhanden zu sein. Jetzt, im vorschriftsmäßigen Schneckentempo auf der Route 1, fragte ich mich bloß, ob ich ihn noch lebend vorfinden würde.
Vor meiner Abreise – ich bekam einen Flug am Ostersonntag, vier Tage nach dem Telefonat – schaute ich mir seine Mails noch einmal an und staunte darüber, wie viele es dann doch waren. Hunderte. Und ich war schockiert und entsetzt darüber, das vergessen zu haben. Mein Vater war alles andere als der große Schweiger, als den ich ihn erinnerte. Woher stammte dann aber dieses Gefühl in mir, er hätte nichts von sich preisgegeben? In welches Loch fielen all seine Mitteilungen? Könnte es sein, dass weniger er sich von mir, als ich mich von ihm abgewendet hatte? Die kanadische Ferne, in der er existierte, war mir immer als adäquater Ausdruck unseres distanzierten Verhältnisses vorgekommen, diese Ferne war mir näher gewesen als seine etwas hölzernen Annäherungsbemühungen mit Weihnachtsgrüßen oder kleinem Geburtstagsscheck. Eltern waren für mich etwas, das es hinter sich zu lassen galt. Nach monatelangem Schweigen war meistens er es, der sich wieder meldete und fragte, was mit mir sei. Es gab Jahre, in denen er mir monatlich geschrieben und wo er mir Kapitel aus seinen Memoiren geschickt hatte, die zu verfassen seinen Lebensabend füllte. Er beschäftigte sich mit seiner Kindheit, dem Elternhaus, der Zeit bei der Flak, wo er mit sechzehn, siebzehn das letzte Kriegsjahr an der Heimatfront erlebt hatte. Die Erinnerungen brachen ab, als er Anfang der 50er Jahre in Tübingen Medizin studierte und dort beim Tanz meine Mutter kennenlernte.
Dieses lose Ende hatte ich gewissermaßen aufgenommen, denn ich bin kürzlich selbst nach Tübingen gezogen, zu A., die dort Philosophie unterrichtet, und ihrem zwölfjährigen Sohn, doch während das für mich eine Rückkehr in die schwäbische Heimat bedeutet, der ich einst entflohen bin, ist es für sie, die aus Siebenbürgen stammt, ein Leben in der Fremde und in einer Sprache, die sie zwar von klein auf gesprochen hat und besser spricht als die meisten Deutschen, die aber doch nicht ihre Muttersprache ist. Ich musste lernen, darauf zu achten, was es heißt, in einem anderen Land zu leben, und wie gefährdet man ist, wenn das Gefühl der Zugehörigkeit so zerbrechlich ist und wenn man, wie sie, weder da, wo man herkommt, noch da, wo man jetzt ist, wirklich zu Hause sein kann. Für mich stand diese Zugehörigkeit nie in Frage, so dass ich erst allmählich verstand, dass sie sich fortdauernd als Gast fühlt, egal wie wir uns einrichten. Ihre Heimat sind die Bücher, Platon, Nietzsche, Heidegger vor allem, und also dann doch die deutsche Sprache. Für mich war die Begegnung mit ihr auch eine Rückkehr zur Philosophie, mit der ich seit der Studienzeit nicht mehr allzu viel zu tun hatte, während es sie von dort aus zur Literatur zog – und damit zu mir und meinen Lektüren, die sie dann wiederum mit ihren eigenen Gedichten bereicherte, Gedichte, die philosophischen Meditationen glichen und die all das aufnahmen, weiterführten und in eine anders sprechende Sprache transportierten, was gelegentlich auch in den Mails anklang, die wir uns schrieben. Es waren immer neue Versuche, Entgrenzung und scharfe Reflektion zusammenzuführen, mit Hilfe eines lyrischen Ich, das aus den Gedichten spricht, über das eigene Ich hinauszugelangen, indem da ein grenzenloses Du angesprochen wird oder das Denken selbst die Regie übernimmt und das Ego hinter sich zurücklässt. Wir trafen uns als Lesende und als Schreibende, schrieben uns nach der ersten Begegnung in Tausenden von E-Mails immer tiefer ineinander hinein, ich war ihr und diesem Schreibprozess völlig verfallen, wartete von Minute zu Minute auf das Eintreffen der nächsten Mail und besaß neben all den Worten, die sie aussandte und die sie aus mir hervorlockte, nichts von ihr, kein Foto und noch nicht einmal ein brauchbares Erinnerungsbild im Gedächtnis. Die Leidenschaft entzündete sich an nichts als der Sprache, die zum Mittelpunkt des Daseins wurde, einem Sehnsuchtsgelände, das unsere Worte füllten, einer Ankunftsstelle, die sich öffnete.
Die Malerin ist über achtzig, wirkte jedoch wie ein junges Mädchen auf mich, das seine Trümpfe kokett auszuspielen versteht und das nur aufgrund einer tragischen Verwechslung oder eines Irrtums der Zeit in einen alten Körper eingesperrt ist. Sie setzte sich immer mit dem Rücken zum Fenster, so dass ihr Gesicht im Schatten lag, und sagte das auch, damit ich nicht sehen müsse, wie alt und hässlich sie sei. Sie wollte schön sein, indem sie das dementierte. Meine Aufgabe bestand darin, ihre über das Alter triumphierende Schönheit zu bestätigen und die Schönheit des Dichters zu besingen. Denn was heißt Schreiben anderes, als die Dinge schöner zu machen, als sie sind? So hat es einer meiner literarischen Väter ausgedrückt, und ich bin ihm darin gefolgt.
»Vielleicht ist sie ja sogar ein kleines bisschen verliebt in dich – und du in sie«, hatte A. vermutet, und auch wenn ich das entschieden dementierte, könnte ein wenig davon doch wahr gewesen sein. Ich mochte die Malerin und ihre Bilder ja wirklich, mochte ihre geschmeidigen, graziösen Bewegungen, denen anzusehen war, dass sie einmal Tänzerin werden wollte und, bevor sie zu malen begann, Tanz studiert hatte; ich mochte ihre eruptive Art des Erzählens, ihre Vitalität und die Farbigkeit ihrer Gesten und Kleidung. Vielleicht suchte sie aber auch einfach nur Gesellschaft, dafür brauchte sie mich, und dafür wollte sie auch meinen Text. Ich erwiderte, so wie sie es von mir erwartete, dass sie sich über ihr Aussehen doch wohl keine Sorgen machen müsse, wo sie so jung geblieben sei. Der Dialog gehörte zum festen Repertoire meiner Besuche, wie auch ihre insistierenden Fragen: »Was halten Sie von ihm? Ist er nicht ein wundervoller Poet? Wie geht es Ihnen mit ihm? Mögen Sie ihn überhaupt?« Dann betonte sie mit gesenkter Stimme: »Er war ein Dichter, ein wirklicher Dichter«, um mir ein ähnliches Bekenntnis zu entlocken, was ich jedoch verweigerte, so dass sie, nie besänftigt, immer misstrauisch, gleich noch einmal sagte, dass er durch und durch ein großer Dichter gewesen sei.
Der Dichter war die Brücke zwischen mir und ihr. Alles was an Nähe und Vertrauen zwischen uns entstand, ging über ihn. Sie suchte die Huldigungsgemeinschaft, musste sich deshalb immer wieder meiner Treue und meiner Wege versichern, auch indem sie sich stets nach meiner Liebe erkundigte, als ob das der Gradmesser wäre, an dem sich meine Verlässlichkeit ablesen ließe. Und sie hatte ja völlig recht, denn wie könnte ich über ihre und des Dichters Liebe schreiben, wenn ich selbst mit dem Element der Liebe nicht in Berührung stünde. Man muss doch, um etwas zu begreifen, auch aus eigener Erfahrung schöpfen. »Wie geht es Ihnen mit Ihrer Liebsten?«, fragte sie bei jedem meiner Besuche, seit ich ihr von dieser meiner Liebesbesetztheit oder -besessenheit oder -bedürftigkeit berichtet hatte. Da sie mir so vieles aus ihrem Leben erzählte, wollte auch ich ihr nichts Wesentliches vorenthalten.
Erst jetzt begriff ich, dass die Wahrheit über ihn ihr Werk sein sollte und seine Würde ihr Wunsch, genau wie ihre Wohnung, die mir wie ein Museum ihrer Liebe erschien, eine Gedenkstätte, in der ihre Gemälde ringsherum an den Wänden hängen, filigran mit feinstem Pinsel gearbeitete, großformatige Traumbilder, auf denen der Dichter immer wieder als Seemann oder als Schlafender auftaucht. Daneben aber sind seine flächigen Ölbilder zu sehen, naive, sehr blauäugige Selbstporträts und kraftvolle Frauenfiguren in klaren Farben, die er hinter Glas in die Rahmen alter Fenster gemalt hat. So vervielfältigen sich beide in der Kunst, wie man sich auch in der Zeit vervielfältigt von Augenblick zu Augenblick, so dass sich naturgemäß immer mehr Bilder, Ansichten, Ausschnitte und Einblicke ansammeln im Lauf der Jahre eines Lebens. Allerlei Devotionalien stehen herum, von ihm gebastelte Figürchen, eine nackte Frau mit beweglichen Brüsten, die er wie ein Schiff in eine Flasche kaprizierte, seine Menora, Masken und Utensilien ihrer gemeinsamen Straßentheaterzeit, ein Hut und Fotos von ihm. Seine Briefe – mehr als tausend schrieb er ihr im Lauf der Jahrzehnte – verwahrt sie in einer weißen Truhe, und jeden Tag nimmt sie einen heraus, um darin zu lesen. Solange er zu ihr spricht, ist er nicht tot.
Dass Nähe aus der Distanz heraus entsteht, hätte mir geläufig sein können, denn schließlich war ja auch im Verhältnis zu meinem Vater der Abstand die Bedingung der Kommunikation, und auch zwischen Dichter und Malerin spielten die Briefe und das Abstandnehmen eine entscheidende Rolle. Doch das, was sich schreibend zwischen mir und A. entwickelte, war etwas völlig Anderes, Umfassenderes, unser Schreiben zum Lieben hin warf mein Leben völlig um und sortierte es neu, und es gab nichts Beglückenderes als den Augenblick, in dem sie mich zum ersten Mal mit »Liebster« anredete, was uns bald zu einem gegenseitigen Bedürfnis wurde, nicht als Formel, sondern als Fakt – oder vielleicht sogar als Bannfluch. Jede Benennung ist auch eine Ermächtigung, weil der Name, den man jemandem gibt, nicht einfach bloß bezeichnet, sondern hervorruft und damit zuallererst das erschafft, was er benennt. Liebe ist zunächst eine Behauptung, ein Wort, das nach einer Entsprechung sucht und das vielleicht deshalb immer aufs Neue zu flüstern und unendlich oft zu wiederholen ist, weil es sich in der Wiederholung belebt als eine absolute, frisch in die Welt entlassene Wahrheit.
In Tübingen setze ich die Wege durch die Stadt und die Gegend fort, die mein Vater einst verlassen hat, denn dort verändert sich ja nichts, es sieht noch immer so aus, wie es schon für Hölderlin, Hegel und Hauff ausgesehen hat. An der Burse, wo A. Seminare gibt, sind die Stiftler vorbeigegangen, als sie über das Systemprogramm des deutschen Idealismus nachdachten, und ein paar Jahre später wurde Hölderlin in diesem Gebäude, damals noch ein Krankenhaus, mit Methoden traktiert, die den Wahnsinn eher förderten als heilten. Auch das Haus, in dem mein Vater seine Studentenbude hatte, steht noch. Er schickte mir die Adresse, und ich schickte ihm ein Foto, alles noch da.
Insgeheim warf ich ihm damals vor, dass er nicht weitererzählte, dass er in den frühen Jahren verharrte und da aufhörte, wo es schwierig zu werden begann. Das, was auf die Studentenzeit folgte, wäre doch erst das Leben gewesen: die erste Ehe und ihr Ende und dann die zweite, bis heute andauernde. Jeweils Geschichten für sich, ineinander verzahnt. Doch wer bin ich, ihm etwas vorzuwerfen, was auch ich nicht leiste. Auch ich hatte mich neu verliebt, die Ehefrau verlassen, mich geschieden und mein Leben umgekrempelt. Vielleicht erzählt man letztlich alles immer nur für sich, um in den Ereignissen Ordnung zu schaffen. Vergangenheit ist nichts Festes, weil sie immer von einem bestimmten, aber nie gleichen Standpunkt, immer von der flüchtigen Gegenwart aus in den Blick gerät. Schreiben heißt, mit der Vergangenheit aufzuräumen. Womöglich hatte Vater sehr wohl weitergeschrieben, das Ergebnis aber für sich behalten. Oder er hatte es vorgezogen, alles im Kopf zu bewahren, weil nur das Nicht-Aufgeschriebene beweglich bleibt und sich unmerklich den jeweiligen Erfordernissen anpasst. Über die Intimsphäre wolle er nichts sagen, hatte er erklärt, weil sie sich der zutreffenden Formulierung und Mitteilbarkeit entziehe. So drückte er sich aus, fast wie Fußballspieler, die, wenn sie nach dem Schlusspfiff nach ihren Gefühlen gefragt werden, zu antworten pflegen: Dafür gibt es keine Worte.
Ich stellte ihn mir vor, wie er in seiner kanadischen Abgeschiedenheit in diesem Holzhaus saß, das ich nur von Fotos kannte, mit Blick über den zum Arrow Lake aufgestauten Columbia River und auf die über 3000 Meter hohen Gipfel der Monashee Mountains, und wie er dort die schwäbische Heimat imaginierte, den Neckar mit seinen Weinbergen, das Elternhaus in Ludwigsburg, die Baracken seiner Flak-Einheit, die Tübinger Gässchen mit dem Hölderlinturm, Schulkameraden und Kommilitonen, Wege, die er als junger Mensch gegangen war und die ich nun statt seiner ging. Ihr teuren Ufer, die mich erzogen einst / Stillt ihr der Liebe Leiden, versprecht ihr mir, / Ihr Wälder meiner Jugend, wenn ich / Komme, die Ruhe noch einmal wieder? Auch die Lust an ausgedehnten Fahrradtouren hatte ich von ihm geerbt und war vielleicht auch schon den Uferweg entlanggefahren, wo er einmal mit einem Mädchen unterwegs gewesen war, was ihm in seinen Erinnerungen den Satz entlockte: »Wir sind nicht nur Fahrrad gefahren.« Das war die einzige Stelle in seinen Aufzeichnungen, die vorsichtig so etwas wie eine erotische Überraschung andeutete. Ich druckte alles aus und dazu die Fotos, die er immer wieder angehängt hatte, sah ihn im blühenden Garten der Kindheit, sah ihn als Soldat in Uniform mit Kindergesicht und einem Gewehr im Anschlag, sah ihn zwischen dem Bruder und der Schwester, mit Mutter und seinem immer schon sehr alten Vater, alle längst tot, eine Totenfamilie, die Toten rufen nach uns. So war er mir zu einer Papierperson geworden, über deren Herkunft ich mehr wusste als über ihre Gegenwart, auch wenn derlei Erinnerungen in ihrer anekdotischen Harmlosigkeit eher dazu dienen, ein Schweigen über all die Abgründe zu legen, die im Rückblick beunruhigt und aus dem eigenen Leben ein weniger überschaubares Gelände gemacht hätten.
Auch der Dichter war für mich zunächst so eine Papierperson gewesen, die aus den Briefen im Archiv, aus Manuskripten, Bildern und Büchern, aus hinterlassenen Dingen, vor allem aber aus den Erzählungen der Malerin hervortrat. Ich bewunderte die Entschlossenheit, mit der er sein Künstlertum gewählt hatte, um diesem Traum ein Leben lang zu folgen, zusammen mit ihr, der Malerin. (Sie aber würde widersprechen und sagen, er habe nichts gewählt, sondern sei immer schon ein Dichter gewesen, weil man zum Künstler nicht wird, sondern es auf existentielle Weise ist, allenfalls das bereitliegende Talent in sich entdecken muss, um es zu ergreifen.) Je länger ich mich mit ihm beschäftigte, umso mehr war er mir als großer Liebender ans Herz gewachsen. Die Liebe betrieb er so wie die Kunst mit Nachdruck und ohne in seinem Wollen je nachzulassen, und ganz sicher war es diese Kraft, die mich für ihn und die Malerin zuerst eingenommen hat, weil ich, als ich mit der Arbeit begann, selbst frisch verliebt und also nicht ganz zurechnungsfähig gewesen war und es auch nicht sein wollte, weil zu lieben heißt, dieser Unzurechnungsfähigkeit zu folgen und bedenkenlos »für immer« zu sagen, auch wenn jeden Tag das Ganze auf dem Spiel steht und schon morgen alles vorbei sein kann. Einen Liebesroman wollte ich also schreiben und keine Biographie, doch als ich das der Malerin verriet, sagte sie bloß: »Um Gottes willen! Nein! Niemals!«, und im Übrigen wolle sie in diesem Buch überhaupt nicht vorkommen, sie sei nicht wichtig, »lassen Sie mich raus«. Dass das unmöglich wäre, konnte ich ihr immerhin begreiflich machen, und im fertigen Manuskript störte sie sich daran dann auch nicht mehr.
Ich schätzte den Dichter für seine Verletzlichkeit, die er zu verbergen suchte, und für seine vielfältigen Talente. So ungezügelt, wie er schrieb, malte er auch. Er war gelernter Matrose, der sechzig Knoten zu knüpfen wusste und manchen Sturm überstanden hatte. Nach den Jahren auf See war er so etwas wie ein trockener Seemann, der vielleicht nur deshalb trank, um den Mangel an Meer in Flüssigkeit zu ertränken. Das Trinken überfiel ihn quartalsweise, doch er habe nie – wie die Malerin nicht müde wurde zu betonen und wie ich dann auch nicht müde wurde, es aufzuschreiben –, niemals getrunken, wenn er dichtete. Ich sollte ihn mir vorstellen, wie er in seinem Stammcafé stumm und still und stundenlang vor einem Glas Bier saß, das er nicht anrührte, oder einem Tee, der kalt wurde, während sich die Worte in ihm ansammelten, bis er dann das fertige Gedicht in einem Guss aufs Papier warf, es musste nur noch hingeschrieben werden, und die Gedichte waren selten kurz. Wenn ich jedoch aus einem seiner Briefe zitierte, in denen er einen fürchterlichen Alkoholexzess beklagte und Besserung gelobte, während die leeren Flaschen vom Vorabend noch auf dem Tisch standen, strich die Malerin alle härteren Getränke, dann aber auch Wein und Bier aus dem Manuskript, als habe er tatsächlich immer nur Mineralwasser getrunken wie in den Phasen der hart erkämpften Abstinenz.