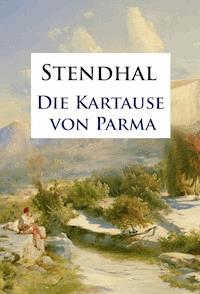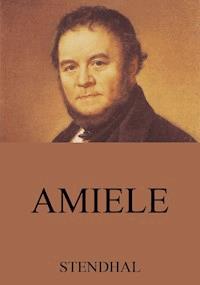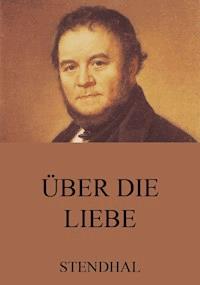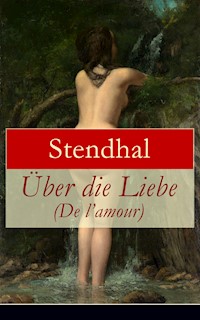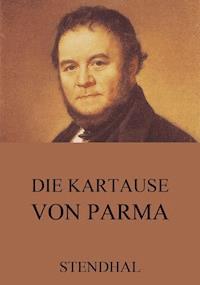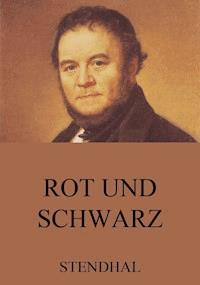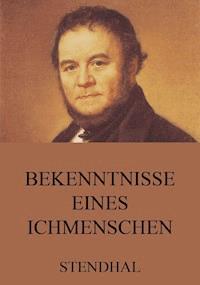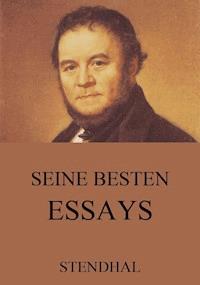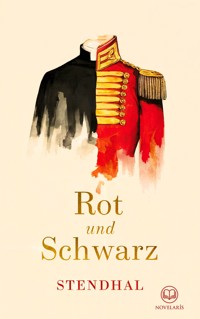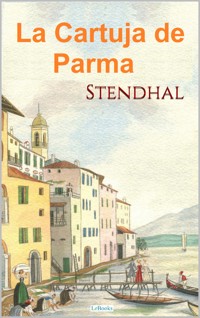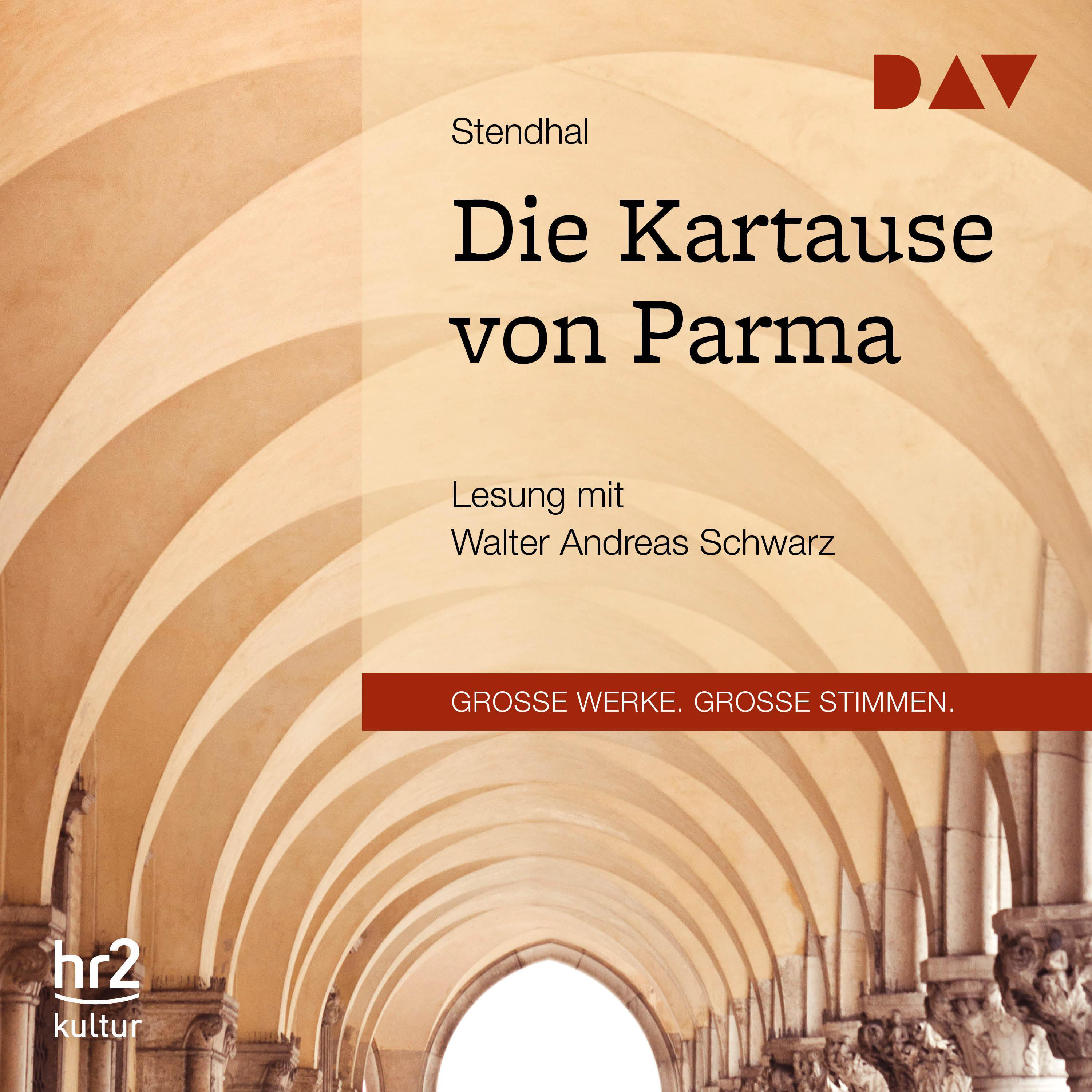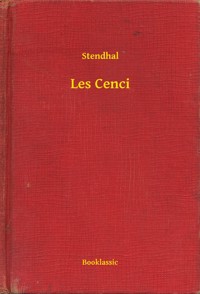1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
In "Die Kartause von Parma" entfaltet Stendhal eine epische Erzählung über das Schicksal des jungen Fabrice del Dongo in einem Europa des 19. Jahrhunderts, geprägt von politischen Turbulenzen und gesellschaftlichen Umwälzungen. Der Roman, in einem komplexen, oft ironischen Stil verfasst, vereint psychologische Einsichten mit einem feinen Gespür für das historische Panorama. Durch eine meisterhafte Mischung aus Realität und Fiktion geizt Stendhal nicht mit seinen persönlichen Erfahrungen und legt die Zerrissenheit und Sehnsüchte seiner Charaktere offen, während er sie in die Konflikte des Risorgimento integriert. Die Themen Liebe, Macht und der innere Konflikt des Individuums sind zentraler Bestandteil dieser literarischen Reise. Stendhal, Pseudonym des Henri Beyle, war ein französischer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, dessen eigene Erlebnisse in Italien und sein tiefes Verständnis für die menschliche Psyche ihn maßgeblich prägten. Seine Besuche in der italienischen Kultur und Geschichte flossen in seine Werke ein und beeinflussten die Komplexität seiner Charaktere sowie die Handlung von "Die Kartause von Parma". Stendhals leidenschaftliches Interesse an Kunst und Leidenschaft spiegelt sich in der dynamischen Erzählweise und den lebendigen Beschreibungen, die den Roman prägen, wider. Dieses Buch ist eine eindringliche Empfehlung für jeden Leser, der sich für die vielschichtigen gesellschaftlichen Strukturen des 19. Jahrhunderts sowie für die inneren Konflikte und Ambitionen des Individuums interessiert. Stendhals brillante Erzählkunst und seine tiefgehenden Einblicke in die menschliche Natur machen "Die Kartause von Parma" zu einem zeitlosen Meisterwerk, das nicht nur unterhält, sondern auch zum Nachdenken anregt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die Kartause von Parma
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Inhaltsverzeichnis
Am 15. Mai 1796 hielt der General Bonaparte seinen Einzug in Mailand an der Spitze jener jungen Armee, die unlängst die Brücke von Lodi überschritten und der Welt gezeigt hatte, daß Cäsar und Alexander nach so vielen Jahrhunderten einen Nachfolger hatten.
Die Wunder von Heldentum und Genie, deren Zeuge Italien geworden, rüttelten das Volk rasch aus seinem Schlaf. Noch acht Tage vor dem Einrücken der Franzosen hatten die Mailänder in ihnen nur Brigantengesindel gesehen, das vor den Truppen Seiner Kaiserlichen und Königlichen Majestät immer Reißaus nahm. So wenigstens wiederholte es ihnen dreimal wöchentlich ein handgroßes, auf schlechtem Papier gedrucktes Zeitungsblatt.
Im Mittelalter hatten die Mailänder eine Tapferkeit bewiesen, die der französischen während der Revolution ebenbürtig war und es verdient, daß ihre Stadt von den deutschen Kaisern der Erde gleichgemacht ward. Seitdem sie sich aber in getreue Untertanen verwandelt hatten, bestand ihre Haupttätigkeit darin, Sonette auf Taschentücher aus rosenroter Seide drucken zu lassen, wenn sich eine Tochter aus dem oder jenem reichen oder vornehmen Hause verheiratete. Zwei oder drei Jahre nach diesem wichtigen Abschnitt ihres Lebens nahm die junge Dame einen Cicisbeo, ja bisweilen prangte der Name des von der Familie des Gatten erkorenen Begleiters schon mit im Ehevertrag. Es war ein Riesensprung von diesen verweichlichten Sitten zu den gewaltigen Erregungen, die das unerwartete Erscheinen des französischen Heeres verursachte. Sogleich kamen neue und leidenschaftliche Zustände auf. Am 15. Mai 1796 ward ein ganzes Volk plötzlich gewahr, daß alles, was es bis dahin geachtet hatte, höchst lächerlich und mitunter verächtlich war. Der Abmarsch des letzten österreichischen Regiments bezeichnete den Sturz der alten Anschauungen. Sein Leben aufs Spiel zu setzen, kam in Mode. Nach Jahrhunderten voll Frömmlertum und fader Liebelei erkannte man, daß man, um glücklich zu sein, etwas mit ernster Leidenschaft lieben und im Notfall sein Leben in die Schanze schlagen müsse. Lange, tiefe Nacht hatte seit der eifersüchtigen Gewaltherrschaft Karls V. und Philipps II. geherrscht. Man stürzte ihre Bildsäulen, und mit einem Male war alles von Licht umflutet. In den letzten fünfzig Jahren, während die Ideenwelt der Enzyklopädisten und Voltaires immer tiefer Wurzel schlug, hatten die Mönche dem lieben Mailänder gepredigt, daß Lesen und sonst etwas Lernen eine recht überflüssige Mühe sei. Wenn man nur seinem Pfarrer gewissenhaft den Zehnten entrichte und ihm jede kleine Sünde getreulich beichte, so dürfe man mit ziemlicher Bestimmtheit auf ein herrliches Plätzchen im Paradiese rechnen. Um das ehemals furchtbare und unbotmäßige Volk vollends zu schwächen, hatte ihm Österreich um geringe Gegenleistung das Vorrecht verkauft, dem kaiserlichen Heere keine Rekruten zu stellen.
Anno 1796 bestand die Besatzung von Mailand aus vierundzwanzig rotröckigen Tagedieben, die im Verein mit vier prächtigen ungarischen Grenadierregimentern die Stadt hüteten. Die Freiheit der Sitten war zügellos, aber Leidenschaft etwas sehr Seltenes. Abgesehen von der Unbequemlichkeit, den Priestern alles beichten zu müssen, wenn man nicht schon in dieser Welt zugrunde gehen wollte, schmachteten die braven Mailänder übrigens noch in gewissen kleinen monarchischen Fesseln, die nicht weniger unangenehm waren. So war zum Beispiel der Erzherzog, der seinen Sitz in Mailand hatte und im Namen des Kaisers, seines Vetters, schaltete und waltete, auf den gewinnbringenden Einfall gekommen, Getreidehandel zu treiben. Die Bauern durften ihr Korn erst verkaufen, wenn die Speicher Seiner Hoheit gefüllt waren.
Im Mai 1796, drei Tage nach dem Einzug der Franzosen, hörte ein junger, etwas närrischer Miniaturmaler, der später berühmt gewordene Gros, damals Schlachtenbummler im Gefolge des Heeres, im Café dei Servi (das derzeit in Mode war) von den Machenschaften des sehr beleibten Erzherzogs erzählen. Er nahm das Preisverzeichnis der Eissorten, das auf einem Blatt groben gelben Papiers gedruckt war, und zeichnete auf die Rückseite den dicken Erzherzog, dem gerade ein französischer Soldat sein Bajonett in den Bauch stieß. Statt Blut entströmte der Wunde unglaublich viel Getreide. Was man Witz und Karikatur zu nennen pflegt, war in jenem Lande des schlauen Despotentums etwas Unbekanntes. So staunte man das von Gros auf dem Tisch im Kaffeehaus liegen gelassene Spottbild wie ein vom Himmel herabgefallenes Wunderding an. Über Nacht ward es in Kupfer gestochen und anderntags in zwanzigtausend Abzügen verkauft.
Am nämlichen Tage verkündeten Maueranschläge die Erhebung einer Kriegssteuer von sechs Millionen Franken für die Bedürfnisse der französischen Armee, die binnen kurzem sechs Schlachten gewonnen und ein Dutzend Provinzen erobert hatte, aber Mangel an Stiefeln, Hosen, Röcken und Kopfbedeckungen litt.
Das Maß von Glück und Freude, das mit diesen so armen Franzosen in die Lombardei drang, war so groß, daß nur die Geistlichkeit und etliche Adlige die Bürde dieser Auflage von sechs Millionen empfanden, der bald noch manche andere folgen sollte. Die französischen Soldaten lachten und sangen den lieben langen Tag. Sie waren alle noch keine fünfundzwanzig Jahre alt, und ihr Obergeneral galt mit seinen siebenundzwanzig für den ältesten Mann im Heer. Dieser Frohsinn, diese Jugend und Sorglosigkeit standen in drolligem Widerspruch zu den grimmigen Prophezeiungen der Mönche, die seit einem halben Jahre von der Kanzel herab verkündet hatten, die Franzosen seien Ungeheuer, bei Todesstrafe verpflichtet, alles niederzubrennen und alle Welt um einen Kopf kürzer zu machen. Jedes Regiment führe dazu eine Guillotine mit sich.
Auf dem Lande sah man vor den Türen der Bauernhäuser die französischen Soldaten sitzen und das Jüngste ihrer Quartierwirtin in den Schlaf wiegen, und fast allabendlich improvisierte irgendein Geige spielender Tambour ein Tanzfest. Da die Kontertänze viel zu gelehrt und schwierig waren, als daß die Soldaten, die sie selber nicht recht konnten, sie den Lombardinnen beizubringen vermochten, so lehrten diese vielmehr die jungen Franzosen die Monferrina, die Saltarola und andere italienische Tänze.
Die Offiziere waren, soweit möglich, bei reichen Leuten untergebracht. Sie bedurften tatsächlich einiger Aufbesserung. So hatte zum Beispiel ein Leutnant namens Robert einen Quartierzettel für den Palast der Marchesa del Dongo erhalten. Dieser Offizier, ein flotter, junger Ausgehobener, nannte bei seiner Einkehr in dieses Herrenhaus nichts sein eigen als ein Sechsfrankenstück, das er in Piacenza bekommen hatte. Nach dem Übergang über die Brücke von Lodi hatte er einem feschen gefallenen österreichischen Offizier ein Paar prächtige, nagelneue Nankinghosen abgenommen, just zu gelegener Zeit. Seine Offiziersepauletten waren von Wolle, und das Tuch seines Feldrockes war an das Futter festgenäht, damit das Ganze zusammenhalte. Aber noch trauriger war ein anderer Umstand. Die Sohlen seiner Stiefel bestanden aus einem Stück Filz von einem Soldatenhut, den er ebenfalls auf dem Schlachtfeld an der Brücke von Lodi aufgelesen hatte. Diese Notsohlen waren so sichtbar mit Bindfaden an das Oberleder genäht, daß der Leutnant Robert in die tödlichste Verlegenheit geriet, als der Haushofmeister des Hauses del Dongo im Zimmer erschien, um ihn feierlichst einzuladen, an der Mittagstafel der Frau Marchesa teilzunehmen. Bursche und Leutnant verwendeten die zwei Stunden bis zu der peinlichen Mittagstafel dazu, den Feldrock nach Möglichkeit zusammenzuflicken und die unglücklichen Bindfäden an den Schuhen mit Tinte zu schwärzen. Endlich schlug die gefürchtete Stunde. Lassen wir ihn selbst berichten:
»In meinem ganzen Leben«, erzählte mir Leutnant Robert in späteren Tagen, »ist mir nie wieder so erbärmlich zumute gewesen. Vielleicht dachten die Damen, ich wolle ihnen Angst einjagen, aber mir bebte das Herz mehr denn ihnen. Ich blickte auf meine Schuhe und wußte kaum, wie ich es anfangen sollte, um nicht zu ungeschickt darin zu gehen. Die Marchesa del Dongo war damals im Vollglanz ihrer Schönheit. Sie haben sie ja gekannt, mit ihren wunderschönen, engelsanften Augen und ihrem hübschen dunkelblonden Haar, das dem Oval ihres reizenden Gesichts einen so prächtigen Rahmen gab. In meinem Zimmer hing eine ›Tochter der Herodias‹ von Leonardo da Vinci, die ihr glich wie ein Porträt. Gott ließ mich von ihrer übernatürlichen Schönheit so ergriffen sein, daß ich meinen Anzug ganz vergaß. Seit zwei Jahren waren mir in den Genueser Bergen nur häßliche und elende Dinge vor Augen gekommen. Ich wagte es, einige Worte über mein Entzücken an sie zu richten.
Gleichwohl hatte ich noch so viel gesunden Verstand, daß ich mich nicht allzu lange in Komplimenten bewegte. Während ich ein paar Redensarten drechselte, gewahrte ich in dem marmorgetäfelten Speisesaal ein Dutzend Lakaien und Kammerdiener, deren Livree mich damals der Inbegriff von Prachtentfaltung dünkte. Stellen Sie sich vor, diese Schlingel hatten nicht nur anständige Schuhe, sondern sogar noch silberne Schnallen darauf. Bei einem Seitenblick merkte ich, daß ihre dummen Augen alle auf meinen Rock und wohl gar auf meine Schuhe gerichtet waren. Das gab mir einen Stich ins Herz. Mit einem einzigen Wort hätte ich die ganze Bande zu Paaren treiben können; wie aber hätte ich das anfangen sollen, ohne die Damen zu erschrecken? Die Marchesa hatte nämlich, um sich ein wenig Mut zu machen, die Schwester ihres Mannes, Gina del Dongo, die nachmalige reizende Contessa di Pietranera, aus dem Kloster, wo sie erzogen wurde, zu sich berufen. Sie hat es mir später oft erzählt. Im Glück übertraf sie niemand an heiterem Sinn und liebenswürdigem Witz, wie ihr auch niemand an Mut und Seelenruhe im Unglück gleichkam.
Gina, die damals dreizehn Jahre alt sein mochte, aber wie achtzehnjährig aussah, lebhaft und freimütig, wie Sie wissen, hatte so große Furcht, beim Anblick meines Aufzuges herauszuplatzen, daß sie sich kaum zu essen getraute. Dafür überhäufte mich die Marchesa mit gezwungenen Höflichkeiten. Sie las mir meinen Unwillen von den Augen ab. Mit einem Wort: ich spielte eine alberne Rolle. Ich schluckte die Geringschätzung hinunter, was bekanntlich einem Franzosen unmöglich sein soll. Endlich gab mir der Himmel einen lichten Gedanken ein. Ich fing an, den Damen zu berichten, was wir in den Genueser Bergen ausgestanden hatten, wo uns altersschwache Generale zwei Jahre hatten sitzen lassen. Dort, so erzählte ich, gab man uns die Löhnung in Assignaten, die im Land keinen Kurs hatten, und neunzig Gramm Brot den Tag. Ich hatte keine zwei Minuten gesprochen, da standen der guten Marchesa die Tränen in den Augen, und Gina war ernst geworden.
›Wie, Herr Leutnant,‹ sagte sie, ›neunzig Gramm Brot?‹ ›Gewiß, Signorina. Dabei blieben diese Portionen dreimal in der Woche ganz aus, und da die armen Gebirgsbewohner, bei denen wir im Quartier lagen, noch weniger zu beißen hatten als wir, so haben wir ihnen auch noch ein wenig von unserem Brot abgegeben.‹
Als wir vom Tisch aufstanden, bot ich der Marchesa meinen Arm und führte sie bis an die Tür des Salons, kehrte dann schnell um und gab dem Lakaien, der mich bei der Tafel bedient hatte, mein einziges Sechsfrankenstück, mit dem ich mir tausend Luftschlösser erbaut hatte.
Acht Tage später, nachdem man sich sattsam überzeugt hatte, daß wir Franzosen niemanden köpften, kehrte der Marchese del Dongo aus seinem Schloß Grianta am Comer See zurück, wohin er sich beim Anrücken unserer Armee geflüchtet hatte, seine junge, schöne Gemahlin und seine Schwester den Wechselfällen des Krieges preisgebend. Der Haß dieses Edelmannes gegen uns war nur mit seiner Furcht zu vergleichen, das heißt, beide waren grenzenlos. Es war ein spaßiger Anblick, wenn er mir mit seinem aufgedunsenen, bleichen Höflingsgesicht Artigkeiten sagte. Am Tage nach seiner Rückkehr nach Mailand erhielt ich drei Ellen Uniformtuch und zweihundert Franken, meinen Anteil an den sechs Millionen Kriegssteuern. Ich stattete mich neu aus und ward der Ritter jener Damen, denn die Bälle begannen.«
Die Geschichte des Leutnants Robert war so ziemlich die aller Franzosen. Statt über ihr Elend zu spötteln, bemitleidete man diese tapferen Krieger und gewann sie lieb. Diese Epoche unerwarteten Heils und toller Freude dauerte knapp drei Jahre, aber der Rausch war so stark und allgemein, daß man sich kaum eine richtige Vorstellung davon machen kann; nur die tiefsinnige historische Betrachtung erklärt sie: dies Volk langweilte sich seit einem Jahrhundert.
Die natürliche Sinnenlust des Südländers hatte ehedem an den Höfen der Visconti und Sforza, der berühmten Herzöge von Mailand, geherrscht. Aber seit dem Jahre 1524, da sich die Spanier Mailands bemächtigt hatten, jene schweigsamen, argwöhnischen, stolzen Herrscher, die überall Aufruhr witterten, waren Freude und Frohsinn entschwunden. Das Volk, das immer die Sitten seiner Herrscher annimmt, ward mehr darauf bedacht, die kleinste Unbill mit einem Dolchstoß zu vergelten, als die Gegenwart zu genießen.
Vom 15. Mai 1796, dem Tage des Einzuges der französischen Armee in Mailand, bis zum April 1799, als sie diese Stadt wegen der Schlacht von Cassano wieder räumen mußte, hatten Übermut, Lebensfreude, Sinnenlust und völliges Vergessen aller trüben, ja selbst aller vernünftigen Gedanken derartig überhand genommen, daß man sogar alte Millionäre und Krämerseelen, Wucherer und griesgrämige Notare finden konnte, die während dieser Zwischenzeit ihr mürrisches Wesen und ihre Gewinnsucht abgelegt hatten.
Eine Ausnahme bildeten etliche Familien des Hochadels, die sich auf ihre Landschlösser zurückgezogen hatten, sozusagen aus Groll über den allgemeinen Jubel und das Aufgehen aller Herzen. Freilich muß man zugestehen, daß diese reichen Adelsgeschlechter bei der Aufbürdung der französischen Kriegssteuern in empfindlicher Weise ausgezeichnet worden waren.
Der Marchese del Dongo, ärgerlich über so viel Frohsinn, hatte sich als einer der ersten auf sein prächtiges Schloß Grianta jenseits Comos zurückbegeben, wo ihn die Damen in Gesellschaft des Leutnants Robert besuchten. Dieses Schloß, in einer Lage, wie sie auf Erden vielleicht nirgends zu finden ist, auf einer Hochebene, hundertundfünfzig Fuß über dem herrlichen See, den es weithin beherrscht, war ehedem eine feste Burg. Die Familie del Dongo hatte sie, wie die wappenbelasteten Marmorwände überall kund gaben, im Quattrocento erbauen lassen. Noch war sie mit Zugbrücken und tiefen Gräben versehen, in denen freilich kein Wasser mehr stand. Gleichwohl war dieses Schloß mit seinen achtzig Fuß hohen und sechs Fuß starken Mauern vor einem etwaigen Handstreich geschützt und eben darum dem mißtrauischen Marchese lieb und wert. Umgeben von fünfundzwanzig bis dreißig Lakaien, die er alle für treu und ergeben hielt, wahrscheinlich, weil er sich nie anders als durch Schimpfworte mit ihnen unterhielt, wurde er dort weit weniger von Furcht gequält als in Mailand.
Diese Furcht war nicht ganz unberechtigt. Der Marchese stand in sehr regem Briefwechsel mit einem österreichischen Spion, der sich an der Schweizer Grenze, drei Meilen von Grianta, aufhielt. Der Zweck war die Befreiung von Kriegsgefangenen, was von den französischen Generalen einmal übel aufgefaßt werden konnte.
Der Marchese hatte seine junge Gemahlin in Mailand gelassen. Dort leitete sie die Familiengeschäfte. Sie war beauftragt, gegen die Kriegssteuern Einspruch zu erheben, die der Casa del Dongo, wie man dort zu sagen pflegt, auferlegt waren. Sie suchte ihre Herabsetzung zu erwirken, was sie freilich zwang, mit Edelleuten, die öffentliche Ämter angenommen hatten, und gar mit besonders einflußreichen Nichtadligen in Berührung zu kommen. Dazwischen hinein fiel ein wichtiges Familienereignis. Der Marchese hatte seine junge Schwester Gina mit einer außerordentlich reichen und hochgeborenen Persönlichkeit verheiraten wollen. Aber der Bewerber trug eine gepuderte Haarbeutelperücke. Gina lachte ihm darob ins Gesicht und beging alsbald die Tollheit, den Grafen Pietranera zu heiraten. Dieser Pietranera war zwar unbedingt ein tadelloser Edelmann, eine wunderschöne Erscheinung, aber wie schon sein Vater arm wie eine Kirchenmaus und, was das Schlimmste war, ein eifriger Anhänger der neuen Ideen. Pietranera war Leutnant in der Italienischen Legion, was den Marchese vollends in Verzweiflung brachte.
Nach jenen zwei Jahren des Rausches und des Glückes nahm das Direktorium der Französischen Republik allmählich einen monarchischen Ton an; es bezeigte tödlichen Haß gegen alles, was sich über die Mittelmäßigkeit erhob. Die unfähigen Generale, die es über die Armee in Italien setzte, verloren in denselben Ebenen um Verona, die zwei Jahre vorher Zeugen der Wunder von Arcole und Lonato gewesen, eine Schlacht nach der anderen. Die österreichische Armee rückte auf Mailand vor, und Robert, inzwischen zum Bataillonskommandeur befördert und in der Schlacht von Cassano verwundet, verweilte eine letzte Nacht im Hause seiner Freundin, der Marchesa del Dongo. Der Abschied war schmerzlich. Robert verließ Mailand zugleich mit dem Grafen Pietranera, der die Franzosen auf ihrem Rückzuge nach Novi begleitete. Die junge Contessa, der ihr Bruder die Auszahlung ihres rechtmäßigen Erbteils verweigerte, folgte ihrem Mann in einem Wagen.
Jetzt begann jene Epoche der Reaktion und der Rückkehr zu den alten Ideen, die die Mailänder ›i tredici mesi‹, die dreizehn Monate, nannten, weil es ihr guter Stern in der Tat wollte, daß diese Rückkehr zur Dummheit nur dreizehn Monate, das heißt bis zur Schlacht von Marengo, währen sollte. Alles, was alt, mürrisch und bigott war, gelangte von neuem ans Ruder und übernahm wieder die Führung der Gesellschaft. Bald darauf verkündeten die Anhänger des alten Kurses in den Dörfern, daß Bonaparte in Ägypten von den Mamelucken wohlverdientermaßen gehängt worden sei.
Unter den Männern, die sich bisher grollend auf ihren Gütern vergraben hatten und nun rachedurstig wieder zum Vorschein kamen, war der Marchese del Dongo einer der grimmigsten, und es war natürlich, daß ihn sein Übereifer an die Spitze der Partei stellte. Diese Herren, aller Ehren werte Leute, sobald sie keine Angst hatten, die aber eigentlich immer zitterten, scharten sich um den österreichischen General. Der, ein gutmütiger Mensch, ließ sich einreden, daß unerbittliche Strenge eine politische Notwendigkeit sei, und infolgedessen wurden einhundertfünfzig Patrioten eingekerkert, die besten Männer, die Italien damals hatte.
Man schleppte sie nach der Bucht von Cattaro, wo die feuchte, dumpfe Kerkerluft und die kärgliche Kost einen gerechten und raschen Strafvollzug an diesen Bösewichten ausübten.
Der Marchese del Dongo erhielt einen hohen Posten, und da sich seinen vielen anderen Vorzügen auch scheußlicher Geiz gesellte, so rühmte er sich öffentlich, daß er seiner Schwester, der Contessa di Pietranera, nicht einen Taler schicke. Immer noch närrisch verliebt in ihren Mann, wollte sie ihn nicht verlassen und zog es vor, in Frankreich mit ihm zu hungern. Die gute Marchesa war verzweifelt; schließlich gelang es ihr, ein paar kleine Diamanten aus ihrem Schmuck beiseite zu bringen, den ihr Gatte allabendlich in Verwahrung nahm und unter seinem Bett in einem eisernen Kasten verschloß. Sie hatte ihrem Mann eine Mitgift von achthunderttausend Franken zugebracht, erhielt aber monatlich nur achtzig Franken für ihre persönlichen Bedürfnisse. Während der dreizehn Monate, da die Franzosen nicht in Mailand waren, fand diese furchtsame Frau allerlei Vorwände, immer in schwarzen Kleidern zu erscheinen.
Wir müssen eingestehen, daß wir – nach dem Beispiel manches werten Autoren – die Geschichte unseres Helden ein Jahr vor seiner Geburt begonnen haben. Diese Hauptperson ist niemand anderes als Fabrizzio Valserra, Marchesino del Dongo. Er geruhte just zur Welt zu kommen, als die Franzosen aus Mailand verjagt wurden. Der Zufall der Geburt machte ihn zum Zweitgeborenen des Marchese del Dongo, jenes großen Herrn, dessen blasses gedunsenes Gesicht, dessen falsches Lächeln und dessen grenzenlosen Haß gegen die neuen Ideen wir bereits kennen. Das ganze Vermögen des Hauses fiel dereinst dem älteren Sohne, Ascanio del Dongo, zu, dem würdigen Ebenbilde seines Vaters. Er war acht und Fabrizzio zwei Jahre alt, als der General Bonaparte, den alle Wohlgesinnten längst gehängt wähnten, plötzlich vom Sankt Bernhard herabstieg und in Mailand einrückte. Dieser Augenblick ist in der Geschichte ohnegleichen. Man denke sich ein ganzes Volk toll verliebt. Wenige Tage danach gewann Napoleon die Schlacht von Marengo. Alles übrige ist unnötig zu erzählen. Der Freudenrausch der Mailänder hatte keine Grenzen; nur war er diesmal mit Rachegedanken untermischt: man hatte das gutmütige Volk hassen gelehrt. Bald sah man die eingekerkerten Patrioten, soweit sie noch am Leben waren, von den Bocche di Cattaro wiederkehren; ihre Befreiung ward durch ein Nationalfest gefeiert. Ihre abgezehrten, bleichen Gesichter, ihre erstaunten Blicke, ihre abgemagerten Glieder stachen gegen die überall ausbrechende Freude seltsam ab. Ihre Rückkehr war für die am meisten bloßgestellten Familien das Zeichen zur Abreise. Der Marchese del Dongo zog sich als einer der ersten nach seinem Schloß Grianta zurück. Die Familienoberhäupter waren von Furcht und Haß erfüllt; nicht so ihre Frauen und Töchter, die sich mit Freuden an die erste Anwesenheit der Franzosen erinnerten und sich nach Mailand und den fröhlichen Bällen sehnten, die nach dem Tage von Marengo in der Casa Tanzi von neuem begannen. Sehr bald bemerkte der französische General, der beauftragt war, die Ruhe in der Lombardei aufrecht zu erhalten, daß alle Pächter der Güter der Adligen und alle alten Frauen auf dem Lande keineswegs mehr an den erstaunlichen Sieg von Marengo dachten, der das Geschick Italiens gewendet und dreizehn feste Plätze an einem Tage wiedererobert hatte, sondern die Köpfe voll hatten von einer Prophezeiung des heiligen Giovita, des obersten Schutzpatrons von Brescia. Nach diesem heiligen Orakel sollte das Glück der Franzosen und Napoleons ausgerechnet dreizehn Wochen nach Marengo ein Ende nehmen. Zur gewissen Entschuldigung des Marchese del Dongo und der übrigen grollenden Edelleute sei gesagt, daß sie ernstlich und ohne Narrenspossen an diese Voraussage glaubten. All diese Leute hatten in ihrem Leben keine vier Bücher gelesen. Sie trafen offenkundig ihre Vorbereitungen, nach den dreizehn Wochen wieder nach Mailand zurückzukehren. Aber während die Zeit verstrich, verzeichnete Frankreichs Sache neue Erfolge. Wieder in Paris, rettete Napoleon durch weise Erlasse die Republik im Innern, wie er sie bei Marengo nach außen gerettet hatte. Nun entdeckten die edlen, in ihren Schlössern harrenden Lombarden, daß sie das Wort des heiligen Schutzherrn von Brescia zuerst falsch verstanden hätten: es handle sich nicht um dreizehn Wochen, sondern offenbar um dreizehn Monate. Die dreizehn Monate gingen dahin, und das Glück der Franzosen wuchs sichtlich von Tag zu Tag weiter.
Wir gehen über zehn Jahre des Fortschritts und des Glückes hinweg, von 1800 bis 1810. Fabrizzio verbrachte davon die ersten im Schloß Grianta, prügelte sich mit den Bauernjungen des Dorfes und lernte nichts, nicht einmal lesen. Später schickte man ihn auf die Jesuitenschule nach Mailand. Der Marchese, sein Vater, verlangte, daß man ihm Latein beibrächte, doch nicht nach den alten Schriftstellern, die immer von Republiken reden, sondern nach einem prächtigen, mit mehr als hundert Kupferstichen geschmückten Folianten, einem Werk von Meistern des Secento. Es war die lateinische Familiengeschichte des Hauses derer von Valserra, Marchesi del Dongo, herausgegeben Anno 1650 von Fabrizzio del Dongo, Erzbischof von Parma. Da die Valserras ihr Glück vornehmlich im Waffenhandwerk gemacht hatten, so stellten die Stiche in der Hauptsache Schlachten dar, und auf jedem sah man einen Helden dieses Namens, der mächtige Säbelhiebe austeilte. Das Buch gefiel dem jungen Fabrizzio ungemein. Seine Mutter, die ihn vergötterte, durfte ihn von Zeit zu Zeit in Mailand besuchen; aber da ihr Gatte ihr niemals Geld zu diesen Reisen gab, war es ihre Schwägerin, die liebenswürdige Contessa Pietranera, die ihr das Nötige borgte. Nach der Wiederkehr der Franzosen war jene eine der glänzendsten Frauen am Hofe des Fürsten Eugen, des Vizekönigs von Italien.
Als Fabrizzio gefirmelt war, erhielt die Contessa von dem noch immer in freiwilliger Verbannung lebenden Marchese die Erlaubnis, ihn ab und zu aus seiner Schule zu sich kommen zu lassen. Sie fand, er sei eigenartig, geweckt, sehr ernst, aber ein netter Junge, der dem Salon einer Modedame keineswegs zur Unzierde gereiche, im übrigen drollig unwissend, ja kaum des Schreibens kundig. Die Contessa, die ihren Feuergeist in keiner Sache verleugnete, versprach dem Schulvorstand ihre Gönnerschaft, falls ihr Neffe Fabrizzio bemerkenswerte Fortschritte mache und am Jahresschluß recht viele Preise bekäme. Das Erreichen dieser Ziele förderte sie damit, daß sie den Jungen alle Sonnabende abends abholen ließ und ihn oft erst am Mittwoch oder Donnerstag darauf zu seinen Lehrern zurückschickte. Die Jesuiten waren, trotz der zärtlichen Vorliebe des Vizekönigs für sie, nach den Gesetzen des Königreichs aus Italien verwiesen, und der Superior der Schule, ein gewandter Mann, wußte genau, welchen Vorteil er aus den Beziehungen zu einer am Hofe allmächtigen Frau ziehen konnte. Er hütete sich, über Fabrizzios Ausbleiben Klage zu führen, der, unwissender denn je, am Ende des Jahres fünf erste Preise erhielt. Infolgedessen wohnte die glänzende Contessa di Pietranera mit ihrem Gatten, jetzt Generalleutnant und Kommandeur einer Gardedivision, nebst fünf oder sechs der höchsten Persönlichkeiten vom Hofe des Vizekönigs der Preisverteilung bei den Jesuiten bei. Der Superior wurde von seinen Vorgesetzten beglückwünscht.
Die Contessa nahm ihren Neffen auf alle glänzenden Feste mit, durch die sich die kurze Regierungszeit des liebenswürdigen Fürsten Eugen auszeichnete. Dank ihrem Einfluß zum Husarenoffizier ernannt, trug der zwölfjährige Fabrizzio Uniform. Entzückt von seiner hübschen Erscheinung, erbat sie eines Tages beim Fürsten eine Pagenstelle für ihn, was soviel bedeutete wie den Friedensschluß der Familie del Dongo mit der Regierung. Am Tage darauf mußte sie freilich ihren ganzen Einfluß aufbieten, damit der Vizekönig sich ihrer Bitte nicht mehr erinnere, der nichts weiter fehlte als die Einwilligung vom Vater des künftigen Pagen, die schroff verweigert worden wäre. Nach dieser Torheit fand der wutschnaubende Marchese einen Vorwand, den jungen Fabrizzio nach Grianta heimzurufen. Die Contessa strafte ihren Bruder mit überlegener Verachtung. In ihren Augen war er ein jämmerlicher Trottel und aller Schandtaten fähig, falls er je die Macht dazu gewänne. In Fabrizzio dagegen war sie vernarrt. Nach zehnjährigem Schweigen schrieb sie an den Marchese und forderte ihren Neffen zurück. Ihr Brief blieb ohne Antwort.
Als Fabrizzio wieder in das düstere Schloß kam, das die kriegerischsten seiner Ahnen erbaut hatten, verstand er von nichts auf der Welt etwas als vom Reiten und Exerzieren. Graf Pietranera, der in den Jungen ebenso vernarrt war wie seine Frau, hatte ihn manchmal auf ein Pferd gesetzt und zum Dienst mitgenommen.
Bei seiner Ankunft im Schloß Grianta waren Fabrizzios Augen noch ganz rot von den Tränen, die er beim Scheiden aus den schönen Gemächern seiner Tante vergossen hatte. Seine Mutter und seine Schwestern empfingen ihn mit leidenschaftlichen Liebkosungen. Der Marchese hatte sich mit seinem ältesten Sohne, dem Marchesino Ascanio, in sein Arbeitszimmer eingeschlossen. Dort fertigten die beiden Geheimbriefe an, die die Ehre hatten, nach Wien zu gehen. Vater und Sohn erschienen nur zu den Mahlzeiten. Der Marchese pflegte mit Betonung zu sagen, er unterrichte seinen natürlichen Nachfolger in der doppelten Buchführung über die Erträge seiner Landgüter. In Wirklichkeit war er viel zu eifersüchtig auf seine Macht, als daß er einen Sohn und notwendigen Erben aller seiner Besitztümer in derlei eingeweiht hätte. Er gebrauchte ihn dazu, Berichte von fünfzehn bis zwanzig Seiten zu chiffrieren, die er zwei-oder dreimal wöchentlich nach der Schweiz schmuggelte, von wo aus sie nach Wien gelangten. Der Marchese vermeinte, seinen rechtmäßigen Herrscher über die Zustände im Königreich Italien, von denen er selber keine Ahnung hatte, auf dem laufenden zu halten. Gleichwohl hatten seine Berichte viel Erfolg. Das kam so: Der Marchese ließ auf den Heerstraßen durch irgendeinen sicheren Beauftragten die Zahl der Soldaten aller französischen oder italienischen Regimenter feststellen, die ihre Standorte wechselten, und wenn er dem Wiener Hof darüber berichtete, so verheimlichte er sorglich ein reichliches Viertel der zur Zeit vorhandenen Truppen. Diese auch sonst lächerlichen Schreiben hatten den Vorzug, andere, genauere Berichte Lügen zu strafen. Deshalb gefielen sie. Und so hatte der Marchese, wenige Tage vor Fabrizzios Ankunft im Schloß, das Großkreuz eines hochgeschätzten Ordens bekommen. Es war der fünfte, der seinen Kammerherrnrock zierte. Zwar wagte er zu seinem Leidwesen nicht, in dem Rock außerhalb seines Zimmers umherzustolzieren, aber er erlaubte sich nie einen Bericht zu diktieren, ohne den bestickten, mit allen seinen Orden geschmückten Rock angelegt zu haben. Er hätte es für Mangel an Ehrerbietung gehalten, wenn er anders gehandelt hätte.
Die Marchesa war über die liebenswürdigen Eigenschaften ihres Sohnes entzückt. Nun hatte sie die Gewohnheit bewahrt, zwei-oder dreimal im Jahr mit dem General Grafen von A. Briefe zu wechseln; so hieß jetzt jener Leutnant Robert. Voller Abscheu davor, Menschen, die sie liebte, zu belügen, fragte sie ihren Sohn aus und war über seine Unwissenheit entsetzt.
›Wenn er schon mir, die ich selber nichts weiß, ungebildet vorkommt,‹ sagte sie sich, ›so wird Robert, der so Wohlunterrichtete, seine Erziehung ganz mangelhaft finden. Und heutzutage muß man etwas taugen.‹ Eine andere Eigentümlichkeit Fabrizzios setzte sie fast ebenso in Erstaunen. Er nahm alle kirchlichen Dinge, die man ihm bei den Jesuiten beigebracht hatte, für Ernst. Obgleich selbst sehr fromm, erschrak sie doch vor dem Glaubenseifer des Kindes. Sie sagte sich: ›Wenn der Marchese Geist genug hätte, diese schwache Seite herauszufinden, so könnte er mir die Liebe meines Sohnes abspenstig machen.‹ Sie weinte viel, und ihre leidenschaftliche Schwäche für Fabrizzio wuchs dadurch noch mehr.
Das Leben in dem Schloß, das dreißig bis vierzig Dienstboten bevölkerten, war recht traurig. Daher verbrachte Fabrizzio den ganzen Tag auf der Jagd oder in einer Barke auf dem See. Bald war er mit den Kutschern und Stallburschen auf vertrautem Fuß. Allesamt eifrige Parteigänger der Franzosen, machten sie sich unverblümt über die kriecherischen Kammerdiener lustig, die dem Marchese oder seinem ältesten Sohne sklavisch ergeben waren. Besonders erregte es ihren Spott, daß sich diese würdevollen Leute nach dem Vorbild ihrer Herrschaft puderten.
Zweites Kapitel
Inhaltsverzeichnis
Nun, da der Abend unser Aug umflort, Betracht ich zukunftssüchtig die Gestirne, Durch die uns Gott in Lettern, wohl zu deuten, Der Kreaturen Los und Schicksal kündet. Denn der aus Himmelshöhn den Menschen schaut, Weist ihm aus Mitleid oft den rechten Pfad In seiner Sternenschrift am Firmament Und sagt das Glück, das Unglück uns voraus. Doch wir, am Staube haftend, sündenschwer, Verachten solche Schrift und sehn sie nicht. Ronsard
Der Marchese bekundete einen starken Haß gegen jede Aufklärung. »Die modernen Ideen«, pflegte er zu sagen, »haben Italien ins Verderben gestürzt.« Er wußte nicht recht, wie er diese heilige Scheu vor der Bildung mit dem Wunsch vereinigen sollte, daß sein Sohn Fabrizzio die so glänzend begonnenen Studien bei den Jesuiten vollende. Um die Gefahr möglichst abzuleiten, beauftragte er den braven Abbate Blanio, den Pfarrer von Grianta, den lateinischen Unterricht mit Fabrizzio fortzusetzen. Dazu hätte der Geistliche diese Sprache verstehen müssen; nun war sie aber gerade der Gegenstand seiner Abneigung. Seine Kenntnisse auf diesem Gebiet beschränkten sich auf das Auswendighersagen der Gebete seines Missales, deren Sinn er seinen Pfarrkindern mit knapper Not erklären konnte. Gleichwohl war der Pfarrer nichtweniger geachtet und sogar in seinem Sprengel gefürchtet. Er hatte immer gesagt, daß die berühmte Prophezeiung des heiligen Giovita, des Schutzpatrons von Brescia, weder in dreizehn Wochen noch auch in dreizehn Monaten in Erfüllung ginge. War er unter sicheren Freunden, so fügte er hinzu, die Zahl dreizehn sei so zu deuten, daß alle Welt staunen werde, wenn er es aussprechen dürfte. (1813!)
Tatsächlich war der Abbate Blanio ein Mann von altfränkischer Tugend und Biederkeit und übrigens kein Dummkopf. Nachts hielt er sich mit Vorliebe oben auf seinem Kirchturm auf. Er war nämlich versessen auf Astrologie. Tagsüber pflegte er die Konjunkturen und Stellungen der Gestirne zu berechnen, und manche schöne Nacht verbrachte er damit, sie am Himmel zu verfolgen. Bei seiner Armut hatte er kein anderes Instrument als ein langes Fernrohr aus Pappe. Man kann sich denken, welche Geringschätzung dieser Mann für Sprachstudien hatte, der sein Leben darein setzte, aus den Sternen den genauen Zeitpunkt abzulesen, da große Reiche stürzen und Revolutionen das Antlitz der Welt verändern. »Weiß ich mehr über das Pferd,« sagte er zu Fabrizzio, »wenn man mir beigebracht hat, daß es auf lateinisch equus heißt?« Die Bauern fürchteten den Abbate Blanio als großen Zauberer, und er jagte ihnen durch sein Observatorium auf dem Kirchturm so viel Schrecken ein, daß sie nicht stahlen. Seine Amtsbrüder, die Geistlichen der Umgegend, waren wegen dieser Macht neidisch und verwünschten ihn. Der Marchese del Dongo verachtete ihn schlechtweg, weil er für einen Mann seines niedrigen Standes viel zu gelehrte Dinge im Kopf habe. Fabrizzio schwärmte für ihn; um ihm zu gefallen, verbrachte er mitunter ganze Abende damit, riesenhafte Additions-oder Multiplikationsexempel auszurechnen. Seitdem durfte er mit auf den Kirchturm klettern. Das war eine große Gunst, die der Abbate Blanio noch niemandem zugestanden hatte; aber er liebte den Knaben seiner Unbefangenheit wegen. »Wenn du kein Heuchler wirst,« pflegte er zu ihm zu sagen, »wirst du vielleicht ein Mann.«
Infolge der Unerschrockenheit und Leidenschaftlichkeit, die Fabrizzio bei allen seinen Belustigungen an den Tag legte, wäre er im Laufe der Jahre mehrmals beinahe im See ertrunken. Bei den Streichen der Bauernjungen von Grianta und Cadenabbia war er der Anführer. Diese Burschen hatten sich verschiedene Nachschlüssel zu verschaffen gewußt, mit denen sie in besonders finsteren Nächten die Schlösser der Ketten zu öffnen trachteten, womit die Barken an großen Steinen oder an Bäumen nahe am Ufer befestigt waren. Auf dem Comer See legen nämlich die Fischer schwimmende Angeln in ziemlich weiter Entfernung vom Ufer aus. Das obere Ende der Schnur ist an einem mit Kork unterlegten Brettchen befestigt, auf dem eine elastische Haselrute mit einem Glöckchen angebracht ist; es klingelt, sobald der Fisch angebissen hat und an der Schnur zerrt.
Der Hauptzweck der nächtlichen Seezüge, die Fabrizzio befehligte, war, diese Nachtangeln aufzusuchen, ehe die Fischer auf das Klingelzeichen aufmerksam wurden. Man wählte zu diesen wagehalsigen Ausfahrten stürmisches Wetter und schiffte sich meist in der Frühe ein, eine Stunde vor Sonnenaufgang. Daß die Jungen beim Einsteigen in die Barken glaubten, sie stürzten sich in die größten Gefahren, darin lag das Schöne ihres Tuns, und nach dem Vorbild ihrer Väter beteten sie andächtig ein Ave-Maria. Nun geschah es zuweilen, daß Fabrizzio im Augenblick der Abfahrt oder kurz nach dem Ave-Maria von einem Vorzeichen betroffen wurde. Das war die Frucht der astrologischen Studien seines Freundes, des Abbaten Blanio. Bei seiner jugendlichen Einbildungskraft kündigte ihm das Vorzeichen mit Sicherheit den guten oder schlimmen Ausgang an, und da er der Beherzteste unter seinen Kameraden war, so gewöhnte sich allmählich die ganze Schar so an die Vorbedeutungen, daß, wenn im Augenblick der Abfahrt ein Bettelmönch sichtbar ward oder linker Hand ein Rabe flog, die Barken schleunigst wieder angekettet wurden und jeder wieder schlafen ging. So hatte der Abbate Blanio seine ziemlich schwierige Wissenschaft Fabrizzio zwar nicht gelehrt, aber er hatte ihm, ohne daß er es selber wußte, ein grenzenloses Vertrauen in alle Vorzeichen künftiger Geschehnisse eingeimpft.
Der Marchese hegte das Gefühl, daß ihn bei seinem geheimen Briefwechsel einmal ein unglücklicher Zufall in die Lage bringen könne, des Einflusses seiner Schwester zu bedürfen; und so erhielt Fabrizzio alljährlich am Feste der heiligen Angela, dem Namenstage der Contessa Pietranera, die Erlaubnis, acht Tage in Mailand zu verbringen. Das ganze Jahr zehrte er von der Hoffnung auf diese acht Tage oder von der Erinnerung daran. Um diesem großen Ereignis noch mehr Bedeutung zu geben, händigte der Marchese seinem Sohn jedesmal vier Taler ein, während er seiner Gattin, die Fabrizzio begleitete, nichts zu geben pflegte. Dafür reisten am Tage vor der Abreise ein Koch, sechs Bediente und ein Wagen mit zwei Pferden nach Como ab, und die Marchesa hatte in Mailand eine Kutsche und eine Tafel mit zwölf Gedecken zur Verfügung.
Eine grollende Lebensweise, wie sie der Marchese del Dongo führte, war sicherlich sehr wenig unterhaltsam, aber sie hatte den Vorteil, daß sie den Reichtum der Familien, die sich darein verloren, ungeheuer aufschwellte. Der Marchese, der mehr als zweihunderttausend Lire Jahreseinkommen hatte, verbrauchte davon nicht ein Viertel. Er lebte von der Hoffnung. Während der dreizehn Jahre von 1800 bis 1813 glaubte er immer felsenfest, daß Napoleon binnen einem halben Jahre gestürzt wäre. Man kann sich sein Entzücken vorstellen, als er zu Beginn des Jahres 1813 das Unglück an der Beresina erfuhr. Die Einnahme von Paris und der Sturz Napoleons hätten ihn beinahe um den Verstand gebracht. Nun erlaubte er sich die kränkendsten Äußerungen gegen seine Frau und seine Schwester. Endlich, nach vierzehn Jahren des Harrens, hatte er die unsägliche Freude, die österreichischen Truppen wieder in Mailand einrücken zu sehen. Auf Anweisung von Wien empfing der österreichische General den Marchese del Dongo mit einer Hochachtung, die an Ehrfurcht grenzte. Man trug ihm alsbald eine der höchsten Stellen der Landesverwaltung an, die er wie die Rückzahlung einer Schuld hinnahm. Sein ältester Sohn erhielt eine Leutnantsstelle in einem der besten Regimenter der Monarchie, der jüngere jedoch wollte die ihm angebotene Würde eines Kadetten nie und nimmer annehmen. Dieser Triumph, den der Marchese mit seltener Unverschämtheit auskostete, dauerte aber nur wenige Monate und hatte ein demütigendes Nachspiel. Geschäftliche Begabung besaß er nicht, und die vierzehn Jahre, die er auf seinem Landschloß im Verkehr mit seinen Dienern, seinem Notar und seinem Hausarzt verbrachte, hatten ihn im Verein mit den Grillen des herannahenden Alters zu einem gänzlich unfähigen Menschen gemacht. Nun ist es in österreichischen Landen ein Unding, sich auf einem wichtigen Posten zu halten, ohne die gewisse Befähigung zu besitzen, die die langsame und umständliche, aber sehr vernünftige Verwaltungsweise dieser alten Monarchie erheischt. Die Mißgriffe des Marchese del Dongo stießen die Beamten vor den Kopf und hemmten den Gang der Geschäfte. Seine ultramonarchischen Redensarten reizten die Bevölkerung, die man in sorglosen Schlummer einlullen wollte. Eines schönen Tages erfuhr er, daß Seine Majestät Allergnädigst geruht hatte, sein Gesuch um die Entlassung aus Allerhöchsten Diensten unter gleichzeitiger Ernennung zum Vize-Oberhofmarschall des lombardisch-venezianischen Königreiches huldvollst entgegenzunehmen. Der Marchese war empört über die maßlose Ungerechtigkeit, deren Opfer er geworden. Er ließ einen Brief an einen Freund veröffentlichen, er, der die Pressefreiheit so sehr verabscheute. Schließlich schrieb er an den Kaiser, seine Minister seien Verräter und nichts weiter als Jakobiner. Darauf zog er sich wieder traurig auf sein Schloß Grianta zurück. Er fand einen Trost. Nach Napoleons Sturz ließen gewisse einflußreiche Persönlichkeiten den Grafen Prina, den ehemaligen Minister des Königs von Italien, einen im höchsten Grade verdienstvollen Mann, in Mailand auf offener Straße ermorden. Der Graf Pietranera setzte sein Leben aufs Spiel, um das des Ministers zu retten, der mit Regenschirmen erschlagen wurde und dessen Todesqualen fünf Stunden lang dauerten. Ein Priester, Beichtvater des Marchese del Dongo, hätte Prina retten können, wenn er ihm das Gitter der Kirche San Giovanni geöffnet hätte, vor die man den unglücklichen Minister schleppte, nachdem man ihn sogar eine Weile im Rinnstein mitten auf der Straße hatte liegen lassen. Aber er weigerte sich höhnisch, sein Gittertor aufzuschließen, und ein halbes Jahr später gelang es dem Marchese glücklich, ihm eine höhere Stellung zu verschaffen.
Er verabscheute seinen Schwager, den Grafen Pietranera, der mit einem Jahreseinkommen von nicht fünfzig Louisdor leidlich zufrieden zu sein wagte und es sich einfallen ließ, dem, was er lebenslang geliebt hatte, die Treue zu wahren, ja die Unverschämtheit besaß, sich offen als Anhänger des gleichen Rechts für alle zu bekennen, was der Marchese schändliches Jakobinertum nannte. Der Graf hatte sich geweigert, in österreichische Dienste zu treten. Man beutete diesen Trotz aus, und ein paar Monate nach der Ermordung Prinas setzten die nämlichen Persönlichkeiten, die Prinas Mörder gedungen hatten, die Verhaftung des Generals Pietranera durch. Darauf ließ sich die Gräfin, seine Gemahlin, einen Paß ausfertigen und bestellte Postpferde, um nach Wien zu fahren und dem Kaiser die Wahrheit zu sagen. Die Mörder Prinas bekamen es mit der Angst zu tun, und einer von ihnen, ein Vetter der Gräfin Pietranera, überbrachte ihr mitternachts, eine Stunde vor ihrer Abfahrt nach Wien, die Order zur Freilassung ihres Mannes. Anderntags ließ der österreichische General den Grafen Pietranera zu sich bitten, empfing ihn mit größter Achtung und versicherte ihm, seine Pensionsangelegenheit werde binnen kurzem auf das beste geregelt. Der brave General Bubna, ein Mann von Geist und Herz, war wegen Prinas Ermordung und der Verhaftung des Grafen sichtlich in starker Verlegenheit.
Nachdem diese Gefahr durch die Entschlossenheit der Gräfin abgewendet war, lebte das Ehepaar schlecht und recht von dem Ruhegehalt, das dank der Fürsprache des Generals Bubna nicht auf sich warten ließ.
Zum Glück traf es sich nach fünf oder sechs Jahren, daß die Gräfin eine große Freundschaft zu einem sehr reichen jungen Manne faßte, der auch Busenfreund des Grafen war und es sich nicht nehmen ließ, ihnen das schönste englische Vollblutgespann, das es damals in Mailand gab, seine Loge in der Scala und sein Landschloß zur Verfügung zu stellen. Aber der Graf ließ sich im Vollgefühl seiner Tapferkeit und seiner edlen Gesinnung, leicht hinreißen und führte dann gern absonderliche Reden. Als er eines Tages mit jungen Leuten auf der Jagd war, begann einer von ihnen, der unter anderen Fahnen als er gedient hatte, Witze über die Tapferkeit der Soldaten der Zisalpinischen Republik zu machen. Der Graf gab ihm eine Ohrfeige. Es kam sofort zu einem Zweikampf, und da der Graf unter allen diesen jungen Menschen keinen auf seiner Seite hatte, so fiel er. Man munkelte allerlei über diese Art von Zweikampf, und die Beteiligten entschlossen sich zur Abreise nach der Schweiz.
Jener lächerliche Mut, den man Gottergebenheit nennt, der Mut eines Toren, der sich hängen läßt, ohne ein Wort zu sagen, war nicht Sache der Gräfin. Wütend über ihres Gatten Tod, hätte sie es am liebsten gesehen, wenn Limercati, jener reiche junge Mann, ihr Vertrauter, gleichfalls auf den Einfall geraten wäre, nach der Schweiz zu fahren und den Mörder des Grafen Pietranera zu erschießen oder wenigstens zu ohrfeigen.
Limercati fand dieses Ansinnen reichlich lachhaft, und die Gräfin bemerkte, daß ihre Verachtung ihre Liebe ertötet hatte. Sie verdoppelte ihre Aufmerksamkeiten gegen Limercati. Sie wollte seine Leidenschaft schüren, ihn dann sitzen lassen und der Verzweiflung preisgeben. Um diesen Racheplan einem Franzosen verständlich zu machen, muß ich sagen, daß man in Mailand, das freilich sehr fern von Paris liegt, aus Liebe noch in Verzweiflung gerät. Die Gräfin, die in ihren Trauerkleidern alle Nebenbuhlerinnen bei weitem hinter sich ließ, tat schön mit den jungen Herren, die auf der Straße schlenderten, und einer von ihnen, der Graf Nani, der schon immer gesagt hatte, er fände Limercati zu schwerfällig, zu steif für eine so begabte Frau, verliebte sich toll in die Gräfin. Sie schrieb an Limercati:
›Wollen Sie sich einmal als geistreicher Mann betätigen? Bilden Sie sich ein, Sie hätten mich nie gekannt!
Ich bin, vielleicht nicht ohne Mißachtung, Ihre untertänigste Gina Pietranera.‹
Als Limercati dieses Briefchen gelesen, reiste er nach einem seiner Schlösser ab. Seine Liebe wuchs ins Grenzenlose; er wurde toll und sprach von Selbstmord, etwas Ungebräuchlichem in einem Lande, wo man an den Teufel glaubt. Gleich am ersten Morgen schrieb er der Gräfin und bot ihr die Ehe und seine Zweihunderttausend Lire Rente an. Sie schickte ihm seinen Brief unerbrochen durch den Reitknecht des Grafen Nani zurück. Darauf verbrachte Limercati drei Jahre auf seinen Gütern. Alle acht Wochen kehrte er nach Mailand zurück, hatte aber nie den Mut, dort zu bleiben, und langweilte seine Freunde mit seiner leidenschaftlichen Liebe zur Gräfin und mit umständlicher Aufzählung aller einst bei ihr genossenen Gunstbezeigungen. Anfangs pflegte er hinzuzufügen, daß sie sich mit dem Grafen zugrunde richte und daß dieses Verhältnis sie entehre.
In der Tat empfand die Gräfin für den Grafen Nani keinerlei Liebe, und das sagte sie ihm offen, als sie der Verzweiflung Limercatis ganz sicher war. Der Graf, ein Weltmann, bat sie, die ihm anvertraute betrübliche Wahrheit nicht etwa stadtbekannt werden zu lassen. »Wenn Sie die außerordentliche Nachsicht üben wollten,« fügte er hinzu, »mich auch fernerhin vor der Welt mit all den Vergünstigungen zu behandeln, die man einem erklärten Liebhaber zukommen läßt, so werde ich mich vielleicht darein schicken.«
Nach ihrer heldenmütigen Erklärung mochte die Gräfin weder mehr die Pferde noch die Loge des Grafen Nani. Aber seit fünfzehn Jahren an den vornehmsten Lebenszuschnitt gewöhnt, stand sie nun dem schwierigen oder, besser gesagt, unlösbaren Rätsel gegenüber, mit einer Pension von fünfzehnhundert Lire in Mailand zu leben. Sie verließ ihren Palast, mietete zwei Zimmer in einem vierten Stock, entließ alle Dienstboten, ja selbst ihre Kammerjungfer, und nahm sich an deren Stelle eine arme, alte Aufwartefrau. In Wirklichkeit war dieses Opfer weniger heldenhaft und hart, als es scheint. In Mailand ist die Armut nichts Lächerliches und wird folglich nicht von ängstlichen Seelen als der Übel größtes angesehen. Einige Monate waren in dieser edlen Armut verflossen, während deren sie fortgesetzt von Limercati und sogar vom Grafen Nani, der sie ebenfalls heiraten wollte, durch Briefe bestürmt wurde, als der Marchese del Dongo, sonst ein abscheulicher Geizhals, auf den Gedanken kam, seine Feinde könnten am Ende ihre Freude am Elend seiner Schwester haben. Was, eine del Dongo sollte ihr Leben kümmerlich mit dem Gnadengeld fristen, das ihr der Wiener Hof, über den er so viel Anlaß zu klagen hatte, als Generalswitwe auszahlte?
Er schrieb ihr also, seine Schwester fände im Schloß Grianta eine Wohnung und angemessene Aufnahme. Das bewegliche Gemüt der Gräfin griff den Gedanken an eine neue Lebensweise mit Begeisterung auf. Seit zwanzig Jahren hatte sie dieses ehrwürdige Schloß nicht betreten, das unter uralten Kastanien, die in den Zeiten der Sforza gepflanzt waren, majestätisch emporragte. ›Dort‹, sagte sie sich, ›werde ich Ruhe finden, und ist Ruhe in meinem Alter nicht Glück?‹ Da sie einunddreißig Jahre alt war, meinte sie, die Stunde ihres Abschieds von der großen Welt sei gekommen. ›Am Gestade jenes herrlichen Sees, wo meine Wiege stand, harrt meiner endlich ein friedsames, glückliches Leben.‹
Ich weiß nicht, ob sie sich täuschte, aber so viel steht fest, daß diese leidenschaftliche Seele, die so leichten Herzens zweimal ein Riesenvermögen verschmäht hatte, das Glück ins Schloß Grianta brachte. Ihre beiden Nichten waren närrisch vor Freude. »Du hast mir die schönen Tage der Jugend wiedergebracht!« jubelte die Marchesa ihr zu und schloß sie in ihre Arme. »Am Tage vor deiner Ankunft war ich hundert Jahre alt.«
Die Gräfin besuchte mit Fabrizzio alle bezaubernden Orte der Umgebung des Schlosses Grianta wieder, die von den Reisenden so gepriesen werden: die Villa Melzi auf dem anderen Seeufer, auf das man vom Schloß einen Ausblick hat, darüber den heiligen Hain der Sfondrata und das kecke Vorgebirge, das die beiden Arme des Sees scheidet, den wonnigen von Como und den tiefernsten von Lecco, erhabene und liebliche Landschaften, denen nur die berühmteste Gegend der Erde, der Golf von Neapel, gleicht, ohne sie zu übertreffen. Mit Entzücken lebte die Gräfin die Erinnerungen ihrer Kindheit wieder durch und verglich sie mit ihrem jetzigen Gemütszustand. ›Der Comer See‹, sagte sie sich, ›ist nicht wie der Genfer See von großen abgegrenzten und nach allen Regeln der Kunst bebauten Feldstücken umrahmt, die an Geld und Gelderwerb erinnern. Hier umgeben mich ringsum Hügel, von ungleicher Höhe, mit Baumgruppen bedeckt, die der Zufall gepflanzt, von Menschenhänden noch nicht verunziert und gezwungen, ihnen etwas einzubringen. Inmitten dieser wunderbar geformten Hügel, die in absonderlichen Hängen nach dem See abstürzen, kann ich alle Illusionen der Schilderungen Tassos und Ariosts bewahren. Alles ist edel und zärtlich, alles spricht von Liebe, nichts erinnert mich an die Häßlichkeiten der Zivilisation. Die auf halber Höhe verstreuten Dörfer sind hinter großen Bäumen versteckt, über deren Wipfel die gefälligen Linien ihrer Kirchtürme hervorlugen. Wenn hier und da ein bebautes Fleckchen von fünfzig Schritt im Geviert die Gruppen der Kastanien und wilden Kirschbäume unterbricht, so schaut das Auge dort zu seiner Befriedigung ein üppigeres und gedeihlicheres Wachstum als anderswo. Und über diese Hügel hinaus, deren Rücken einsame Stätten bieten, die man alle bewohnen möchte, gewahrt der staunende Blick die fernen, von ewigem Schnee bedeckten Spitzen der Alpen, deren ernste Erhabenheit an alles Weh des Lebens erinnert, das einem die Wonne des Augenblicks um so wertvoller macht. Der ferne Glockenton eines unter Bäumen versteckten Dorfkirchleins rührt die Phantasie; dieser gedämpft über das Wasser herdringende Klang nimmt die Farbe süßer Schwermut und Entsagung an und scheint dem Menschen zuzuflüstern: Das Leben flieht dahin. Sei darum nicht allzu wählerisch im Glück, das sich dir darbietet! Eile, es zu genießen!‹
Die Sprache dieser entzückenden Landschaft, die ihresgleichen nirgends auf Erden hat, machte das Herz der Gräfin wieder jung wie damals, als sie sechzehn Jahre zählte. Sie begriff nicht, wie sie so lange Zeit hatte verbringen können, ohne den See wiederzusehen. ›Hat sich also mein Glück auf die Schwelle des Alters geflüchtet?‹ fragte sie sich. Sie kaufte eine Barke, die sie mit Fabrizzio und der Marchesa eigenhändig ausschmückte, denn trotz aller fürstlichen Herrlichkeit hatte man für nichts Geld. Seit der Marchese del Dongo in Ungnade gefallen war, hatte er seinen aristokratischen Aufwand verdoppelt. Zum Beispiel hatte er, um dem See zehn Schritt Land abzugewinnen, an der berühmten Platanenallee nach Cadenabbia einen Damm aufwerfen lassen, der achtzigtausend Lire kostete. Am Ende dieses Dammes erhob sich, nach Plänen des berühmten Marchese Cagnola, eine Kapelle aus Granitquadern, in der ihm Marchesi, der Modebildhauer von Mailand, ein Grabmal erbaute, dessen zahlreiche Reliefs die Taten seiner Vorfahren rühmten.
Fabrizzios älterer Bruder, der Marchesino Ascanio, zeigte Lust, an den Ausflügen der Damen teilzunehmen; aber seine Tante goß ihm Wasser über sein gepudertes Haar und hatte täglich eine neue kleine Neckerei, um ihn aus seiner Schwerfälligkeit herauszubringen. Endlich befreite er die lustige Schar, die in seiner Gegenwart nicht zu lachen wagte, vom Anblick seines dicken, bleichen Gesichts. Man hielt ihn für den Spion seines Vaters, des Marchese, und man mußte sich vor diesem, der seit seiner unfreiwilligen Verabschiedung ein strenger und allzeit wütiger Despot geworden war, in acht nehmen.
Ascanio schwur dem Fabrizzio Rache.
Bei einem Unwetter geriet man in Gefahr; obgleich das Geld äußerst knapp war, belohnte man die beiden Ruderknechte reichlich, damit sie vor dem Marchese ihren Mund hielten, der schon genug murrte, daß man ihm immer seine beiden Töchter entführe. Sie wurden ein zweites Mal vom Sturm überfallen. Unwetter sind auf diesem schönen See von furchtbarer Plötzlichkeit; ganz jäh brechen Windstöße aus zwei entgegengesetzten Gebirgsschluchten hervor und kämpfen über den Fluten.
Die Gräfin wollte landen, während der Sturm tobte und der Donner krachte. Sie behauptete, von einem einsamen Felsen in der Seemitte, der kaum die Größe eines Zimmers hatte, genösse man ein einzigartiges Schauspiel; man sähe sich ringsum von wilden Wogen umbraust. Aber beim Herausspringen aus der Barke fiel sie ins Wasser. Fabrizzio sprang ihr sofort nach, um sie zu retten, doch wurden beide ziemlich weit weggetrieben. Zweifellos ist es kein Vergnügen, beinahe zu ertrinken, aber es bannte die Langeweile ganz erstaunlich aus der Ritterburg.
Die Gräfin hatte sich für das altfränkische Wesen und für die Astrologie des Abbaten Blanio begeistert. Das wenige Geld, das ihr nach Ankauf der Barke verblieben war, hatte sie dazu verwendet, ein kleines Spiegelfernrohr zu kaufen, und fast allabendlich stellte sie es mit Fabrizzio und ihren Nichten auf der Plattform eines der gotischen Schloßtürme auf. Fabrizzio mußte den Gelehrten spielen, und man verlebte da droben, fern von Spionen, manche höchst heitere Stunde.
Es muß zugegeben werden, daß es Tage gab, da die Gräfin mit keinem Menschen ein Wort sprach. Dann sah man sie unter den hohen Kastanien hinwandeln, in düstere Träumereien versunken. Ihr Geist war zu rege, als daß sie nicht bisweilen den Mangel an Gedankenaustausch empfunden hätte. Aber anderntags lachte sie wieder wie sonst. Besonders waren es die Klagen ihrer Schwägerin, der Marchesa, die ihre von Natur so tatenlustige Seele schwermütig machten.
»Sollen wir denn den Rest unserer Jugend in diesem traurigen Schloß verbringen?« jammerte die Marchesa. Vor der Ankunft der Gräfin hatte sie nicht einmal den Mut zu solchen Klagen gehabt.
So verlebte man den Winter von 1814 auf 1815. Zweimal ging die Gräfin ungeachtet ihrer Armut auf ein paar Tage nach Mailand. Der Zweck war, ein köstliches Ballett von Viganò zu sehen, das in der Scala gegeben wurde, und der Marchese hatte nichts dagegen, wenn seine Frau ihre Schwägerin begleitete. Sie hob den Vierteljahrsbetrag der kleinen Pension ab, und so war es die arme Witwe des zisalpinischen Generals, die der steinreichen Marchesa del Dongo ein paar Zechinen borgte. Diese kleinen Reisen waren entzückend. Die Damen luden sich alte Freunde zum Mittagsmahl ein und trösteten sich wie Kinder, indem sie über alles lachten. Diese italienische Heiterkeit, voller Leidenschaft und Laune, ließ sie die düstere Trübsal vergessen, die ihnen in Grianta die Blicke des Marchese und seines ältesten Sohnes bereiteten. Der kaum sechzehnjährige Fabrizzio spielte seine Rolle als Familienhaupt vorzüglich.
Am 7. März 1815 waren die Damen gerade den zweiten Tag von solch einem herrlichen kleinen Ausflug nach Mailand zurück. Sie lustwandelten in der schönen Platanenallee, die neuerdings bis unmittelbar an das Seegestade verlängert worden war. Eine Barke tauchte aus der Richtung von Como auf und machte sonderbare Zeichen. Ein Agent des Marchese sprang auf den Damm: Napoleon sei im Golf von Juan gelandet. Europa in seiner Gutmütigkeit war ob dieses Ereignisses überrascht, der Marchese del Dongo ganz und gar nicht. Er schrieb an seinen kaiserlichen Gebieter einen überschwenglichen Brief, bot ihm seine Talente und mehrere Millionen an und wiederholte ihm, seine Minister seien Jakobiner und stäken unter einer Decke mit den Pariser Rädelsführern.
Am 8. März, um sechs Uhr früh, ließ sich der Marchese, seine Orden auf der Brust, von seinem ältesten Sohne den Entwurf einer dritten politischen Depesche diktieren und brachte sie würdevoll in seiner wohlgepflegten Handschrift ins reine. Das Papier trug als Wasserzeichen das Bildnis des Kaisers. Zur selben Stunde ließ sich Fabrizzio bei der Gräfin Pietranera melden.
»Ich gehe fort,« sagte er zu ihr, »ich will zum Kaiser, der auch König von Italien ist. Er hat deinem Gatten so viel Gutes erwiesen. Ich reise durch die Schweiz. Mein Freund Vasi, der Barometerhändler in Menaggio, hat mir seinen Paß gegeben. Gib mir jetzt ein paar Napoleons, denn ich besitze nur zwei. Aber wenn es sein muß, gehe ich auch zu Fuß!«
Die Gräfin weinte vor Freude und Schrecken. »Mein Gott,« rief sie aus und faßte ihn bei den Händen, »warum mußtest du auf diesen Einfall kommen?«
Sie stand auf und holte eine kleine, perlenbestickte Börse aus dem Wäschespind, wo sie sorglich versteckt lag; sie enthielt alles, was sie auf der Welt besaß.
»Nimm das!« sagte sie zu Fabrizzio. »Aber, um Gottes willen, laß dich nicht töten! Was bliebe uns dann noch, deiner unglücklichen Mutter und mir, wenn du nicht wiederkämst? An Napoleons Erfolg kann ich nicht glauben, mein armer Junge; die Unseren werden ihn bald unterkriegen. Hast du nicht vor acht Tagen in Mailand die Geschichte von den dreiundzwanzig ausgeklügelten Mordanschlägen gehört, denen er nur durch ein Wunder entgangen ist? Und damals war er allmächtig! Auch hast du gesehen, daß es unseren Feinden nicht am Willen fehlt, ihn zu verderben. Frankreich war nichts mehr seit seiner Abdankung.«
Und im Ton der lebhaftesten Erregung sprach die Gräfin vom künftigen Schicksal Napoleons. »Wenn ich dir erlaube, zu ihm zu gehen,« sagte sie, »bringe ich ihm mein Liebstes auf der Welt zum Opfer.« Fabrizzios Augen wurden feucht. Er umarmte die Gräfin unter Tränen, aber sein Entschluß wurde nicht einen Augenblick erschüttert. Das Herz ging ihm über, als er seiner teueren Freundin die Gründe auseinandersetzte, die ihn dazu bestimmten und die recht töricht zu finden wir uns erlauben.
»Gestern abend, es war sieben Minuten vor sechs, gingen wir, wie du weißt, in der Platanenallee unterhalb der Villa Sommariva am See spazieren. Wir wanderten südwärts. Da gewahrte ich als erster in der Ferne das Boot, das von Como kam und uns eine so bedeutsame Kunde brachte. Gar nicht an den Kaiser denkend, war ich beim Anblick des Schiffes nur neidisch auf alle, denen das Schicksal zu reisen erlaubt, und ganz plötzlich ergriff mich eine tiefe Bewegung. Das Schiff legte an. Der Bote sprach leise mit meinem Vater. Der wurde blaß und nahm uns beiseite, um uns die ›schreckliche Nachricht‹ mitzuteilen. Ich schaute nach dem See hinaus, ohne andere Absicht, als meine Freude zu verbergen, von der mir die Augen überliefen. Plötzlich, in unendlicher Höhe, rechter Hand von mir, sah ich einen Adler, den Vogel Napoleons; er flog majestätisch dahin, in der Richtung nach der Schweiz, also auf Paris zu. Auch ich, sagte ich mir sofort, will die Schweiz mit Adlerschnelle durcheilen und hingehen und dem großen Mann alles darbieten, was ich ihm darzubieten vermag. Es ist wenig genug: die Hilfe meines schwachen Armes! Er wollte uns ein Vaterland geben. Und er liebte meinen Onkel. Im Augenblick, während ich noch den Adler sah, versiegten seltsamerweise meine Tränen, und der Beweis, daß mein Einfall von oben stammt, ist der: blitzartig kam mir mein Entschluß, und zugleich sah ich die Mittel, wie ich die Reise ausführen könne. Im Nu war all meine Schwermut, die mir das Leben vergällt – du weißt, besonders an Sonntagen –, wie durch einen göttlichen Hauch weggeweht. Ich sah das hehre Bild der Italia wieder aus dem Schmutz emporsteigen, in den es die Habsburger niederdrückten. Sie streckte ihre zerschundenen Arme, noch halb mit Ketten belastet, ihrem König und Befreier entgegen. Und ich, sagte ich mir, ich noch unbekannter Sohn meiner unglücklichen Heimat, ich will hingehen und sterben oder siegen mit diesem Mann; ihn hat das Schicksal ausersehen, uns reinzuwaschen von der Verachtung, mit der uns sogar die gemeinsten Knechtsseelen Europas überschütten.
Du kennst,« fuhr er im Flüsterton fort, indem er ganz nahe an die Gräfin herantrat und sie flammenden Auges ansah, »du kennst den jungen Kastanienbaum, den meine Mutter in dem Winter, da ich geboren wurde, mit eigenen Händen gepflanzt hat, am Rand der großen Quelle in unserem Walde, zwei Meilen von hier. Ich wollte nichts unternehmen, ehe ich ihn nicht besucht hatte. Der Frühling ist noch im Rückstand, sagte ich bei mir. Gerade darum! Wenn mein Baum schon Blätter hat, soll mir das ein Zeichen sein! Auch ich soll aus dem Winterschlaf aufwachen, in dem ich in diesem öden, kalten Schloß hinsieche. Findest du nicht, daß diese altersschwarzen Mauern, einst Mittel und heute Sinnbilder der Gewalt, ein wahres Abbild des traurigen Winters sind? Sie sind für mich, was der Winter für meinen Baum ist.
Wirst du es glauben, Gina? Gestern abend, um halb acht Uhr, kam ich zu meinem Kastanienbaum. Er hatte Blätter, schöne kleine Blätter, ja schon ziemlich kräftige. Ich küßte sie behutsam und grub die Erde rund um den lieben Baum ehrfurchtsvoll um. Dann ging ich, von frischer Leidenschaft erhoben, über die Berge nach Menaggio; ich mußte mir einen Paß nach der Schweiz verschaffen. Die Zeit verstrich im Fluge. Es war bereits ein Uhr nachts, als ich an Vasis Tür anlangte. Ich hatte gedacht, ich müßte lange klopfen, um ihn wach zu kriegen; aber er war noch auf mit drei Freunden. Ehe ich Worte fand, rief er mir entgegen: ›Du willst zu Napoleon!‹ und flog mir um den Hals. Auch die anderen umarmten mich freudig. ›Warum bin ich verheiratet!‹ sagte der eine.«
Die Gräfin war nachdenklich geworden; sie meinte, ein paar Einwände vorbringen Zu sollen. Mit der geringsten Welterfahrung hätte Fabrizzio merken müssen, daß seine Tante selber nicht an die guten Ratschläge glaubte, die sie ihm in aller Eile zu geben versuchte. Für den Mangel an Erfahrung besaß er Entschlossenheit. Er hörte gar nicht auf die trefflichen Lehren. Schließlich bestürmte ihn die Gräfin, er möge wenigstens seine Mutter in seinen Plan einweihen.
»Sie wird es meinen Schwestern sagen, und diese Frauenzimmer werden mich ungewollt verraten!« rief Fabrizzio in gewisser Heldengröße.
»Sprich doch mit etwas mehr Achtung«, entgegnete die Gräfin, unter Tränen lächelnd, »von dem Geschlecht, das einst dein Glück bilden wird, denn den Männern wirst du allezeit mißfallen. Du bist zu feurig für die prosaischen Seelen.«
Die Marchesa zerfloß in Tränen, als sie den absonderlichen Plan ihres Sohnes erfuhr. Sie hatte kein Verständnis für Heldentum und tat alles mögliche, um ihn zurückzuhalten. Als sie überzeugt war, daß ihn nichts auf der Welt zu hemmen vermochte, höchstens Kerkermauern, händigte sie ihm das wenige Geld aus, das sie besaß. Da fiel ihr ein, daß ihr der Marchese tags zuvor acht oder zehn Brillanten anvertraut hatte, die in Mailand gefaßt werden sollten. Sie waren etwa zehntausend Franken wert. Als die Gräfin diese Diamanten in den Rock unseres Helden einnähte, kamen Fabrizzios Schwestern hinzu. Er gab den armen Damen die armseligen Goldstücke zurück. Seine Schwestern waren von seinem Vorhaben dermaßen begeistert, sie umarmten ihn mit so ungestümer Freude, daß er die noch nicht eingenähten Diamanten in die Hand nahm und Hals über Kopf abreisen wollte.
»Ihr werdet mich, ohne daß ihr es wollt, verraten!« sagte er zu seinen Schwestern. »Da ich so viel Schätze besitze, ist es unnötig, Sachen einzupacken. Ich bekomme überall das Nötige.« Damit umarmte er diese Menschen, die ihm so lieb und wert waren, und reiste unverzüglich ab, ohne sein Zimmer noch einmal zu betreten. Er ging, so schnell er konnte, immer in Furcht, er werde von Berittenen verfolgt. So kam er noch am nämlichen Abend in Lugano an. Nun war er, Gott sei Dank, in einer Schweizer Stadt und nicht mehr auf der einsamen Landstraße und in Angst, in die Gewalt von Gendarmen zu geraten, die im Sold seines Vaters standen. Von dort aus schrieb er an ihn einen schönen Brief – eine kindliche Schwäche –, der den Zorn des Marchese nur schürte.
Fabrizzio mietete sich ein Pferd und ritt über den Sankt Gotthard. Seine Reise ging rasch vonstatten. In Pontarlier betrat er französischen Boden. Der Kaiser war bereits in Paris. Dort begannen Fabrizzios Leiden. Er war mit dem festen Vorsatz von Hause weggegangen, den Kaiser zu sprechen, aber es war ihm nie eingefallen, daß dies seine Schwierigkeiten hatte. In Mailand hatte er den Fürsten Eugen zehnmal am Tage gesehen und hätte ihn oft ansprechen können. In Paris ging er jeden Vormittag in den Tuilerieenhof, wenn Napoleon Truppenschau abhielt, aber niemals konnte er an den Kaiser herankommen.