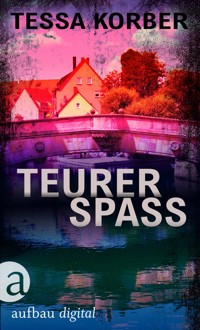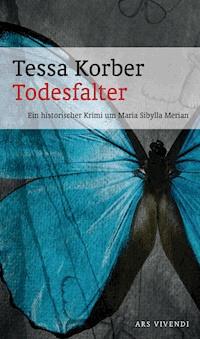8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie liegen auf den Steinen des Friedhofs, streunen durch die Straßen von Paris und sonnen sich auf den Treppenstufen, die zu Sacré-Coeur hinaufführen. Die Katzen von Montmartre sind überall und erschnuppern oder erfühlen mit ihren Schnurrhaaren so einiges, was den menschlichen Bewohnern der Stadt nur zu leicht entgeht. Als die Leiche eines jungen Mädchens auf dem Friedhof von Montmartre gefunden wird und zudem noch die Katze Grisette, der Schwarm aller Kater, von einem auf den anderen Tag verschwunden ist, beginnen die Katzen auf eigene Pfote zu ermitteln. Hat der Mord etwas mit dem plötzlichen Verschwinden von Grisette zu tun? Und wie tief müssen die Katzen in die Geschichte des Montmartre hinabsteigen, um dieses Geheimnis zu lüften?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
BuchSie liegen auf den Steinen des Friedhofs, streunen durch die Straßen von Paris und sonnen sich auf den Treppenstufen, die zu Sacré-Cœur hinaufführen. Die Katzen von Montmartre sind überall und erschnuppern oder erfühlen mit ihren Schnurrhaaren so einiges, was den menschlichen Bewohnern der Stadt nur zu leicht entgeht. Als die Leiche eines jungen Mädchens auf dem Friedhof von Montmartre gefunden wird und zudem noch die Katze Grisette, der Schwarm aller Kater, von einem auf den anderen Tag verschwunden ist, beginnen die Katzen auf eigene Pfote zu ermitteln. Hat der Mord etwas mit dem plötzlichen Verschwinden von Grisette zu tun? Und wie tief müssen die Katzen in die Geschichte des Montmartre hinabsteigen, um dieses Geheimnis zu lüften?
Autorin
TESSA KORBER, 1966 in Grünstadt in der Pfalz geboren, studierte in Erlangen Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaften und promovierte im Fachbereich Germanistik. Bei btb hat sie bereits zwei Kriminalromane um die Bestatterfamilie Anders veröffentlicht. »Die Katzen von Montmartre« ist ihr erster Katzenkrimi. Tessa Korber lebt mit ihrem Mann und ihren Katzen in der Nähe von Würzburg.
Tessa Korber
Die Katzen von Montmartre
Kriminalroman
Für alle Katzen,die mein Leben geteilt oder durchquert haben.Vor allem für Marie und ihre Kinder. Für Paul, Artjom, Heisenberg, Joan Watson und Célimène.Und für alle, die ich am Wegrand sah.
Das Katzenpersonal
Matisse aus dem Andenkenladen von Monsieur Martis ist ein junger Herumtreiber, neugierig, lebhaft gefleckt, und hat seine Freunde unter den Gauklern und Bettlern, die sich Tag für Tag um Sacré-Cœur drängen.
Bonnard hat ein sonniges Gemüt. Der rot gestromte Kater lebt auf dem Friedhof, schätzt die ruhige Nachbarschaft und den Frieden, mit dem die Hinterbliebenen nach der Grabpflege auf den Bänken sitzen und ihn kraulen.
Grisette ist der Schwarm aller Kater vom Montmartre, schlank, grau, mit einem Hauch Perser und den blauesten Augen der Welt. Wer sie sieht, verfällt ihr. So wie einst ihrer Herrin, Madame Chauchat, die als Prostituierte arbeitete, ehe sie den Zeitungskiosk übernahm.
Dégas misstraut jedem. Der düstere Kater ist ein Schatten, der im Bateau-Lavoir lebt wie eine Erinnerung an eine bessere Zeit. Wenn einer um das Geheimnis der sieben Leben der Katzen weiß, dann ist es Dégas. Doch der große Schwarze teilt sein Wissen nicht mit jedem.
Schon gar nicht mit den jungen Tunichtguten Pablo und Miró aus dem Bistrot von Monsieur Moulin. Dabei sind diese beiden es, die bei ihren endlosen Spielen über die eine Leiche stolpern, die nicht auf den Friedhof Montmartre gehört.
Mein Name ist Bonnard. Ich wohne auf dem Friedhof von Montmartre. Es ist kein schlechter Ort, still, grün, mit frischer Erde für die gewissen Bedürfnisse, was in der Stadt keine Selbstverständlichkeit ist. Mit warmen Ruheplätzen in der Sonne, Gewölben und Löchern zum Unterschlüpfen und – was Sie nicht wahrnehmen können mit Ihren Ohren – erfüllt vom ewig raschelnden, fiependen, trippelnden, zuckenden, atmenden Lied der Mäuse. Es erklingt überall, es hüllt mich ein wie eine Decke. Es ist immer da. Sie sollten sich einmal in Ruhe hinsetzen, die Ohren aufstellen und die Schnurrhaare – ach, und da beginnen die Probleme schon wieder. Sie haben ja gar keine. Und diejenigen unter Ihnen, die einen Schnurrbart besitzen, können nicht damit hören. Genauso wenig, wie Sie mit Ihren Pfoten sehen können. Pardon, mit Ihren Fingern. Trösten Sie sich, dafür vermögen Sie damit so schöne Dinge zu erschaffen wie diesen Ort, mein Zuhause.
Sie denken, wir würden Sie mit unseren Katzenaugen schon seit der Zeit des Pyramidenbaus beobachten. Und – aber das wollen Sie ungern zugeben – wir hätten dabei all Ihre Geheimnisse erfahren. Menschen sind schon seltsam. Über solche Dinge machen Sie sich einen Kopf, aber an das Naheliegendste denken Sie nicht. Was das ist, das Naheliegendste? Typisch, dass Sie das fragen müssen.
Im Moment liege ich hier auf dieser Bank aus Schmiedeeisen und grünem Holz. Mein rotes Fell leuchtet in der Sonne, derselben Sonne, die all die Steine ringsum erwärmt: die steilen gepflasterten Straßen von Montmartre, auf denen in diesem Moment das Wasser der Straßenreinigung hinuntersprudelt, hinaus auf den Boulevard de Clichy und hinein nach Paris. Die Häuser in den engen Gassen sind alt, alle stehen schon lange hier und atmen ihre Geschichte. Die Sonne braucht lange, bis sie ihre Fundamente erreicht. Die Kirchen und Treppen und Türme dagegen streben steil aufwärts, hoch hinauf bis zur weißen Kuppel von Sacré-Cœur, die sich in einen blauen Himmel streckt, der sich wie ein seidenes Zelt über die ganze Stadt spannt.
Die Mausoleen und Gräber rings um mich bilden eine eigene kleine Stadt, nicht der Toten, sondern des Erinnerns. Auch hier dominieren die Lebenden, gerade hier. Sie fahren auf der Straße, die auf gußeisernen Stelzen über den Friedhof hinwegführt. Die Rue Caulaincourt ist ein Viadukt, in dem der Verkehr rauscht. Sie gießen und gärtnern zwischen den Gräbern oder laufen mit Kameras und Karten herum und suchen raschelnd und beratschlagend die Ruhestätten von prominenten Persönlichkeiten. Sie alle liegen mir nahe.
Ich mag die Menschen. Und zugegeben, ich weiß einiges über sie. Auch wenn ich damals bei den Pyramiden nicht dabei war. Keiner von uns war das, schätze ich. Allenfalls Dégas, ja, bei Dégas, dem großen Schwarzen, an dem sich kein einziges helles Haar befindet, bei dem würde ich es für möglich halten, dass er die Geheimnisse aller neun Katzenleben kennt und noch einiges darüber hinaus. Aber sonst?
Ich bin nicht der einzige Kater auf dem Friedhof, viele unserer Gemeinschaft leben hier. Junge Dinger, die kommen und gehen. Die sich nicht zu schade sind, in einer Gruft zu nächtigen oder sich in einer leeren Blumenschale zusammenzurollen. Manche spielen mit den ausgebleichten Bändern der Grabkränze, zum Entzücken der Leute. Nun ja.
Meine Aufgabe ist eine andere.
Ich bin für die Menschen da, die der Toten wegen kommen. Sie spazieren herein, hantieren ein wenig mit der Kanne und der Harke, die sie hinter dem Grabstein versteckt haben, zupfen und richten die Blumen; einige sprechen ein Gebet. Und früher oder später setzen sie sich zu mir auf die Bank. Ich tue nichts, das ist gar nicht nötig. Es dauert nicht lange, bis sie die Hand ausstrecken, um mir unbeholfen über den Kopf zu streicheln oder mich am Kinn zu kraulen. Ich rühre mich noch immer nicht. Sie bemerken von selber, wie leicht ihre Hand über meinen Körper gleitet. Wie von selbst, wie dafür gemacht.
Der zweite Streichler ist schon glatter, flüssiger, länger. Ich schmiege mich an die Bewegung an, dehne mich. Ihre Finger finden genau den richtigen Widerstand in meinem Fell, um darin zu spielen. Es geht ganz einfach. Nur ein Weilchen, und wir sind eins, meine Menschen und ich. Sie atmen ruhiger, ihr Puls verlangsamt sich. Ich schnurre dazu und weiß, wie es ihnen geht. Denn es geht mir genauso. Und dann, ganz sacht, manchmal stockend und manches Mal wie ein Wasserfall, beginnen sie zu erzählen.
So wie Madame Valladon. Sie kommt schon lange hierher, viel zu lange. Wenn sie am Grab ihres Vaters die Begonien gerichtet hat, setzt sie sich jedes Mal zu mir. Sie ist eine von denen, die mit meinem schönsten Schnurren belohnt werden, dem tiefen, das wie eine Wolke Bienen in der Luft steht. Und dazu schenke ich ihr einen Blick aus meinen ägyptischen Augen.
»Ach, Bonnard«, sagt Madame Valladon dann. Sie riecht nach Butter und Hefe, denn sie ist Pâtissière.
Schnurren, einatmen.
»Mein Vater hat es nicht leicht gehabt.«
Schnurren, ausatmen.
»Dreißig Jahre! Dreißig Jahre hat er im Gefängnis verbracht. Und weißt du, was er am Ende gesagt hat?«
Inzwischen kenne ich die Geschichte gut. Ihr Vater Marcel war siebzehn, als er verhaftet wurde. Und ihre Mutter ein schwangerer Teenager, die aus allen Wolken fiel, als sie davon erfuhr. Marcel hätte Konditor werden sollen, wie alle Valladons vor ihm seit dem Tag, da ihr Vorfahr, der jüngste Sohn eines armen Bauern in der Provence, sich auf dem Montmartre ein Zimmer genommen hatte, auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Damals fuhren die Eisenbahnen noch mit Dampf.
Der Montmartre hat viele Gesichter, immer schon. Die Pâtisserie der Valladons liegt, so unscheinbar sie hinter ihrem grün gestrichenen Rolladen wirkt, am Schnittpunkt vieler Welten: Abwärts findet man die Cafés, Boutiquen und Galerien des mondänen Paris, oberhalb die Touristenwelt von Sacré-Cœur. Rechts geht es in die Viertel, die heute Afrika gehören und von denen es heißt, dass sie dort schwarze Katzen für Voodoo-Rituale benutzen. Links liegt das Moulin Rouge, seit jeher Mittelpunkt des Rotlichtmilieus.
Den jungen Marcel zog es eher nach links. Seine Familie vermietete damals die Zimmer im dritten Stock an Touristen. Dort wohnten zu der Zeit ein deutscher Schriftsteller mit Frau und Sohn, den der Mythos vom Künstlerviertel angezogen hatte. Einen Roman wollte er schreiben. Morgens vom Balkon aus zusehen, wie seine Frau mit einem Baguette unter dem Arm aus dem Bäckerladen tritt, in einem Blumenkleid. Wie sie ihm winkt, und er und das Kind zurückwinken.
Der Junge war drei; das vergaß in der Familie Valladon niemand mehr. Nur wie er hieß, daran kann sich keiner erinnern. Marcel und ein Freund hatten getrunken, auch ein paar andere Rauschmittel genommen und es plötzlich für eine gute Idee gehalten, die deutsche Familie auszurauben. Es war nicht das erste Mal: Handtaschen, Kioskkassen, an solchen Dingen hatten sie sich schon ein paarmal versucht. Immer ging es nur um ein paar Francs. Die Deutschen kannten Marcel und würden ihm öffnen, wenn er klopfte. Sie vertrauten ihm.
»Mein Vater sagt, dass sein Freund angefangen hat. Mit dem Messer. Auf einmal hat er losgestochen. Dann war da Blut, überall Blut.« Sie seufzt an dieser Stelle immer. Als könnte sie die Schreie hören, als wäre sie dabei gewesen. Ihre Hand stockt dann in meinem Fell. Ein kleines Zucken eines Muskels meinerseits bringt sie dazu, mich weiter zu streicheln.
»Aber er hat mitgemacht, sagt er. Auch er.«
Ich setze für eine Weile pietätvoll mit dem Schnurren aus.
»Erst als sein Freund den Jungen am Bein gepackt hatte, kam er wieder zu sich.«
Die Schreie, die Gewalt und das Blut mussten die jungen Männer in einen Rausch versetzt haben. Wer einmal Mardern nachts zugesehen hat, wenn sie einen offenen Kaninchenstall finden, der weiß, wovon ich rede. Aber ich schweife ab. Der Junge also baumelte kopfüber vom Balkon, von dem völlig durchgedrehten Freund nur noch an einem Fuß gehalten. Die Mutter, schon fast tot, lag auf dem Boden und umklammerte sein Bein in dem Versuch, ihren Sohn zu retten. Da besann Marcel sich plötzlich. Er ließ sein Messer fallen, packte den anderen Fuß des Kindes mit seinen vom Blut glitschigen Händen, bekam ihn zu fassen und rief laut über den Balkon nach Hilfe.
Unten in der Straße liefen schon die Leute zusammen. Der Freund flüchtete. Marcel aber wartete, von allen angestarrt, bis unten zwei Männer die Arme ausgestreckt hatten. In ihre Hände ließ er den Jungen dann fallen. Ihm geschah nichts. Die Frau starb. Der Mann war schon tot. Marcel wurde an Ort und Stelle verhaftet, blutüberströmt und fassungslos.
»Und weißt du, was er gesagt hat?«
Ja, Madame Valladon, ich weiß es. Er sagte: Als ich den Jungen rettete, wurde ich selbst gerettet.
Sie streichelt mich weiter, mit der freien Hand fischt sie nach einem Taschentuch. Auch als sie sich schnäuzt, bleibt ihre warme, trockene Hand in meinem Fell. Ihr Puls wird ruhiger.
Als Madame Valladon geboren wurde, saß ihr Vater schon in Haft. Ihr Großvater nahm Mutter und Kind bei sich auf und machte das Mädchen zur Pâtissière und seiner Nachfolgerin im Geschäft. Madame Valladon backt mit Hingabe, bis heute. Als sie erwachsen war, brachte sie ihrem Vater hin und wieder ein Brioche oder ein paar Macarons ins Gefängnis. Dann erzählte er ihr jedes Mal, was sie mir erzählt. Warum er tat, was er getan hatte, verstand er selbst bis zuletzt nicht. Aber ich kenne das Gefühl, eine Maus zu töten und ihr hinterher liebevoll das Fell abzulecken. Gefühle sind eine starke Sache. Stärker als Gedanken.
So vergehen meine Tage. Ich lebe auf dem Friedhof. Manche sagen, ich hätte einmal einem Priester gehört. Immer wäre ich mitgegangen, wenn er hier seine Beerdigungen zelebriert hat. Hätte am Saum seiner Soutane gesessen während des »Asche zu Asche« und »Staub zu Staub« und wäre mit schlängelndem Schwanz hinter dem Trauerzug hergelaufen bis ins Bistrot zum Leichenschmaus. Und als er selber zu Grabe getragen wurde und nicht wieder ging, da wäre ich auch einfach hiergeblieben.
Manch andere wiederum behaupten, ich wäre mit einer jungen Frau hierher gelangt, die nachts heimlich auf den Friedhof geschlichen war, um Selbstmord zu begehen. Maunzend wäre ich ihr hinterhergelaufen bis zu dem Ort, an dem sie sich das Leben nahm, und hätte ihn dann aus Kummer nie wieder verlassen. Mit der Zeit wäre ich ruhiger geworden.
Wieder andere dagegen … aber ich habe genug erzählt. Sie müssen nur verstehen: Ich kam. Ich blieb. Ich bin eine Institution.
Ich war dabei, als das tote Mädchen gefunden wurde, als der Alte fast starb und der Junge sein Lied sang.
Ich würde Ihnen die Geschichte ja erzählen. Aber Katzen sind keine Freunde großer Worte. Tun Sie das Naheliegende: Streicheln Sie mich. Fahren Sie mit der Hand durch mein knisterndes Fell. Spüren Sie die Wärme, die Weichheit, diese Nachgiebigkeit, mit der ich mich dehne und dehne? Nein, das sind keine Funken, nur Mut. Ein wenig Elektrostatik vielleicht. Und das Strahlen der Sonne, die alle Farben zu etwas Besonderem macht. Meine Streifen leuchten nicht plötzlich auf in diesem überirdischen Rot. Sie sehen es jetzt nur, das Rot. Sehen es wie zum ersten Mal. Begreifen mit all Ihren Fingern, was es bedeutet. Und jetzt horchen Sie in sich hinein.
Es ist alles schon da.
Suzanne räkelte sich auf dem Fensterbrett, ein Auge auf die Straße gerichtet, eines auf den Tisch der Backstube, wo Madame Valladon gerade den Teig für die Religieuses bearbeitete, eine Art von Windbeutel in zwei Stockwerken, mit Buttercremefüllung und Schokoladenguss. Der Teig war trocken und schwer, Madame Valladon rührte mit aller Kraft. Jedes der fünf Eier musste einzeln untergehoben und hineingearbeitet werden, so hatte sie es von Großvater Valladon gelernt, und so hielt sie es.
Suzanne gähnte und leckte an ihren Pfoten.
Da Madame Valladon eine praktisch veranlagte Frau war, glaubte sie, Suzanne warte auf ihren Anteil am Teig und der Crème, der ihr auch immer liebevoll ausgehändigt wurde. Und da Suzanne eine überaus pragmatische Katzendame war, traf diese Vermutung auch zu. Aber das war nur ein Grund für ihre Fensterwache.
Suzanne machte sich Sorgen um ihr Frauchen. Sich so an den eigenen Vater zu hängen, das war in Suzannes Augen nicht normal. Junge hingen an ihren Müttern, sie fiepten und maunzten und suchten die Wärme des mütterlichen Bauches, bis sie dann groß und frech wurden und ihrer eigenen Wege gingen. Eine Ohrfeige, die konnte man ihnen mit auf den Weg geben, dachte Suzanne, ganz erfahrene Maman. Für all den Unsinn, den sie noch anstellen würden, und all die Mühe, die sie einen gekostet hatten. So redete Suzanne mit sich selbst, dabei schmolz ihr Herz schon bei dem Gedanken an all die Kätzchen, die sie im Lauf der Jahre großgezogen hatte, schmolz wie die Schokolade in der Crème pâtissière. Und sie dachte, dass es vielleicht das war, was Madame Valladon fehlte: ein Wurf, den man umsorgen und bemuttern musste. Oder wenigstens ein Junges.
Suzanne stammte aus demselben Dorf wie die Valladons; ihre Vorfahren waren grundsolide Scheunenbewohner und Mäusejäger gewesen, mit geschickten Pfoten und einem Sinn für das Notwendige. Alle paar Sommer, wenn wieder einmal ein vierbeiniger Mitbewohner den Tücken des Stadtlebens zum Opfer gefallen war, kam ein neuer Provinzler aus der Heimat der Valladons nach Paris, maunzend, aufgelöst, empört an seinem Reisekorb kratzend. Vor fünfzehn Jahren war das Suzanne gewesen. Und sie war geblieben. Weder Verkehr noch Gift noch böse Nachbarn hatten ihr schaden können. Suzanne hatte sich eingerichtet in der Backstube, den paar Zimmerchen darüber und den Gassen, die zu ihrem Heim gehörten. Zuverlässig sah man sie am Fenster oder im Schatten der Hecke des kleinen Gärtchens, in dem Madame Valladon die Damaszenerrosen zog, die sie für ihr berühmtes Rosengelee benötigte. Und ebenso zuverlässig, liebevoll und vernünftig zog Suzanne Wurf um Wurf groß. Immer waren es vier Kätzchen, und immer war eines davon dreifarbig wie sie selbst, ein Glückskätzchen. Dazu eines rot und eines grau getigert und eines zu guter Letzt schwarz. Die Menschen im Viertel wussten um Suzannes Zuverlässigkeit und tätigten ihre Bestellungen für einen neuen Hausgenossen bei Madame Valladon bald im voraus.
Suzanne zog all die Kleinen mit Liebe und Strenge auf, säugte sie, putzte sie und leckte ihnen Schnäuzchen und Bäuche mit ihrer warmen, rauhen, liebevollen Zunge. Bis es an der Zeit war, dass die Kleinen aufbrachen. Jedes Mal brach es Suzanne ein wenig das Herz, aber nie war viel Zeit für Kummer, denn der nächste Wurf kündigte sich bereits an in ihrem sich rundenden Bauch.
Die einzige Romanze in Suzannes Leben – wenn man denn so viel Mutterliebe die Romantik absprechen will – war ihre Affaire mit diesem griechischen Schiffskater im letzten Sommer. Er war von den Ufern der Seine bis zu ihr hinaufgestiegen, nur ihretwegen. Zumindest hatte er das erzählt. Aber ach, er hatte so manches gesagt. Dass sie schön sei, dass er mit ihr um die Welt reisen wolle. Dass Katzen wie sie im fernen Japan als Glücksbringer gälten und Kapitäne Reichtümer dafür gäben, eine Dreifarbige wie sie auf ihrem Schiff zu haben. Dass er sie niemals verlassen würde.
Suzanne war verzaubert gewesen, hingerissen. Das Lied des Fremden, das über die Mauer zu den Rosen stieg, schien ihr das schönste, das sie je gehört hatte. Obwohl die provenzalische Dorfmaid in ihr zugleich fürchtete, der Fremde könne ein Mädchenhändler sein, gekommen, um sie an japanische Seeleute zu verschachern. Und natürlich hatte sie niemals vor, eine ihrer Pfoten auf die Planken eines Schiffes zu setzen. Mit dem Griechen von den Sternbildern der Südsee zu träumen genügte Suzanne durchaus. Ein wenig länger allerdings hätte der Traum schon dauern dürfen. Allzu bald war es August und der Fremde fort, und die nächsten Jungen kündigten sich an. Es waren nur zwei, und sie waren gefleckt wie die Clowns. Suzanne schämte sich ihrer ein wenig. Ihr war, als verspottete die Fellzeichnung für alle sichtbar ihre kleine amouröse Verirrung.
Madame Valladon brachte die beiden Katerchen bei Monsieur Moulin unter, der sie Pablo und Miró nannte und sie in seinem Bistrot an einem eigenen Tisch essen ließ, den er seinen Katzentisch nannte. Sitten waren das! Suzanne zuckte mit den Schnurrhaaren, wenn sie daran dachte. Seither waren ihre romantischen Neigungen, ja jegliches Interesse am männlichen Geschlecht ohne Groll und Kummer eingeschlafen.
Suzanne gähnte erneut.
Madame Valladon schaute auf und wischte sich mit dem Unterarm über die Stirn. »Du bekommst deinen Anteil schon noch, ma chérie. Nur keine Langeweile.« Sie lächelte.
Doch gleich kam er wieder: der nächste abgrundtiefe Seufzer. Madame Valladon selbst bemerkte es schon gar nicht mehr. Wenn Suzanne ihr hätte sagen können: He! Du seufzt. Dann hätte sie sicher nur verständnislos geschaut und es geleugnet. Aber Suzanne hob nur jedesmal den Kopf und wendete die Ohren nach vorne, wenn ihrer Herrin wieder unbewusst der schmerzliche Laut entfuhr. Diese hob dann ebenfalls den Blick, fand ihre Katze in aufmerksamer Haltung und lächelte erfreut. Für einen Moment. Dann ließ sie den Kopf hängen, und es ging alles wieder von vorne los.
Auf der Gasse war lautes Geschrei zu hören. Ruckartig hob Suzanne den Kopf. Ihre Söhne Pablo und Miró kamen den Gehsteig entlanggesaust, mit gesträubten Schwänzen, aber fröhlich gereckten Ohren. Wenn Suzanne auch hätte seufzen können, dann hätte sie es jetzt getan.
Immerhin richtete sie ihre mollige Gestalt zu einer würdigen Kugel von sieben Kilogramm auf. Mit einem kurzen Fauchen brachte sie die beiden Tunichtgute zum Stehen. »Was soll das? Was führt ihr euch so auf?«
Brav hielten die Katerchen an, setzten sich hin, legten die Schwänze um die Vorderpfoten, wie sie es gelernt hatten, und guckten zu ihrer Maman hoch. Pablo war beinahe weiß. Schwarze Flecken verteilten sich über seinen ganzen Körper, einer davon bedeckte die linke Gesichtshälfte samt Kiefer und Auge, ein zweiter den Ansatz des rechten Ohres, ein anderer saß ihm am Schwanzansatz. Mirós Rücken war schwarzbraun getigert, ebenfalls die Stirn bis zu den Augen, sodass es aussah, als trüge er eine Maske, dazu weiße Stiefel und einen weißen Pompon an der Schwanzspitze. Am schlimmsten aber, fand seine Mutter, waren die Sprenkel um die Nase, die bei Menschen als Sommersprossen gegolten hätten, bei ihm aber aussahen, als wäre er eben durch eine Pfütze galoppiert. Beide hatten kupferfarbene Augen und rosa Schnauzen wie ihre Mutter.
»So ein Theater!«, schimpfte Suzanne weiter, die froh war, für ihre schlechte Laune ein Ventil zu finden.
Im Mietshaus gegenüber hatten der dumme Pudel und der Mops aus dem Erdgeschoss zu bellen angefangen. Manche Menschen hoben die Köpfe von ihren Smartphones und lächelten; einige schossen sogar Fotos. Es war peinlich.
»Aber wir haben ein Gespenst gesehen!«, protestierten Suzannes Söhne.
»Ja, auf dem Friedhof!«
»Ein blondes Gespenst!«
»Und es hat geschrien!«
Pablo hatte seine guten Manieren vor lauter Aufregung schon wieder vergessen. Laut schnurrend streifte er abwechselnd mit der rechten und linken Kopfseite um eine der grünen Metallsäulen, die den Eingang zur Pâtisserie flankierten. Schlingschlängelnd folgte ihm sein Schweif. Miró hingegen war völlig fasziniert von einer Ameise. Mit wackelndem Hintern bereitete er sich auf den Angriffssprung vor. Suzanne seufzte. Dieser Junge hatte die Aufmerksamkeitsspanne einer Eintagsfliege. Er würde nie im Leben eine Maus fangen. Sie hob die Tatze.
Für einen Moment herrschte wieder Ordnung.
»Wie oft soll ich es euch noch sagen: Bei Menschen heißt das singen, nicht schreien. Und Gespenster gibt es nicht.«
»Und wieso nennen sie unseren Gesang dann Geschrei?«, fragte Miró trotzig.
Pablo blieb wenigstens beim Wesentlichen: »Gibt es doch«, sagte er. »Gespenster gibt es eben doch. Und wir haben eins gesehen: ein Mädchen, ganz weiß. Und es saß auf einem Grab und hat gesungen.«
»Wie oft habe ich schon …«, begann Suzanne erneut.
Pablo zuckte die Achseln, die noch schlank und schlaksig waren. Doch man konnte schon ahnen, dass er, sollte er wider Erwarten ein höheres Lebensalter erreichen, zweifellos zu einer imposanten Größe heranwachsen würde.
»Dann hat es eben geschrien«, gab Pablo widerwillig nach. »Mir doch egal.«
Miró sprang an seine Seite und gab ihm einen herzhaften Kopfstoß. »Komm, wir erzählen es allen.«
»Nichts dergleichen!«, fauchte Suzanne. »Ihr werdet schön brav hierbleiben und euch diesen Unfug aus dem Kopf schlagen.«
Doch es war zu spät. Die beiden rannten bereits weiter. Ein Stück die Straße hinunter konnte Suzanne noch sehen, wie sie in einem halb spielerischen, halb ernsten Angriff übereinander herfielen. Straßenstaub wolkte auf. Bald sprangen sie auf, und weiter ging die wilde Jagd. Ob sie noch an ihr Gespenst dachten, wer konnte es sagen?
Suzanne verdrängte den Gedanken, dass jemand sie jetzt putzen und ihnen das Fell nach Schmutz durchknuspern müsste. Das war nicht mehr ihre Aufgabe. Oh, wie oft hatte sie Miró das gesprenkelte Schnäuzchen geleckt.
Ob sie sich bei Bonnard erkundigen sollte nach diesem weißen Mädchen, das auf einem Grabstein sang? Oder einfach hoffen, dass irgendjemand den beiden Strolchen den Kopf zurechtrückte? Früher oder später würden sie richtig Ärger bekommen. Mit Schaudern dachte Suzanne daran, wie sie in das Auto des Postboten geklettert waren. Er hatte sie erst bei der Rückkehr ins Paketlager entdeckt. Zum Glück hatte der Postbote selbst Katzen und brachte die beiden wieder zurück. Seither bekam er bei Moulin im Lokal immer einen Rosé umsonst, wenn er wollte. Oder wie sie im Fuß des Billardtisches einer Bar am Pigalle feststeckten. Sie hatten so laut geschrien, dass sogar die spielenden Zuhälter auf sie aufmerksam geworden waren. Wieder hatten sie Glück: das halbe Lokal, Nutten, Freier, Kuppler, überbot sich darin, sie aus ihrer Klemme zu befreien. Die Kneipe benannten sie danach um in »Le chat qui chante«. Und wenn das Mädchen nun doch geschrien hatte? Waren ihre Söhne am Ende in etwas hineingeraten?
Was trieben sie überhaupt auf dem Friedhof? Neugier war der Katze Tod, das wusste jeder. Oh diese beiden, kein Wurf hatte ihr je solche Sorgen bereitet wie dieser. Und der Gedanke daran, dass es ihr letzter war, versetzte Suzanne einen kleinen Stich. Vielleicht musste man einen Preis dafür zahlen, dass man den Wahnsinn der Liebe einmal gekostet hatte.
Suzanne warf einen schrägen Blick auf Madame Valladon, die nichts mitbekommen hatte und inzwischen dazu übergegangen war, den cremig gewordenen Teig in eine Spritztülle zu füllen.
Und vielleicht, dachte Suzanne weiter und begann, ihr in der Aufregung gesträubtes Fell zu reinigen, vielleicht war Nachwuchs doch nicht die Lösung für Madame.
Matisse war von dem Jungen fasziniert. Es lag nicht nur an seiner Hautfarbe; er war beinahe genauso schwarz wie Dégas, der Kater, an dem kein weißes Haar saß. Matisse fand das ungewöhnlich. Denn er kam weit herum in Montmartre und wusste genau, dass die afrikanischen Immigranten fast alle drunten wohnten, um das östliche Ende des Boulevard de Clichy herum und vor allem beim Kaufhaus Tardi. Hier oben hingegen selten – und schon gar nicht im Garten von Madame Valladon, der nur über eine versteckte private Treppe von der Rue Junot aus zu erreichen war.
Der Garten war ein Relikt des alten Montmartre, in dem es noch kleine Häuser mit kleinen Gärten gegeben hatte. Das Haus zu diesem hier war verfallen und in den Zwanzigerjahren durch einen Neubau ersetzt worden. Aber der Garten selbst war noch da, die Birke und die Zeder, an deren Rinde man so schön seine Krallen schärfen konnte. Die Rosen gab es noch, den Ginster und die Brombeerhecke. Und einen Stamm Mäuse, dessen Ursprünge laut Dégas noch auf 1789 zurückgingen.
Dégas pflegte zu sagen, die Vorfahren dieser Nager hätten damals das Brot für den Pariser Pöbel weggefressen, sodass die Königin Marie Antoinette, die, auf den Missstand aufmerksam gemacht, seinerzeit gesagt hatte: »Dann sollen sie halt Kuchen fressen.« Und von da an nahm das Unglück bekanntermaßen seinen Lauf. Die Königin kam aufs Schafott, der König dazu. Die Menschen nannten es: die Französische Revolution. Dégas kannte zahlreiche solcher Geschichten. Matisse fand nicht, dass die Mäuse hier deshalb anders schmeckten. Aber man jagte in angenehmer Umgebung. Und jetzt war dieser Junge hier.
Das allerseltsamste an ihm war seine Beschäftigung: Er hatte einen viereckigen Gegenstand bei sich, der aus Papierbögen bestand, die an einem Ende zusammengeklebt waren. Matisse konnte den Kleister bis in sein Versteck riechen und auch das Aroma des Papiers und des Stoffes, in den es eingebunden war. All das stammte nicht von hier. Es roch fremd, nach Mottenkugeln und Weihrauch und ein wenig nach Honig, aber auch nach Salz. Einen Geruch konnte Matisse nicht zuordnen, doch er fühlte sich von ihm zum Schnurren gebracht. Schnell verstummte er, als der Junge den Kopf hob.
Was tat der Fremde da nur? Er nahm Blatt für Blatt und legte es um, aber nicht in einer vernünftigen Geschwindigkeit, sondern so, als wollte er sich jede Faser des Papiers, jede Unebenheit und jedes Staubkorn darauf einprägen. Eine Weile verfolgte Matisse diese Bewegung mit großen Augen und vor Aufregung zuckender Schwanzspitze. Doch es geschah weiter nichts. Keine Beute, nichts wollte sich zeigen zwischen den Seiten. Warum nur starrte der Junge so angestrengt darauf wie auf ein Mauseloch?
Lag es an dem schwarzen Muster, das sich über die Seiten zog? Matisse war nicht dumm, im Gegenteil, er war eine Großstadtkatze und mit allen Wassern gewaschen. Da sollte erst einmal einer kommen und das Gegenteil behaupten! Mit seinen zwei Jahren hatte er schon Dinge gesehen, da konnten andere nur von träumen! Er kam zurecht zwischen Dieben und Schleppern, Touristen und Straßenkids. Nicht umsonst nannte man ihn die Python. Den Spitznamen hatte Matisse sich selbst gegeben. Er fand, er passte gut zu seiner schwarzbraunen Zeichnung, die mehr gefleckt war als gestromt und ein wenig an einen Urwald erinnerte. Den Dschungel der Städte, in dem er sich bewegte, wenn auch teilweise nur in seiner Fantasie. Na und? Er war die Python und keiner machte ihm etwas vor.
Er wusste daher durchaus, was Lesen war. Das war, wenn man die Buchstaben aus Licht über einem Geschäft entzifferte und ihnen so überflüssige Hinweise entnahm wie den, dass darin Fisch verkauft wurde. Überflüssig, weil er das schon drei Straßen weiter gerochen hatte. Bonnard konnte lesen, hieß es, er wusste, wer in den Gräbern lag, auf denen er sich wärmte. Weil es mit den Zeichen auf den Stein geschrieben war.
Schön und gut, Matisse war es recht. Aber die Zeichen in diesem Buch, das war nicht dasselbe. Sie schlängelten sich wie Mäuseschwänze, wie Schneckenstraßen, wie der Flug der Hummel, wenn der eine Spur hinterlassen würde, und wie die Ranken der Kapuzinerkresse. Hübsch sah das aus, das musste Matisse zugeben. Und je länger er darüber nachdachte, desto mehr kam er zu der Überzeugung, dass der Junge diese Zeichen las. Denn er ließ seine Stimmbänder schwingen und brachte Laute hervor, die Matisse zwar ebenfalls nicht verstand. Aber er hatte seine Ohren nicht umsonst, und er hörte wohl, dass ein Muster in diesen Lauten lag und dass es schön war. Steigend und fallend, sich windend und sich verschlingend. Wie Mäuseschwänze, wie Schneckenstraßen, wie der Flug der Hummel und die Kresseranke. Beinahe klang es wie Musik. Aber doch nicht ganz. Es war irgendetwas dazwischen. Matisse lauschte nun schon seit einer halben Stunde fasziniert.
»Poésie«, sagte eine dunkle Stimme.
»Ach«, entfuhr es Matisse. Er unterdrückte ein Fauchen. »Ich hab dich schon gehört, Dégas.« Das war natürlich eine Lüge. Aber Matisse war die Python und hätte niemals zugegeben, dass es einem anderen Kater gelingen könnte, ihn zu überraschen.
Wenn seine kleine Angeberei Dégas amüsierte, dann bemerkte man es nicht. Dégas war schwarz wie die Nacht, und wenn er zusammengerollt im Halbschatten lag, dann sah man nichts anderes als den Umriss seiner Ohren und das Glühen seiner mandelförmigen grünen Augen. Gerade schlossen diese Augen sich in großem Genuss. »Verse aus dem Orient.«
»Orient? Der Junge kommt aber aus Afrika.« Matisse wollte sich schon auf die Zunge beißen.
Zu seiner Überraschung allerdings strafte Dégas die vorlaute Bemerkung nicht ab. Er öffnete vielmehr sein Maul und flehmte. Duftmoleküle strömten in seinen Rachen, in seine Nase und zu dem Jacobschen Organ, das dort seine Arbeit tat, an der Grenze der Welten von Geruch und Geschmack, in einem ganz eigenen Königreich der Wahrnehmung.
»Westküste«, stellte der große Schwarze nach einer Weile fest. Es war, als kostete er jedes Wort wie ein Gewürz. »Nicht der Kongo, weiter oben. Mmmmh, ich kann das Meer riechen, das Mittelmeer, nicht den Atlantik. Er kam mit dem Schiff.« Dégas verstummte und öffnete die Augen. »Aber seine Sprache ist altarabisch.« Sein Blick wurde opak, als blickte er in andere Räume. »Wie lange habe ich das schon nicht mehr gehört? Wusstest du, dass die Araber die Dichtung ›erlaubte Magie‹ nannten?«
»Altarabisch?« Matisse verstand nicht viel.
»Ausgestorben«, bestätigte Dégas gelangweilt. Seine Stimme wurde sachlicher, sein Blick wieder klar. »Übernachtet hat er hier. Und seine letzte Mahlzeit war ein Cheeseburger.« Er gähnte.
»Das rieche ich selber«, sagte Matisse beleidigt. Die Lumpen, mit denen der Junge sich zugedeckt hatte, waren unübersehbar, der Schlafgeruch hing noch wie eine dicke Wolke über ihnen. Das Einwickelpapier des Burgers leuchtete beim zweiten Hinsehen schadenfroh daraus hervor. Unauffällig versuchte Matisse, näher hinzuschnuppern.
Da klappte der Junge das viereckige Ding zu. Gerüche stiegen auf wie Vogelschwärme, als er in dem Lumpenhaufen wühlte, um es sorgsam darin einzuwickeln und zu verstecken. Dann stand er auf. Wohin er wohl wollte? Matisse war entschlossen, es herauszufinden. Nicht ausgeschlossen, dass man so auch auf eine Quelle für Burger stieß.
»Dégas, wollen wir …?«, begann Matisse und wandte sich um. Der Schwarze war fort. Natürlich, jetzt roch er es auch. Dégas Aroma war durchsichtig geworden wie ein Gespenst. »Ich hab dich schon weggehen hören«, sagte Matisse. Zur Sicherheit sagte er es laut.
Der Junge wandte den Kopf und bemerkte ihn. In einem Lächeln zeigte er seine großen weißen Zähne. Dann griff er nach dem Einwickelpapier für sein Abendessen, faltete es auf, kratzte mit dem Finger darin herum und brachte ein Klümpchen kalt gewordenen Käses zum Vorschein, das er in Matisse’ Richtung schnippte, ehe er ging.
Matisse roch vorsichtig an dem Käse. Endlich fraß er ihn. Dann machte er sich daran, dem Jungen zu folgen, der die ausgestorbene Sprache sprach. Um besser an ihn denken zu können, nannte er ihn bei sich Poésie.
Poésie schlug einen vielversprechenden Kurs ein, fand Matisse. Denn keine halbe Stunde später fanden sie sich auf den Terrassen unterhalb von Sacré-Cœur, dort, wo die Touristen sich drängten. Es war ein gutes Jagdgebiet, denn die Grünflächen mit den Blumenrabatten boten gute Deckung. Auch gab es hier viel Futter, und alle starrten nach oben, niemals auf ihre Füße und das, was sich dazwischen bewegte. Auch jetzt am frühen Mittag war das Gedränge bereits wieder groß.
Manche machten sich auf den weiten Weg über die Treppen hinauf zur Kirche, andere stiegen in den Funiculaire, diese kleine Seilbahn ohne Seil. Alle schossen hier ihre ersten Fotos vom berühmten Montmartre, flanierten zwischen den wartenden Portraitzeichnern herum und kauften sich Wasser, denn es war ein heißer Tag. Das gekühlte Nass gab es bei Straßenverkäufern, illegale Einwanderer, die davon lebten, kleine Plastikflaschen mit Mineralwasser aus eisgefüllten Eimern anzubieten.