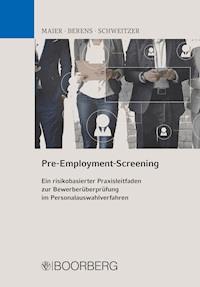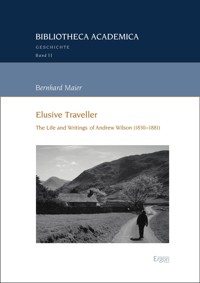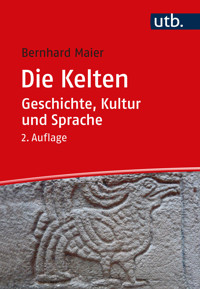
27,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer waren die Kelten? Woran glaubten sie? Wie sprachen sie? Und warum spielen sie für das Selbstverständnis Europas eine so große Rolle? Unter den zahlreichen, teilweise üppig bebilderten, neueren Büchern über die Kelten fehlt bislang ein Studienbuch, das den gegenwärtigen Stand der internationalen keltologischen Forschung prägnant, gut verständlich und mit ausführlichen Hinweisen auf weiterführende Literatur zusammenfassend darstellt. Der vorliegende Band leistet eben dies. Er richtet sich nicht nur an Keltologen, sondern auch an Vertreter benachbarter Fächer wie etwa der Archäologie, Geschichts-, Sprach- und Literaturwissenschaft, Theologie, Religionswissenschaft und Europäischen Ethnologie. Darüber hinaus bietet er allen an der keltischen Kultur Interessierten eine Fülle zum Teil schwer zugänglicher Informationen und vielfältige Anregungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 456
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Bernhard Maier
Die Kelten
Umschlagabbildung: Fragment eines frühmittelalterlichen piktischen Reliefs aus dem Museum von St. Vigeans (Angus, Schottland), © Bernhard Maier
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838563503
© UVK Verlag 2024— Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 4354
ISBN 978-3-8252-6350-8 (Print)
ISBN 978-3-8463-6350-8 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Im Unterschied zu vielen anderen europäischen Philologien (wie etwa der Germanistik, Romanistik oder Slavistik) ist die Keltologie als eigenes Universitätsfach bzw. eigener Studiengang fast nur noch in den Ländern vertreten, in denen noch immer keltische Sprachen gesprochen werden. Dies steht gerade im deutschsprachigen Raum in einem augenfälligen Gegensatz, nicht nur zu dem lebhaften Interesse, das eine breite Öffentlichkeit den Kelten und ihrer Kultur entgegenbringt, sondern auch zu den vielfältigen methodischen Berührungspunkten und inhaltlichen Schnittmengen, welche die Keltologie mit anderen geisteswissenschaftlichen Fächern wie etwa der Frühgeschichtlichen und Provinzialrömischen Archäologie, Geschichtswissenschaft, Vergleichenden Sprach- und Literaturwissenschaft, Anglistik, Romanistik, Theologie, Religionswissenschaft und Europäischen Ethnologie verbindet. Wer sich jedoch als Studierende(r) oder Lehrende(r) eines dieser Nachbarfächer über die gesamte Keltologie oder einen ihrer Teilbereiche rasch und zuverlässig orientieren will, tut sich keineswegs leicht, denn die weitaus meisten neueren Veröffentlichungen sind in englischer, französischer, irischer oder kymrischer (walisischer) Sprache gehalten und oftmals nur in wenigen großen Bibliotheken greifbar. Auch das Internet kann hier nur in sehr beschränktem Umfang Abhilfe leisten, da die Trennung der Spreu vom Weizen dem Unerfahrenen gerade auf diesem Gebiet häufig schwerfällt und die Zuverlässigkeit und Aktualität vieler Informationen mitunter nur schwer abzuschätzen ist.
Das vorliegende Buch bietet Studierenden und Vertretern der oben genannten Fächer, aber auch allen anderen am Gegenstand interessierten Lesern, eine verlässliche Einführung in den gegenwärtigen Stand der Keltologie, eine Übersicht über ihre vielfältigen Beziehungen zu verschiedenen Nachbarfächern sowie ausführliche Angaben über die zur Verfügung stehenden Hilfsmittel. Zu diesem Zweck orientiert zunächst eine Einleitung über die Geschichte und den derzeitigen Stand der keltologischen Forschung. Die darauffolgenden sechs Kapitel behandeln der Reihe nach archäologische, historische, sprach- und literaturwissenschaftliche, theologische und religionswissenschaftliche sowie ethnologische Aspekte der Keltologie. Dabei besteht jedes Kapitel aus sechs Abschnitten, die jeweils grundlegende Informationen sowie im Anschluss daran Hinweise auf weiterführende Literatur enthalten. Ein Anhang mit zwei Verzeichnissen neuerer keltologischer Festschriften und wichtiger keltologischer Fachzeitschriften, Angaben zu den wichtigsten im Internet verfügbaren Hilfsmitteln für das Studium sowie einem ausführlichen Personen- und Sachregister runden das Werk ab.
Für die vorliegende zweite Auflage wurde der mittlerweile fast zehn Jahre alte Text überprüft, an einigen Stellen verbessert und im Hinblick auf neuere Erkenntnisse und Forschungen erweitert. Ebenso wurden die Literaturhinweise am Ende jedes Abschnitts um wichtige Neuerscheinungen ergänzt. Um die Anschaulichkeit zu erhöhen, wurden dem Text darüber hinaus einige Illustrationen beigegeben.
1Einleitung
1.1Geschichte und Stand der keltologischen Forschung
Die Geschichte der Keltologie beginnt im 6./5. Jahrhundert v. Chr. mit den Berichten antiker Historiker und Ethnographen über jene Völker, welche die Griechen Keltoí oder Galátai, die Römer Celtae, Galatae oder Galli nannten. Dabei bezog sich die Bezeichnung Galátai / Galatae im Unterschied zum modernen Sprachgebrauch keineswegs ausschließlich oder auch nur in erster Linie auf die GalaterGalater oder Kelten Kleinasiens, sondern war weitgehend bedeutungsgleich mit den Bezeichnungen Keltoí / Celtae und Galli, bezeichnete also die Kelten im Allgemeinen. Mit Bezug auf die Iberische Halbinsel sprechen die antiken Autoren von Keltiberern (Keltíbēres / Celtiberi), während man für die kleinasiatischen Galater die Bezeichnungen Hellēnogalátai bzw. Gallograeci findet. Die Bewohner der Britischen Inseln und Irlands wurden von den antiken Autoren demgegenüber niemals als Kelten bezeichnet, sondern werden erst seit der Frühen Neuzeit zusammen mit den schon in der Antike als Kelten bezeichneten Völkern des europäischen Festlands unter diesem Namen zusammengefasst. Zur sprachlichen Ableitung des KeltennamensKelten (Name) kommen in erster Linie die indogermanischen Wurzeln *kel- „erheben“, *kel- „schlagen, hauen“ und *kel- „verbergen“ in Betracht, wobei die genaue Bedeutung des Namens jedoch unklar bleibt. Unbekannt ist auch die Etymologie der Bezeichnungen Galli und Galátai / Galatae.
Erstmals erscheint der Name der Kelten vielleicht schon in der (uns nicht erhaltenen) Erdbeschreibung des Hekataios von Milet im 6. Jahrhundert v. Chr., mit Sicherheit aber im 5. Jahrhundert v. Chr. bei Herodot von HalikarnassosHerodot von Halikarnassos, der ihn augenscheinlich bereits als seinen Lesern wohlbekannt voraussetzt (Historien 2,33,3–4). Was genau HerodotHerodot von Halikarnassos meinte, wenn er schreibt, die Donau entspringe „bei den Kelten und der Stadt Pyrene“, ist indessen umstritten. Während einige Archäologen die „Stadt Pyrene“ mit der Heuneburg an der oberen Donau identifizieren, vermuten manche Philologen und Historiker hier eine Verwechslung mit dem Gebirge der Pyrenäen und nehmen an, Herodot habe die Quellen der Donau irrtümlich nicht in der Mitte, sondern im fernen Westen Europas lokalisiert.
Die ausführlichsten und historisch wertvollsten Keltenschilderungen des folgenden halben Jahrtausends bis zur Romanisierung der festlandkeltischen Völker findet man bei PolybiosPolybios von Megalopolis von Megalopolis (um 200 – um 120 v. Chr.), PoseidoniosPoseidonios von Apameia von Apameia (um 135 – um 50 v. Chr.), bei den auf PoseidoniosPoseidonios von Apameia fußenden Autoren StraboStrabo von Amaseia von Amaseia (um 63 v. Chr. – um 23 n. Chr.) und Diodor von SizilienDiodor von Sizilien (1. Jahrhundert v. Chr.) sowie bei Gaius Iulius CaesarCaesar, Gaius Iulius (100–44 v. Chr.). Charakteristisch für alle diese antiken Nachrichten über die Kelten ist die Eigenart der antiken EthnographieEthnographie, antike, kleinere Volksgruppen oder Stämme unter einem oft willkürlich gewählten Namen zu größeren Einheiten zusammenzufassen, so dass die betreffenden Autoren die Bezeichnung „Kelten“ als Oberbegriff einer Vielzahl unterschiedlicher Völkerschaften verwenden, ohne sie nach Zeit und Raum zu differenzieren. Charakteristisch ist ferner eine zumeist implizit, gelegentlich auch explizit ethnozentrische Sichtweise, die den Mittelmeerraum als Mittel- und Höhepunkt der kulturellen Entwicklung und die „Barbaren“ als Bewohner einer rückständigen Peripherie begreift. Unklar bleiben häufig die genaue Herkunft einer Information sowie der Einfluss literarischer Vorbilder und stereotyper Wandermotive. Innere Stimmigkeit und Präzision der Keltenschilderungen spielten jedoch allem Anschein nach eine eher untergeordnete Rolle, so dass die griechischen und römischen Beobachter literarische Versatzstücke unterschiedlicher Herkunft nach Gutdünken miteinander kombinieren konnten. Dabei rückten sie zur Steigerung des Unterhaltungswertes ihrer Darstellungen gerne das Verblüffende und Ungewöhnliche in den Vordergrund und kolportierten mitunter auch offenkundig Widersinniges.
Durch die Romanisierung der ehemals keltischsprachigen Regionen auf dem europäischen Festland ging die Kenntnis der keltischen Sprache dort überall spätestens bis zum Ausgang der Antike verloren. Nach wie vor gesprochen wurden keltische Sprachen dagegen in Irland, auf den Britischen Inseln sowie in der Bretagne, wo Einwanderer aus dem Südwesten der Britischen Hauptinsel ihre keltische Sprache seit der Spätantike heimisch gemacht hatten. Dass die Iren, Schotten, Waliser und Bretonen eine Sprache verwendeten, die stark der Sprache der antiken Kelten ähnelte, fand vor der Neuzeit jedoch kaum Beachtung, da die von der griechisch-römischen und christlichen Kultur geprägte Gelehrsamkeit des Mittelalters den Ursprung der Volkssprachen unter Rückgriff auf die alttestamentliche und klassisch-antike Überlieferung und damit im Anschluss an die Urgeschichte der Bibel (1 Mose / Genesis 10) oder die Aeneis Vergils zu deuten suchte. Erst im späten 16. Jahrhundert entdeckte der schottische Humanist George BuchananBuchanan, George (1506–1582) die Zusammengehörigkeit der antiken festlandkeltischen Sprachen mit den noch lebenden inselkeltischen Idiomen.
Das Grab des schottischen Humanisten George Buchanan (1506–1582) im Greyfriars Kirkyard, Edinburgh.
Als „Keltisch“ bezeichnete man alle diese Sprachen jedoch erst seit dem 18. Jahrhundert, in dessen Verlauf sich diese Bezeichnung in allen europäischen Sprachen als Oberbegriff für die Sprache der antiken Kelten und jene der antiken Bewohner der Britischen Inseln und Irlands sowie ihrer Nachfahren allgemein durchsetzte. Maßgeblichen Anteil an der Etablierung der Bezeichnung „Keltisch“ in diesem neuen, sprachwissenschaftlichen Sinn, hatte zum einen der walisische Natur- und Sprachforscher Edward LhuydLhuyd, Edward (um 1660–1709) mit seinem Buch Archaeologia Britannica (1707), zum anderen der aus der Bretagne stammende Historiker Dom Paul Yves PezronPezron, Paul Yves (1639–1706) mit seinem Werk Antiquité de la nation et de la langue des Celtes, autrement appellez Gaulois (1703).
Besondere Aufmerksamkeit fand in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die keltische Sprache Schottlands, als James MacphersonMacpherson, James (1736–1796) 1760 seine Fragments of Ancient Poetry collected in the Highlands of Scotland veröffentlichte. Die betreffenden Texte, die er in englischer Übersetzung vorlegte, hatte MacphersonMacpherson, James nach eigenem Bekunden aus mündlicher Überlieferung gesammelt, in Wahrheit jedoch unter Rückgriff auf diese Überlieferung weitgehend frei gestaltet. Starken Auftrieb erfuhr die Beschäftigung mit den keltischen Sprachen dann seit dem frühen 19. Jahrhundert mit der Entdeckung der indogermanischen Spracheinheit durch William JonesJones, William (1746–1794). Der schlüssige Nachweis der indogermanischen Herkunft des Keltischen gelang unabhängig voneinander dem Arzt und Anthropologen James Cowles PrichardPrichard, James Cowles (1786–1848), dem Sprachwissenschaftler Adolphe PictetPictet, Adolphe (1799–1875) und dem Begründer der Vergleichenden Sprachwissenschaft, Franz BoppBopp, Franz (1791–1867). Zum eigentlichen Begründer der Keltologie als sprachwissenschaftlicher und philologischer Disziplin wurde Johann Kaspar ZeussZeuss, Johann Kaspar (1806–1856), dessen Grammatica Celtica (1851) die Grundlage aller weiteren Forschung bildete und erst im frühen 20. Jahrhundert durch das Handbuch des Altirischen (1909) von Rudolf ThurneysenThurneysen, Rudolf (1857–1940) und die Vergleichende Grammatik der keltischen Sprachen (1909–1913) von Holger PedersenPedersen, Holger (1867–1953) ersetzt wurde. Als erste Fachorgane der Keltologie entstanden in Frankreich die Revue celtiqueRevue celtique (1870–1934, seit 1936 Études celtiquesÉtudes celtiques) und in Deutschland die Zeitschrift für celtische PhilologieZeitschrift für celtische Philologie (seit 1897). Zuvor waren viele keltologische Beiträge in der 1862 von Adalbert KuhnKuhn, Adalbert (1812–1881) begründeten Zeitschrift Beiträge zur vergleichenden Sprachforschung auf dem Gebiet der arischen, keltischen und slawischen Sprachen erschienen. Die ersten Lehrstühle für Keltologie hatten in Oxford (seit 1877) der walisische Philologe John RhŷsRhŷs, John (1840–1915), in Paris (seit 1882) der Historiker Henri d’Arbois de JubainvilleD’Arbois de Jubainville, Henri (1827–1910), in Edinburgh (seit 1882) der Philologe Donald MacKinnonMacKinnon, Donald (1839–1914) und in Berlin (seit 1901) der Vergleichende Sprachwissenschaftler und Indologe Heinrich ZimmerZimmer, Heinrich (1851–1910) inne. 1903 entstand auf eine Initiative des zu jener Zeit in Liverpool tätigen deutschen Sprachwissenschaftlers Kuno MeyerMeyer, Kuno (1858–1919) hin als erste Forschungs- und Ausbildungsstätte für irische Keltologen in Dublin die School of Irish LearningSchool of Irish Learning, ein Vorläufer der 1940 gegründeten School of Celtic StudiesSchool of Celtic Studies. Ihr walisisches Pendant ist das 1919 gegründete Board of Celtic StudiesBoard of Celtic Studies mit den Unterabteilungen Sprache und Literatur, Geschichte und Recht, Archäologie und Kunst sowie (seit 1969) Sozialwissenschaften.
Wie alle so genannten kleinen Fächer mit einem weiten Gegenstandsbereich und einem anspruchsvollen Programm ist auch die Keltologie in den vergangenen Jahrzehnten weltweit von den wiederholten Kürzungen öffentlicher Mittel, der Verlagerung des universitären Schwerpunkts von den Geistes- auf die Naturwissenschaften, dem Wandel des Bildungssystems und der damit verbundenen Verkürzung der Studienzeiten stark in Mitleidenschaft gezogen worden. In Deutschland kann das Fach derzeit nur an der Philipps-Universität Marburg sowie an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn studiert werden. Zu den wichtigsten keltologischen Zentren des europäischen Auslands zählen gegenwärtig Cambridge, Aberystwyth, Edinburgh, Glasgow, Dublin und Cork. Dabei liegt – wie bei den vergleichbaren Disziplinen Slavistik oder Romanistik – auch in der Keltologie der Schwerpunkt des Studiums und der Forschung nicht auf sämtlichen keltischen Sprachen, so dass man sich in Irland, Schottland und Wales in erster Linie mit der keltischen Sprache des eigenen Landes befasst.
Da das allgemeine Interesse an den Kelten gerade im deutschsprachigen Raum oft weniger von der Sprache und Literatur als vielmehr von der vor- und frühgeschichtlichen Archäologie ausgeht, sind an dieser Stelle noch einige klärende Worte zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit den Kelten aus historischer oder archäologischer Perspektive anzufügen. Die Anfänge einer keltischen AltertumskundeAltertumskunde, keltische fallen ebenfalls in die Zeit des Humanismus und sind zunächst eng verbunden mit der Wiederentdeckung der antiken Literatur und dem Studium des Griechischen. Eine wichtige Rolle spielte dabei das aus der theologischen Exegese und christlichen Geschichtsdeutung übernommene Verfahren der Typologie, mit dessen Hilfe man Gegenwart und Vergangenheit in der Weise aufeinander bezog, dass man die keltische Vergangenheit als unvollkommene Vorwegnahme gegenwärtiger Verhältnisse betrachtete bzw. die Gegenwart als Vollendung bereits in der schriftlosen Vorzeit angelegter Tendenzen ansah. Tatsächliche oder auch nur vermeintliche Kontinuitäten deutete man in Übereinstimmung mit biblischen und antiken Denkmustern gerne als das Ergebnis einer biologischen Kontinuität der Bevölkerung, wobei man die Völker Europas bzw. deren fiktive Stammväter in lückenloser Folge auf die in der so genannten VölkertafelVölkertafel (1 Mose / Genesis 10) erwähnten Nachkommen von Noahs Sohn Japhet zurückführte. Erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts begann sich allmählich die Auffassung durchzusetzen, dass Bodendenkmäler sowie planmäßig oder zufällig gewonnene archäologische Funde nicht nur zur Veranschaulichung der antiken Literaturwerke dienen, sondern einen selbständigen Beitrag zur Erhellung der schriftlosen Vorgeschichte Mittel- und Nordeuropas leisten könnten. Da man zu jener Zeit jedoch noch allgemein davon ausging, dass die Welt nur wenige tausend Jahre alt und Europa erst nach der Sintflut von den Nachkommen Japhets bevölkert worden sei, schrieb man – vor allem in Frankreich und Großbritannien – unterschiedslos sämtliche Bodendenkmäler der vorrömischen Zeit den aus der antiken Literatur bekannten Kelten zu. In einigen populären Vorstellungen, wie etwa der von StonehengeStonehenge als einem „keltischen“ Heiligtum, wirkt diese Auffassung bis heute nach.
Die Anfänge einer differenzierten und kritisch reflektierten Verwendung der Bezeichnungen „Kelten“ und „keltisch“ in der Archäologie stehen im Zusammenhang mit der Unterscheidung einer Stein-, Bronze- und Eisenzeit, die Christian Jürgensen ThomsenThomsen, Christian Jürgensen (1788–1865) in den 1820er und 1830er Jahren entwickelte. Ausgehend davon beschränkte man die Verwendung des Namens der Kelten seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts weitgehend auf die Eisenzeit und jedenfalls auf das erste Jahrtausend v. Chr. Von weit reichender Bedeutung für die archäologische Begriffsbildung erwiesen sich in diesem Zusammenhang Ausgrabungen, die man seit 1846 in Hallstatt im österreichischen Salzkammergut und seit 1857 an der unter dem Namen La Tène bekannten Untiefe bei Marin-Epagnier an der Nordostspitze des Neuenburger Sees in der Schweiz durchführte. Mit Blick auf die dort gemachten Funde unterteilte der schwedische Kulturhistoriker und Archäologe Hans HildebrandHildebrand, Hans (1842–1913) bereits 1874 die vorrömische Eisenzeit in eine ältere HallstattHallstatt, Hallstattkultur- und eine jüngere LatèneperiodeLatènekultur. Davon ausgehend entwickelten Otto TischlerTischler, Otto (1843–1891) und Paul ReineckeReinecke, Paul (1872–1958) unter Berücksichtigung typologischer Beobachtungen vor allem an Fibeln und Schwertern eine weitergehende Periodisierung (HallstattHallstatt, Hallstattkultur A–D bzw. La TèneLatènekultur A–D), während Georg KossackKossack, Georg (1923–2004) die begriffliche Unterscheidung zwischen einem Westhallstattkreis (Nordostfrankreich, Mittelrheingebiet, Süddeutschland, Böhmen und Oberösterreich) und einem Osthallstattkreis (Mähren, Niederösterreich, Steiermark, Westungarn, Slowenien und das nördliche Kroatien) etablierte. Bereits 1871 hatte Gabriel de MortilletMortillet, Gabriel de (1821–1898) auf dem Internationalen Kongress für Anthropologie und Prähistorische Archäologie in Bologna Funde aus Marzabotto und Bologna mit dem Hinweis auf genaue Entsprechungen in Regionen nördlich der Alpen mit den antiken Nachrichten über die Einwanderung keltischer Scharen in Oberitalien in Verbindung gebracht und so eine Brücke von der frühen literarischen Überlieferung zur schriftlosen Vorgeschichte geschlagen. Als umfassende Synthese dieser Forschungen zur Archäologie der Kelten in Mitteleuropa erschien am Vorabend des Ersten Weltkriegs das Manuel d’archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine von Joseph DécheletteDéchelette, Joseph (1862–1914).
Aus dem zeitlichen Abstand eines Jahrhunderts betrachtet, lassen die hier umrissenen grundlegenden Forschungen zur Archäologie der Kelten in Mitteleuropa vielfach Denkmuster und Prämissen erkennen, die seither kritisch hinterfragt worden sind. Dies gilt insbesondere für den von der Geologie und Biologie inspirierten Evolutionismus des 19. Jahrhunderts, der in der Vorgeschichtsforschung zu teilweise stark übertriebenen Vorstellungen von der Primitivität noch der bronze- und eisenzeitlichen Kulturen führte, sowie für die zentrale Rolle des Erklärungsmusters der Diffusion, infolge dessen man das Ausmaß, die Komplexität und die Dynamik eigenständiger kultureller und gesellschaftlicher Entwicklungen im vorgeschichtlichen Mittel-, Nordwest- und Nordeuropa lange Zeit unterschätzte und zugunsten des Postulats einer bloßen Übernahme oder Imitation von Neuerungen aus dem Vorderen Orient in den Hintergrund rückte. Kritisch sieht man heute auch den Nationalismus des 19. Jahrhunderts, der vielerorts an die im 18. Jahrhundert entstandene romantische Vorstellung von einem einheitlichen „Volksgeist“ anknüpfte. Dies begünstigte die – von antiken Ethnographen unter ganz anderen Voraussetzungen initiierte – verallgemeinernde Rede von „den“ Kelten, so dass man immer wieder archäologische Funde der vorrömischen Eisenzeit – ohne Rücksicht auf chronologische oder geographische Distanzen, doch mit dem (expliziten oder impliziten) Hinweis auf ihren „keltischen“ Charakter – mit Hilfe von Nachrichten antiker Autoren oder gar den phantasievollen Schilderungen der mittelalterlichen irischen Literatur zu interpretieren suchte.
Darstellung eines Druiden auf dem Frontispiz des Buches De Dis Germanis von Elias Schedius (1615–1641) aus dem Jahr 1648. In der Altertumswissenschaft der Frühen Neuzeit wurden Kelten und Germanen bis ins später 18. Jahrhundert oft nicht genau unterschieden. Die hier abgebildete Darstellung eines Druiden, die an einen römisch-katholischen Priester erinnert, ist wahrscheinlich der konfessionellen Polemik im Zeitalter der Religionskriege verpflichtet.
Gerade im deutschsprachigen Raum ist die moderne Sicht der Kelten und ihrer Kultur bis heute stark von den archäologischen Funden der (spezifisch mitteleuropäischen) HallstattHallstatt, Hallstattkultur- und LatènekulturLatènekultur geprägt. Dies liegt zum einen an der extensiven Ausgrabungstätigkeit gerade in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Frankreich, zum anderen an der Vereinnahmung der vor- und frühgeschichtlichen Bewohner dieser Regionen zur Fundamentierung moderner Identitäten. Dabei brachte es das weitgehende Fehlen umfänglicher eigenständiger Schriftzeugnisse in den Regionen nördlich der Alpen mit sich, dass – gerade in populärwissenschaftlichen Darstellungen – Schlussfolgerungen aus diesen Funden in unzulässiger Weise verallgemeinert oder aber in methodisch fragwürdiger Weise durch Nachrichten antiker Autoren, archäologische Funde aus dem römischen Gallien oder mittelalterliche Schilderungen der vorchristlichen irischen Kultur ausgeschmückt und ergänzt wurden. Weitgehend ausgeblendet wurden und werden demgegenüber vielfach noch immer archäologische Funde und Befunde aus den – nur aus mitteleuropäischer Sicht randständigen – Siedlungsgebieten der Kelten in Irland, auf der Iberischen Halbinsel, in Ost- und Südosteuropa, in Oberitalien und in Kleinasien. Wenig bekannt waren und sind aber gerade hierzulande auch die inselkeltischen Sprachen und Literaturen, deren Darstellung daher im vorliegenden Buch breiten Raum einnimmt.
Zum Keltenbegriff und Keltenbild der Antike vgl. Marco Martin, Posidonio d’Apamea e i Celti (Rom 2011), Gerhard Dobesch, Das europäische „Barbaricum“ und die Zone der Mediterrankultur (Wien 1995), Martina Jantz, Das Fremdenbild in der Literatur der Römischen Republik und der Augusteischen Zeit (Frankfurt/Main 1995) und Bernhard Kremer, Das Bild der Kelten bis in augusteische Zeit (Stuttgart 1994). Eine umfangreiche und ausführlich kommentierte zweisprachige Sammlung der griechischen und lateinischen Nachrichten über die Religion der Kelten in chronologischer Anordnung bietet das dreibändige Werk von Andreas Hofeneder, Die Religion der Kelten in den antiken literarischen Zeugnissen (Wien 2005–2012).
Umfangreiche Sammlungen klassischer Texte aus der Geschichte der modernen Keltologie bieten Raimund Karl und David Stifter (Hrsg.), The Celtic World: critical concepts in historical studies, 4 Bde. (London 2007) sowie Daniel R. Davis (Hrsg.), The Development of Celtic Linguistics, 1850–1900, 6 Bde. (London 2002).
Unterschiedliche Aspekte der neuzeitlichen Keltenrezeption behandeln Francesca Kaminski-Jones und Rhys Kaminski-Jones (Hrsg.), Celts, Romans, Britons: Classical and Celtic influence in the construction of British identities (Oxford 2020), Lisa Regazzoni, Geschichtsdinge: Gallische Vergangenheit und französische Geschichtsforschung im 18. und frühen 19. Jh. (Berlin 2020), Jean-Louis Brunaux, Les Celtes: histoire d’un mythe (Paris 2017), Oriane Hébert und Ludivine Péchoux (Hrsg.), Gaulois: images, usages et stéréotypes (Autun 2017), Caoimhín de Barra, The Coming of the Celts, AD 1860: Celtic nationalism in Ireland and Wales (Notre Dame, Indiana 2017), Joanne Parker (Hrsg.), The Harp and the Constitution: myths of Celtic and Gothic origin (Leiden 2016), Silke Stroh, Gaelic Scotland in the Colonial Imagination (Chicago 2016), Chris Manias, Race, Science, and the Nation: reconstructing the ancient past in Britain, France and Germany (London 2013), Jean-Louis Brunaux, Nos ancêtres les Gaulois (Paris 2012), Ludivine Péchoux (Hrsg.), Les Gaulois et leurs représentations dans l’art et la littérature depuis la Renaissance (Paris 2011), Anne de Mathan (Hrsg.), Jacques Cambry (1749–1807) (Brest 2008), Helmut Birkhan, Nachantike Keltenrezeption (Wien 2009), Eva-Maria Winkler, Kelten heute (Wien 2006), Christine Gallant, Keats and Romantic Celticism (New York 2005), Gerard Carruthers u. Alan Rawes (Hrsg.), English Romanticism and the Celtic World (Cambridge 2003), David Boyd Haycock, William Stukeley: science, religion, and archaeology in eighteenth-century England (Woodbridge 2002), Murray G. H. Pittock, Celtic Identity and the British Image (Manchester 1999) und Terence Brown (Hrsg.), Celticism (Amsterdam 1996). .
2Archäologie
Da die Keltologie traditionell philologisch und sprachwissenschaftlich ausgerichtet ist, liegen die von der Archäologie erforschten Kulturen der vorrömischen Kelten, auf die sich die antiken Keltenschilderungen beziehen, weitgehend außerhalb der Grenzen des Fachs. Gleichwohl ist dieser Bereich für die Keltologie durchaus relevant, da keltische Sprachen zweifellos bereits lange vor dem Einsetzen der ältesten Schriftzeugnisse gesprochen wurden und kulturelle Kontinuitäten von der Vorgeschichte bis zu den geschichtlichen Epochen zwar nicht ohne weiteres vorauszusetzen sind, mitunter aber doch als Möglichkeit in Betracht kommen. Aus eben diesem Grund sind umgekehrt auch die Ergebnisse der philologisch-sprachwissenschaftlichen Forschung für die Archäologie von Interesse, zumal – insbesondere in der Vergangenheit – Rückschlüsse aus den Verhältnissen in den mittelalterlichen keltischsprachigen Kulturen bzw. aus den Schilderungen in inselkeltischen Literaturwerken immer wieder zur Deutung vorgeschichtlicher Funde und Denkmäler herangezogen wurden.
2.1Die vorrömischen Kelten Mitteleuropas
Im Allgemeinen spricht man heute frühestens im Hinblick auf den Zeitraum zwischen 650 und 600 v. Chr. von Kelten. Begründet wird dies zum einen mit dem Einsetzen der antiken Schriftquellen um diese Zeit, zum anderen mit der Beobachtung markanter Unterschiede an dem auf diese Zeit datierten Übergang von der dritten Periode der HallstattkulturHallstatt, Hallstattkultur (Ha C) zur vierten und letzten (Ha D). Eine augenfällige Zäsur bildete bereits um 800 v. Chr. der Übergang von der bronzezeitlichen Kulturstufe Ha B zur eisenzeitlichen Kulturstufe Ha C. In die zweite Hälfte des 7. Jahrhunderts v. Chr. werden von archäologischer Seite eine Reihe weiterer Neuerungen datiert, die gleichzeitig mehrere Bereiche der Kultur betreffen und Entwicklungen einleiten, wie man sie noch für die historisch bezeugten Kelten der unmittelbar vorrömischen Zeit für charakteristisch hält. Eine wesentliche Voraussetzung dafür bildete allem Anschein nach die Ausweitung der Eisenproduktion. Da Eisen lokal gewonnen, verhüttet und weiter verarbeitet werden konnte, verloren die weiträumigen, auf den Handel mit ZinnZinn(handel) und Kupfer gegründeten Verkehrsverbindungen der Bronzezeit mitsamt den Eliten, die diese Handelswege beherrschten und machtpolitisch nutzten, immer mehr an Bedeutung. Anzeichen für die Ausbildung neuer Eliten in der Späthallstattzeit sieht man in der Anlage aufwendig gestalteter und befestigter Höhensiedlungen, wie sie vor allem in Ostfrankreich, Teilen der Schweiz und in der Südhälfte Deutschlands nachgewiesen und archäologisch erforscht wurden. Im Zusammenhang damit steht die Anlage monumentaler Hügelgräber, welche die Annahme einer beträchtlichen sozialen Differenzierung nahe legen und durch die Beigabe prestigeträchtiger Luxusgüter aus dem Mittelmeerraum auf weit verzweigte Handelskontakte und/oder diplomatische Beziehungen schließen lassen. Eine wichtige Rolle spielte in diesem Zusammenhang die um 600 v. Chr. gegründete phokäische Kolonie von MassaliaMassalia (Marseille), deren Einfluss sich über das Tal der Rhône bis weit nach Norden erstreckte. Möglicherweise führte die Niederlage der Griechen gegen die miteinander verbündeten Karthager und Etrusker in der Seeschlacht von Alalia/Aléria auf Korsika (zwischen 540 und 535 v. Chr.) dazu, dass die Griechen von diesem Zeitpunkt an Landverbindungen ins innere Gallien intensiver nutzten, um trotz der karthagischen Seehoheit im westlichen Mittelmeerraum nach wie vor mit dem zur Bronzeherstellung notwendigen Zinn aus Britannien beliefert zu werden.
Die Ursachen und Bedingungen des Wandels, der im 5. Jahrhundert v. Chr. allenthalben zur Ablösung der Westlichen Späthallstattkultur durch die LatènekulturLatènekultur führten, sind nach wie vor weitgehend unklar. Festzustellen ist, dass die alten Zentralsiedlungen mit ihren reich ausgestatteten Gräbern innerhalb von wenigen Jahrzehnten aufgegeben wurden und an den Rändern des Westhallstattkreises neue Machtzentren entstanden. Im Zusammenhang damit steht die Ausbildung eines eigenständigen, von mediterranen Vorbildern inspirierten neuen Kunststils, der als „Latène-Kunst“ häufig, wenn auch unzutreffend, als „keltische KunstKunst, keltische“ wahrgenommen wird. Was dem modernen Betrachter an dieser Kunst wohl als erstes auffällt, ist das weitgehende Fehlen von Ausdrucksmitteln, die sowohl in der mittelalterlichen als auch in der griechisch-römischen und altorientalischen Kunst eine große Rolle spielen. So etwa gibt es keine monumentale Steinarchitektur und nur wenige Beispiele großplastischer Darstellungen aus Holz, Stein oder Metall. Weitgehend ungenutzt blieben auch die Möglichkeiten einer szenischen Darstellung von Handlungs- oder Bewegungsabläufen und der individuellen realistischen Porträtierung von Menschen oder Tieren. Vielmehr sind die weitaus meisten Werke der keltischen Kunst Erzeugnisse einer handwerklichen Kleinkunst, deren Schöpfer Schmuck, Waffen und Gebrauchsgegenstände aller Art mit großer Liebe zum Detail und technischer Perfektion gestalteten. Dabei bedienten sich die Künstler einer ausgefeilten Ornamentik, die sich durch Abstraktion und Vieldeutigkeit auszeichnet. Oft können einzelne Muster sowohl positiv als auch negativ „gelesen“ werden, so dass geradezu der Eindruck eines Vexierbilds entsteht. War die Kunst der Späthallstattzeit noch durch starre, geometrische Muster gekennzeichnet, so bevorzugt die Kunst der Latènezeit weiche und fließende Formen, wobei pflanzliche Motive sowie Darstellungen von Tieren, Fabelwesen und menschlichen Gesichtern in die Ornamentik miteinbezogen werden. Eine wichtige Rolle spielen geometrische Muster, die auf teilweise komplizierten Zirkelkonstruktionen aufgebaut sind. Dass diese neue Kunst auch Wandlungen im Weltbild und neue religiöse Vorstellungen widerspiegeln dürfte, steht zu vermuten. Es ist bisher jedoch noch nicht gelungen, die Bildersprache der Latènekunst zu entschlüsseln oder in überzeugender Weise mit inschriftlichen oder literarischen Quellen zu korrelieren.
Wurde die Entstehung der keltischen KunstKunst, keltische durch Anregungen aus dem Mittelmeerraum und namentlich aus Etrurien angestoßen, so gibt es für die Annahme erheblicher Migrationen oder Bevölkerungsverschiebungen zu Beginn der Frühlatènezeit keine ausreichenden Anhaltspunkte. Auch sind keine durchgreifenden Änderungen der Wirtschaftsformen als unmittelbare Grundlage der kulturellen Neuerungen ersichtlich. Tatsächlich dürften die archäologisch nachweisbaren Neuerungen auch gar nicht alle Bereiche der Gesellschaft in gleicher Weise erfasst haben, zumal viele Siedlungen außerhalb der Zentralorte über das Ende der Hallstattzeit hinaus bewohnt blieben und erst später aufgegeben wurden. Einmal mehr ist daher auch hier zu vermuten, dass der Niedergang der alten Machtzentren im Zusammenhang mit weiträumigen Änderungen im Netz der Fernhandelswege steht. Keltische Sprachzeugnisse sind aus dieser frühen Zeit bis jetzt jedoch nur in Oberitalien zutage gekommen, während die inschriftliche Überlieferung in Mittel- und Westeuropa (wie auch auf der Iberischen Halbinsel) deutlich später einsetzt.
In der zweiten Hälfte der Frühen Latènezeit, vom 4. bis zum frühen 3. Jahrhundert v. Chr., ist im Unterschied zu früheren Zeiträumen von erheblichen Migrationen mutmaßlich keltischsprachiger Bevölkerungsgruppen auszugehen. Fassbar werden sie archäologisch durch die Ausbreitung der LatènekulturLatènekultur etwa von Ostfrankreich nach Westen, historisch durch die Nachrichten griechischer Historiker wie etwa PolybiosPolybios von Megalopolis. Das Ausmaß sowie die Ursachen und Bedingungen der keltischen Wanderungen sind jedoch kaum zu ermitteln, da Änderungen im Fundgut oft auch auf Diffusion bzw. Akkulturation seitens einer alteingesessenen Bevölkerung beruhen können, während die Darstellungen der antiken Historiker ausgesprochen schematisch wirken und überdies in der uns vorliegenden Form erst lange nach den geschilderten Ereignissen aufgezeichnet wurden. Als unmittelbare Ursachen der keltischen Migrationen in Richtung des Mittelmeerraums vermutet man eine vorübergehende Verschlechterung des mitteleuropäischen Klimas, soziale und ethnische Spannungen aufgrund von Übervölkerung sowie die aus langen Kulturkontakten erwachsene Vertrautheit mit den materiellen Anreizen der südlichen Regionen.
Wie zahlreiche archäologische Funde belegen, bildete die Landwirtschaft die wichtigste Grundlage der keltischen Kultur. Sie diente durch den Anbau von Nutzpflanzen und die Haltung von Nutztieren zum einen der Nahrungsmittelproduktion, zum anderen der Gewinnung von Rohstoffen, etwa zur Herstellung von Bekleidung. Darüber hinaus ermöglichte sie durch die Erzeugung von Überschüssen das Funktionieren einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Von zentraler wirtschaftlicher Bedeutung war auch der Abbau von Eisenerzvorkommen, der nicht nur eine wesentliche Grundlage der handwerklichen Produktion darstellte, sondern auch weit reichende Auswirkungen auf das Siedlungswesen, den Handel und die Struktur der Gesellschaft hatte. Von ähnlich hoher wirtschaftlicher Bedeutung war der vor allem in Hallstatt und am DürrnbergDürrnberg bei Hallein bezeugte Salzabbau, da man Salz in großen Mengen zur Ernährung, zur Konservierung von Lebensmitteln sowie in der Metall- und Lederverarbeitung benötigte. Unsere Kenntnis des Siedlungswesens der vorrömischen Kelten Mittel- und Westeuropas beruht fast ausschließlich auf den Ergebnissen der archäologischen Forschung, da die antiken Quellen dazu nur sehr allgemeine und teilweise geradezu irreführende Aussagen treffen. Dabei ergibt sich eine gewisse Verzerrung des Bildes allerdings dadurch, dass historisch besonders prominente Orte sehr viel besser erforscht sind als der Durchschnitt und daher in der Vergangenheit zu Verallgemeinerungen Anlass gaben, die heute auf der Grundlage einer breiteren Materialbasis wieder in Frage gestellt werden. Auch sind Siedlungen mit zentralörtlicher Funktion insgesamt weit besser erforscht als die an sich sehr viel häufigeren kleineren Dörfer und Gehöfte, deren große Bedeutung für das Siedlungswesen vielfach erst in der jüngsten Vergangenheit durch den Einsatz neuer naturwissenschaftlicher Untersuchungsmethoden gewürdigt werden konnte. Für die Zentralsiedlungen der Späthallstattzeit hat sich weithin die Bezeichnung „FürstensitzeFürstensitze“ eingebürgert, obschon sowohl die damit suggerierte Einheitlichkeit dieser Anlagen als auch deren politische Funktion gerade neuerdings wieder kontrovers diskutiert werden. Zu den bekanntesten und zugleich am besten erforschten dieser Anlagen zählen der Mont LassoisMont Lassois in Burgund, die Heuneburg an der oberen Donau und der Ipf bei BopfingenIpf bei Bopfingen. In die Frühlatènezeit datiert die großflächige Anlage auf dem GlaubergGlauberg ca. 30 km nordöstlich von Frankfurt am Main, die man als Überreste eines Zentralheiligtums interpretiert.
Rekonstruktion einer frühkeltischen Pfostenschlitzmauer auf dem Ipf bei Bopfingen, einem mutmaßlichen frühkeltischen Zentralort.
Rekonstruktion eines Hauses aus dem 6. Jh. v. Chr. auf dem Ipf bei Bopfingen. Der 15x15m große Pfostenbau diente vielleicht kultischen Zwecken
Sehr wahrscheinlich wurde der Prozess der Zentralisierung und Urbanisierung bei den vorrömischen Kelten Mittel- und Westeuropas von ähnlichen Entwicklungen im Mittelmeerraum angestoßen, wobei die Entstehungsbedingungen und Geschichte der keltischen Siedlungen jedoch insgesamt und in vielen Einzelheiten nach wie vor kontrovers beurteilt werden. Dies liegt nicht zuletzt an unserem höchst uneinheitlichen Forschungs- und Kenntnisstand, denn während manche Anlagen seit Jahrzehnten planmäßig untersucht werden, sind andere fast gar nicht erforscht bzw. wegen späterer Überbauungen auch gar nicht systematisch erforschbar. Klar ist auch, dass die von neuen naturwissenschaftlichen Methoden geprägten archäologischen Untersuchungen der beiden vergangen Jahrzehnte in mehreren Fällen unseren Kenntnisstand so stark erweitert haben, dass die Vorläufigkeit jeder Beurteilung wenig erforschter Anlagen nachdrücklich hervorzuheben ist. Ungeachtet dieser Vorbehalte zeichnet es sich ab, dass die genannten Anlagen in vielen Fällen auf einer älteren bronzezeitlichen Besiedlung aufbauen, diese an Intensität und Ausdehnung jedoch oft übertreffen. Ausschlaggebend für ihre zentralörtliche Funktion war augenscheinlich ihre Lage an Schnittpunkten bedeutender Fernhandelswege, welche die keltischen Regionen Mittel- und Westeuropas mit den Zentren der mediterranen Kulturen in Südfrankreich und Oberitalien verbanden. Neben einer verkehrs- und handelspolitisch beherrschenden Lage sind außerdem in mehreren Fällen die intensive Nutzung eines landwirtschaftlich ertragreichen Hinterlands und der Abbau von Bodenschätzen wie z. B. Salz oder Eisen nachgewiesen, die wiederum die Entwicklung eines spezialisierten Handwerks nach sich zogen.
Eine zweite Welle der Urbanisierung der vorrömischen Kelten ist in der Spätlatènezeit zu beobachten. Charakteristisch dafür sind die so genannten OppidaOppidum, Pl. Oppida (Singular: Oppidum). So nennt die moderne Archäologie – im Unterschied zu dem weit weniger spezifischen antiken Sprachgebrauch etwa bei CaesarCaesar, Gaius Iulius – die stadtähnlichen Anlagen der mittel- und westeuropäischen Kelten des 2. und 1. Jahrhunderts v. Chr. Sie wurden, wie schon die Mehrzahl der späthallstattzeitlichen Zentralorte, zumeist auf Höhenzügen, in Flussbiegungen oder in anderweitig geschützter Lage angelegt, unterscheiden sich jedoch von Anlagen früherer und späterer Jahrhunderte durch ihre gewaltige Ausdehnung, die in einigen Fällen mehrere hundert Hektar beträgt. Teilweise auf bereits in früheren Zeiten befestigtem Gelände errichtet, dienten OppidaOppidum, Pl. Oppida in Kriegszeiten als Fluchtburgen für die umliegende Bevölkerung und im Frieden als Zentren für Handwerk und Handel. Bei der Wahl des Standorts spielten daher neben einer zur Verteidigung günstigen Lage auch das Vorkommen von Bodenschätzen sowie die Beherrschung bedeutender Fernhandelswege eine wichtige Rolle. Zu den am besten erforschten OppidaOppidum, Pl. Oppida zählen BibracteBibracte ca. 20 km westlich von Autun in Burgund und ManchingManching ca. 8 km südlich von Ingolstadt. Mit dem Ende der OppidaOppidum, Pl. Oppida-Kultur im Gefolge der römischen Eroberung Galliens durch CaesarCaesar, Gaius Iulius endete die Zeit der keltischen Selbständigkeit in Kontinentaleuropa.
Neuere regionale Übersichten zu den archäologischen Funden der Späthallstatt- und Latènekultur bieten Markus Schussmann, Die Kelten in Bayern (Regensburg 2019), Paola Piana Agostinetti (Hrsg.), Celti d’Italia (Rom 2017), Walter Reinhard, Die Kelten im Saarland (Saarbrücken 2017), François Malrain und Matthieu Poux (Hrsg.), Qui étaient les Gaulois? (Paris 2011), Martin Schönfelder (Hrsg.), Kelten? Kelten! Keltische Spuren in Italien (Mainz 2010), Patrice Brun und Pascal Ruby, L’Age du Fer en France: premières villes, premiers états celtiques (Paris 2008), Felix Müller und Geneviève Lüscher (Hrsg.), Die Kelten in der Schweiz (Stuttgart 2004), Andres Furger, Die Helvetier: Kulturgeschichte eines Keltenvolkes, Aufl. (Zürich 2003), Virginie Defente, Les Celtes en Italie du Nord (Rom 2003) sowie Sabine Rieckhoff und Jörg Biel (Hrsg.), Die Kelten in Deutschland (Stuttgart 2001).
Eine kurzgefasste Gesamtdarstellung der Latènekunst bietet Felix Müller, Die Kunst der Kelten (München 2012). Ausführlicher Ders., Kunst der Kelten: 700 v. Chr. – 700 n. Chr. (Stuttgart 2009). Vgl. ferner Ernst Pernicka (Hrsg.), Early Iron Age Gold in Celtic Europe (Rahden, Westf. 2018), Chris Gosden (Hrsg.), Celtic Art in Europe: making connections (Oxford 2014), Duncan Garrow und Chris Gosden, Technologies of Enchantment? Exploring Celtic Art: 400 BC to AD 100 (Oxford 2012), Dennis W. Harding, The Archaeology of Celtic Art (London 2007) sowie Ruth und Vincent Megaw, Celtic Art (London 2001).
Zusammenfassende Darstellungen der vorrömischen keltischen Wirtschaftsformen bieten François Malrain, Véronique Matterne u. Patrice Méniel, Les Paysans gaulois (Paris 2002) und Patrice Méniel, Les Gaulois et les animaux (Paris 2001). Vgl. ferner die Beiträge in Claus Dobiat, Susanne Sievers und Thomas Stöllner (Hrsg.), Dürrnberg und Manching: Wirtschaftsarchäologie im ostkeltischen Raum (Bonn 2001). Zur Eisenerzverhüttung vgl. Pierre-Yves Milcent (Hrsg.), L’économie du fer protohistorique (Aquitania Supplément 14/2, 2007) sowie Guntram Gassmann u. a., Forschungen zur keltischen Eisenerzverhüttung in Südwestdeutschland (Stuttgart 2005). Zur Salzgewinnung vgl. Iris Ott u. Egon Wamers (Hrsg.), Das weiße Gold der Kelten (Frankfurt/Main 2008), Marie-Yvane Daire, Le sel des Gaulois (Paris 2003) sowie Thomas Stöllner u. a., Der prähistorische Salzbergbau am Dürrnberg bei Hallein, 2 Bde. (Rahden/Westf. 1999–2002).
Regionale Studien zum Siedlungswesen der Kelten Mitteleuropas bieten Patrice Brun u. Pascal Ruby, L’age du fer en France: premières villes, premiers états celtiques (Paris 2008) und Miloslav Chytráček u. Milan Metlička, Die Höhensiedlungen der Hallstatt-, und Latènezeit in Westböhmen (Prag 2004). Die späthallstattzeitlichen Zentralorte behandeln die Beiträge in Dirk Krausse (Hrsg.), „Fürstensitze“ und Zentralorte der frühen Kelten, 2 Bde. (Stuttgart 2010). Zum Ipf vgl. Rüdiger Krause (Hrsg.), Archäologische Beiträge zur Bronze- und Eisenzeit auf dem Ipf (Bonn 2020) und Ders. (Hrsg), Neue Forschungen zum frühkeltischen Fürstensitz auf dem Ipf (Bonn 2014). Zum Glauberg vgl. Holger Baitinger, Der Glauberg: ein Fürstensitz der Späthallstatt- / Frühlatènezeit in Hessen (Wiesbaden 2010) und den Sammelband Der Glauberg in keltischer Zeit (Wiesbaden 2008). Zu den Oppida vgl. Stephan Fichtl u. a. (Hrsg.), L’urbanisation aux âges du Fer (Strasbourg 2021), Irena Benková (Hrsg.), Gestion et présentation des oppida (Glux-en-Glenne 2008) und Stephan Fichtl, La ville celtique, 2. überarbeitete u. erweiterte Aufl. (Paris 2005). Zu Bibracte bzw. Manching vgl. Anne-Marie Romero u. Antoine Maillier, Bibracte (Glux-en-Glenne 2006) und Susanne Sievers, Manching, 2. aktualisierte Aufl. (Stuttgart 2007).
Neuere Studien zu den größtenteils schon seit längerem bekannten sogenannten Fürstengräbern der Späthallstatt- und Latènezeit bieten Jörg Biel und Erwin Keefer (Hrsg.), Hochdorf X: Das bronzene Sitzmöbel aus dem Grab von Eberdingen-Hochdorf (Kr. Ludwigsburg) (Wiesbaden 2021), Patrice Brun u. a. (Hrsg.), Vix et le phénomène princier (Pessac 2021), Daniela Euler, Glanzvoll ins Jenseits: die keltischen Prunkgräber vom Glauberg (Wiesbaden 2020), Udo Recker und Vera Rupp (Hrsg.), Die „Fürstengräber“ von Glauberg (Wiesbaden 2018) und Giacomo Bardelli (Hrsg.), Das Prunkgrab von Bad Dürkheim 150 Jahre nach der Entdeckung (Mainz 2017).
2.2Die vorrömischen Kelten der Britischen Inseln
Im Unterschied zu Mittel- und Westeuropa, Oberitalien, der Iberischen Halbinsel und Kleinasien, gelten die Britischen Inseln nicht schon in der Antike als Siedlungsgebiete der Kelten, da antike Autoren die Bezeichnung Keltoi / Celtae auf Kontinentaleuropa und Kleinasien beschränkten. Als „keltisch“ gelten die betreffenden Länder daher erst seit dem 18. Jahrhundert, und zwar zunächst im Hinblick auf ihre Sprache. Wann und unter welchen Umständen das Keltische nach Britannien und Irland gelangte und alle vorher dort verbreiteten Sprachen verdrängte, ist jedoch bis heute ungeklärt. Dass eine oder mehrere Wellen von Einwanderern aus dem europäischen Festland dafür verantwortlich sein müssten, galt bis in die 1960er Jahre als ausgemacht, wird seitdem jedoch zunehmend in Zweifel gezogen, da man keine eindeutigen archäologischen Hinweise auf solche Wanderungsbewegungen hat und man auf den Britischen Inseln wie auch in Irland eine ausgeprägte Kontinuität von der Bronze- zur Eisenzeit feststellen kann.
Ein Blick in die bronzezeitliche Kupfermine bei Llandudno in Nordwales, deren Gänge sich über mehrere Kilometer Länge bis zu 70 Meter in die Tiefe erstrecken.
Archäologische Hinweise auf die Einwanderung geschlossener Gruppen bieten lediglich die Gräber der nach dem Gräberfeld von Arras in East Yorkshire so genannten Arras-KulturArras-Kultur aus der Mittleren Latènezeit, deren einzige Parallelen nicht in Britannien, sondern in Nordgallien zu finden sind. Selbst in diesem Fall ist es jedoch umstritten, ob die Übereinstimmungen im Bestattungsbrauch auf den Zustrom größerer Bevölkerungsteile, auf die Einwanderung einer kleinen Elite oder gar überhaupt nur auf kulturelle Konvergenzen ohne eine wirkliche Migration zurückzuführen sind.
Die Anfänge der Bronzeverarbeitung in Britannien fallen in die Zeit um 2100 v. Chr. Zwischen 2100 und 1500 v. Chr. datiert man die Frühe Bronzezeit, zwischen 1500 und 1100 v. Chr. die Mittlere und zwischen 1100 und 800 v. Chr. die Späte Bronzezeit, die jeweils anhand charakteristischer Fundgruppen in weitere Phasen unterteilt werden. Aus dem 8./7. Jahrhundert v. Chr. stammen die ältesten Funde eiserner Waffen und Werkzeuge vom Typ Hallstatt C, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts im See von Llyn FawrLlyn Fawr in Südwales sowie seither auch an anderen Fundorten vor allem im Südwesten Britanniens gefunden wurden. Die darauf folgende Periode HallstattHallstatt, Hallstattkultur D, aus der man auf dem europäischen Festland die gemeinhin als frühkeltisch angesehenen Fürstengräber kennt, ist in Britannien ebenfalls durch einzelne Funde vertreten, wobei einige davon importiert, andere dagegen vor Ort hergestellt worden sein dürften und jedenfalls die Kontinuität der kulturellen Beziehungen zwischen Britannien und dem europäischen Festland bezeugen.
Im Hinblick auf die Wirtschaftsformen der britannischen Kelten ist davon auszugehen, dass die Insel im ersten Jahrtausend v. Chr. keine naturräumliche Einheit darstellte, sondern ganz im Gegenteil große, durch Relief, geographische Lage und Klima bedingte Unterschiede aufwies. Entsprechend unterschiedlich sind in den einzelnen Regionen das Ausmaß der landwirtschaftlichen Nutzung des Bodens und der jeweilige Anteil des Ackerbaus und der Viehzucht. Insgesamt ist die Eisenzeit in Britannien durch eine Intensivierung der Landwirtschaft gekennzeichnet. Stark ausgeprägte Unterschiede in der Häufigkeit des Vorkommens von Keramik lassen darauf schließen, dass in einigen Regionen Britanniens (wie auch ganz allgemein in Irland) Gefäße und Behälter vielfach aus Holz oder anderen organischen Materialien gefertigt wurden, jedoch nur ausnahmsweise erhalten blieben.
Während Siedlungen im 19. und frühen 20. Jahrhundert nur selten ausgegraben wurden, hat ihre archäologische Untersuchung in den vergangenen 50 Jahren so stark zugenommen, dass für das Siedlungswesen im eisenzeitlichen Britannien mehr Daten zur Verfügung stehen als in allen anderen von den Kelten bewohnten Gebieten. Gleichwohl ist die Quellenlage sehr unterschiedlich, da sich die weitaus meisten gut erforschten Anlagen in Süd- und Südostengland befinden, während das Siedlungswesen in Wales, Nordengland und auf dem Schottischen Festland (im Unterschied zu den in dieser Hinsicht wiederum besser erforschten HebridenHebriden sowie Orkney- und Shetland-Inseln) sehr viel unzureichender erschlossen ist. Darüber hinaus bringen es die große Menge der vorhandenen Daten, aber auch die großen naturräumlich bedingten Unterschiede mit sich, dass man nur wenige allgemein gültige Aussagen treffen kann. So etwa kennt man viele Hundert kleine, teils offene und teils leicht befestigte Siedlungen oder Gehöfte sowohl aus dem Südwesten (Cornwall) als auch aus dem Süden und Südosten Britanniens. Große Hügelfestungen mit einer Fläche über 6 ha sind jedoch in Cornwall sehr viel seltener als in den weiter östlich gelegenen Regionen. Es steht zu vermuten, dass das Fehlen großer Hügelfestungen in vielen Gegenden Cornwalls einen geringeren Grad der politischen Zentralisierung widerspiegelt. Dies wiederum könnte mit den insgesamt weniger günstigen Umweltbedingungen und der relativ größeren Bedeutung der Viehzucht gegenüber dem Ackerbau zusammenhängen, da die geringere Mobilität von Ackerbauern die Etablierung ortsfester politischer Zentren begünstigt haben dürfte. Dazu passt der Umstand, dass man über 6 ha große Hügelfestungen in Wales vor allem im Osten entlang der späteren walisisch-englischen Grenze findet, während der Südwesten nur relativ kleine Hügelfestungen und der Nordwesten überhaupt nur wenige solcher Anlagen aufweist. Ein augenfälliges Kennzeichen der kleineren Siedlungen im Westen von Wales ist andererseits ihre lange Nutzungsdauer, da kleinere Gehöfte und Siedlungen in Westwales allem Anschein nach oft sehr viel länger bewohnt waren, als dies in dem durch gesellschaftliche Umbrüche und Umschichtungen gekennzeichneten Südosten der Insel Britannien der Fall war. Wiederum andere Bedingungen findet man in Schottland, wo insbesondere entlang der Westküste, auf den Hebriden, im äußersten Norden sowie auf den Orkney- und Shetland-Inseln kleinere Siedlungen und Gehöfte in massiver Trockensteinbauweise, die so genannten brochs und duns, begegnen. Charakteristisch für den Westen Schottlands sind ferner die so genannten crannogs, die auf künstlichen Inseln in der Nähe von Seeufern angelegt wurden. Großflächige Hügelfestungen, die einen fortgeschrittenen Grad der Zentralisierung widerspiegeln, findet man demgegenüber vor allem in der Osthälfte Schottlands.
Über die großen Hügelfestungen (hillforts) mit mutmaßlich zentralörtlicher Funktion liegt eine umfangreiche Literatur vor, die sich jedoch nur auf relativ wenige großflächige Grabungen stützen kann und daher teilweise spekulativ bleibt. Klar ist, dass die großen eisenzeitlichen Hügelfestungen in einer längeren, bis in die Bronzezeit zurückreichenden Tradition stehen und trotz oberflächlicher Ähnlichkeiten im Hinblick auf ihre topographische Lage und Befestigungsweise durchaus unterschiedlichen Zwecken gedient haben können, die sich erst bei großflächigen Ausgrabungen erschließen würden. Klar ist auch, dass jede Anlage eine individuelle Geschichte hat, die sich nicht zuletzt in ihrer Nutzungsdauer und im Verhältnis zu benachbarten Anlagen widerspiegelt. Namentlich in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends v. Chr. ist dabei mit einer Hierarchie von Anlagen zu rechnen, deren relative Bedeutung man nicht nur aus Unterschieden der Größe und Besiedlungsdichte, sondern auch aus solchen des Aufwands beim Bau repräsentativer Wall- und Toranlagen erschließen kann.
Zu den am intensivsten erforschten eisenzeitlichen Hügelfestungen Englands gehört DaneburyDanebury ca. 20 km nordwestlich von Winchester. Im 7./6. Jahrhundert v. Chr. angelegt und um 100 v. Chr. aufgegeben, wurde der Ort von 1969 bis 1988 in zwanzig Grabungskampagnen erforscht, wobei man knapp über die Hälfte der Fläche freilegte. Wie sich dabei herausstellte, wurden die Befestigungs- und Toranlagen mehrfach erweitert, während gleichzeitig die Besiedlungsdichte im Innern beständig zunahm. Die Aufgabe der Siedlung erfolgte wohl im Zusammenhang mit Kampfhandlungen, wie die Zerstörung des Haupttors durch Feuer und Funde zahlreicher Skelette mit Hieb- und Stichverletzungen vermuten lassen. Ungefähr zur gleichen Zeit wie Danebury entstand auch die Hügelfestung Maiden CastleMaiden Castle ca. 2,5 km südwestlich von Dorchester. Mit einer Fläche von ca. 6,4 ha nahm sie in den beiden ersten Jahrhunderten ihres Bestehens noch keine herausragende Stellung ein, doch wurden die Befestigungen zwischen 400 und 300 v. Chr. erheblich verstärkt und die befestigte Fläche auf 19 ha ausgedehnt. Im Gefolge dieser Erweiterung nahm auch die Besiedlungsdichte im Innern der Anlage zu, während gleichzeitig zwei deutlich kleinere Hügelfestungen in der näheren Umgebung aufgegeben wurden. Im 2. Jahrhundert v. Chr. erreichte die Anlage ihre größte Blüte, verlor bald darauf jedoch zunehmend an Bedeutung und wurde im Gefolge der Römischen Invasion des Jahres 43 ganz aufgegeben.
Die Archäologie der Kelten Britanniens und Irlands im Rahmen einer umfassenden Geschichte vom Spätpaläolithikum bis zur Ankunft der Normannen schildert Barry Cunliffe, Britain Begins (Oxford 2012). Ausführliche Gesamtdarstellungen bieten ferner Richard Bradley, The Prehistory of Britain and Ireland (Cambridge 2007) und Barry Cunliffe, Iron Age Communities in Britain, 4. Aufl. (London 2005). Vgl. ferner die Beiträge in Niall M. Sharples, Oliver Davis u. Kate Waddington (Hrsg.), Changing Perspectives on the First Millennium BC (Oxford 2008), Colin Haselgrove u. Rachel Pope (Hrsg.), The Earlier Iron Age in Britain and in the near Continent (Oxford 2007) sowie Colin Haselgrove u. Tom Moore (Hrsg.), The Later Iron Age in Britain and Beyond (Oxford 2007). Zum Bau- und Befestigungswesen der britannischen Kelten vgl. Tanja Romankiewicz, The Complex Roundhouses of the Scottish Iron Age (Oxford 2011), Graeme Cavers, Crannogs and Later Prehistoric Settlements in Western Scotland (Oxford 2010), Dennis W. Harding, The Iron-Age Round-House (Oxford 2009), Ian Brown, Beacons in the Landscape: the hillforts of Ireland and Wales (Oxford 2009) und Ian Ralston, Celtic Fortifications (Stroud 2006). Die Zeugnisse der Latènekunst auf den Britischen Inseln behandelt ausführlich Edward Martyn Jope, Early Celtic Art in the British Isles, 2 Bde. (Oxford 2000).
2.3Die Kelten im vorgeschichtlichen Irland
Die ältesten Spuren der Anwesenheit des Menschen in Irland stammen aus der Mittleren Steinzeit (ca. 7000–4000 v. Chr.), als die Insel noch dicht mit Eichen-, Ulmen- und Birkenwäldern bestanden war und sich durch großen Wildreichtum auszeichnete. Bei den Zeugnissen aus dieser frühen Zeit handelt es sich vor allem um Überreste steinerner Waffen und Werkzeuge, die auf das Vorhandensein kleiner Gruppen von Jägern und Sammlern schließen lassen. Im Gefolge der zunehmenden Erwärmung nach der Eiszeit stieg der Meeresspiegel beständig an, bis er um 3000 v. Chr. seinen Höhepunkt erreichte, weshalb einige der ältesten Lagerplätze heute unterhalb des Meeresspiegels liegen dürften. Seit der ersten Hälfte des 4. Jahrtausends v. Chr. findet man sesshafte Gemeinschaften, die in runden oder rechteckigen Häusern aus Holz und Flechtwerk wohnten, verschiedene Getreidesorten anbauten, Steinwerkzeuge und Keramik herstellten, Haustiere wie Rinder, Schafe und Ziegen hielten und ihre Toten in gemeinschaftlich genutzten Megalithgräbern beisetzten. Es steht zu vermuten, dass die Verbreitung dieser Kenntnisse und Fertigkeiten mit der Ankunft neuer Bevölkerungsgruppen aus England und vom europäischen Festland in Zusammenhang steht. Seit der Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. breitete sich die Kenntnis der Metallverarbeitung aus, wie Spuren des Kupferabbaus und Funde verschiedener Waffen und Werkzeuge aus Kupfer bezeugen. In die Jahrhunderte zwischen 2000 und 500 v. Chr. datiert man die Bronzezeit, die üblicherweise in eine Frühe (2000–1400 v. Chr.), Mittlere (1400–1200 v. Chr.) und Späte Phase (1200–500 v. Chr.) unterteilt wird. Aus der Frühen und Mittleren Bronzezeit stammen die in großer Zahl gefundenen Objekte aus gehämmertem Gold, darunter Lunulae, Sonnenscheiben und Ohrringe. In der Späten Bronzezeit entstanden, wohl unter auswärtigem Einfluss, sowohl neue Arten von Bronzewerkzeugen als auch neue Formen des Goldschmucks und der Goldverarbeitung.
Der rekonstruierte Eingang des jungsteinzeitlichen Grabs von Newgrange im Tal der Boyne, dessen vorgeschichtliche Monumente als „Elfenhügel“ noch in der mittelalterlichen Literatur eine wichtige Rolle spielen.
Die Anfänge der Eisenverarbeitung in Irland sind vielleicht noch in der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends v. Chr. zu suchen, doch kann man ähnlich wie in Britannien eine ausgeprägte Kontinuität von Bronze- und Eisenzeit beobachten. Objekte, wie sie auf dem europäischen Festland für die HallstattkulturHallstatt, Hallstattkultur charakteristisch sind, kommen in Irland nur selten vor. Aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. stammen die frühesten Zeugnisse der Latènekunst im Norden Irlands. Insgesamt handelt es sich dabei um über 70 Metallgegenstände, darunter eiserne Schwerter und Speerspitzen sowie Schmuck und Trachtbestandteile aus Bronze. Ob diese Funde im Zusammenhang mit einem Kultplatz stehen und möglicherweise als Weihegaben anzusehen sind, ist unklar. Aus den letzten drei Jahrhunderten v. Chr. sind Zeugnisse der Latènekunst zwar auch aus anderen Landesteilen bekannt, doch ist ihre Zahl insgesamt so gering, dass man darin kaum Hinweise auf die Zuwanderung größerer Bevölkerungsgruppen etwa aus England oder Kontinentaleuropa sehen kann. Darüber hinaus waren sie möglicherweise überhaupt nur für einen kleinen Teil der eisenzeitlichen Bevölkerung charakteristisch, zumal sie gerade im Süden und Südwesten der Insel großflächig fehlen. Eine zusätzliche Schwierigkeit der Interpretation ergibt sich daraus, dass viele der in Irland gefundenen Latèneobjekte im Vergleich zu kontinentaleuropäischen Vergleichsstücken regionale Besonderheiten aufweisen und daher nicht genau datiert werden können.
Wie in Kontinentaleuropa bildeten auch in Irland Ackerbau und Viehzucht die Grundlage der Wirtschaft. Die große Bedeutung des Getreideanbaus für die Nahrungsversorgung bezeugen dabei insbesondere die in großer Zahl gefundenen kreisrunden, scheiben- oder bienenstockförmigen Handmühlen. Durch Knochenfunde unmittelbar bezeugt sind die Haustiere Rind, Schaf, Ziege, Schwein und Hund. Die ältesten Hinweise auf Pferdehaltung in Irland stammen bereits aus der Frühen Bronzezeit. Hinweise auf die Nutzung des Pferdes als Zug- und Reittier findet man in der Eisenzeit in Form eiserner Gebiss-Stangen, die einzeln und paarweise vorkommen. Wie schon in der Bronzezeit liegen auch in eisenzeitlichen Fundzusammenhängen Hinweise auf den Verzehr von Pferdefleisch vor. Ob dies in rituellen Zusammenhängen geschah, ist wiederum unklar. Die Jagd auf Hoch- und Niederwild dürfte, ähnlich wie auf dem europäischen Festland, vor allem zum Vergnügen betrieben worden sein, wie die geringe Menge von Wildtierknochen in Siedlungen nahelegt, doch kam der Fischerei sowohl an den Küsten als auch im Landesinneren eine relativ große wirtschaftliche Bedeutung zu. Eisenerzvorkommen wurden vor allem in Antrim und Wicklow ausgebeutet.
Im Unterschied zu den in großer Zahl erhaltenen früh- und hochmittelalterlichen Erdwerken (raths), Ringwällen (ringforts) und auf künstlichen Inseln errichteten Siedlungen (crannogs), sind die eisenzeitlichen Siedlungsformen der Jahrhunderte vor der Christianisierung weitgehend unbekannt. Eine der wenigen Ausnahmen ist die ländliche Siedlung von Feerwore (Galway), bei deren archäologischer Untersuchung sowohl Tierknochen als auch Latène-Objekte zutage kamen, über deren Gebäude und mögliche Befestigung jedoch nichts bekannt ist. Einen Ursprung in den Jahrhunderten um Christi Geburt vermutet man für einige der großen Hügelfestungen, deren heutige Kenntnis jedoch kaum jemals auf Ausgrabungen, sondern fast ausschließlich auf Rückschlüssen aus ihren im Gelände sichtbaren Überresten beruht. Die meisten Anlagen mit einer einzigen Verteidigungslinie sind 2 bis 9 ha groß, doch gibt es auch Hügelfestungen mit mehreren, in größeren Abständen hintereinander gestaffelten Verteidigungslinien, die bis zu 20 ha einnehmen. Von besonderen topographischen Bedingungen abhängig und daher insgesamt seltener sind Hügelfestungen, die auf steil abfallenden Bergvorsprüngen angelegt wurden und daher nur auf einer Seite eine oder mehrere dicht hintereinander liegende Befestigungen aufweisen. Sehr viel häufiger sind solche Hügelfestungen auf Bergvorsprüngen, den Möglichkeiten des Geländes entsprechend, an den Küsten, wo über 200 solcher Anlagen bekannt sind. Zu den bekanntesten und zugleich eindrucksvollsten dieser Küstenfestungen zählt Dún AengusDún Aengus auf Inishmore, der größten der Aran-Inseln vor der Irischen Westküste. Dort findet man neben den Überresten von insgesamt vier bis zu 4 m hohen und an der Basis bis zu 4 m dicken Steinmauern als zusätzliche Verteidigungseinrichtung einen 10 bis 23 m breiten Streifen mit zahlreichen, senkrecht oder schräg in den harten Untergrund eingegrabenen Steinen von 1 bis 1,7 m Höhe, die wohl als eine Art von Spanischen Reitern (chevaux-de-frise) eine Erstürmung erschweren sollten. Solche steinernen chevaux-de-frise kennt man in Irland nur aus vier vor- oder frühgeschichtlichen Befestigungen, die alle im Westen der Insel in Küstennähe zu finden sind. Einer möglichen Theorie zufolge handelt es sich dabei um eine fortifikatorische Neuerung, die in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends v. Chr. von der Iberischen Halbinsel (wo sie besonders häufig vorkommt) nach Irland gelangte.
Besondere Beachtung verdienen in diesem Zusammenhang drei in mehrerer Hinsicht ungewöhnliche Stätten, bei denen die Anlage eines tiefen Grabens hinter der Einfriedung, also im Inneren der Anlage, die Annahme ihres fortifikatorischen Charakters in Frage stellt und eine hauptsächlich rituelle oder zeremonielle Nutzung vermuten lässt. Die erste davon ist das auf einem Hügel westlich der Altstadt von ArmaghArmagh, Bistum gelegene Navan FortNavan Fort. Erste Hinweise darauf, dass dort Menschen lebten, stammen noch aus der späten Bronzezeit, in der zunächst ein einzelnes, von einer Palisade umgebenes und wenigstens achtmal erneuertes Haus auf der Kuppe des Hügels stand. In die Zeit um 100 v. Chr. datiert man eine sehr viel aufwendigere Anlage, die aus einer kreisrunden Palisade von 40 m Durchmesser und fünf konzentrischen Ringen mit Pfostenlöchern bestand. Da die gesamte Anlage nach ihrer Zerstörung mit einer Steinpackung überdeckt wurde, diente sie vermutlich rituellen Zwecken.
Einen rituellen Hintergrund vermutet man auch für die zwischen 300 v. Chr. und 300 n. Chr. genutzte Anlage Dún AilinneDún Ailinne (Knockaulin), die mit einer Ausdehnung von 16 ha das größte vorgeschichliche Denkmal in Leinster darstellt. Wie die archäologische Untersuchung eines Areals von ca. 3500 m2 ergab, wurde der Ort bereits in der Jungsteinzeit von Menschen genutzt. In der Eisenzeit errichtete man dort zunächst eine kreisrunde Palisade von 22 m Durchmesser, die später zu einer Einfriedung von 36 m Durchmesser mit einer Art Anbau auf der Südseite und einer aufwendig gestalteten Toranlage erweitert wurde. In der dritten und letzten Ausbauphase hatte diese Einfriedung einen Durchmesser von 42 m, mit einem kreisrunden, vermutlich turmähnlichen Einbau in der Mitte. Der Fund zahlreicher Rinder- und Schweineknochen lässt vermuten, dass in Dún AilinneDún Ailinne umfangreiche Schlachtungen stattfanden, was die Annahme einer rituellen oder zeremoniellen Nutzung der Anlage nahelegt. Von der Jungsteinzeit bis in die ersten Jahrhunderte n. Chr. genutzt wurde nach Ausweis der Archäologie die bekannteste vorgeschichtliche Stätte Irlands, TaraTara. Angelegt auf einem von Südosten nach Nordwesten verlaufenden Hügelrücken, besteht TaraTara aus ca. 24 verschiedenen Einfriedungen, Erdaufschüttungen und künstlich errichteten Tumuli. Nur wenige von ihnen wurden bislang ausgegraben, und einige sind überhaupt nur dank der Luftbildarchäologie bekannt. Eine wichtige Rolle spielte nach Ausweis der Größe und Lage die knapp 6 ha große, als Ráth na Ríogh (Festung der Könige) bekannte Einfriedung, die ebenso wie Navan FortNavan Fort und Dún AilinneDún Ailinne einen Graben auf der Innenseite aufweist. Ausgrabungen in den 1950er Jahren erbrachten den Nachweis, dass der V-förmige Graben ursprünglich 3 m tief war und sich gleich hinter dem inneren Rand eine Palisade befand. Im Inneren der Einfriedung findet man den „Hügel der Geiseln“ (Mound of the Hostages / Dumha na nGiall), bei dem es sich, wie die archäologische Untersuchung ergab, um eine jungsteinzeitliche Grabanlage handelt, sowie zwei weitere kreisförmige Einfriedungen. In einer von ihnen steht der als Lia Fáil bekannte, mutmaßlich eisenzeitliche unverzierte Steinpfeiler, der mittelalterlichen Texten zufolge aufschrie, wenn der rechtmäßige König Irlands seine Herrschaft antrat. Nördlich und südlich des Ráth na Ríogh befinden sich weitere Erdaufschüttungen, darunter der so genannte Ráth na Seanaid