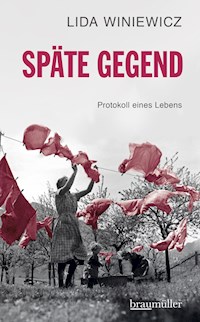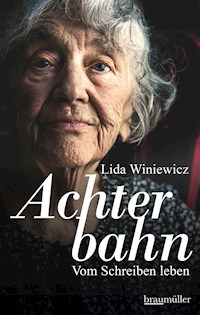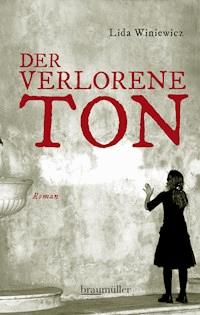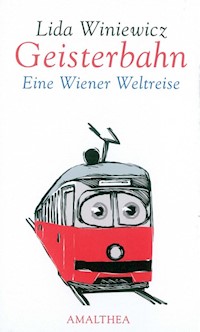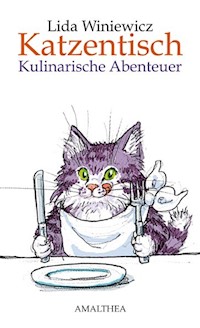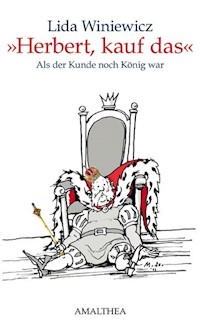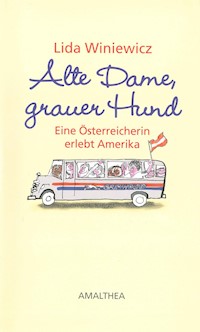Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berührender Roman einer Jugend im Kriegs-Wien Zweiter Weltkrieg in Wien: Verdunkelung, Feind im Anflug, Verschüttete, "Kraft durch Freude", die Hakenkreuzfahne am Rathaus, das Fallbeil im Landesgericht. Und nie gekannt, längst verstorben, eine Großmutter namens Esther. Die Spur führt mitten durchs Leben der beiden Enkelinnen. Sie gehen in die Oper. Die Oper bietet Asyl. Musik und Unwirklichkeit helfen, die Wirklichkeit zu ertragen. Lida Winiewicz schildert packend die lebensgeschichtlichen und historischen Ereignisse einer Jugend im Kriegs-Wien und parallel das Leben der Familienmitglieder im Exil. "Eine hochkarätige und beliebte Autorin, die sehr vielen Menschen Nachdenken und Vergnügen bereitet." Bücherschau
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lida Winiewicz
Die Kinder gehen in die Oper
Lida Winiewicz
Die Kinder gehenin die Oper
Besuchen Sie uns im Internet unterwww.amalthea.at
© 2007 by Amalthea Signum Verlag GmbH, WienAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: verlagsbüro hamtil, wienUmschlagillustration: © IMAGNO, SV-BilderdienstHerstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger& Karl Schaumann GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 11,9/15,45 Punkt GoudyDruck und Binden: CPI Moravia Books GmbHPrinted in the EUISBN 978-3-85002-616-1eISBN 978-3-902862-49-5
Die Stunde vor Publikumseinlass. Das ist die schönste, weiß Lili. Nur wir und die Billeteure.
Wir kennen sie, sie kennen uns, die Kinder vom Stehparterre, die stundenlang angestellt waren im Eisengestänge des »Köh« (wie schreibt sich das Ding eigentlich?), die Türen sind zu, Sitzplatzleute dürfen noch nicht herein, aber wir sind schon da, vollzählig, die ganze Bande, der Bruno, der Charly, die Friedl mit ihrer Mutter (die Friedl kommt nie ohne Mutter), die Gusti, der Xaver, der Heinz, die Molly, der Eberhard, die Oper gehört jetzt uns, mit allem Rot, allem Gold, der Venus in ihrer Muschel, der Stille vor dem Sturm.
Ein einzelner Musiker übt eine Passage.
»Fagott?«
»Oboe«, sagt Marion, die Große. »Die Stelle aus der Ouvertüre.«
»Ich weiß.«
Lili ist gekränkt.
»Ich hab die Stelle erkannt. Nur die Instrumente verwechselt.«
Marion nimmt Lilis Hand. Lili hat kleine Hände. Marion sieht es nie ohne Rührung, fühlt sich an ihre Pflichten als große Schwester erinnert, an ihre Verantwortung.
Lili lächelt.
Die Welt ist in Ordnung, trotz Krieg, trotz Hakenkreuzfahne am Rathaus, trotz Furcht und Verlassenheit.
Die Kinder, Magie des Orts, sind vor allem Übel gefeit, unantastbar unter dem Glassturz. Bald wird es Musik schneien. Und Glück.
Der Vater der Kinder sitzt im Café, unter Platanen, irgendwo in Südfrankreich.
Hätte Henryk, sein eigener Vater, vor nahezu hundert Jahren nicht die Jüdin Esther Levy geheiratet, wäre er selbst nach dem Tod Maries, seiner katholischen Frau, der Mutter der beiden Kinder, keine zweite Ehe eingegangen, mit der Jüdin Miriam Blum –, er säße unbehelligt an seinem Schreibtisch in Wien, im Büro der DDSG, der Ersten Donau-Dampfschifffahrtsgesellschaft.
So aber gerät er ins Mahlwerk deutscher Rassengesetz-Arithmetik: »Halbjude« plus Jüdin ist gleich »Volljude«, Nachrechnen zwecklos, die DDSG wirft ihn hinaus, nach fünfundzwanzig Dienstjahren, Heil Hitler, er emigriert nach Frankreich mit Miriam, ohne die Kinder. Die bleiben bei Tante Frieda.
»Wir lassen euch nachkommen.«
»Wann?«
»Sobald euer Visum da ist.«
»Wann wird das sein?«
»Ihr müsst warten. Ihr werdet verständigt werden. Vom französischen Konsulat.«
Und die Kinder warten, warten, von Tag zu Tag, Woche zu Woche, Monat zu Monat. Kein Visum.
Der Krieg bricht aus. Frankreich, besiegt, wird in zwei Zonen geteilt, der Norden deutsch besetzt, der Süden Marschall Pétain überlassen.
Ein Kriegsende ist nicht in Sicht.
Der Vater, unter den Platanen, schreibt seinen Kindern Briefe. Die Briefe kommen nie an.
Der Heimweg durchs Dunkel dauert eine knappe Viertelstunde: Kärntnerstraße, Stephansplatz, der Dom ein schwarzes Gebirge, Rotenturmstraße, Hafnersteig. Kein Lichtschimmer. Kriegsfinsternis. Trotzdem ist die Nacht belebt.
Unsichtbare gehen zielstrebig ihres Wegs, schwebende, grünliche Punkte dank phosphoreszierenden Knöpfen an Mantel- und Jackenkragen.
Niemand hat Angst. Wer Nacht für Nacht möglicherweise von Bomben erschlagen wird, den schreckt kein Handtaschenräuber. Letzterer wäre sogar der tröstliche Beweis, es gibt tatsächlich Wiener, die glauben an ein Morgen.
Die Kinder sind angelangt. Sie sperren auf, treten ein, lassen das Haustor zuschnappen und machen sich an den Aufstieg. Die beiden bewohnen, mit Tante, ein unwirtliches Atelier, sechster Stock, hundertachtzig Stufen, Liftfahren kostet zehn Pfennig, zehn mal zehn Pfennig bedeutet ein Mal Oper, Stehparterre. Die Wohnung ist nicht beheizbar. Nur in der winzigen Küche gibt’s einen Kohleofen, außerdem Gasherd, Tisch, vier Sessel, eine Kredenz und Tante Friedas Bett.
Die Betten der Kinder stehen im riesigen Atelierraum. Über dem Glasdach der Mond.
Die Kinder lieben den Mond.
Vielleicht schaut der Vater hinauf, zufällig, in diesem Moment, und die Blicke treffen einander, irgendwo zwischen den Sternen.
»Sie ist keine Erste Dame!«, schimpft Lili, bis zum Kinn unter der Daunendecke, einem der letzten Stücke aus einem früheren Leben.
Marion weiß, wen sie meint. Anny Konetzni, stimmgewaltig, malträtiert die Partie.
»Soll die Brünnhilde singen!«, sagt Lili. »Keinen Mozart! Da muss eine lyrische her. Zum Beispiel die Reining!«
»Du spinnst! Wer singt dann die Pamina?«
»Warum nicht die Rethy?«
»Die Rethy?« Marion setzt sich auf. »Die Rethy tremoliert! Außerdem hat deine Reining neulich das ›B‹ geschmissen!«
»Als Arabella«, sagt Lili. »Aber als Erste Dame braucht sie kein ›B‹!«
Lili, selbst hoher Sopran, will Opernsängerin werden.
Marion unterstützt den Plan, steht aber nichtsdestotrotz zur eigenen Meinung:
»Die Rethy –«
Lili unterbricht: »Marion, ein geschmissenes ›B‹ von der Reining ist mir lieber als ein tremoliertes von der Rethy!«
»Auf einmal? Ich hab gedacht, die Rethy tremoliert nicht!«
»Na ja, hin und wieder –«
»Schluss jetzt. Morgen ist Schule.«
»Marion –«
»Gute Nacht!«
»Marion, ich kann nicht schlafen!«
»Zähl bis hundert!«
»Sag das den Wanzen!«
Marion springt aus dem Bett. »Schon wieder?«
»In deinem Bett nicht?«
Marion macht Licht, überprüft Bettzeug, Matratze, Gestell.
»Ich hab mein Bett desinfiziert!«
»Mit Salmiak?«
»Natürlich mit Salmiak.«
Marion steigt wieder ins Bett, deckt sich zu.
»Darf ich bei dir schlafen?«
Keine Antwort.
»Marion! Bitte! Bitte!«
Marion seufzt. »Meinetwegen.«
Lili steht auf, läuft barfuß durchs Niemandsland und schlüpft zu der Schwester ins Bett.
»Danke!«
»Schon gut.«
»Danke! Danke!«
»Wetz nicht!«
»Gute Nacht, Marion.«
»Gute Nacht, Lili.«
Der Vater, unter den Platanen, schreibt keine Briefe mehr. Er ahnt, sie kommen nicht an.
Anfangs, in der ersten Kriegszeit, gab’s Briefwechsel via Schweiz, Zürcher Freunde haben die Briefe neu adressiert, frankiert und auf den Weg gebracht.
Sind sie des Aufwands müde? Oder gibt’s keinen Postweg mehr, zwischen dem Großdeutschen Reich und der neutralen Schweiz? Der Vater kauft ein Schulheft, schlägt es auf und beginnt:
Meine lieben Kinder, damit Ihr wisst, was geschehen ist, falls wir uns nicht wiedersehen – daran will ich gar nicht denken –, schreibe ich in dieses Heft, was ich Euch erzählen würde, säßen wir endlich beisammen.
Und stocke schon.
Wollt Ihr es wissen?
Interessiert Euch ein Vater, der seine Kinder verließ?
Ich werde eines Tages versuchen, mich zu rechtfertigen. Nicht heute.
Jetzt will ich berichten, wie es kam, dass wir hier gestrandet sind, in Südfrankreich, in Montauban, nach Gastspielen meinerseits in diversen Internierungslagern.
Kurz nach Kriegsausbruch, in Paris, wurde ich zur Polizei bestellt. Es handle sich um Auskünfte und werde nicht lange dauern. Ich solle, für alle Fälle, eine Decke mitbringen.
Am Kommissariat nahm man meine Personalien auf, befühlte in peinlicher Weise meine Taschen und schickte mich in ein wenig anheimelndes Arrestlokal, wo es heftig stank.
Einige schäbige Herren saßen schon da, übler Laune. Sie machten auf der Holzbank nur widerwillig Platz.
Auch ein paar Frauen kamen. Sie weinten bzw. schimpften. Eine Saarländerin aus Galizien erzählte unaufgefordert, sie habe ein einziges Hemd mit, daran schloss sich die Beschreibung der Ausstattung, die sie habe zurücklassen müssen – diese war reichlich –, machte jedoch auf die Anwesenden, deren jeder mit sich selbst beschäftigt war, keinen besonderen Eindruck.
In der eklen Atmosphäre von Abortgestank, kaltem Rauch, Nervosität und Egoismus wurde das Warten zur Qual.
Gegen drei Uhr nachmittags wurden die Männer ausgesondert, ein Überfallswagen fuhr vor, wir wurden verladen und dann ging’s kreuz und quer durchs Arrondissement, bei jeder Wachstube wurden Leute eingesammelt und schließlich fuhren wir über die Boulevards Magenta, Strasbourg und Saint-Michel zur Porte d’Orléans und weiter zum Buffalo-Stadion.
Vor dem Eingang drängten sich Menschen.
Der Einlass verzögerte sich. Der Abend kam und wir standen immer noch vor dem Tor. Es gab weder Essen noch eine Schlafgelegenheit. Ich legte mich auf einen Strohhaufen, zum Glück hatte ich meine Decke. Ein Mensch mit schlohweißem Haar und gelbem zerfurchtem Gesicht schmiegte sich schlotternd an mich. Ich ließ ihm die halbe Decke, nicht etwa aus Nächstenliebe wie weiland der heilige Martin, sondern aus Bequemlichkeit. Nachgeben war weniger mühsam als peinlicher Widerstand.
Der Mann hörte auf, zu schlottern. Wir schliefen beide ein.
Am nächsten Tag gegen vier waren wir endlich im Stadion. Surprise, surprise: gutes Essen, richtige Aborte. Um die Arbeit, die im Kehren der Aschenbahn bestand, musste man sich reißen.
Einmal, als ich den Besen ergattert hatte, machten sich ein paar Leute den Spaß, dem Wachsoldaten zu sagen, ich sei ein berühmter Gelehrter.
Er nahm mir den Besen weg.
Meinen Einwand, ich sei kein Gelehrter, ließ er nicht gelten. Er sei zwar nur ein einfacher Eisenbahner, sagte er, aber er wisse sehr wohl, dass die besten Menschen bescheiden seien.
Ein junger bärtiger Bursche – er sah aus wie ein Rabbinatskandidat – bestätigte die Ansicht des Soldaten, fügte jedoch hinzu, seine (des Rabbinatskandidaten) Heimat sei völlig ungewiss, er daher staatenlos und unverzüglich zu entlassen.
Der Soldat führte mangelnde Kompetenz ins Treffen, drückte dem Jüngling den Besen in die Hand und ging.
Der Vater macht das Heft zu.
Tante Frieda legt Patience.
Am Wannsee ist Konferenz.
Die Kinder gehen in die Oper.
»Süß! Er ist süß!«, sagt Friedl, die kleine Rothaarige, die nie ohne Mutter kommt.
Es ist Pause.
Die Bande sitzt auf den Sofas im Vorraum des Stehparterres. Man spielt den »Barbier von Sevilla« und Doktor Alfred Poell singt erstmals den Figaro.
»Ein Mann ist nicht süß!«, rügt Lili. »Ein Mann kann gut aussehen, schön singen, musikalisch sein oder nicht, ganz ordentlich spielen – aber süß?«
»Warum ist sie immer so altklug?«, fragt Friedls Mutter, die aussieht wie ihre Tochter, nur größer. Dasselbe Gesicht, dieselben kupferroten Haare, sogar die Sommersprossen wirken wie abgepaust.
»Lili ist nicht altklug«, sagt Marion. »Lili ist klug. Ganz einfach.«
»Marion geht für dich durch’s Feuer«, sagt Friedls Mutter, anerkennend. »Wie findest du diesen Poell?«
»In Ordnung«, sagt Lili.
»In Ordnung?« Friedl ist aufgebracht. »Der Mann sieht gut aus, singt phantastisch –«
»Phantastisch? Ich muss schon sehr bitten!«, sagt Heinz, Amateurbariton, der die »Figaro«-Cavatine daheim zu brüllen pflegt, bis die Nachbarn die Polizei rufen, »du hast keine Ohren, Friedl! Der Mann verfügt über eine ganz nette Mittellage, aber die Höhe ist glanzlos –«
»Er meint seine eigene«, sagt Gusti, einziger Profi der Bande, Studentin an der Akademie, Schülerin von Anny Konetzni.
Heinz geht auf Gusti los. Friedls Mutter tritt dazwischen. »Kinder! Vergesst nicht, wo wir sind!«
»Außerdem ist er ein Doktor!«, sagt Eberhard, knappe achtzehn, der demnächst einrücken muss.
»Was für ein Doktor?«, fragt Charly. Er besucht die Abendschule, ist eben erst gekommen und schwindelt sich dann mit den Freunden in die erste Reihe vor.
»Medizin.«
»Allerhand«, sagt Bruno, in Uniform. Er muss morgen zurück an die Front. Dass er den letzten Abend lieber in der Oper verbringt als daheim bei seiner Mutter, bricht Letzterer das Herz.
Molly, vierzehneinhalb, schwankt zwischen Bewunderung und Neid.
»Mein Bruder hat nicht einmal das erste Semester geschafft. Er wollte auch Arzt werden, wisst ihr. Und singen kann er schon gar nicht. Manche Leute sind überbegabt.«
Molly, dicklich und klein, heißt eigentlich Wilma Mollgruber.
»Das Leben ist ungerecht, Molly«, sagt Xaver. »Dafür kurz.«
»Besonders heutzutage«, sagt Friedls Mutter, fröhlich. Es läutet. Die Oper geht weiter. Marion sagt gemessen: »Herr Doktor Poell ist eine Bereicherung des Ensembles.«
In der Nacht jedoch, als die Kinder das sechste Stockwerk erklimmen, bleibt sie plötzlich stehen und seufzt: »Die Friedl hat Recht. Er ist süß.«
Führers Geburtstag.
Hunderte Kinder, auch Lili, zum Huldigen abkommandiert, füllen den Großen Musikvereinssaal. Ein Meer von Hakenkreuzfahnen überflutet die goldenen Nymphen, neun Musen, an die Decke gemalt, blicken befremdet herab, Baldur von Schirach, Reichsstatthalter des Reichsgaues Wien, hält eine begeisternde Rede, das Deutschlandlied ertönt:
»Deutschland Deutschland über alles,
über alles in der Welt!
Wenn es stets zu Schutz und Trutze
brüderlich zusammenhält!
Von der Maas bis an die Memel,
von der Etsch bis an den Belt.
Deutschland Deutschland über alles
über alles in der Welt!«
gefolgt vom Horst-Wessel-Lied:
»Die Fahne hoch! Die Reihen dicht geschlossen!
SA marschiert mit mutig-festem Schritt.
Kam’raden, die Rotfront und Reaktion erschossen,
marschieren im Geist in unsern Reihen mit.«
Während der Kraftgesänge muss der rechte Arm ausgestreckt bleiben, zum Hitlergruß. Das strengt an.
Endlich ist es überstanden.
Die Kinder strömen hinaus. Lili lässt sich Zeit. Dieser Saal! Dort oben auf dem Podium, denkt sie. Dort stehe ich eines Tages und singe. Was Anderes.
Meine lieben Kinder, ich wollte, ich wüsste, wie Ihr lebt, sähe vor mir, wie Ihr wohnt.
Das Atelier habt Ihr beschrieben, aber wenn ich die Augen schließe, seid Ihr für mich noch immer in unserer alten Wohnung, ich sehe das Kinderzimmer, die rosa Blumentapete, die Schleiflackmöbel, das Klavier, den weißen Kachelofen und den Alkoven samt Vorhang, wo wir Opern aufgeführt haben, Darsteller und Publikum in Personalunion. Unsere Dreizimmerwohnung mit Bad erschien mir normal. Heute stelle ich mir die Frage: Wie »sozialistisch« waren wir Sozialisten der ersten Stunde?
Denn so sehr ich, als junger Mensch, den Zerfall der Monarchie bedauerte – was Euch vielleicht wundern wird –, so sehr war ich Sozialist, sofort, aus Gerechtigkeitsstreben. Dennoch: Die Not der Nachkriegsjahre, das Elend der Arbeitslosen brachten mich nicht um den Schlaf. Ich fürchte, dergleichen war für mich bedauerliche Statistik. Armut hatte es immer gegeben. Meine eigene Kindheit, nach Vaters frühem Tod, spielte sich in einem Bassena-Haus ab, Zimmer-Kuchl-Kabinett, Wasser und Klo am Gang. Mit fünfzig und fünfundzwanzig Dienstjahren, eine Dreizimmerwohnung zu bewohnen, erschien mir angebracht. Heute stehen uns zwölf Quadratmeter zur Verfügung, so groß ist der uns zugewiesene Raum in dem elenden Kollektiv, das wir mit drei anderen Flüchtlings familien bewohnen. Ich beschreibe es ungern. Man liebt einander nicht.
Also: Ein trüber Tag. Durch das Fenster – achtundzwanzig kleine Scheiben – sieht man die Wipfel der Bäume. Der Kamin mit seiner Rohziegeleinfassung ist durch eine Wäscheleine verhängt, daran baumeln Geschirrtücher und Strümpfe. Daneben der (von der Gemeinde gespendete) Ofen mit hässlichem senkrechtem Blechrohr. Auf der Herdplatte Töpfe. An der dem Kamin gegenüberliegenden schmierigen Wand zwei Kisten, in denen wir Brennholz lagern, daneben ein Kohlesack. Auf den Kisten allerlei Zeug, Pappschachteln, eine Waschschüssel, alte Zitronenschalen, Handtaschen, Bücher, Zeitschriften, meine Aktentasche et cetera. Das Radio – wir haben es für 60 Francs im Monat ausgeborgt – steht ebenfalls auf einer Kiste. In der Ecke leere Flaschen.
Der Fußboden besteht aus Ziegeln, quadratisch, dunkelrot. In der Mitte zwei rohe Tische, neben dem Fenster eine kleine Türe mit kaputtem Schloss, zum Abort.
Nein, hier ist es nicht »wohnlich«. Aber wir leiden keine Not. Trotz Rationierung gibt es genug zu essen. Wir haben Gas und elektrisches Licht. Seit wir den Ofen haben, wird es in der Küche auch bei großer Kälte angenehm warm. Viele Menschen würden uns beneiden.
Der Vater macht das Heft zu.
Tante Frieda legt Patience.
Heydrich unterschreibt das von Eichmann verfasste
Wannsee-Protokoll.
Die Kinder gehen in die Oper.
»Ille mi par esse deo videtur
ille, si fas est, superare divos
qui sedens adversus identidem te
spectat et audit –«
Lili bricht in Tränen aus, springt auf und verlässt die Küche. »Was hat das Kind?«, fragt Gustav, ein Jugendfreund des Vaters, der ihr Latein beibringt.
»Ich weiß nicht«, sagt Tante Frieda.
Marion schweigt.
Ihr Latein steht auf schwachen Füßen (zwei Jahre Gymnasium, dann wurde sie der Schule verwiesen), doch sie erahnt die Bedeutung des Gedichts von Catull: »Wer dir gegenüber sitzt, darf sich glücklicher preisen als ein Gott …« Tante Frieda regt sich auf: »Anstatt Ihnen dankbar zu sein, dass Sie jeden Samstag kommen!«
»Er kommt doch gern!«
»Marion! Sofort entschuldigst du dich!«
Marion beißt die Zähne zusammen. Sie weiß genau, es ist wahr.
Gustavs Leidenschaft gilt der Antike, genauer dem alten Rom, sein Latein würde jedem Bischof zur Ehre gereichen, aber wen interessiert das schon bei Rumpold & Co, Spedition, deren Disponent er ist? Nicht einmal Gustavs Frau kann Caesar viel abgewinnen. Sie schwärmt für Willy Fritsch.
Lili, die begabte Lili, ist ein Geschenk des Himmels. Ihr kann er die Schätze zeigen, die sonst keiner sehen will, für sie entwirft er kluge, entzückende Lernbehelfe, ihre Fortschritte sind seine Freude, neben ihr lebt er auf.
Marion gönnt es ihm.
Aber muss er sich deshalb gleich als Wohltäter feiern lassen? Schön, er hat dem Vater versprochen, er kümmert sich um die Kinder. Er übt die amtliche Funktion des »Sachwalters« aus – früher hieß so jemand »Vormund«, vor allem im »Barbier von Sevilla«, er hat sich angetragen, Lili Latein beizubringen, ohne Bezahlung, versteht sich, weil höhere Bildung dem Kind betrüblicherweise versagt bleibt, er unterstützt die Mädchen sogar (heimlich) mit Taschengeld, und als er dem Vater die Hand reicht, bevor der zum Bahnhof fährt, stehen in seinen Augen Tränen. Was seine Frau nicht hindert, später, bei der Wohnungsauflösung, nach dem Perserteppich zu fragen, doch den hat Miriam bereits der Hausgehilfin geschenkt.
Nach einem Jahr will Gustav (»der Chef hat’s mir nahegelegt«) der NSDAP beitreten. Der Antrag wird abgelehnt. Geschieht ihm recht, denkt Marion, man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Erzählte der Vater nicht, er und Gustav seien beim Ersten-Mai-Aufmarsch der österreichischen Sozialdemokraten Arm in Arm mitgegangen, im Knopfloch eine rote Nelke? »Lili!«, ruft Tante Frieda. »Lili, komm sofort heraus!« Lili antwortet nicht.
Gustav stopft seine Pfeife.
Marion sagt: »Ich hol’ sie!«, und geht nach nebenan.
Das Atelier ist mondhell.
»Lili! Wo bist du?«
»Hier.«
Lili hockt unterm Klavier, ihrem Lieblingsplatz bei Problemen.
Sie weint nicht mehr. Sie kommt hervor. Getrocknete Tränen glitzern an ihren Wangen wie silbrige Schneckenspuren.
Marion nimmt Lili in die Arme. »Er kann nichts dafür, Lili, glaub mir! Erwachsene haben keine Ahnung!«
Meine lieben Kinder, Buffalo war nicht das einzige Stadion, mit dem ich Bekanntschaft machte. Das nächste war Colombes.
Es dämmerte, als wir einzogen, eskortiert von einem Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett.
Ein alter Schönling, eine Steppdecke über der Schulter, verglich die Szene mit dem Aufmarsch der Christen in Neros Kolosseum. Da gehörte schon viel irregeleitete Phantasie dazu. Wo waren, vor allem, die Christen?
Die alten Herren mit ihren Bündeln fühlten sich vielleicht als Märtyrer, sahen aber aus wie ermüdete Hausierer.
Den guten Ursus aus Quo Vadis hätte ich allerdings gern dabei gehabt, mein Binkel war ziemlich schwer.
Da kamen uns Leute entgegen. Einer bat um Zeitungen. Ich erfreute ihn mit dem zerknüllten »Paris Midi« und er half mir dafür, mein Gepäck zu tragen. Richtiger: Er trug es. Sein Name war, natürlich, Schlesinger.
Auf den Tribünen trieb sich eine Menge Leute herum, auf der Aschenbahn herrschte Abendkorso.
Plötzlich Geschrei: Eine wilde Rotte hat eine Maus aufgescheucht. Schon ist sie erschlagen und ein Rechtsanwalt trägt sie fort, halb Triumphator, halb Naturforscher, ganz Kindskopf.
Wir klettern auf die Galerie. Hier wohnt man zwar unter Dach, aber nach vorne liegt alles frei, man ist auf einer offenen Veranda und schläft wie der Herzog von Mantua bei Sparafucile.
Der Zwischenraum zwischen der hölzernen Sitzbank und der Betonstufe des Amphitheaters dient als Lager.
Ich saß noch erschöpft auf der Bank, als ein paar gebückte Gestalten mächtige Packen Strohs herbeischleppten. Auch mir wurde ein stacheliges Lager bereitet.
In der Nacht wache ich auf. Ich sehe eine exotische Landschaft. Der liebe Mond gießt seinen Silberflimmer (oder so ähnlich), die gegenüberliegende Tribüne sieht aus wie die Silhouette eines chinesischen Palastes und hinter den weißen Sitzreihen des nicht überbauten Teils erscheinen die Konturen der runden Baumwipfel wie aus Papier geschnitten.
Gleich tritt Turandot auf und die arme Liu opfert sich für den Prinzen. Du hast ihre Arie gesungen, Lili, glockenrein, fehlerlos, und ich fand es normal. Du warst sieben!
Der Vater macht das Heft zu.
Tante Frieda legt Patience.
Himmler beauftragt Heydrich, alle für die Durchführung der vom Führer befohlenen Endlösung der Judenfrage erforderlichen organisatorischen Maßnahmen zu treffen.