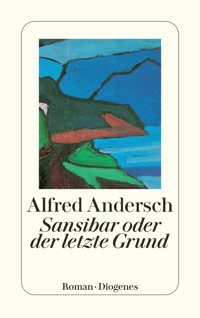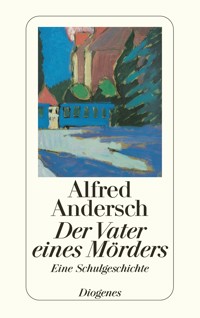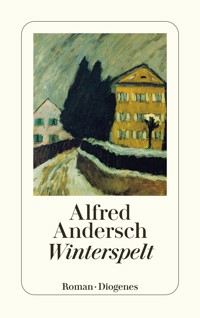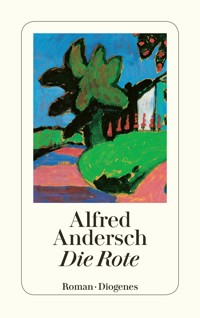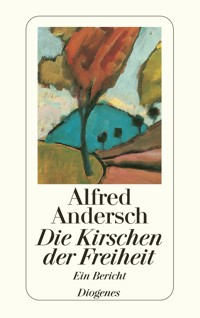
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Am 6. Juni 1944 desertierte Alfred Andersch an der italienischen Front aus der deutschen Wehrmacht. In dem Bericht Die Kirschen der Freiheit, 1952 erstmals erschienen, schildert Andersch in szenischen Bildern entscheidende Situationen seines bisherigen Lebens und die Desertion als dessen logische Konsequenz. Gezeigt wird der Weg einer Emanzipation, der den Autor aus dem Münchner Kleinbürgermilieu heraus zu politischem Engagement in der Kommunistischen Partei und ersten künstlerischen Versuchen bis zur Fahnenflucht führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Alfred Andersch
Die Kirschen der Freiheit
Ein Bericht
Die Erstausgabe erschien 1952 in der Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main
Im Diogenes Verlag erschien das Buch 1968, 1971 erstmals als Taschenbuch (detebe 20001)
Der Text der vorliegenden Ausgabe entspricht demjenigen in Band 5 der 2004 im Diogenes Verlag erschienenen textkritisch durchgesehenen und kommentierten EditionAlfred Andersch, Gesammelte Werke in zehn Bänden, herausgegeben von Dieter Lamping
Bibliographie der Sekundärliteratur zum Werk von Alfred Andersch unter www.diogenes.ch/andersch/bibliographie
Umschlagillustration: Gabriele Münter, ›Herbstliche Landstraße‹, 1910 (Ausschnitt) Copyright © 2012 ProLitteris, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Ich baue nur noch auf die Deserteure.
[6] Kerpen (Eifel) – Kämpen (Sylt)
[7] Inhalt
Der unsichtbare Kurs[9]
Der Park zu Schleißheim [9]
Verschüttetes Bier [18]
In der Tasche geballt [26]
Das Fährboot zu den Halligen [35]
Die Fahnenflucht[45]
Die Kameraden [45]
Die Angst [58]
Der Eid
[9] Der unsichtbare Kurs
Der Park zu Schleißheim
Weiß nicht mehr genau, in welche Jahreszeit die Münchner Räterepublik fiel. Ist ja leicht festzustellen. Frühjahr, glaub’ ich. War, glaub ich – mein ich, wollen Sie sagen, würde K. sagen, glauben können Sie nur an Gott –, mein ich also, ein dunkler, schmutziger Frühlingstag, an dem sie Menschen in langen Reihen die Leonrodstraße in München entlangführten, in Richtung auf das Oberwiesenfeld zu, um sie in den weiten Höfen, vor den Garagenwänden des ›Kraftverkehr Bayern‹ zu erschießen. Die erschossen werden sollten, hatten die Hände über den Kopf erhoben, vor Müdigkeit lagen die Hände lose gekrümmt auf den Köpfen, oder die eine Hand umschloß die andere am Gelenk. Lange Kolonnen, in unregelmäßigen Trupps, immer wieder kamen welche. Die anderen, die auf sie schießen würden, hatten die Gewehre im Anschlag. Sah das vom Balkon unserer Wohnung in einer Seitenstraße aus, aber verstand es damals noch nicht. »Das Gesindel«, hörte ich meinen Vater hinter mir sagen, denn die Räterepublik war zu Ende, aber dann zog er mich doch weg, vielleicht, weil ein Grausen ihn überfiel oder weil ein Wichtigtuer unten auf der Straße gerufen hatte: »Fenster zu! Es wird geschossen!« Sah damals mit meinem fünfjährigen Kindergesicht über die Brüstung des Balkons hinweg auf sie hinab, aber wußte noch nicht, daß sie zum Erschießen geführt wurden, daß ich keinen von ihnen jemals kennenlernen würde. Bin erst später dahintergekommen, vielleicht so mit vierzehn oder fünfzehn Jahren, um das Jahr 1928 etwa. Weiß [10] noch, daß mich dann am meisten interessierte, zu erfahren, wie es einem zumute war, der einen anderen erschießen sollte. Nicht im Zorn –, sondern der mit ihm eine lange Vorstadtstraße im dunklen Frühling entlangging, hatte Zeit, zu denken, daß er am Ende der Straße dem anderen das Leben auslöschen würde. So lange hält Zorn nicht vor. Was währt denn schon eine Straße lang? Die Dummheit, sich im Recht zu glauben? Der Befehl? Die Hetze? Der verwirrte Geist, der in anderen nur noch Gesindel sieht? Oder das gefällte Gewehr, das zur Entladung drängt? Der Blick, der sich schon den zusammenbrechenden Körper auf die Netzhaut zeichnet?
Versteh jedenfalls nicht, warum der mit dem Gewehr nicht stehenbleibt, sich eine Zigarette anzündet und in den zwei Sekunden, die das Glimmen des Streichholzes dauert, dem nächsten, der mit erhobenen Händen darauf wartet, daß der Marsch in den Tod das Ziel erreicht, zuflüstert: »Da drüben – die Straße, in den ersten Hausgang! Hau ab!«
Gebe zu, daß mich solche Gedanken in der Zeit, in der ich konfirmiert wurde, nur selten beschäftigten. In der übrigen Zeit lief meine Kindheit ab wie ein Uhrwerk. Wenn ich an sie denke, ergreift mich wieder das Gefühl der Langeweile, das mich umklammert hielt, als ich zwischen den charakterlosen Fassaden der bürgerlichen Mietshäuser aufwuchs, aus denen der Münchner Stadtteil Neuhausen besteht. Meine damals schon bebrillten Augen blickten in eine Landschaft verwaschener Häuserfronten, toter Exerzierplätze, aus roten Ziegelwänden zusammengesetzter Kasernen; die Lacherschmied-Wiese war im Sommer ganz ausgedörrt, und die Rufe der Fußballspieler drangen matt in das Zimmer, in dem ich lustlos an den Schularbeiten saß. Noch heute, wenn ich nach München komme, kann ich der Lockung nicht widerstehen, mit der Trambahn zur Albrechtstraße zu fahren und, im Durchwandern der Straßen meiner Kindheit, das Gefühl [11] faden Wartens noch einmal auszukosten, das mich als Knaben hier umgab. In der Eingangshalle des Wittelsbacher Gymnasiums konnten mich nur die Aquarien fesseln, die an den südlichen Fenstern standen, so daß die Sonne durch das grüne Wasser und das Gold der Fischleiber hindurchschien; ich wartete auf die Naturkunde-Stunden bei Professor Burckhardt, nicht, weil mich das Fach interessierte, sondern weil mich der rothaarige, weißhäutige Mann anzog, der, wenn er das Klassenzimmer betrat, einen gereizten Blick aus den von schweren Gläsern und buschigen weißen Brauen geschützten hellblauen Augen in die Runde warf, ehe er den Unterricht begann. Aber die empfindliche Geistigkeit von Burckhardts Unterricht war nur ein Intermezzo in einer Welt, die mich mit Überdruß erfüllte. Ich mußte das Gymnasium bereits am Ende der Untertertia verlassen; zwar erwarb ich mir in Deutsch und Geschichte die besten Noten, aber ich war – auch in meinem späteren Leben – niemals in der Lage, eine Sprache nach grammatikalischen Gesetzen zu erlernen oder mathematische Formeln zu verstehen, die über die einfachsten Rechenmethoden hinausgehen, ebensowenig wie es mir gegeben ist, philosophischen Gedankengängen folgen zu können, wenn sie sich in der Sprache begrifflicher Deduktionen vollziehen. Der schreiende Mißklang zwischen meiner Eins in Deutsch und meiner Fünf in Griechisch verleitete die in reinem Wissenschaftsdenken erzogenen Lehrer zu der Annahme, ich wolle nur das lernen, was ich lernen wolle. Sie hätten besser daran getan, einzusehen, daß ich überhaupt nichts ›lernen‹ wollte; was ich wollte, war: schauen, fühlen und begreifen.
Etwa ein Jahr vor meinem Austritt aus der höheren Schule bin ich in der lutherischen Christus-Kirche zu München-Neuhausen konfirmiert worden. Die Konfirmation ist für mich, wie jeder öffentliche Vorgang seither, nichts als eine [12] peinliche Angelegenheit gewesen. Während ich an der Spitze des nach dem Alphabet geordneten Zuges der Konfirmanden durch eine Gasse zwischen der dunkelgekleideten Menge auf den im Kerzenlicht flimmernden Altar zuschritt, bemühte ich mich krampfhaft, eine feierliche Stimmung in mir zu erwecken. Es gelang mir nicht. Ohne rechtes Bewußtsein von dem sakramentalen Akt, an dem ich teilnahm, setzte ich einfach meine Gleichgültigkeit mit einem Anflug von Hohn gegen die weihevolle Rührung, die mir aus der Gemeinde wie eine klebrige Masse entgegenzufließen schien. Nicht einmal als Pfarrer Johannes Kreppel mir die Oblate auf die Zunge legte und den Kelch an die Lippen hob, bin ich über die reine Mechanik der Handlung hinausgekommen.
Das ist um so erstaunlicher, als dieser evangelische Diaspora-Geistliche für mich stets eine verehrungswürdige und machtvolle Persönlichkeit war. Von eher kleiner als großer Statur und heller, zarter, fast wächserner Haut, die ja immer ein Zeichen von Anfälligkeit für den Geist und von körperlicher Schutzlosigkeit ist – und tatsächlich ist Pfarrer Kreppel schon mit fünfzig Jahren an einer Lungenentzündung gestorben –, war sein Gesicht mit den lebensprühenden Augen dennoch ganz von protestantischem Trotz erfüllt. Er wurde der wichtigsten Bedingung seines Bekenntnisses gerecht, die mit dem Charakter, der es verkündet, steht und fällt. Die protestantische Revolution, die eine inhaltslos gewordene Priesterherrschaft fällen wollte, hat, allein durch die Bedeutung, die sie der Predigt im Gottesdienst zuerkennt, das Amt des Priesters zur höchsten persönlichen Würde erhoben. Ich habe später die lutherische Kirche verlassen und seither kein Bekenntnis zu einer anderen christlichen Konfession abgelegt. Die Antwort auf die Frage, ob ich dadurch das Sakrament der Taufe aufgehoben habe, überlasse ich den Theologen und meinem eigenen Gewissen.
[13] Während ich dies niederschreibe, fällt mir auf, daß ich in den letzten Absätzen den Stil des unmittelbaren Erzählens eines Erlebnisses, mit dem ich begann, verlassen habe und mich der breiter gesponnenen Reflexion, des Periodenbaus und der harmonikalen Schönheit älterer Schulen bediene. Vielleicht deshalb, weil ich eine Zeit der Langeweile zu schildern hatte? Setzen wir also neu an!
Der Pfarrer Kreppel war nicht nur ein frommer, er war auch ein nationaler Mann. Deshalb wohl bewunderte ihn mein Vater, der zwar gläubig, vor allem anderen aber national gesinnt war. Mein Vater hatte die schwarzen Haare, die Adlernase, die goldumrandete, scharf funkelnde Brille und die rote, sich leicht erregende Haut eines feurigen Menschen. Während er die Gewerbe eines kleinbürgerlichen Kaufmanns und Zivilisten – Versicherungen, Immobilien und Derartiges – sehr mangelhaft betrieb, so daß die Familie immer tiefer in Schulden geriet, fühlte er sich in Wahrheit als jener Hauptmann der Reserve, als der er, mit Dekorationen und Verwundungen übersät, aus den Infanteriestellungen in den Vogesen zurückgekehrt war. Als er dem Zug, der ihn in den Münchner Hauptbahnhof brachte, entstieg, wurden ihm von Revolutionären die Achselstücke heruntergerissen. Er kam nach Hause, nicht nur ein geschlagener, sondern auch ein entehrter Held, und führte von da an ein halbmilitärisches Leben in Verbänden weiter, die ›Reichskriegsflagge‹ oder ›Deutschlands Erneuerung‹ hießen. Wenn man zu denen gehört, die den Hartmannsweilerkopf im Sturm genommen haben, wird man wohl unfähig zu begreifen, daß die geschichtlichen Entscheidungen nicht dort fallen, wo man durch ein Scherenfernrohr die feindlichen Stellungen ausspäht.
Immer wieder ging er fort, um geschlagen zurückzukehren. Ich entsinne mich noch des Morgens, an dem er aus dem Wirbel des Hitler-Putsches heimkehrte, nach kurzer Haft. [14] Das war 1923. Darnach wurde er ein bedingungsloser Parteigänger des Generals Ludendorff. Eines Abends nahm er mich zu einem Fackelzug mit, der dem General dargebracht wurde. Die uniformierten Männer sammelten sich in einem Walde am Ufer der Isar und marschierten dann in langen Kolonnen bis zu einem Platz in der Nähe von Ludendorffs Haus. Dort standen sie lange im Karree, in einem von Kommandorufen zerstückelten Schweigen. Die gelbrot brennenden Fackeln machten die Nacht und die Baumwipfel zu einer Faust, die sie umschlossen hielt. Ich stand im Glied neben meinem Vater, als Ludendorff sehr langsam die Front abschritt und mit einzelnen Männern sprach. Sein Gesicht mit den großen Flächen wirkte blockartig und löwenhaft, aber die helle Haut und das weiße Haar teilten dem entblößten Kopf auch etwas Empfindliches, Membranhaftes und Denkerisches mit. Man ahnte, daß diesem Haupte das Verschieben einer Division auf der Landkarte mehr war als nur eine technische Maßnahme. Der da vorbeiging – übrigens als einziger auf dem Platz als Zivilist – war ein Künstler des Schlachtfeldes.
Die Geschäfte gingen schlecht, indessen meines Vaters politisches Fieber zusammen mit seiner Zuckerkrankheit anstieg. Als ein Granatsplitter ausschwärte, den er noch im Bein trug, schloß sich die Wunde nicht mehr, und das Leiden warf ihn aufs Bett. Von meinem vierzehnten bis zu meinem sechzehnten Jahre wohnte ich dem Sterben meines Vaters bei. Ich sah die Zehen seines rechten Fußes vom Brand schwarz werden und sah, wie er ins Krankenhaus geschafft wurde, wo man ihm das rechte Bein abnahm. Wieder einmal kehrte er in unsere schon Spuren des Elends zeigende Kleinbürgerwohnung geschlagen zurück. Wenn ich das Klappern seiner Krücken hörte, wich ich in andere Zimmer aus, weil ich seine Reden, die stets um die Themen der nationalistischen Politik kreisten, nicht hören wollte.
[15] Ich mußte zu den Händlern gehen, um die Lebensmittel, die wir brauchten, zu holen und anschreiben zu lassen. Als ich eines Tages in die Straße, in der wir wohnten, einbog, sah ich meinen Vater, auf seine Krücken gestützt, aus der Haustüre kommen. Ich sah die Einsamkeit, die ihn umgab. Er stand vor der Türe und blickte unentschlossen vor sich hin, ohne mich wahrzunehmen. Etwas fürchterlich Tragisches war um ihn; ich wußte, daß er kein Geld hatte und daß er nicht wußte, wohin er gehen sollte. Seine Bekannten hatten sich von dem armen Mann zurückgezogen, und auch wir, die Familie, hatten ihn im Geiste schon verlassen. Er wußte, daß meine Mutter Augenblicke hatte, in denen sie ihr Schicksal bis zum Überdruß erfüllte, und daß mein älterer Bruder und ich seine politischen Anschauungen nicht teilten. Sein Leben war zerstört, alle seine Pläne waren gescheitert, und sein Körper war dem Tode geweiht. In diesem Augenblick, als er sich unbeobachtet glaubte, war sein stolzes, männliches Gesicht von Leere und Trauer erfüllt, blicklos starrten seine Augen über den glatten Asphalt der Straße hinweg in den Abgrund der Jahre. Die Schultern über die Krücken geneigt, sah er den Plankenzaun einer Kohlenhandlung an und wußte, daß er keinen Pfennig in der Tasche hatte.
[16] Ich lief, von diesem Anblick überwältigt, auf ihn zu, um ihn zu stützen, ihm zu helfen, denn ich wußte, daß er einen seiner ersten Gehversuche nach der Amputation machte. Aber ich kam zu spät. Noch während ich lief, sah ich, wie er sich verfärbte, wie er die Krücken losließ und auf das Pflaster hinschlug. In seiner tiefen Ohnmacht lag er sehr still, und die Trauer seines Gesichts war auf einmal zur Ruhe gekommen; in der Erschöpfung enthüllte das Haupt aus gelbem Wachs eine Menschen-Natur, die sich aus Selbstlosigkeit einer politischen Idee verschrieben hatte und daran zugrunde ging. [17] Mein Vater hatte kein Geld, weil er die Niederlage Deutschlands zu seiner eigenen gemacht hatte.
Von diesem Sturz hat er sich nie wieder erholt. Die notdürftig zum Schließen gebrachte Wunde seines Beinstumpfs brach auf und ging in Brand über, der nicht mehr zu heilen war. Er versank in eine zwei Jahre dauernde Agonie aus Morphiumräuschen und Schmerzanfällen. In den Nächten habe ich ihn, zwischen verzweifeltem Stöhnen, oft beten gehört. Er betete stets das alte Kirchenlied O Haupt voll Blut und Wunden, oder er sang diese Melodie aus der Matthäus-Passion mit blecherner Stimme, die gefärbt war von höchster Qual. Das waren die Augenblicke, in denen in meines Vaters Brust der Pfarrer Johannes Kreppel über den General Ludendorff siegte. Dann hörte ich, wie meine Mutter das Licht anzündete, aufstand und eine neue Morphiumspritze bereitete. Mein Vater wäre durchaus der Mann gewesen, diesem Leben selbst ein Ende zu bereiten. Aber dann wäre er nicht als ein hundertprozentig Kriegsbeschädigtem gestorben, wie es in der entsetzlichen Sprache des Versorgungswesens heißt, und meiner Mutter wäre nach seinem Tode keine Rente zugefallen. So nahm er es auf sich, unter der Geißel eines Grans Zucker, das sein Blut nicht ausscheiden konnte, dem Tode entgegengemartert zu werden.