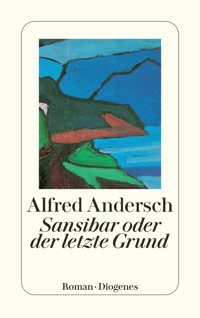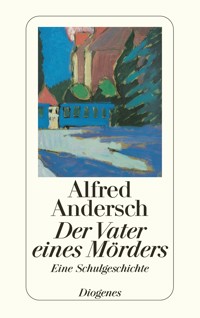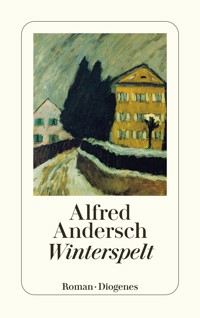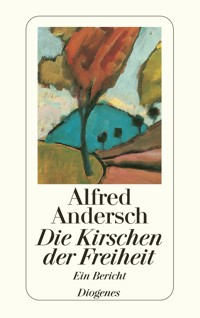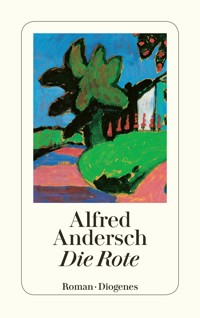
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 30jährige Dolmetscherin Franziska flieht aus ihrem mondänen Leben und einer anstehenden Wahl zwischen Ehemann und Liebhaber ins winterlich ungastliche Venedig. Doch auch dort findet ›die Rote‹ nicht die erhoffte Freiheit, sondern verstrickt sich bald wieder in seltsame Bekanntschaften. Die Ausgabe entspricht der 1972 von Andersch überarbeiteten Fassung, die von der Kritik einhellig gelobt wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Alfred Andersch
Die Rote
Roman
Die Erstausgabe erschien 1960 im
Walter Verlag, Olten und Freiburg i.Br.
Die Neufassung des Romans
erschien 1972 im Diogenes Verlag,
1974 erstmals als Taschenbuch (detebe 20160)
Die vorliegende Ausgabe bringt die Neufassung;
der Text entspricht demjenigen in Band I
der 2004 im Diogenes Verlag erschienenen
textkritisch durchgesehenen und kommentierten Edition
Alfred Andersch, Gesammelte Werke in zehn Bänden,
herausgegeben von Dieter Lamping
Bibliographie der Sekundärliteratur zum Werk
von Alfred Andersch unter
www.diogenes.ch/andersch/bibliographie
Umschlagillustration: Gabriele Münter,
›Garten in Murnau‹, 1910 (Ausschnitt)
Copyright © 2012 ProLitteris, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23602 6 (3.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60079 7
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Der moderne Komponist schreibt seine Werke, indem er sie auf der Wahrheit aufbaut.
Claudio Monteverdi Die Vollkommenheiten
[7] Inhalt
Freitag
Rapido und Betrachtung eines Hauses – Ursachen eines Wechsels von C-Dur zu Cis – Plötzlicher Entschluß einer Dame im Café Biffi zu Mailand – Auslegung von Giorgiones Sturm – Das Licht raffinierter Leute – Montecatini-Sirene [9]
Samstag
Inventur mit kleinen Löwen – Grausiges Erlebnis eines venezianischen Ofensetzers – Vorauszahlung gewünscht – Brahms und die beiden Schwestern – Fünf-Uhr-Tee mit dem smarten Set – Paludi della Rosa [43]
Sonntag
Ein Mann, der pazienza besitzt – Folgen eines Schocks – Der heilige Markus und die falschen Alternativen – Telefonat mit Dortmund – Mappa Mundi – Die Linien schneiden sich auf dem Campanile – Rock and Roll mit einem Mörder – Oststurm [97]
Montag
Geschäfte mit Shylock – Autobiographie eines Antisemiten – Das Meer – Jemand möchte auf Reisen gehen – Von Mythen und Strophen – Der goldene Knopf – Ein Testament [189]
[9] Freitag
Rapido und Betrachtung eines Hauses – Ursachen eines Wechsels von C-Dur zu Cis – Plötzlicher Entschluß einer Dame im Café Biffi zu Mailand – Auslegung von Giorgiones ›Sturm‹ – Das Licht raffinierter Leute – Montecatini-Sirene
[11] Franziska, Spätnachmittag
Auf dem Bahnsteig der Stazione Centrale war es trocken, trocken unter dem dunklen Gebirge aus Glas, Rauch und Beton, aber der Rapido nach Venedig troff von Nässe, sie hatten ihn sicherlich erst vor ein paar Minuten aus dem Regen, aus dem Grau des Regen-Nachmittags, in die Halle geschoben, Abfahrt 16.54, also fünf Minuten Zeit, im Waggon war es noch kalt, so daß Franziska nur ihre Handschuhe auf den Platz legte und wieder hinausging, um nicht zu frösteln, aber statt dessen fror sie im Januarwind, der durch die Halle fuhr, vielleicht bin ich schwanger, es war ihr kalt, obwohl sie den Kamelhaarmantel anhatte, sie klemmte sich die braune Handtasche unter den Arm und steckte die Hände in die Manteltaschen. Eine Zigarette, das erste, was ich tue, wenn der Zug fährt, ist, mir eine Zigarette anzünden. Sie sah, wie die Nässe an den Flanken des Waggons, neben dem sie stand, im Rauch der Bahnhofshalle zu Inseln verdunstete, schmutzig kondensierte und sich dann plötzlich mit einem gelben Schimmer überzog, als die Lampen auf den Bahnsteigen eingeschaltet wurden. Wenn Herbert in diesem Augenblick auftauchen würde, weil er mir nachgelaufen wäre, ließe ich vielleicht die Handschuhe da drinnen liegen und ginge mit ihm weg. Wenn er jetzt käme, so würde es bedeuten,daß wir vielleicht im letzten Augenblick einen Modus fänden. Wie feige ich manchmal bin. Mailand Stazione Centrale war ein dunkler Ort, besonders im Regen, im Januar, im grauen Spätnachmittag, seinen Eingang bildeten riesige poröse Quadersäulen, Franziska war aus der Straßenbahn gestiegen und schnell in den Bahnhof hineingelaufen, in der Vorhalle [12] fuhren die Taxis an, stoppten und glitten wieder hinweg, Rolltreppen führten nach oben, sie waren um diese Zeit noch nicht überfüllt gewesen, unbewegtes nach oben Schweben, Franziska hatte hinter einer alten mageren kleinen Frau gestanden, die in vier schweren Einkaufstaschen, abgewetzten geflickten Einkaufstaschen, Pakete und Flaschen trug, eine Falkin, Mäuler stopfend, arm, alt, unterernährt, mit einem spähenden Blick, oben verschwand sie sogleich in der Menge, die aus einem angekommenen Zug strömte, Franziska war zu einem Schalter gegangen und hatte gefragt, wann der nächste Zug ginge.
»Wohin?«
»Irgendwohin.«
Der Beamte hatte sie einen Augenblick lang angesehen, sich dann nach der Uhr umgewendet und gesagt: »Der Rapido nach Venedig. Sechs Minuten vor fünf.«
Venedig. Wieso Venedig? Was habe ich in Venedig zu tun? Aber es ist wie im Roulette, ich habe auf Zero gesetzt und es ist eine Farbe herausgekommen. Irgendwohin hieß Zero. Herausgekommen war Venedig. Vermutlich gab es keinen Ort, der Null hieß.
»Gut, geben Sie mir Venedig!«
»Rückfahrkarte?«
»Nein, einfach.« Sie sah auf ihre Armbanduhr. Dreizehn vor fünf. Venedig war so gut wie jeder andere Ort, wie alle jene Orte, in denen Herbert mich nie vermuten wird. Herbert wird höchstens annehmen, ich sei nach Deutschland zurückgefahren, um ihn zu Hause zu erwarten.
»Viertausendsechshundert«, sagte der Beamte und schob ihr das Billet hin.
Franziska reichte ihm einen Fünftausend-Lire-Schein. Es ist zu teuer, die Reise nach Venedig ist zu teuer. Als er ihr herausgab, sagte er: »Die Zuschläge müssen Sie im Zug lösen.«
[13] Sie war erschrocken. Einen Augenblick lang hatte sie überlegt, ob sie ihm das Billet zurückgeben solle. Ich kann mir ja irgend etwas näher Gelegenes aussuchen, Turin zum Beispiel, und mit einem gewöhnlichen Zug fahren. Aber sie steckte das Billet ein, während der Mann ihr zusah. »Bahnsteig sieben«, sagte er höflich. Eine Ausländerin. Irgendwohin. Sie sind verrückt oder Huren oder beides. Eine Ausländerin, die irgendwohin fahren will und Geld genug hat, um ein Rapido-Billet nach Venedig zu bezahlen. Ein Viertel meines Monatsgehalts. Eine verrückte Hure. Wie ihre Haare flattern. Eine Rothaarige. Keine Italienerin läßt ihre Haare so flattern. Er sah ihr nach, bewundernd und obszön.
Das plötzliche Lampenlicht verwandelte den grauen Abend, der draußen vor der Abfahrtshalle lag, in etwas Dunkles, das noch nicht ganz Nacht war. Die Lautsprecher verkündeten, der Direttissimo aus Rom habe Einfahrt. Als Franziska in den Waggon eingestiegen war, setzte sich der Rapido auch schon in Bewegung, sanft und unwiderstehlich, als würde er von einer ungeheuren Feder gespannt, einer Feder, die ihn tatsächlich nach wenigen Minuten über die Gleise schnellte wie ein Geschoß. Schnell fahren ist wunderbar. Manchmal habe ich Joachims Porsche auf hundertsechzig gebracht, wenn wir ins Theater fuhren, abends, auf der Autobahn zwischen Dortmund und Düsseldorf. Sie saß während der ersten Augenblicke, in denen der Rapido seine Schnelligkeit entfaltete, bewegungslos auf ihrem Platz, eingehüllt in die Geschwindigkeit des stählernen, lautlos und seidenweich den Abend durchschneidenden Pfeils. Wenn du Kinder hättest, würdest du nicht so schnell fahren, hat Joachim jedesmal gesagt, wenn ich loslegte. Doch, habe ich geantwortet, genauso schnell. Außerdem habe ich keine. Ihr macht mir ja keine. Ihr seid ja so vorsichtig. Gerade als sie Joachims wütendes Gesicht aus der Erinnerung verlor, kam der Zugschaffner. Er [14] prüfte ihr Billet und sagte: »Differenza classe e supplemento Rapido.«
Während er die Zuschlagbillets schrieb, wartete sie besorgt auf den Preis, den er nennen würde.
»Zweitausendfünfhundert«, sagte er und reichte ihr die Fahrscheine.
Sie nahm den einen der beiden Zehntausend-Lire-Scheine aus der Handtasche. Er hatte Wechselgeld. Als er gegangen war, lehnte Franziska sich mit geschlossenen Augen zurück. Ich hatte Fünfundzwanzigtausend und etwas Silbergeld. Wenig, sehr wenig, aber zehn Tage hätte es gereicht. Jetzt sind siebentausend weg. Ich habe jetzt noch achtzehntausend und ein paar Münzen. Es ist Wahnsinn gewesen, diesen Zug zu nehmen. Es war nicht konsequent – dieser Rapido, der nur Wagen erster Klassen führt, ist eine Täuschung, er enthielt in seiner gepolsterten, geheizten, gut beleuchteten Schnelligkeit die Illusion, das, was sie getan hatte, könne mit Komfort umgeben, mit Eleganz getan werden. Ich müßte auf einer Holzbank sitzen, eingeklemmt zwischen drei andere Leute. Ihr schauderte bei diesem Gedanken, sie öffnete die Augen, erinnerte sich plötzlich ihres Wunsches zu rauchen und zündete sich eine Zigarette an. Zweitausendvierhundert Lire wären zwei Nächte in einem billigen Hotel gewesen, also drei Tage Frist. Herrgott, was für ein Blödsinn! Schon der erste Schritt ist schiefgegangen. Ist es ein böses Vorzeichen?
Sie war geneigt, es dafür zu halten, und nahm sich vor, vom Moment ihrer Ankunft in Venedig an scharf zu rechnen, nicht mehr rauchen, sie zählte die Zigaretten in dem Päckchen, das sie bei sich hatte, es waren noch zwölf Stück, das reicht bis morgen abend, wenn ich mich zusammennehme, dann las sie automatisch einige Überschriften in der Abendausgabe des Corriere, die der Mann, der in dem offenen Abteil neben dem ihren saß, ausgebreitet vor sich hin hielt, [15] ancora nessuna decisione nella vertenza Callas – Opera, Mosca alla conquista dei mercati stranieri, tre progetti per salvare il campanile di Pisa, l’abito da sposa della Mansfield (mit Bild), es interessierte sie alles nicht. Ich habe überhaupt nichts zu lesen dabei. Das Buch, das ich gerade angefangen hatte, war unglaublich gut. William Faulkner, Wild Palms. Sehr intelligent, sehr wild, nein, das reicht nicht aus: ein rasendes Buch, eine in Raserei gegen das Schicksal erhobene Faust, aber man weiß, daß sie gesenkt werden wird, sich senken, doch Faust bleiben wird, ruhig, aber gespannt neben dem Schenkel hängen wird, besiegt, aber wachsam. Eigentlich ist es unerträglich, daß ich das Buch jetzt nicht fertiglesen kann, aber es liegt in einem Hotelzimmer in Mailand. Herbert mochte es nicht. Er fand es unangenehm. Aber er kann auch nicht genug Englisch, um Faulkner verstehen zu können. Er macht sich nicht viel aus amerikanischer Literatur. Er findet sie überschätzt. Er liest gerne ›schöne‹ Bücher, die feinen, die gebildeten Leute, über deren Lippen niemals und unter keinen Umständen ein rauhes Wort kommt, ich glaube, heimlich liest er immer noch Rilke, hat aber Angst, sich zu blamieren, wenn er es offen zugibt. Am meisten Furcht hat er vor Dostojewskij, Beckett und den neorealistischen Filmen, ›Il Grido‹ fand er natürlich peinlich, dieser Ästhet, ich habe ihn auf der Straße stehenlassen, als er das sagte, wie wir in Mailand aus dem Kino kamen, er hätte ja nicht mitzugehen brauchen, ich habe ihm gesagt, er solle sich das ersparen, aber er war neugierig, wollte sehen, was ich sehe.
Franziska bemerkte, daß der Herr, der den Corriere las, sie manchmal mit einem Seitenblick beobachtete, ein älterer italienischer Geschäftsmann, er sieht gut aus, ein bißchen dick, aber straff, von jener Eitelkeit, die ihn bis ans Lebensende zu einem sicheren kalten Herrn machen wird, bei uns in Deutschland sind die älteren Geschäftsleute nur sicher und [16] kalt, aber nicht eitel, denn sie sehen nicht gut aus, hinter ihrer Sicherheit steckt nichts als Impotenz und Mikos und Neurosen, deshalb arbeiten sie so viel, aber die hier sind eitel und potent, sie arbeiten nur halb soviel wie die bei uns, aber sie machen die glänzenderen Geschäfte. Sein Blick irrtierte sie, meine Haare sehen sicher furchtbar aus, sie mußte sowieso auf die Toilette, seitdem sie auf dem Bahnsteig in Mailand gefroren hatte, sie nahm die Handtasche auf und erhob sich. Der Mann las mechanisch über eine Nachricht aus Novara weg, merkwürdig, eine Frau ohne Gepäck, das ist doch sehr merkwürdig, aber diese Ausländerinnen sind ja verrückt, vielleicht hat sie eine Wohnung in Mailand und einen Geliebten in Venedig oder umgekehrt, die Rothaarigen sollen ja schärfer sein als die anderen, immerhin sehr merkwürdig, eine Frau, die gänzlich ohne Gepäck reist, wenn ich bei der Polizei wäre, wenigstens eine kleine Tasche für das Nachthemd müßte sie bei sich haben, aber vielleicht schläft sie ohne Nachthemd, ich möchte keine Frau haben, die nackt schläft, es gibt nichts Hübscheres als ein hübsches italienisches Mädchen in einem Nachthemd. Franziska haßte es, in Zügen die Toilette zu benutzen, aber das Kabinett des Rapido war klinisch sauber; sie überwand ihren Ekel. Nachher kämmte sie sich vor dem Spiegel und zog sorgfältig ihre Lippen nach. Zurückgekehrt, sah sie zum Fenster hinaus, im Südwesten stand noch Helligkeit über dem Horizont, ein letzter Schein, der die Ebene dämmern ließ, der Regen hatte aufgehört, aber es mußte kalt sein, denn Franziska war gezwungen, mit ihren Handschuhen von Zeit zu Zeit die Scheibe abzuwischen, die sich immer neu beschlug. Vielleicht bin ich schwanger. Der Zug verlangsamte seine Fahrt, Häuser tauchten auf, Fabriken, glänzend erleuchtete, ganz neue Fabriken, Franziska hörte, ohne hinzusehen, daß der Mann, der den Corriere gelesen hatte, aufstand, seinen Mantel anzog, den Koffer aus [17] dem Gepäcknetz nahm, also Verona, der einzige Halt des Rapido zwischen Mailand und Venedig, ich könnte aussteigen, wäre morgen früh in München, morgen abend in Dortmund, mit nur achtzehntausend Lire in der Handtasche bin ich eigentlich gezwungen zu kapitulieren, was soll nur aus mir werden?, es wäre so leicht, bei Herbert zu bleiben. Ich wäre verdammt, aber nichts ließe sich leichter arrangieren, als verdammt zu sein, ein Arrangement, mit leichter Hand getroffen, anläßlich eines – wie hatte Herbert sich ausgedrückt? – anläßlich eines Betriebsunfalls, sie schauderte, der Zug hielt, sie wendete den Kopf nicht, um den Mann, der den Corriere gelesen hatte, aussteigen, andere Männer einsteigen zu sehen, sie sah weiter zum Fenster hinaus. Kurz nach der Ausfahrt Verona kam der Zug zwei, drei Minuten zum Stehen, jenseits der Gleise stand ein Haus. Es war vielleicht einmal weiß gestrichen gewesen, jetzt hing der Bewurf schmutzig und in Fetzen an ihm, im ersten Stock waren die Fenster mit grauen Holzläden verschlagen, ob die Wohnung im ersten Stock frei ist?, im Parterre waren die Läden zurückgeschlagen, aber alle Fenster waren dunkel, um das Haus war eine Fläche aus Kies und Erde, Wäschestangen, an denen ein paar Hemden und Handtücher hingen, die Landstraße führte an dem Haus vorbei, irgendeine Nebenstraße, kein Auto fuhr darauf, sie glänzte schwach im letzten Licht des wässerigen Ebenen-Himmels, auch die Gleise spannten sich wie schimmelig phosphoreszierende Fäden an dem Haus vorbei, die Ausfahrtgleise Verona an dem lichtlosen Haus, es sind sicher Leute drinnen, sie machen nur kein Licht, das Haus war ein Würfel, ein Würfel aus Trostlosigkeit und Verfall und geheimem Leben, Leben im Dunkel, mit runden Ziegeln auf dem beinahe flachen Dach, die Kamine, beschädigt, ließen Mörtel auf die runden Coppi rieseln, Flecken von Feuchtigkeit zogen sich über die Wände aus nackten Ziegeln, aus grauen [18] Lappen von Bewurf, ich habe mich immer nur für diese Art Häuser interessiert, ich wollte hinter das Geheimnis solcher Häuser kommen, ganz Italien besteht aus solchen Häusern, in denen die Leute abends im Dunkeln sitzen und Geheimnisse bewahren, arme bittere leuchtende Geheimnisse, du bist romantisch, hat Herbert immer zu mir gesagt, wenn ich ihn bat, das Auto zu stoppen, weil ich mir eines dieser Häuser ansehen wollte, irgendwo, er hatte nie einen Blick für sie, er hatte immer nur Blicke für Kirchen und Palazzi, für seine Palladios und Sansovinos und Bramantes, den ganzen kunstgeschichtlichen Tinnef. Der wieder anfahrende Zug riß das Haus aus ihrem Blick, dann wurde es endgültig Nacht draußen, und Franziska lehnte sich in ihren Sitz zurück. Sie zündete sich eine zweite Zigarette an. Unglaublich, daß ich es mir so lange habe gefallen lassen. Sie stieß den Rauch heftig aus dem Mund. Weißt du, Franziska, San Maurizio ist ein vorzügliches Beispiel für den sensualistischen Spätstil von Solari. Du tätest mir einen Gefallen, wenn du dir’s nachher mit mir zusammen ansehen würdest. Sie erinnerte sich, wie er sein Cognacglas gehoben und daran gerochen hatte. Ein Satz, eine Bewegung haben eine Entscheidung ausgelöst, auf die ich drei Jahre lang gewartet habe wie auf ein Gottesurteil. Die Zigarette langsam aufrauchend, den Kopf an die Polster des Sitzes gelehnt, den Blick auf das dunkle Fenster gerichtet, das Fenster, das mit ungeheurer Geschwindigkeit an der Nacht entlang wischte, begann Franziska zu staunen.
Fabio Crepaz, Spätnachmittag
Fabio Crepaz blätterte mißmutig in der Partitur des Orfeo, er hatte die Violine abgesetzt und stocherte mit dem Bogen in den Seiten herum. Die Klagearie des Orpheus saß nun, sie [19] wurde von zwei konzertierenden violini obligati umspielt, deren eine er, Fabio, zu führen hatte, technisch war alles in Ordnung, aber er wußte, daß Massari am Montag vormittag, auf der Probe vor der Generalprobe, abklopfen und ihn gequält und theatralisch anblicken würde: »Stile concitato«, würde er jammern, »wie oft soll ich es Ihnen noch sagen, Crepaz? Sie bringen alles so… so…«, er würde nach Worten ringen, »…so resignierend!«
»Aber wenn ich zu laut werde, Maestro, decke ich die Singstimme zu.«
»Sie sollen nicht laut werden, Sie sollen lebhaft, bewegt, leidenschaftlich werden!« Massari würde sich die Gelegenheit, ein musikgeschichtliches Kolleg abzuhalten, nicht entgehen lassen.
»Meine Herren«, würde er dozieren, sich mit großer Geste an das Orchester wendend, »bedenken Sie, daß das Concitato, der leidenschaftliche Stil, Monteverdis eigentliche Erfindung ist. Vor ihm gab es nur das Lieblich-Anmutige und das Gelassene, molle und moderato, aber den kriegerischen Ausdruck, das Kämpferische, den Zorn, hat er als erster für die Musik entdeckt.«
»Wie ist es«, würde ihm der Sänger ins Wort fallen, »machen wir weiter?«, und Massari würde abbrechen und betreten auf die Partitur blicken. »Sie haben ganz recht, Crepaz, bleiben Sie ruhig im Hintergrund«, würde der Sänger entscheiden, aber gerade die Diktatoren-Geste dieses schreienden Dummkopfs würde Fabio veranlassen, dem Wunsch Massaris nachzukommen und seinen Part ein wenig ›agitato‹ zu spielen, begleitet von einem Dankesblick des gedemütigten Maestro.
Während er mit dem Violinbogen die Seiten der Orfeo-Partitur umwendete, dachte Fabio darüber nach, ob er wirklich alles so ›resignierend‹ spiele, wie der Dirigent sich [20] ausdrückte, ob das Gefühl, das ihn beherrschte, wahrhaftig Resignation genannt werden konnte. War er resigniert, weil er beinahe fünfzig Jahre alt war, weil er nicht geheiratet hatte, weil er als Geschlagener aus einigen revolutionären Aktionen zurückgekehrt war, aus dem Spanienkrieg, aus dem Partisanenkampf, heimgekehrt nach Venedig, weil er in seinem Beruf untergetaucht war, ein Geiger im Orchester der Fenice-Oper, ein ehemaliger Bataillonskommandeur in der Internationalen Brigade ›Matteotti‹, der Führer der Partisanenbewegung im Raum Dona di Piave, und nun ein Mann, der sich nicht mehr beteiligte, irgendein Mensch, der sehr ordentlich Violine spielte, wenige Freunde hatte, die er aber nicht zu Hause traf, sondern gelegentlich, nach dem Theater, in der Bar bei Ugo, einer, der allein lebte, in zwei Zimmern, die er einer Witwe abgemietet hatte, sie war sehr leise, störte ihn nie, nur manchmal kam ihr Kind herein, ein siebenjähriges Mädchen, und hörte ihm beim Üben zu. Hier und da besuchte ihn auch seine Mutter, sie kam von Mestre herüber, alt, klein und zäh, um ihm ein paar Fische zu bringen, die sein Vater in der Lagune gefangen hatte, aber sie blieb nie länger als eine Stunde, sie räsonierte mit ihrer rauhen warmen Altweiberstimme über die Rosa, seine Schwester, die am Fließband einer Fabrik in Mestre arbeitete, und über ihn, Fabio, weil er keine Frau und keine Kinder hatte. Er gab ihr manchmal Geld mit, weil er wußte, daß sie oft schlecht aßen, besonders, wenn der alte Piero, sein Vater, wenig Fische fing. Ein solches Leben, einen solchen Hintergrund – konnte man sie mit dem Wort ›Resignation‹ bezeichnen? War er resigniert, weil er das Concitato nicht mehr für sehr wichtig hielt? Was hielt er denn für wichtig? Klares Denken hielt er für wichtig, und klares Denken führte zu dem Ergebnis, daß die revolutionären Bewegungen, an denen er sich beteiligt hatte, verloren gegangen und wahrscheinlich sogar vergeblich gewesen [21] waren. Nicht sinnlos, aber vergeblich. Es war so weit gekommen, daß die Leute, die eine revolutionäre Änderung der Verhältnisse angestrebt hatten, sich heute überhaupt nicht mehr verständlich machen konnten. Sie waren aus der Mode gekommen, im besten Falle hielt man sie für verschrobene Idealisten, die neueste Mode des Jahrhunderts hieß Zynismus, es war chic, Geld zu verdienen und zynisch zu sein, in einer solchen Zeit hielt man am besten den Mund und wartete, kein Bedarf für Massaris Pathos vom Kämpferischen, vom Zorn. Stile concitato war schlechter Stil. Übrigens, dachte Fabio, war Massaris Monteverdi-Auffassung einfach falsch. Schon möglich, daß Monteverdi seine Concitato-Erfindung für sehr wichtig hielt, aber die wenigsten Künstler konnten beurteilen, worauf ihre Wirkung beruhte, sie hatten keine Ahnung von dem, was die Leute faszinierte, wenn sie ihre Werke hörten, lasen oder sahen. Orfeo zum Beispiel war bestimmt keine kämpferische, keine zornige oder pathetische Oper, es war eine dunkle, stille, glühende und melancholische Oper. Fabio stieß beim Blättern auf jene Verkündigung im zweiten Akt, die eine Botin Orpheus überbringt. Er las den sehr einfachen Text: ›Ich komme zu dir, Orpheus, als unglückliche Botin eines furchtbaren und traurigen Schicksals: deine schöne Eurydike ist tot‹, und er hob die Violine wieder an und spielte das C-Dur-Tremolo, das die Violinen um die Botschaft woben. Wie verhielt sich Monteverdi dazu? Kein Ausbruch der Leidenschaft, im Gegenteil, er brach C-Dur ab und ließ Orgel und Kitarone mit dem Sextakkord auf Cis einsetzen, das ergab einen Eindruck von magischer Trauer. Es war genau die richtige Reaktion auf die Meldung von einer äußersten Katastrophe. Dies also war das sogenannte Ewige in der Kunst: weil ein Mann sich im Jahre 1606 zu dem Gedanken der Katastrophe richtig verhalten hatte, stimmte seine Musik auch heute noch. Monteverdi hatte die Pest in Venedig erlebt. [22] Er schrieb Musik für Zeiten, in denen die Pest herrschte, Eurydike gestorben war, Revolutionen verlorengingen und die Wasserstoffbombe geworfen werden würde.
Franziska, Nachmittag
»Gar nichts werde ich nachher mit dir ansehen«, gab sie ihm zur Antwort. Er stellte das Cognacglas hin, ohne getrunken zu haben.
»Was ist los?« fragte er.
Sie saßen im Biffi, es war zu kalt, im Freien zu sitzen, durch die riesigen Fenster sahen sie auf die Menschen, die durch die Galleria strömten, Hunderte in ein paar Minuten. Morgens hatten sie Verhandlungen mit Leuten von Montecatini gehabt, nach dem Mittagessen hatte Franziska sich hingelegt, während Herbert spazieren gegangen war, er geht niemals spazieren, er besichtigt Spätstile, Spätstile und Frühstile und Mittelstile und seinen eigenen Stil, er besichtigt sich selbst, ich habe mich einmal mit Professor Moeller über Kunstgeschichte unterhalten, Moeller war sachlich, einen Augenblick lang sah ich ein, wozu Kunstgeschichte gut ist, sie ist eine brauchbare Hilfswissenschaft, wie Moeller sagte, aber für Herbert ist sie eine Sache für sich, eine Sache für seine Eitelkeit, wie seine Anzüge und seine Verhandlungstechnik, morgens Prozente mit Montecatini und nachmittags Spätstile mit Solari, alles ist Ästhetik, Kunst, Spiel, so kann man es weit bringen, aber niemals wirklich weit wie Joachim, darum ist Herbert auch nichts weiter als ein Vertreter, Ästheten sind Vertreter, Ästheten sind Handlungsreisende, während Joachim der Chef ist, der Unternehmer, Joachim hat sich niemals mit Ästhetik abgegeben, sondern immer nur mit der Macht.
»Es ist doch etwas los, oder?«
[23] »Ich habe eben über Joachim nachgedacht«, antwortete Franziska.
»Ach so«, sagte Herbert. »Entschuldige bitte, ich möchte dich dabei nicht stören.«
»Du störst mich auch gar nicht. – Dabei«, fügte sie hinzu. Er sah sie haßerfüllt an.
»Wenn du glaubst, wieder einmal die femme fatale spielen zu müssen – bitte!«
Eines seiner Lieblingsworte, eine der Vokabeln, bei denen seine Stimme einen genießerischen Klang bekommt. Bin ich das, was man eine fatale Frau nennt? Ihr Blick wanderte zu der phantastisch überladenen Dekoration der Galleria hinauf; als er zurückkehrte, geriet er in den Blick eines Mannes, der an einem Tisch im Biffi saß, einen Espresso vor sich, scheinbar den Corriere lesend. Laufbahn einer femme fatale: Sekretärin und Dolmetscherin, geprüft in drei Sprachen, Englisch, Französisch, Italienisch, ein paar Freunde, ein paar Auslandsaufenthalte, dann die Stellung bei Joachim, seine Geliebte (mit 26), als er nach drei Jahren nicht daran dachte, mich zu heiraten, nahm ich den Antrag Herberts, des Freundes und Exportleiters von Joachim, an, eine Art Trotzreaktion bei mir, eine Art von ästhetisch-geschäftlicher Planung bei Herbert, wie ich inzwischen weiß, auch eine Art von Perversion bei uns beiden, wie sich nachher herausstellte, seit drei Jahren, jetzt bin ich 31, und wie soll es weitergehen, wie soll es weitergehen, jedenfalls nicht so, sie wußte es auf einmal ganz genau, während ihr Blick sich aus dem Blick des Fremden löste und sich auf das Glas Tee senkte, das vor ihr stand.
»Ich möchte nur wissen, warum du dir deswegen nicht ein paar hübsche Dinge ansehen kannst«, hörte sie Herbert sagen. »San Maurizio zum Beispiel wäre das Richtige für dich, in deiner Gemütsverfassung.«
[24] »Es ist so geschmackvoll, nicht wahr?« fragte sie.
»Ja.« Er hatte offenbar beschlossen, den Spott in ihrer Stimme zu überhören. »Er ist ein Triumph von Solaris gutem Geschmack.«
»Also von deinem feinen Sinn fürs Geschmackvolle.«
»Du bist absurd, Franziska«, sagte er.
»Geh doch zu Herrn Solari«, sagte sie. »Ich bleibe hier. Ich finde die Galleria viel schöner als deine Kunstgeschichte.«
»Die Galleria ist scheußlich.«
»Du warst doch so entzückt von Steinbergs Zeichnungen, erinnerst du dich noch?«
»Steinbergs Zeichnungen der Galleria sind herrlich, aber die Galleria selbst ist scheußlich.«
Sie sah ihn fassungslos an. Er trug den braunen Anzug von Meyers in der Königsallee und dazu die schmale lila Wollkrawatte, die er unlängst bei Beale & Inman in der Bond Street gekauft hatte. Er hatte die Beine übereinander geschlagen, seine Hände, sein Hals und sein Gesicht waren braun, er hatte eine dunkle Hautfärbung und dazu wasserblaue Augen hinter scharfen Gläsern, er war eigentlich schlank, leptosom, aber mit einer leichten Fettschicht überzogen, seine etwas zu weiche Hand hielt, angewinkelt, die Zigarette, eine weiße Zigarette zwischen braunen weichen Fingern. Am besten sieht er immer zu Hause aus, wenn er vor den Bücherwänden seiner Bibliothek steht, er sieht dann beinahe aus wie ein Gelehrter, beinahe wie ein exquisiter Privatdozent. Obwohl er so gut aussieht, sind die Frauen nicht toll hinter ihm her. Wir haben schon unseren Riecher.
»Du bist ein widerlicher Ästhet«, sagte sie.
»Ich finde, du wirst nun wirklich geschmacklos«, erwiderte er. Er griff nach dem Cognacglas und leerte es mit einem Zug. Er sah Franziska nicht an, sondern funkelte mit seinen Gläsern irgendwohin ins Leere.
[25] »Mein Geschmack ist gut genug«, sagte sie, »um dich widerlich zu finden.«
Der Kellner kam heran und fragte Herbert, ob er noch etwas zu trinken wünsche. Herbert blickte angeekelt zu ihm auf und schüttelte den Kopf.
»Wie oft soll ich dir noch erklären, daß du in einem Café in der Galleria nicht vor einem leeren Glas sitzenbleiben kannst«, sagte Franziska scharf. »Also bestell was!«
»Noch einen Cognac!« sagte Herbert zum Kellner.
Franziska zündete sich eine Zigarette an. Sie beobachtete zwei Carabinieri, die draußen vorbeigingen. Ihre Köpfe und Dreispitze ragten hoch über die Menge; sie sahen ernst aus. Carabinieri sehen immer ernst aus, wahrscheinlich ist es Pose, aber es gefällt mir.
»Vermutlich habe ich die Tatsache, daß du mich widerlich findest, dem Umstand zu verdanken, daß es dir gerade einfällt, an deinen Freund zu denken«, sagte Herbert.
»Red doch nicht so geschwollen daher!« sagte Franziska.
»Es fällt mir ein bißchen schwer, mich auf deinen Gesprächsstil einzustellen, wenn du nichts dagegen hast.«
»Oh, fühlst du dich beleidigt?« fragte Franziska. »Das konnte ich nicht ahnen. Du bist doch sonst durch nichts zu beleidigen.«
Sie wies einen neuen Blick des Mannes, der den Corriere las, kühl zurück. Ob er merkt, daß wir uns streiten?
»Wenn du damit darauf anspielst, daß ich so anständig bin, dir deine kleinen Freiheiten zu lassen…« Herbert beendete den Satz nicht.
»Meine kleinen Freiheiten!« sagte Franziska. Mit leiser, empörter Stimme fragte sie: »Daß ich mit deinem Chef schlafe, wann immer er es wünscht, das nennst du meine ›kleinen Freiheiten‹? Ich will dir sagen, worin meine ›kleinen Freiheiten‹ bis jetzt bestanden haben: daß ich es noch manchmal mit [26] dir getan habe. Ich habe es mit dir getan, weil ich Joachim hasse – ich habe es in den Augenblicken getan, in denen ich Joachim am meisten haßte.«
Der Kellner stellte das Cognacglas vor Herbert hin und schob die beiden Rechnungsbons unter den kleinen Teller, auf dem das Glas stand. Franziska sah zu, wie ein kleines Mädchen hinter dem Verkaufstisch des Biffi goldene und silberne Pralinen in die Glaskästen schüttete, sie leuchteten im Neonlicht, das von Tabakrauch, Chromleuchten und dem Mahagonibraun der Möbel gebrochen wurde, das Biffi war jetzt bis zum letzten Platz gefüllt, es müssen zwanzig bis dreißig Pfund Pralinen sein, wer kauft nur die vielen Pralinen? Der Mann, der die Zeitung liest, sieht nicht mehr her, Gott sei Dank, ich will keinen Zeugen für das, was jetzt kommt.
»Ich weiß«, sagte Herbert, »du hast es mir schon öfter gesagt. Was ich nicht verstehe, ist, warum du mir ausgerechnet jetzt diese Szene machst. Ich habe dich doch nur gefragt, ob du mit mir eine Kirche besichtigen willst.«
O Gott ja, er hat vollständig recht, ich habe eine scheußliche Szene gemacht, es war das letzte, was ich wollte. Was ich wollte war, ganz ruhig und still Schluß machen, aber statt dessen habe ich eine Szene gemacht, wir Weiber sind doch furchtbar, wir können es nicht lassen, aber obwohl es schiefgegangen ist, muß ich jetzt Schluß machen, Schluß, Schluß, Schluß.
»Weil ich jetzt Schluß mache«, sagte sie. »Schluß mit dir, Schluß mit uns.«
Herbert fragte: »Heißt das, daß du dich scheiden lassen willst?«
»Scheidung«, sagte Franziska. Sie dehnte das Wort ein wenig. »Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja, natürlich Scheidung. Aber zuerst einmal will ich einfach fortgehen. Fort von dir.«
»Wann?«
[27] »Jetzt. Jetzt sofort.«
»Ach! Und wohin?«
»Ich weiß nicht. Irgendwohin.«
»Also zu Joachim, nehme ich an.«
»Nein«, sagte sie, »ganz bestimmt nicht zu Joachim.«
»Franziska«, sagte er, »du bist doch eigentlich gar nicht hysterisch. Du regst dich manchmal über etwas auf, aber hysterisch bist du nicht. Also laß doch diesen Blödsinn!«
»Wieviel Geld hast du bei dir?«
»Ich? Warum?«
»Wieviel Geld hast du bei dir?«
»Zwanzigtausend, glaube ich. Franziska…«
Sie unterbrach ihn. »Gib es mir!« sagte sie. »Du hast ja noch die Reiseschecks im Hotel.«
»Ich lasse nicht zu, daß du irgendeinen Unsinn machst. Wir wollen uns doch wie Erwachsene benehmen!«
»Gib mir das Geld!«
Er funkelte mit seinen Gläsern wieder ins Leere, zog dann seine Brieftasche heraus, entnahm ihr zwei Zehntausend-Lire-Scheine und reichte sie ihr. »Es ist ja doch nur so eine Laune von dir«, sagte er. »Warum machst du ein solches Theater, statt mir zu sagen, daß du Geld brauchst.«
Zwanzigtausend, plus fünftausend, die ich in der Handtasche habe. Wenn ich sparsam bin, komme ich damit vierzehn Tage aus.
»Danke«, sagte sie.
»Was für ein Aufwand!« sagte er. »Wo hast du denn das Kleid gesehen? In der Via Monte Napoleone?«
»Herbert«, sagte sie, »ich gehe jetzt fort. Mach keinen Versuch, mich aufzuhalten. Lauf mir nicht nach, um festzustellen, wohin ich gehe.«
»Ah«, sagte er. »Ein neues Abenteuer.«
»Ja«, sagte Franziska. »Ein neues Abenteuer.«
[28] »Wann darf ich dich wieder in Dortmund erwarten?«
Sie sah ihn an und bewegte den Kopf in einer verneinenden Geste.
»Handelt es sich um einen Italiener? Du hast dir doch bisher nichts aus Italienern gemacht?«
»Kein Kommentar«, sagte sie kühl. »Oder doch«, ergänzte sie, »es handelt sich um zwei Männer: um dich und Joachim.« Sie griff nach ihren Handschuhen. »Ich möchte dich noch etwas fragen, Herbert.«
Er gab keine Antwort. Offenbar will er noch immer nicht zur Kenntnis nehmen, daß ich fortgehe. Trotzdem muß ich ihn dieses eine noch fragen: »Warum hast du vorgestern nacht nicht aufgepaßt?«
Herrgott, wenn er jetzt auch nur etwas halbwegs Richtiges sagt, bin ich dazu verdammt, bei ihm zu bleiben, dazu verurteilt, es noch einmal zu versuchen. Es ist seine letzte Chance. Vielleicht sagt er drei Worte, aus denen ich ahnen kann, daß er irgend etwas für mich empfunden hat, als er nicht aufpaßte, vorgestern nacht, daß eine noch so kleine Kleinigkeit von Gefühl für mich ihn hingerissen hat, nicht aufzupassen, vorgestern nacht…
»Ein kleiner Betriebsunfall«, hörte sie ihn sagen. »Das kann doch immer mal vorkommen.«
Gut. Er hat das abscheulichste Wort gewählt, das dafür zu finden war. Aber es kann Zynismus sein, Angst, sich zu bekennen. Ich muß weiterfragen.
»Und wenn ich jetzt ein Baby bekomme?«
»Du wirst kein Kind bekommen. Du hast doch nachher eine Spülung gemacht, oder?«
»Ja, aber es gibt keine absolute Garantie, wenn es mal passiert ist.«
»Im schlimmsten Fall haben wir Doktor Pape. Er bringt das in Ordnung.«
[29] »Und wenn ich ein Kind haben will?«
»Du vergißt, daß ich keines haben will. Solange du ein Verhältnis mit einem anderen Mann hast, wünsche ich kein Kind von dir.«
Er ist im Recht. Ich könnte noch sagen, daß wir drei Wochen unterwegs sind und daß ich kurz nach der Abreise meine Periode hatte, Joachim ist also nicht mit im Spiel, aber trotzdem ist Herbert im Recht. Er hat ganz einfach nicht aufgepaßt, mehr war nicht dahinter. Mehr nicht als ein Betriebsunfall. Sie stand auf.
»Aber du kannst mich doch nicht einfach hier sitzenlassen«, sagte Herbert. Er sah plötzlich bleich aus, grau unter dem Braun seiner Gesichtshaut. Auch er hatte sich erhoben. »Ich brauche dich doch. Wir haben morgen wieder Verhandlungen mit den Montecatini-Leuten.«
»Ruf die Berlitz-School an!« sagte Franziska. »Sie schicken dir morgen früh eine Dolmetscherin ins Hotel.«
Sie ließ ihn stehen, während er eine halbe Verbeugung machte, eine Verbeugung, um ihr abruptes Weggehen vor dem Café Biffi zu cachieren, sie spürte, daß ein paar Leute ihr nachsahen, der Kellner, una rossa genuina, meraviglioso!, dann wandte er sich wieder seinen Gästen zu, sie ging durch die Schwingtüre des Biffi, wandte sich nach rechts, schnell durch das Gewühl in der Gallería, auf dem Platz vor der Scala bekam sie sofort eine Tram nach Stazione Centrale.
Fabio Crepaz, Spätnachmittag
Während Fabio noch übte, kam das Kind der Witwe herein, blieb, die Arme auf dem Rücken gekreuzt, an der Wand stehen und hörte zu. Es blickte ernst zu ihm auf, und Fabio warf ihm einen ernsten Blick zu; er lächelte nicht. Ihre [30] Begegnungen verliefen immer ernsthaft, wie zwischen zwei Erwachsenen oder zwei Kindern; ein Kind, zu dem er sich als Erwachsener hätte verhalten müssen, wäre für Fabio bei den Violin-Exerzitien nicht zu ertragen gewesen. Übrigens kam die Kleine nicht oder nicht in erster Linie seines Geigenspiels wegen zu ihm ins Zimmer. Sie hörte ihm zwar gerne zu, besonders wenn er klare, leichtverständliche Melodien spielte, aber was sie zum erstenmal und dann immer wieder in sein Zimmer gezogen hatte, war das Bild, eine kleine Abbildung von Giorgiones Sturm, die, ohne Rahmen, auf seinem Tisch stand, gegen die Wand gelehnt. Fabio hatte die Reproduktion in einem Bildergeschäft neben der Accademia gekauft, aber er besuchte auch in gewissen Zeitabständen die Galerie selbst, um sich das Original anzusehen. Er beobachtete, wie die kleine Serafina sich auch heute wieder, an der Wand entlang, lautlos zum Tisch hinschob und das Bild betrachtete. Sie hatte ein dreieckiges braunes Gesicht unter einem Wald von dichten braunen glatten Haaren. Fabio wußte, daß Serafina am meisten von dem Akt des Stillens beeindruckt war, den die nackte Frau auf Giorgiones Bild an ihrem Säugling vollzog; Serafinas Mutter hatte ihm erzählt, daß die Kleine sie einmal gefragt hatte, warum sie nicht an ihrer Brust trinken dürfe. Aber heute fragte sie, als Fabio seinen Bogen abgesetzt hatte: »Ist der Mann da der Mann von der Frau?«
Fabio blickte auf das Bild und antwortete: »Wahrscheinlich.«
»Warum steht er dann nicht bei seiner Frau?« fragte das kleine Mädchen.
»Der Fluß ist zwischen ihnen«, sagte Fabio.
»Der Fluß ist gar kein Fluß, er ist nur ein kleiner Bach«, sagte Serafina, »der Mann könnte ganz leicht hinübergehen, zu der Frau und zu seinem kleinen Kind.«
»Siehst du nicht, daß er ein Mann ist, der zu seiner Arbeit [31] geht?« fragte Fabio. »Er ist ziemlich sicher ein Fischer, er trägt eine lange Bootsstange.«
»Er soll nicht fortgehen, wenn gerade ein Gewitter ist«, sagte das kleine Mädchen. Es deutete auf den Blitz im Gewölk des Hintergrundes.
Fabio Crepaz blickte traurig auf die braunen Haare des Kindes, das nicht verstehen wollte, warum es keinen Vater hatte. Es war gerade so alt, daß es eben gelernt hatte, den Namen seines Vaters zu lesen; es las ihn, wenn es aus dem Hause trat, auf der großen Gedenktafel für die während des Krieges von der SS verschleppten und ermordeten venezianischen Juden; sie war an dem Haus angebracht, in dem Fabio bei Serafinas Mutter Wohnung genommen hatte, gegenüber der alten Synagoge. Fabio hatte dafür gesorgt, daß der Name seines Freundes Tullio Toledano dort eingetragen wurde, obgleich Tullio sogar zurückgekehrt war, heimgekehrt aus dem schalltoten Raum als ein Sterbender; fünf Jahre lang war er an einer Tuberkulose gestorben, die er sich in Maidanek geholt hatte. Für ihn, Fabio, hatte das Bild eine ganz andere Bedeutung als für die kleine Serafina. Für ihn war es die Darstellung der ewigen Trennung zwischen Mann und Frau. Auf dem einen Ufer saß die Frau, nackt und innig in ihren kleinen Fruchtbarkeits-Ritus verzaubert, hell beleuchtet, eine klare biologische Formel, während auf dem anderen Ufer der Mann stand, dunkel, schön, lässig, genießerisch, verliebt, er hatte ein Kind gezeugt, und das Glied spannte sich schon wieder im Lederbeutel der Tracht des Jahres 1500; jung und getrieben, geistig und rätselhaft, hatte er sich noch einmal umgewendet, aber das Wasser – »er könnte ganz leicht hinübergehen« – lag unüberschreitbar dunkel und tief zwischen ihm und der Mutter mit ihrem Kind, indes der Wolkenhimmel aller Jahrhunderte von einem großen Blitz durchzuckt wurde; er illuminierte eine Stadt, einen Fluß und Bäume, wie [32] es sie im Veneto gab, im Hinterland von Mestre und Dona di Piave, Gegenden, in denen Fabio zu Hause war.
»Es gibt viele Frauen, die keine Männer haben«, sagte er zu Serafina. Wenn ich ein Kind hätte, dachte er, würde ich ihm nichts vormachen. Auch nicht, wenn ich etwas zu erklären hätte. »Weißt du«, sagte er, »die Menschen sterben zu verschiedenen Zeiten. Sie können nicht zusammenbleiben.«
Serafina hörte ihm offenbar gar nicht zu. Sie kratzte mit dem Fingernagel auf dem Kopf des Säuglings herum; ihre braunen Haare fielen ihr übers Gesicht, Fabio sah von ihr nur diese braunen Haare und ihr blaues Waschkleid.
»Ich wollte, ich hätte so einen kleinen Bruder«, sagte sie.
»Was würdest du denn mit ihm machen?«
»Ich würde mit ihm auf dem Campo spielen«, sagte Serafina.
»Da müßtest du aber gut aufpassen, daß er nicht in den Kanal fällt«, sagte Fabio. Er blickte über das Synagogendach hinweg, auf die vielstöckigen Häuser am Campo di Ghetto Nuovo. Wegen dieser Aussicht hatte er die Wohnung gemietet, einige Zeit, nachdem Tullio gestorben war, er hatte den Blick auf die hohen asymmetrischen Häuser mit ihren bleichen verwaschenen Fronten gern, das Ghetto war ein bleiches, stilles, fast totes Viertel in Venedig, der Todesengel war durch das Ghetto gegangen, durch die schwarzen Trödlergassen um Longhenas spanische Synagoge, über den weiten Campo, an dem die hohen, die ganz unvenezianischen Häuser standen, ein Dickicht von Wohnungen, das nun fast ausgeleert und stumm erschien. Fabio Crepaz lebte gern unter den zurückgebliebenen Juden von Venedig, in einem ihrer schweigsamen Häuser, in denen es männerlose Frauen und Männer ohne Frauen gab und nur wenige Kinder, Kinder, über die Giorgione ein Trauma von vaterloser Existenz, ein Netz der Sehnsucht nach Brüsten voller Milch und Fruchtbarkeit werfen [33] konnte. Der Schauplatz der schrecklichsten Niederlage des Jahrhunderts war der richtige Platz für einen Mann der verlorenen Revolution; der Sturm – auch jener Sturm, den Giorgione gedämpft und tragisch über sein Bild spielen ließ – hatte ihn an einen Strand geworfen, der von den Wenigen bewohnt wurde, die dem großen Morden entgangen waren.
Er legte das Instrument beiseite und spielte mit Serafina ein Würfelspiel, bis ihre Mutter kam und die Kleine zum Abendessen holte.
Franziska, Abend und Nacht
Der Zugschaffner kam durch den Waggon und rief: »Mestre! Mestre!« Also doch noch ein Halt vor Venedig, Mestre, das ist doch die Fabrikvorstadt von Venedig auf dem Festland, Franziska sah einen Bahnsteig voller Arbeiter, Leute, die den Tag über in Venedig gearbeitet haben und jetzt nach Hause fahren, in Mestre umsteigen, nach Padua oder Treviso oder kleineren Orten, ob ich schon hier aussteige, was tue ich eigentlich dort drüben auf der Insel, auf der Insel habe ich wahrscheinlich gar keine Möglichkeiten, auf einer Insel komme ich nicht weiter, vom Festland aus komme ich weiter, das Festland bietet viel mehr Chancen, eine Insel, das ist etwas Abgeschlossenes, in Mestre gibt es sicherlich ein oder zwei billige Hotels, aber da fuhr der Zug schon wieder an, klopfte präzis über die Weichen der Ausfahrtgleise Mestre, die silbernen Tanks der Ölraffinerie des Montecatini-Konzerns waren von Flutlicht angestrahlt, Herbert, Verhandlungen mit den Montecatini-Leuten, grüner, gelber, weißer Rauch zwischen den Türmen, Pumpen und Pipelines, giftiges Gewölk, von Nacht angestrahlt, dann schwang der Rapido auf den Damm nach Venedig ein. Nach einer Weile blieb er stehen, er [34] wartete, und Franziska sah die Stadt vor sich liegen, ein schwarzer Streifen, die Januar-Stadt, keiner der Türme angestrahlt, nur die Lichter der Hafenanlagen schimmerten, ein paar Umrisse waren kaum zu ahnen, auf der Straße liefen die Autos vorbei, da bin ich das letzte Mal gefahren, voriges Frühjahr, mit Herbert, sie war schon ein paarmal in Venedig gewesen, zuerst mit der Touropa, 1952 glaub ich, später einmal allein, von Grado aus, kurz ehe ich Herbert heiratete, im Herbst 53, dann zweimal mit Herbert, sehr chic, im Bauer-Grünwald, auf Spesen, auf von Joachim bewilligten Spesen, sie kannte Venedig ganz gut, im vorigen Frühjahr ist es scheußlich gewesen, die Touristen auf dem Markusplatz, Kopf an Kopf, man konnte das Pflaster des Markusplatzes nicht sehen vor Touristen, wir sind nach den geschäftlichen Besprechungen schnell wieder abgereist, Herbert hat sich geärgert, er wollte noch ein paar Sachen besichtigen, aber ich wollte weg, wenn ich nicht dolmetschen mußte, lag ich im Bauer-Grünwald auf dem Bett und las Kriminalromane, ich wollte keine Touristin sein, keine von der Touropa oder Herbertgeführte Touristin, ich ging Herbert auf die Nerven, und so reisten wir ab. Mag ich Venedig eigentlich? Sie zuckte unwillkürlich mit den Achseln, während sie aus dem Fenster auf die dunkle Fläche starrte, die am Tage die Lagune war.