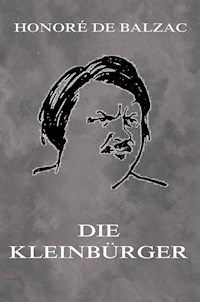
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Humorvoll und pointiert beschreibt Balzac sein Milieu, die kleinbürgerlichen Viertel in Paris. Einer der ganz großen Balzac-Klassiker und immer wieder lesenswert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 862
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Kleinbürger
Honoré de Balzac
Inhalt:
Honoré de Balzac – Biografie und Bibliografie
Die Kleinbürger
Erster Teil
Zweiter Teil
Die Kleinbürger, Honoré de Balzac
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849605889
www.jazzybee-verlag.de
Honoré de Balzac – Biografie und Bibliografie
Franz. Romandichter, geb. 20. Mai 1799 in Tours, gest. 18. Aug. 1850 in Paris, übernahm, da seine ersten Romane, die er unter verschiedenen Pseudonymen veröffentlichte (30 Bde.), durchaus nicht beachtet wurden, eine Buchdruckerei, die er aber infolge schlechter Geschäfte bald wieder aufgeben mußte, kehrte dann zur Literatur zurück und schwang sich mit dem Roman »Le dernier Chouan, ou la Bretagne en 1800« (1829, 4 Bde.), den er unter seinem eignen Namen erscheinen ließ, mit einemmal zur Berühmtheit des Tages empor. Von nun an erschienen Schlag auf Schlag eine Unmasse von Romanen, in denen er die allmählich entstandene Idee, alle Seiten des menschlichen Lebens darzustellen, zu verwirklichen suchte. Bis zu einem gewissen Grad ist ihm dies gelungen; in der »Comédie humaine«, wie er selbst die Gesamtheit seiner Schriften bezeichnete, vereinigte er: »Scènes de la vie privée« (im ganzen 27 Werke); »Scènes de la vie de province« (»Eugénie Grandet« etc.); »Scènes de la vie parisienne« (»La dernière incarnation de Vautrin«, »Le père Goriot«, »Grandeur et décadence de César Birotteau«, »La cousine Bette«); »Scènes de la vie politique«; »Scènes de la vie militaire«; »Scènes de la vie de campagne«; »Etudes philosophiques« (»La peau de chagrin«, »Louis Lambert«); »Études analytiques« (»La physiologie du mariage«). Dazu kommen noch einige Dramen, die aber keinen Beifall fanden, und einige Komödien, von denen »Mercadet, ou le faiseur« (1851) sehr gefiel. Sein letztes Werk, der Roman »Les parents pauvres«, ist auch wohl sein reifstes. Balzacs Romane zeigen eine vorzügliche Schilderung des bürgerlichen Lebens, dem er den Glanz des Reichtums und die eleganten Formen und hochtönenden Namen der Aristokratie andichtet, ohne daß darum seine Personen in Manier und Gesittung ihre Parvenunatur verleugnen. Deshalb fällt auch Balzacs Erfolg mit dem Bürgerkönigtum zusammen. Mit der Julirevolution ging sein Stern auf, in der Februarrevolution, die den vierten Stand zur Herrschaft brachte, erblich er. Eine andre, wesentliche Stütze seines Ruhmes hatte er in der Frauenwelt gefunden, deren Herz er gewann durch »La femme de trente ans« (1831). Seinen Erfolg in Frankreich übertraf bei weitem der in Europa; überall wurde B. gelesen, man kopierte das Leben seiner Helden und Heldinnen und möblierte sich á la B. In seinen »Contes drolatiques« (30 Erzählungen im Stile Rabelais'), der »Physiologie du mariage« etc. ist er dem nacktesten Realismus verfallen, und mit Recht nennen ihn die Zola und Genossen ihren Herrn und Meister. Wenige Schriftsteller haben es verstanden, so treu die Sitten der Zeit und des Landes zu schildern, so tief in die Herzen der Menschen einzudringen und das Beobachtete zu einem lebendigen, überraschend wahren Bilde zu vereinigen. Aber seine Schilderungen sind jedes idealen Elements bar, die letzten Gründe menschlicher Handlungen führt er auf die Geldsucht und den gemeinsten Egoismus zurück, besonders seine Schilderungen des weiblichen Herzens sind oft von empörendem Naturalismus. Dazu kommen häufig große Flüchtigkeit in der Anordnung des Stoffes, Geschmacklosigkeit im Ausdruck und viele Mängel im Stil. Balzacs Werke erscheinen in einzelnen Ausgaben noch jedes Jahr und sind auch mehrmals gesammelt worden, z. B. 1856–59, 45 Bde., 1869–75, 25 Bde. (der letzte enthält Balzacs Briefwechsel von 1819–50), 1899 ff. (noch im Erscheinen); eine Ergänzung bilden die »Histoire des œuvres de H. de B.« von Lovenjoul (1879, 2. Aufl. 1886) und dessen »Études balzaciennes« (1895). Vgl. Laura Surville (Balzacs Schwester), B., sa vie et ses œuvres (1858); Th. Gautier, Honoré de B. (1859); de Lamartine, B. et ses œuvres (1866); Champfleury, Documents pour servir à la biographie de B. (1876); E. Zola, Über B. (in »Nord und Süd«, April 1880); H. Favre, La Franceen éveil. B. et le temps présent (1887); Gabr. Ferry (Bellemarre d. jüng.), B. et ses amies (1888); Barrière, L'œuvre de B. (1890); Lemer, B., sa vie, son œuvre (1892); Wormeley, Life of B. (Boston 1892); Lie, Honoré de B. (Kopenh. 1893); Cerfberr und Christophe, Répertoire de la Comédie humaine de B. (1893); Flat, Essais sur B. (1893–95, 2 Bde.); Biré, Honoré de B. (1897). Balzacs Büste ist im Foyer des Théâtre-Français aufgestellt; ein Denkmal (von Fournier) ist ihm in Tours errichtet.
Die Kleinbürger
Das Drehkreuz Saint-Jean, dessen Schilderung seiner Zeit zu Beginn der Studie »Eine doppelte Familie« langweilig erschienen sein mag, dieses kleine harmlose Wahrzeichen des alten Paris, existiert nur noch in dieser Beschreibung. Die Errichtung des heutigen Rathauses hat ein ganzes Stadtviertel verschwinden lassen.
Im Jahre 1830 konnten die Passanten noch das Drehkreuz auf dem Schilde eines Weinhändlers erblicken, aber auch dieses Haus, sein letzter Zufluchtsort, ist inzwischen niedergelegt worden. Ach, das alte Paris verschwindet mit erschreckender Schnelligkeit! Bei dieser Zerstörung bleibt noch irgendwo ein Haus aus dem Mittelalter stehen, wie das am Anfang der »Ballspielenden Katze« geschilderte, und wie solche nur noch in ein oder zwei Exemplaren existieren; oder ein Haus wie das des Richters Popinot in der Rue du Fouarre, das Muster eines alten Bürgerhauses. So ist auch das Haus von Fulbert erhalten, ebenso das ganze Seinebassin aus der Zeit Karls IX. Warum sollte der Historiker der französischen Gesellschaft, ein moderner »Old mortality«, nicht die interessanten Denkmäler der Vergangenheit vor der Vergessenheit bewahren, ebenso wie es Walter Scotts Alter mit den Gräbern tat? Die Warnrufe der Publizisten, die seit zehn Jahren laut geworden sind, waren wahrhaftig nicht unbegründet: Die Baukunst wird durch die gemeinen Fassaden der Häuser verschimpfiert, die man in Paris »Rentenhäuser« nennt und die einer unserer Poeten in amüsanter Weise mit Kommoden verglichen hat.
Es mag hier darauf hingewiesen werden, daß die Einrichtung einer städtischen Kommission »del ornamento«, die in Mailand die Architektur der Straßenfassaden zu überwachen hat, und der jeder Bauherr seine Pläne vorlegen muß, aus dem XII. Jahrhundert stammt. Daher wird auch jedermann in dieser schönen Hauptstadt erkennen müssen, was der Patriotismus der Bürgerschaft und des Adels für seine Stadt geleistet hat, und die charakteristischen eigenartigen Bauten bewundern ... Die abscheuliche, zügellose Spekulation, die Jahr für Jahr die Höhe der Stockwerke vermindert, aus dem Raum, den früher ein Salon ausfüllte, eine ganze Wohnung macht und einen mörderischen Kampf gegen die Gärten führt, wird unvermeidbar ihren Einfluß auch auf die Pariser Sitten ausüben. In kurzer Zeit wird man genötigt sein, mehr draußen als drinnen zu leben. Das geheiligte Privatleben, das unbeeinträchtigte Zuhause, wo ist es noch zu finden? Es fängt erst bei fünfzigtausend Franken Rente an. Und es gibt sogar nur noch wenige Millionäre, die sich den Luxus eines eigenen Hauses gestatten, das von der Straße durch einen Vorhof getrennt und durch einen schattigen Garten vor der Neugierde des Publikums geschützt ist.
Durch das Nivellieren der Vermögen hat der Code, der die Erbschaften regelt, diese steinernen ???Phalansterien entstehen lassen, in denen dreißig Familien wohnen, und die hunderttausend Franken Rente bringen. Daher werden in fünfzig Jahren die Häuser zu zählen sein, zu denen das gehört, welches zu Beginn dieser Erzählung die Familie Thuillier bewohnte, ein wirklich interessantes Haus, das der Ehre einer eingehenden Beschreibung würdig ist, sei es auch nur, um die frühere Bourgeoisie mit der heutigen vergleichen zu können.
Die Lage und das Äußere dieses Hauses, das den Rahmen für dieses Sittenbild abgibt, hat übrigens schon an sich einen gewissen Anstrich von Kleinbürgerlichkeit, der, je nach dem Geschmack eines jeden, die Aufmerksamkeit fesseln kann oder nicht.
Zunächst muß bemerkt werden, daß das Haus Thuillier weder Herrn noch Frau, sondern Fräulein Thuillier, der älteren Schwester des Herrn Thuillier, gehörte.
Es war während der ersten sechs Monate nach der Revolution von 1830 von Fräulein Marie-Jeanne-Brigitte Thuillier, einem majorennen Mädchen, erworben worden und befand sich etwa in der Mitte der Rue Saint-Dominique-d'Enfer, wenn man von der Rue d'Enfer kommt auf der rechten Seite, so daß der Flügel, in dem Herr Thuillier wohnte, nach Süden zu gelegen war.
Der fortschreitende Drang, mit dem sich die Pariser Bevölkerung nach dem höheren Teil des rechten Seineufers hinüberzieht, während das linke Ufer leer wird, hatte lange Zeit hindurch den Verkauf der Grundstücke des sogenannten lateinischen Viertels stocken lassen; da veranlaßten Gründe, die bei der Schilderung des Charakters und Wesens des Herrn Thuillier angegeben werden sollen, seine Schwester, ein Haus zu erwerben: sie kaufte dieses für den geringen Grundpreis von sechsundvierzigtausend Franken; die Nebenkosten betrugen etwa sechstausend Franken, so daß die Gesamtausgabe sich auf zweiundfünfzigtausend Franken belief. Die Einzelbeschreibung dieser Besitzung im Stil einer Verkaufsanzeige und die durch die Bemühungen des Herrn Thuillier erzielten Resultate werden erkennen lassen, auf welche Weise im Juli 1830 so viele Vermögen sich neu zu bilden begannen, während vorhandene Vermögen zurückgingen.
Nach der Straße hin besaß das Haus eine Fassade aus Gipsputz, der sich mit der Zeit geworfen hatte, und auf der mit der Maurerkelle Einschnitte gemacht waren, wodurch Hausteine vorgetäuscht werden sollten. Diese Häuserfassaden sind so verbreitet in Paris und so häßlich, daß die Stadt Preise für Grundbesitzer aussetzen sollte, die neue Fassaden in Hausteinen herstellen. Die grau gewordene, sieben Fenster breite Vorderfront war drei Stockwerke hoch, über denen Mansarden unter einem Ziegeldache sich befanden. Das dicke, solide Seitentor zeigte in Form und Stil deutlich, daß der nach der Straße zu gelegene Flügel zur Zeit des Kaiserreichs errichtet war, um einen Teil des Hofes damals, als das Quartier d'Enfer sich noch einer gewissen Gunst erfreute, für eine sehr geräumige alte Wohnung auszunutzen.
Auf der einen Seite war der Portier untergebracht, auf der andern befand sich die Treppe des Vorderhauses. Die beiden Flügel, die an die Nachbarhäuser stießen, waren früher für Remisen, Ställe, Küchen und Gesindezimmer des Hinterhauses verwendet worden; seit dem Jahre 1830 aber hatte man sie in Lagerräume umgewandelt.
Die rechte Seite hatte ein Papierhändler en gros, in Firma M. Métiviers Neffe, gemietet; die linke ein Buchhändler namens Barbet. Die Bureaus der beiden Kaufleute befanden sich über ihren Lagerräumen, die Wohnung des Buchhändlers im ersten, die des Papierhändlers im zweiten Stock des Vorderhauses. Métivier war weit mehr Agent in der Papierbranche als Kaufmann, Barbet mehr Darlehnsgeber als Buchhändler, und beide benutzten die ausgedehnten Lagerräume, der eine um Partien von Papier, die er in Bedrängnis geratenen Fabrikanten abgekauft hatte, der andere, um Auflagen von Büchern, die ihm als Pfand für Darlehen gegeben waren, unterzubringen.
Der Haifisch des Buchhandels und der Hecht des Papiergeschäfts lebten im besten Einvernehmen miteinander, und ihre Tätigkeit, die nichts von der Geschäftigkeit des Detailhändlers hatte, ließ nur selten Wagen in diesem Hofe erscheinen, der so unbenutzt dalag, daß der Portier das Unkraut, das zwischen einzelnen Pflastersteinen wuchs, ausjäten mußte. Die Herren Barbet und Métivier, die hier bloß eine Statistenrolle zu spielen haben, machten ihren Hauswirten nur selten einmal einen Besuch, zählten aber, da sie ihre Miete pünktlich bezahlten, zu den guten Mietern; sie galten in den Augen der Familie Thuillier als sehr anständige Leute.
Der dritte Stock des Vorderhauses enthielt zwei Wohnungen: die eine hatte ein Herr Dutocq, Gerichtsvollzieher beim Friedensgericht, ein pensionierter Beamter, inne, der zu dem ständigen Kreise der Thuilliers gehörte; die andere bewohnte der Held dieser Erzählung: für jetzt mag es genügen, die Höhe seines Mietzinses anzugeben, der siebenhundert Franken betrug, und die Stellung zu kennzeichnen, die er inmitten dieses Hauses drei Jahre vor dem Augenblick eingenommen hatte, in dem sich der Vorhang vor dieser häuslichen Tragödie hebt.
Der Gerichtsvollzieher, ein Junggeselle im Alter von fünfzig Jahren, hatte die größere der beiden Wohnungen des dritten Stocks inne; er hielt sich eine Köchin und zahlte tausend Franken Miete. Zwei Jahre nach dem Erwerb des Grundstücks hatte Fräulein Thuillier ein Einkommen von siebentausendzweihundert Franken aus ihrem Hause, das der letzte Besitzer mit Jalousien ausgestattet, im Inneren restauriert und mit Spiegeln versehen hatte, ohne es verkaufen oder vermieten zu können; und die Thuilliers, die, wie man sehen wird, eine großartige Wohnung besaßen, erfreuten sich außerdem eines der schönsten Gärten dieses Viertels, dessen Bäume die kleine stille Rue Neuve-Sainte-Cathérine beschatteten.
Der Flügel, den sie bewohnten, zwischen Hof und Garten gelegen, verdankte anscheinend sein Dasein der Laune eines reich gewordenen Bürgers unter Ludwig XIV., eines Parlamentspräsidenten, oder es war die Behausung eines stillen Gelehrten gewesen. Seine schöne, von der Zeit angegriffene Hausteinfassade hatte etwas von der Großartigkeit der Zeit Ludwigs XIV.; die Rustika stellten Steinschichten dar, die roten Ziegelsteinmuster erinnerten an das Aussehen der Versailler Pferdeställe, die Rundbogenfenster hatten Masken als Schmuck der Schlußsteine der Bögen und unterhalb des Gesimses. Durch die Tür, die in ihrem oberen Teile mit kleinen viereckigen Scheiben versehen, in ihrem unteren glatt geschlossen war, sah man in den Garten; sie zeigte den soliden unaufdringlichen Stil, den man so häufig an den Pavillons der Portiers bei königlichen Schlössern sieht.
Dieser Pavillon mit fünf Fenstern hatte über dem Parterre zwei Stockwerke und zeichnete sich durch ein viereckiges Dach mit einer Wetterfahne aus, das von großen schönen Schornsteinen und Oeils-de-boeuf-Fenstern durchbrochen war. Vielleicht war dieser Bau der Rest irgendeines großen Privathauses; aber in den alten Plänen von Paris ist nichts zu finden, was diese Annahme rechtfertigte; im übrigen nennen die Akten des Fräuleins Thuillier als Besitzer unter Ludwig XIV. Petitot, den berühmten Emailmaler, der dieses Grundstück von dem Präsidenten Lecamus erworben hatte. Es ist anzunehmen, daß der Präsident diesen Pavillon bewohnte, während er sein berühmtes Haus in der Rue de Thorigny erbauen ließ.
Die Richterschaft und die Kunst hatten also beide hier gehaust. Aber mit welchem reichen Verständnis für das Nötige wie für das Angenehme war auch das Innere dieses Pavillons eingerichtet worden! In dem viereckigen Saal, der ein abgeschlossenes Vestibül bildete, befand sich rechts eine steinerne Treppe, die durch zwei Fenster nach der Gartenseite hin erhellt wurde; unter der Treppe war die Tür zum Keller. Vom Vestibül ging es in ein Speisezimmer, dessen Fenster auf den Hof hinaussahen. An das Speisezimmer schloß sich seitlich eine Küche an, die an Barbets Lagerräume grenzte. Hinter der Treppe nach dem Garten zu befand sich ein prächtiges, längliches, zweifenstriges Arbeitszimmer. Der erste und der zweite Stock enthielten zwei vollständige Wohnungen, die Dienstbotenzimmer lagen unter dem viereckigen Dache hinter den Oeils-de-boeuf-Fenstern. Ein prachtvoller Ofen schmückte das geräumige, quadratische Vestibül; die beiden einander gegenüberliegenden Glastüren gewährten das erforderliche Licht. Dieser mit einem Fußboden von schwarzem und weißem Marmor versehene Raum zeichnete sich durch eine Decke mit vorspringenden Balken aus, die, früher farbig und vergoldet, zweifellos unter dem Kaiserreich glatt weiß überstrichen worden waren. Gegenüber dem Ofen war ein Springbrunnen aus rotem Marmor mit einem Marmorbassin angebracht. Über den drei Türen des Arbeitszimmers, des Salons und des Speisezimmers enthielten die ovalen Rahmen der Sopraporten Bilder, deren Restaurierung mehr als nötig war. Das Holzwerk war plump, zeigte aber feine Ornamente. Der ganz in Holz getäfelte Salon erinnerte mit seinem Kamin aus Languedoc-Marmor, seinen Deckenverzierungen und der Form seiner mit kleinen quadratischen Scheiben versehenen Fenster an das große Jahrhundert. Das Speisezimmer, in das eine zweiflügelige Tür aus dem Salon führte, hatte Steinfußboden; es war in naturfarbenem Eichenholz getäfelt und an Stelle der alten Wandbehänge mit einer abscheulichen modernen Tapete versehen. Die Decke war aus geschnitztem Kastanienholz hergestellt, das unberührt geblieben war. Das von Thuillier modernisierte Arbeitszimmer erhöhte noch die Disharmonie.
Das Gold und Weiß der Gesimse des Salons war so verändert, daß man an Stelle des Goldes nur noch rote Linien sah, während das gelb und streifig gewordene Weiß abblätterte. Ein schönerer Kommentar zu dem lateinischen Worte Otium cum dignitate als diese Wohnung wäre für einen Poeten nicht zu finden gewesen. Die Schmiedearbeit des Treppengeländers war eines Richters und eines Künstlers würdig; um aber in dem, was heute von dieser majestätischen Antiquität übriggeblieben war, ihre Spuren wiederzufinden, dazu bedürfte es der Späheraugen eines Künstlers.
Die Thuilliers und ihre Vorgänger haben dieses Kleinod der vornehmen Bourgeosie durch die Lebensweise und die Erfindungen des Kleinbürgertums entstellt. Man braucht bloß auf die Nußbaumstühle mit Roßhaarbezug zu achten, auf den mit Wachstuch überzogenen Mahagonitisch, die Mahagonibuffets, den bei einem Gelegenheitskauf erworbenen Teppich unter dem Tische, die Lampen aus Zinkguß, die billige Tapete mit roter Borte, die gräßlichen Schabkunstbilder und die Schirtinggardinen mit rotem Rande in diesem Speisezimmer, wo Petitots Freunde tafelten! Und wie wirkten im Salon die Bilder von Herrn, Frau und Fräulein Thuillier von Pierre Grassou, dem Porträtmaler der bürgerlichen Gesellschaft; die Spieltische, die seit zwanzig Jahren im Gebrauch waren, die Konsolen im Empirestil, der von einer großen Lyra getragene Theetisch, die Möbel aus ästigem Mahagoni, mit buntem Plüsch auf schokoladenfarbenem Grund bezogen; die Kandelaber mit kanellierten Säulen auf dem Kamin mit seiner Uhr, die eine Bellona im Empirestil darstellte, die leinenen Vorhänge und die gestickten Musselingardinen, die mit gestanzten kupfernen Haltern aufgenommen waren! Auf dem Parkett lag ein billiger Teppich. In dem schönen länglichen Vestibül standen Plüschbänke; die Reliefbilder der Wände waren mit Schränken in verschiedenen Stilarten verstellt, die in den früheren Wohnungen der Thuilliers gestanden hatten. Über den Springbrunnen war ein Brett gelegt, das eine qualmende Lampe aus dem Jahre 1815 trug. Schließlich hatte die Furcht, diese scheußliche Gottheit, die Besitzer veranlaßt, nach der Garten- und nach der Hofseite hin doppelte, mit Eisenblech beschlagene Türen anzubringen, die am Tage zurückgeklappt und nachts vorgelegt wurden.
Die beklagenswerte Profanierung dieses Monuments des Privatlebens im siebzehnten Jahrhundert durch die privaten Lebensgewohnheiten des neunzehnten Jahrhunderts läßt sich unschwer erklären. Etwa zu Beginn der Konsulatszeit kam ein Maurermeister, der das kleine Haus erworben hatte, auf den Gedanken, das nach der Straße hin gelegene Terrain auszunutzen; er legte wahrscheinlich den schönen, von kleinen Pavillons, die, um einen altertümlichen Ausdruck zu gebrauchen, diesen hübschen »Wohnsitz« vervollständigten, flankierten Seiteneingang nieder, und die Betriebsamkeit eines Pariser Hausbesitzers drückte dieser Zierlichkeit ihr Brandmal auf, wie die Zeitungen und ihre Druckerpressen, die Fabriken und ihre Magazine, der Handel und seine Kontore an die Stelle der Aristokratie, der alten Bourgeosie, der Finanzleute und der Richterschaft überall, wo diese sich glanzvoll ausgebreitet hatten, getreten sind. Was für ein interessantes Studium gewähren Akten des Hausbesitzes von Paris! In der Rue des Batailles ist aus der Besitzung des Chevaliers Pierre Bayard du Terrail ein Krankenhaus geworden; der dritte Stand hat dort, wo das Haus Neckers sich befand, eine Straße entstehen lassen. Das alte Paris verschwindet, wie die Könige verschwunden sind. Für ein erhaltenes architektonisches Meisterwerk, das eine polnische Fürstin vor der Zerstörung bewahrt hat, fallen so viele andere kleine Palais, wie Petitots Wohnung, in die Hände von Thuilliers! Die Gründe, aus denen Fräulein Thuillier dieses Haus kaufte, waren folgende:
Beim Sturz des Ministeriums Villèle wurde Herr Louis-Jérôme Thuillier, der damals sechsundzwanzig Dienstjahre hinter sich hatte, Vizechef; aber kaum erfreute er sich der subalternen Ehre dieser Stellung, die einst das geringste war, worauf er gehofft hatte, als die Ereignisse des Julis 1830 ihn zwangen, seinen Abschied zu nehmen. Er rechnete sehr schlau damit, daß ihm von den Leuten, die glücklich waren, über einen freien Platz mehr verfügen zu können, eine anständige Pension glatt bewilligt werden würde, und er hatte sich nicht verrechnet, denn seine Pension wurde auf siebzehnhundert Franken festgesetzt.
Als der kluge Vizechef davon sprach, daß er sich aus dem Verwaltungsdienst zurückziehen wolle, geriet seine Schwester, die weit mehr als seine Frau seine Lebensgefährtin war, in Angst wegen seiner Zukunft.
»Was soll aus Thuillier werden? ...« Das war die Frage, die sich Frau und Fräulein Thuillier, die damals in einer kleinen Wohnung im dritten Stock in der Rue d'Argenteuil lebten, gegenseitig in großer Sorge vorlegten.
»Mit der Regelung seiner Pensionsansprüche wird er nur für einige Zeit zu tun haben,« hatte Fräulein Thuillier gesagt; »aber ich denke daran, meine Ersparnisse so anzulegen, daß eine Beschäftigung für ihn damit verbunden ist ... Die Verwaltung eines Grundstücks ist ja beinahe so etwas wie eine amtliche Tätigkeit.«
»Ach, liebe Schwägerin, Sie sind seine Lebensretterin!« rief Frau Thuillier aus.
»Ich habe schon immer an diese für Jérômes Leben kritische Zeit gedacht!« antwortete die alte Jungfer mit Protektormiene.
Fräulein Thuillier hatte ihren Bruder allzuoft sagen hören: »Der und der ist gestorben! Er hat seine Pensionierung nicht zwei Jahre überlebt!« Sie hatte allzuoft Colleville, den intimen Freund Thuilliers, einen Beamten wie er, wenn er über diese kritische Zeit der Bureaukraten scherzte, sagen hören: »Wir kommen alle dahin!« ..., um nicht die Gefahr, die ihr Bruder lief, zu würdigen. Der Übergang von der Tätigkeit zum Ruhestand ist in der Tat die kritische Zeit für den Beamten. Wer von ihnen nicht die Fähigkeit oder die Möglichkeit hat, an Stelle seiner bisherigen Tätigkeit eine andere Beschäftigung aufzunehmen, der verändert sich ganz auffallend: einige sterben, viele werden Angler, eine Zerstreuung, deren Leere ihrer früheren Bureauarbeit entspricht; wieder andere, spekulative Köpfe, kaufen Aktien, verlieren daran ihre Ersparnisse und sind glücklich, wenn sie dann eine Anstellung bei einem Unternehmen erhalten, das nach dem ersten Niederbruch und der ersten Liquidation in geschickten Händen, die das abgewartet hatten, Aussicht auf Ertrag gewährt; dann reibt sich der Beamte die Hände, die inzwischen leer geworden sind, und sagt zu sich: »Ich habe es richtig geahnt, daß aus dieser Sache mal etwas werden wird ...« Aber fast alle sträuben sich dagegen, ihre frühere Lebensweise beizubehalten.
»Es gibt welche,« pflegte Colleville zu sagen, »die von dem besonderen Beamtenspleen (er sagte: Splehn) aufgezehrt werden; sie gehen an den immer wiederkehrenden Erinnerungen an die Rundverfügungen zugrunde; sie leiden nicht am Bandwurm, sondern am Papierwurm. Der kleine Poiret konnte kein weißes, blau liniiertes Papier sehen, ohne daß dieses geliebte Bild ihn die Farbe wechseln ließ; seine grünliche Gesichtsfarbe wurde dann gelb.«
Fräulein Thuillier galt als der starke Geist des brüderlichen Haushalts; es fehlte ihr nicht an Kraft und Entschlußfähigkeit, wie ihre eigene Lebensgeschichte erweisen wird. Diese Überlegenheit über ihre Umgebung gestattete ihr, ihren Bruder richtig zu beurteilen, so leidenschaftlich sie ihn auch liebte. Nachdem die auf ihr Ideal gesetzten Hoffnungen zunichte geworden waren, wurde ihr mütterliches Empfinden sich über die soziale Bedeutung des Vizechefs klar.
Thuillier und seine Schwester waren die Kinder des ersten Portiers im Finanzministerium. Jérôme war, dank seiner Kurzsichtigkeit, allen militärischen Requisitionen und Konskriptionen entgangen. Der Vater hatte den Ehrgeiz, aus seinem Sohne einen Beamten werden zu lassen. Zu Beginn dieses Jahrhunderts gab es zu viele Stellen bei der Armee, als daß nicht viele in den Bureaus unbesetzt gewesen wären, und der Mangel an Unterbeamten machte es dem dicken Vater Thuillier möglich, seinen Sohn die ersten Stufen der Beamtenhierarchie überspringen zu lassen.
Der Portier starb im Jahre 1814, als Jérôme kurz vor der Ernennung zum Vizechef stand, und hinterließ ihm als einziges Vermögen nur diese Hoffnung. Der dicke Thuillier und seine Frau, die im Jahre 1806 gestorben war, waren mit der Pension als ihrem einzigen Besitz in den Ruhestand getreten, denn sie hatten ihre Ersparnisse aufgebraucht, um Jérôme eine zeitgemäße Erziehung zu geben und ihn und seine Schwester zu unterhalten.
Es ist bekannt, welchen Einfluß die Restauration auf die Bureaukratie ausübte. Aus einundvierzig verlorengegangenen Departements kehrte eine Menge tüchtiger Beamter zurück und verlangte eine Anstellung, die niedriger war als die von ihnen innegehabte. Zu jenen Rechtsansprüchen kamen noch die Ansprüche der proskribierten Familien hinzu, die durch die Revolution ruiniert worden waren. Von diesen beiden Strömen bedrängt, war Jérôme noch sehr glücklich, daß er nicht unter irgendeinem bei den Haaren herbeigezogenen Vorwande verabschiedet wurde. Er zitterte davor bis zu dem Tage, wo er durch einen Glücksfall Vizechef geworden und nun sicher war, daß er sich in Ehren zurückziehen konnte. Dieser kurze Bericht zeigt, daß Thuillier wenig Bedeutung und Beziehungen besaß. Er hatte Latein, Mathematik, Geschichte und Geographie gelernt, wie man das in der Schule lernt; aber er war nicht über die sogenannte zweite Klasse hinausgekommen, da sein Vater von einer günstigen Gelegenheit, in das Ministerium hineinzukommen, Gebrauch machen wollte, wobei er rühmte, daß sein Sohn »eine vortreffliche Hand« schriebe. Da der kleine Thuillier also die ersten Eintragungen in das Hauptbuch zu machen hatte, konnte er den Kursus der Rhetorik und Philosophie nicht besuchen.
Einmal in das ministerielle Triebwerk eingespannt, befaßte er sich wenig mit Literatur und noch weniger mit Kunst; aber er erwarb sich Routine in seinem Amte; und als es ihm unter dem Kaiserreich möglich wurde, in die Sphäre der höheren Beamten zu gelangen, eignete er sich äußerliche Formen an, die den Portiersohn verbargen, aber auf seinen Geist hatte das nicht den geringsten Einfluß. Seine Unwissenheit riet ihm, sich schweigend zu verhalten, und dieses Schweigen war ihm nützlich. Unter der kaiserlichen Verwaltung gewöhnte er sich an den passiven Gehorsam, der den Vorgesetzten gefällt, und dieser Eigenschaft verdankte er es, daß er dann zum Vizechef aufrückte. Mit seiner Routine erwarb er sich eine große Geschäftserfahrung, und seine Manieren wie sein Schweigen verbargen seinen Mangel an Kenntnissen. Seine Unbedeutendheit empfahl ihn, wenn man einen Unbedeutenden brauchte. Man scheute sich, die beiden Parteien in der Kammer vor den Kopf zu stoßen, und das Ministerium half sich dadurch aus der Verlegenheit, daß es das Prinzip der Anciennität durchführte. So wurde Thuillier Vizechef. Da Fräulein Thuillier wußte, daß ihr Bruder einen Widerwillen gegen Bücher hatte und das Bureaugetriebe durch keine andere Tätigkeit ersetzen konnte, so hatte sie klugerweise beschlossen, ihm die Sorge für das Grundstück aufzuhalsen, die Pflege des Gartens, die unendlich vielen kleinen Mühen des Privatlebens und die Intrigen mit der Nachbarschaft.
Die Übersiedelung der Familie Thuillier aus der Rue d'Argenteuil in die Rue Saint-Dominique-d'Enfer, die durch den Grundstückskauf sich ergebenden Erfordernisse, die Suche nach einem geeigneten Portier, das Heranschaffen von Mietern beschäftigten Thuillier von 1831 bis 1832. Als die Übersiedelung beendet war und seine Schwester sich überzeugt hatte, daß Jérôme diese Sache gut überstanden hatte, fand sie andere Mühewaltungen für ihn, von denen später die Rede sein soll, die aber auf Thuilliers Charakter basiert waren, den jetzt zu schildern am Platze sein dürfte.
Obwohl der Sohn eines Portiers im Ministerium, war Thuillier das, was man einen schönen Mann nennt; über mittelgroß, schlank, besaß er ein Gesicht, das mit der Brille nicht unangenehm, aber, wie bei vielen Kurzsichtigen, schrecklich war, wenn er seine Augengläser abnahm; denn die Gewohnheit, durch die Brille zu sehen, hatte über seine Pupillen eine Art von Schleier gebreitet.
Zwischen achtzehn und dreißig Jahren hatte der junge Thuillier Erfolg bei Frauen gehabt, allerdings immer nur in der Sphäre, die bei den Kleinbürgern beginnt und bei den Abteilungsvorstehern endet; es ist bekannt, daß unter dem Kaiserreich der Krieg die Pariser Gesellschaft ein wenig dezimiert hatte, indem er die kraftvollen Männer auf das Schlachtfeld führte, und diesem Umstande ist vielleicht, wie ein großer Arzt gesagt hat, die Verweichlichung der Generation um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts zuzuschreiben.
Da Thuillier genötigt war, sich durch andere als geistige Vorzüge bemerkbar zu machen, so lernte er so gut Walzer tanzen, daß man ihn als Muster nannte; er hieß »der schöne Thuillier«, er spielte vollendet Billard, konnte Schattenrisse ausschneiden, und sein Freund Colleville verstand es, ihn so gut einzuüben, daß er modische Romanzen zu singen vermochte. Mit diesen kleinen Gesellschaftskünsten hatte er den äußerlichen Erfolg, der die Jugend zu täuschen und sie über ihre Zukunft zu verblenden pflegt. Von 1806 bis 1814 glaubte Fräulein Thuillier an ihren Bruder, wie die Prinzessin Orléans an Louis-Philippe; sie war stolz auf Jérôme, sie sah ihn schon als Generaldirektor, dank seinen Erfolgen, die ihm damals den Zutritt zu einigen Salons eröffneten, in denen er sicherlich ohne die Verhältnisse, die unter dem Kaiserreich aus der Gesellschaft ein buntes Allerlei gemacht hatten, niemals zugelassen worden wäre.
Aber die Triumphe des schönen Thuillier waren im allgemeinen von kurzer Dauer; die Frauen legten ebensowenig Wert darauf, ihn zu halten, wie er darauf, ewig an sie gefesselt zu sein; er hätte das Sujet für eine Komödie mit dem Titel »Der Don Juan wider Willen« abgeben können. Das Handwerk eines »Beau« ermüdete Thuillier dermaßen, daß er alt wurde; sein mit Runzeln bedecktes Gesicht, wie das einer alten Kokette, ließ ihn zwölf Jahre älter erscheinen, als er war. Von seinen Erfolgen hatte er nur die Gewohnheit beibehalten, sich im Spiegel zu betrachten, sich an die Taille zu fassen, um sie hervortreten zu lassen, und die Pose eines Tänzers anzunehmen, so daß über die Zeit hinaus, wo ihm seine Vorzüge Annehmlichkeiten verschaffen konnten, der Kontrakt, den er mit seinem Beinamen »der schöne Thuillier« geschlossen hatte, verlängert wurde!
Was im Jahre 1806 der Wahrheit entsprach, wurde im Jahre 1826 zur Lächerlichkeit. Er behielt noch einige Reste der Tracht eines Beau aus der Kaiserzeit bei, was übrigens seiner Würde eines früheren Vizechefs keinen Abbruch tat. Er trug weiterhin die weiße Krawatte mit zahlreichen Falten, in die das Kinn vergraben war, und deren beide Enden rechts und links die Passanten bedrohten, während sie von einem ziemlich zierlichen Knoten zusammengehalten wurde, der einstmals von schöner Hand geknüpft worden war. Er richtete sich ein wenig nach der Mode, trug den Hut sehr nach hinten geschoben und zog im Sommer Schuhe und feine Strümpfe an; seine langen Überröcke erinnerten an die Leviten des Kaiserreichs; er behielt auch das steife Jabot und die weiße Weste bei, spielte immer noch mit seinem Spazierstöckchen aus dem Jahre 1810 und hielt sich gebeugt. Wenn Thuillier über die Boulevards spazierte, so hätte niemand in ihm den Sohn eines Mannes vermutet, der für die Beamten des Finanzministeriums das Frühstück zubereitete und die Livree Ludwigs XVI. trug: er sah aus wie ein kaiserlicher Diplomat oder wie ein Unterpräfekt. Und Fräulein Thuillier begünstigte nicht nur ganz harmlos diese Schwäche ihres Bruders dadurch, daß sie ihn noch zu besonderer Sorgfalt für seine Person antrieb, was bei ihr nur eine Fortsetzung ihrer Anbetung war, sondern sie gewährte ihm auch alle häuslichen Freuden, indem sie in ihr Haus als Nachbarn eine Familie aufnahm, deren Existenz ein Seitenstück zu der ihrigen bildete.
Es handelt sich um Herrn Colleville, den intimen Freund Thuilliers; bevor aber Pylades geschildert werden kann, ist es um so unerläßlicher, mit Orestes zu Ende zu kommen, als erklärt werden muß, weshalb Thuillier, der schöne Thuillier, ohne Familie war, denn von einer Familie kann man nur sprechen, wo Kinder vorhanden sind; und hier muß nun eins von den tiefen Geheimnissen ans Licht gezogen werden, die im Privatleben vergraben liegen, und von denen nur Teile sichtbar werden, wenn bei einer sonst geheimgehaltenen Situation die Bedrängnisse allzu stark geworden sind: es handelt sich um das Privatleben von Frau und Fräulein Thuillier, denn bis jetzt haben wir nur das sozusagen öffentliche Leben Jérôme Thuilliers betrachtet.
Marie-Jeanne-Brigitte Thuillier, die vier Jahre älter war als ihr Bruder, wurde diesem vollständig aufgeopfert; es war leichter, dem einen eine Stellung zu verschaffen, als der andern eine Mitgift zu geben. Für gewisse Charaktere ist das Unglück ein Leuchtturm, der über die dunklen Tiefen des sozialen Lebens Licht verbreitet. Ihrem Bruder an Energie und Intelligenz überlegen, besaß Brigitte jenen Charakter, der sich unter den Hammerschlägen der Verfolgung zusammenpreßt, hart wird, und eine große Widerstandsfähigkeit, um nicht zu sagen Unbeugsamkeit, erlangt. Auf ihre Unabhängigkeit eifersüchtig bedacht, wollte sie nicht in der Portierloge ihr Leben fortführen, sondern sich selbst ihr Geschick gestalten.
Vierzehn Jahre alt mietete sie sich ein Mansardenzimmer, wenige Schritte vom Finanzamt entfernt, das damals in der Rue Vivienne war, nicht weit von der Rue de la Vrillière, wo sich noch heute die Bank von Frankreich befindet. Mutig begann sie eine wenig bekannte Tätigkeit, die, dank den Protektoren ihres Vaters, ein Privileg genoß und die darin bestand, daß sie Säcke für die Bank, für die Schatzkammer und auch für große Finanzhäuser nähte. Im dritten Jahre beschäftigte sie schon zwei Arbeiterinnen. Ihre Ersparnisse ließ sie ins Staatsschuldbuch eintragen und besaß im Jahre 1814 bereits dreitausendsechshundert Franken, die sie im Verlaufe von fünfzehn Jahren beiseite gelegt hatte. Sie hatte wenig Ausgaben, aß fast alle Tage bei ihrem Vater, solange er lebte, und es ist ja bekannt, daß die Rente während der letzten Erschütterungen des Kaiserreichs nur einige Vierzig stand; so erklärt sich dieses anscheinend so außerordentliche Ergebnis von selbst.
Nach dem Tode des alten Portiers zogen Brigitte und Jérôme, die eine siebenundzwanzig, der andere dreiundzwanzig Jahre alt, zusammen. Der Bruder und die Schwester besaßen eine ganz ungewöhnliche Zuneigung zueinander. Wenn Jérôme, der damals auf der Höhe seiner Erfolge stand, in Geldverlegenheit war, so hatte seine Schwester, die grobe Wolle trug und von dem starken Faden, mit dem sie nähte, zerarbeitete Finger hatte, immer einige Louisdor für ihren Bruder übrig. In Brigittes Augen war Jérôme der schönste und reizendste Mann des französischen Kaiserreichs. Diesem geliebten Bruder die Wirtschaft zu führen, in seine Lindor- und Don Juan-Geheimnisse eingeweiht zu werden, seine Dienerin, sein Pudel zu sein, das war der Traum Brigittes; sie war beinahe verliebt in den Gedanken, sich für ihr Idol aufopfern zu können, dessen Egoismus durch ihre Opfer noch vergrößert wurde. Sie verkaufte ihre Kundschaft für fünfzehntausend Franken an ihre erste Arbeiterin und bezog mit Thuillier eine Wohnung in der Rue d'Argenteuil, wo sie sich zur Mutter, Beschützerin und Dienerin dieses »verhätschelten Lieblings der Damen« machte. Mit der bei einem Mädchen, das alles seiner Umsicht und seiner Arbeit verdankte, selbstverständlichen Klugheit, verheimlichte sie ihrem Bruder ihr Vermögen; sie mußte fürchten, daß ein Mann, der sich für wohlhabend halten dürfte, es bald vergeudet haben würde, und trug nur sechshundert Franken zu den Wirtschaftsausgaben bei, was mit Jérômes achtzehnhundert Franken zusammen für den Jahresverbrauch hinreichte.
Vom ersten Tage ihres Zusammenlebens an hörte Thuillier auf seine Schwester wie auf ein Orakel, fragte sie bei den geringsten Anlässen um Rat, hatte kein Geheimnis vor ihr und ließ sie so das Bewußtsein ihrer Machtvollkommenheit, ihrer einzigen kleinen Charakterschwäche, auskosten. Die Schwester hatte ja auch dem Bruder alles geopfert und alle seine Wünsche zu den ihrigen gemacht; sie lebte ja nur für ihn. Der Einfluß Brigittes auf Jérôme verstärkte sich noch ganz erheblich durch seine Heirat, die sie gegen das Jahr 1814 zustande brachte.
Als sie sah, welchen heftigen Druck die neuen Männer der Restauration auf die Ämter ausübten, und besonders wie die frühere Gesellschaft die Bürgerlichen zurückdrängte, begriff Brigitte, und zwar um so deutlicher, als ihr Bruder sie darüber aufklärte, daß dieser soziale Umschwung ihre gemeinsamen Hoffnungen vernichtete. Für den schönen Thuillier war von dem Adel, der jetzt die bürgerlichen Kreise der Kaiserzeit von ihrem Platze verdrängte, nichts mehr zu erwarten!
Thuillier war nicht imstande, sich eine politische Meinung zu bilden, aber er empfand, ebensosehr wie seine Schwester, daß er das, was ihm noch von Jugend verblieben war, benutzen müsse, um einen entscheidenden Schritt zu tun. In einer solchen Situation mußte ein auf ihre Stellung so eifersüchtiges Mädchen wie Brigitte daran denken, ebensowohl ihretwegen wie seinetwegen, ihren Bruder zu verheiraten; ihn glücklich machen konnte allein sie, und eine Frau Thuillier war nur ein zwar notwendiges, aber nebensächliches Beiwerk, damit er ein oder zwei Kinder haben könnte. Wenn auch Brigitte den ihrer Willenskraft entsprechenden Geist nicht besaß, so hatte sie doch instinktiv das Bewußtsein ihrer Herrschfähigkeit; sie hatte keinerlei Unterricht genossen, aber sie ging geradeswegs auf ihr Ziel los mit der Hartnäckigkeit einer Natur, die gewohnt ist, sich durchzusetzen. Sie verstand vortrefflich zu wirtschaften, hatte den Sinn für Sparsamkeit, das Verständnis für die Erfordernisse des täglichen Lebens und die Liebe zur Arbeit. Es war ihr daher klar, daß sie Jérôme niemals in einer höheren Sphäre als der ihrigen, wo die Familien sich über ihre häuslichen Verhältnisse informieren und sich an einer schon vorhandenen Leiterin des Haushaltes stoßen könnten, zu verheiraten vermöge; deshalb suchte sie in niedrigeren Gesellschaftsschichten nach Leuten, die sie blenden konnte, und sie fand auch in der Nähe eine passende Partie.
Der älteste Bankdiener, ein gewisser Lemprun, hatte eine einzige Tochter Celeste. Fräulein Celeste Lemprun war die dereinstige Erbin ihrer Mutter, der einzigen Tochter eines Landwirts. Das Vermögen bestand aus einigen Morgen Land in der Umgegend von Paris, die der alte Mann immer noch selbst bebaute; dann aus dem Vermögen des guten Lemprun, der zuerst bei der Firma Thélusson und der Firma Keller in Stellung gewesen, und dann zur Staatsbank bei ihrer Gründung übergetreten war. Lemprun, der damals Dienstleiter war, genoß Achtung und Ansehen bei der Direktion und bei den Kommissaren.
Daher setzte auch der Aufsichtsrat der Bank, als er von der Heirat Celestes mit einem achtbaren Beamten des Finanzministeriums hörte, ihr eine Gratifikation von sechstausend Franken aus. Diese Gratifikation, die zwölftausend Franken, die der Vater Lemprun seiner Tochter mitgab, und die zwölftausend Franken die Galard, der Gemüsezüchter aus Auteuil, spendete, machten zusammen eine Mitgift von dreißigtausend Franken aus. Der alte Galard und Herr und Frau Lemprun waren entzückt von dieser Verbindung; dem Dienstleiter war Fräulein Thuillier als eins der anständigsten und ehrenhaftesten Mädchen von Paris bekannt. Brigitte verstand es im übrigen, ihre Eintragungen ins Staatsschuldbuch ins rechte Licht zu setzen, und gab Lemprun vertraulich die Versicherung, daß sie sich nie verheiraten würde, und weder der Dienstleiter noch seine Frau, Leute aus dem goldenen Zeitalter, hätten gewagt, an Brigittes Wort zu zweifeln. Ihnen imponierte besonders die glänzende Stellung Thuilliers, und die Hochzeit fand, wie die geheiligte Formel lautet, zu allseitiger Zufriedenheit statt.
Der Gouverneur und der Sekretär der Bank waren Trauzeugen der Braut, ebenso wie Herr von Billardière, der Abteilungsvorsteher, und Herr Rabourdin, der Bureauchef, die des Bräutigams waren. Sechs Tage nach der Hochzeit wurde der alte Lemprun das Opfer eines frechen Diebstahls, von dem damals in den Zeitungen die Rede war, der aber über den Ereignissen von 1814 in Vergessenheit geriet. Die Diebe hatten sich allen Nachforschungen entzogen und Lemprun wollte den Verlust bezahlen; aber obgleich die Bank ihn auf ihr Gewinn- und Verlustkonto übernehmen wollte, starb der arme Alte an dem Kummer, den ihm dieser Schimpf verursachte. Er sah diesen Handstreich als ein Attentat auf seine siebzigjährige Ehrlichkeit an.
Frau Lemprun überließ ihr Erbteil Frau Thuillier, ihrer Tochter, und zog zu ihrem Vater nach Auteuil; dieser starb infolge eines Unfalls im Jahre 1817. Da sie davor zurückschrak, die Gemüsezucht und die Feldwirtschaft ihres Vaters selbst zu leiten oder zu verpachten, so bat Frau Lemprun Brigitte, deren Fähigkeit und Ehrlichkeit sie bewunderte, den Besitz des guten Galard zu liquidieren und die Angelegenheit so zu arrangieren, daß ihre Tochter alles bekäme und ihr nur eine Rente von fünfzehnhundert Franken zugesichert und das Haus in Auteuil überlassen würde. Das Gelände des alten Landwirts erbrachte, in Parzellen verkauft, dreißigtausend Franken. Lemprun hatte ebensoviel hinterlassen und so betrug das Vermögen von beiden Seiten zusammen mit der Mitgift im Jahre 1818 neunzigtausend Franken.
Die Mitgift war in Aktien der Bank angelegt worden, als diese neunhundert standen. Brigitte kaufte für sechzigtausend Franken fünftausend Franken Rente, als die fünfprozentige sechzig stand und ließ auf den Namen der Witwe Lemprun als Nutznießerin fünfzehnhundert Franken eintragen. So gewährten zu Beginn des Jahres 1818 die Pension von sechshundert Franken, die Brigitte bezahlte, die dreitausendfünfhundert Franken, die Thuillier Gehalt hatte, die dreitausendfünfhundert Franken Rente Celestes und die Dividende der vierunddreißig Aktien der Bank der Familie Thuillier ein Einkommen von elftausend Franken, über die, ohne die andern zu fragen, Brigitte verfügte. Es war nötig, sich zunächst mit dieser Geldfrage zu befassen, nicht nur um etwaigen Einwürfen zu begegnen, sondern auch um den tragischen Verlauf klarzulegen.
Anfangs gab Brigitte ihrem Bruder monatlich fünfhundert Franken und lenkte das Schiff so, daß der Haushalt mit fünftausend Franken bestritten wurde; ihrer Schwägerin bewilligte sie monatlich fünfzig Franken, wobei sie hervorhob, daß sie sich für ihren Teil mit vierzig begnügte. Um ihre Oberherrschaft noch durch die Macht des Geldes zu festigen, verschaffte sich Brigitte noch einen Zuschuß zu ihren Renten; sie machte, wie man sich in den Bureaus erzählte, Darlehngeschäfte durch Vermittlung ihres Bruders, der als ein Geschäftstalent galt. Wenn Brigitte von 1813 bis 1830 ein Kapital von sechzigtausend Franken zusammenbrachte, so ließ sich ein solcher Betrag aber auch durch geschäftliche Operationen mit der Staatsrente, die in ihrem Kurse um vierzig Prozent schwankte, erklären, ohne daß man auf diese mehr oder weniger begründeten Anschuldigungen zu hören brauchte, die, auch wenn sie wahr wären, für diese Geschichte kein Interesse böten.
Vom ersten Tage ab unterwarf sich Brigitte die unglückliche Frau Thuillier mit Spornstößen und Anziehen der Zügel, die sie sie hart fühlen ließ. Aber dieses Übermaß von Tyrannei war unnötig; das Opfer unterwarf sich sofort. Celeste war, wie Brigitte sie richtig beurteilte, ohne Geist, ohne Kenntnisse, gewöhnt, zu Hause in aller Ruhe zu leben, und besaß einen Charakter von außergewöhnlicher Sanftmut; sie war fromm im umfassendsten Sinne dieses Wortes; sie hätte für ein Unrecht, daß sie unwissentlich ihrem Nächsten angetan hätte, die härteste Buße auf sich genommen. Vom Leben hatte sie keine Ahnung; gewöhnt, von ihrer Mutter bedient zu werden, die selber die Wirtschaft besorgte, und genötigt, sich wegen ihrer lymphatischen Konstitution, die sie bei der geringsten Arbeit ermüden ließ, nur wenig zu bewegen, war sie so recht ein Pariser Volkskind, eins von jenen selten hübschen Produkten des Elends, der übermäßigen Arbeit, der stickigen Wohnungen, ohne Bewegung in freier Luft und aller Bequemlichkeiten des Lebens beraubt.
Nach ihrer Heirat war Celeste eine kleine, widerwärtig fade Blondine, dick, träge und sehr dumm. Ihre zu große und übermäßig vorspringende Stirn ähnelte der eines Wasserkopfes, das unverhältnismäßig kleine Gesicht unter dieser wachsfarbenen Kuppel lief spitz wie ein Mäuseschnäuzchen aus und ließ bei manchen Besuchern die Ansicht aufkommen, daß sie früher oder später irrsinnig werden würde. Ihre blaßblauen Augen und ihr fast starres Lächeln auf den Lippen widersprach dem nicht. An ihrem Hochzeitstage machte sie in ihrer Haltung, ihrem Aussehen und ihrem Benehmen den Eindruck einer zum Tode Verurteilten, die nur den Wunsch hat, daß alles möglichst bald zu Ende sein möchte.
»Sie hat etwas von einem Kloß! ...« sagte Colleville zu Thuillier.
Brigitte drang in dieses Wesen, zu dem sie den schärfsten Kontrast darstellte, wie ein Dolch ein. Sie selbst war von regelmäßiger, fehlerfreier Schönheit, die nur von den Anstrengungen schwerer, mühevoller Arbeit von klein auf und von den Entbehrungen, die sie sich im stillen auferlegte, um Ersparnisse machen zu können, zerstört worden war. Ihr frühzeitig fleckig gewordener Teint schimmerte wie Stahl. Ihre braunen Augen waren von dunklen Ringen umzogen, oder vielmehr zerdrückt; auf der Oberlippe lag wie ein Hauch ein brauner Flaum; die Lippen waren schmal und über ihrer Herrscherstirn thronten früher schwarze, jetzt wie Chinchilla schimmernde Haarflechten. Sie hielt sich gerade, wie eine schöne Blondine, und alles an ihr zeugte von harter Arbeit und gedämpftem Feuer; sie hatte, wie die Gerichtsvollzieher sagen, »die Kosten des Verfahrens« zu tragen.
Für Brigitte war Celeste nur ein Vermögen, das man sich angeeignet hatte, eine, die als Mutter zu dienen, ein Subjekt mehr, dem sie zu befehlen hatte. Sie warf ihr sehr bald ihre »Schlappheit«, wie sie sich ausdrückte, vor, und das eifersüchtige Mädchen, das eine tätige Schwägerin zur Verzweiflung gebracht hätte, fand ein grausames Vergnügen darin, dieses schwache Wesen aus seiner Untätigkeit aufzurütteln. Celeste, die sich schämte, daß ihre Schwägerin alle Stubenarbeit und die Küche so eifrig besorgte, versuchte, ihr zu helfen; aber davon wurde sie krank; sofort war Brigitte eifrig um Frau Thuillier besorgt, pflegte sie wie eine liebe Schwester und sagte vor Thuillier zu ihr: »Du hast keine Kräfte, also darfst du nichts anfassen, Kleine! ...« Mit diesem zur Schau getragenen Troste, der Celestes Unfähigkeit noch betonte, zeigte sie, wie die Kraft ihr zärtliches Mitleid mit der Schwäche dazu benutzt, um sich selber zu rühmen.
Und weil despotische Naturen, die ihre Kräfte gern zeigen, voll zarten Empfindens gegen körperlich Leidende sind, so pflegte sie ihre Schwägerin so gut, daß Celestes Mutter, wenn sie ihre Tochter besuchte, zufrieden war. Als Frau Thuillier aber wiederhergestellt war, nannte sie sie wieder, und zwar so, daß sie es hören mußte, »krankes Gewächs, zu nichts zu gebrauchen usw.« Dann ging Celeste weinend in ihr Zimmer, und wenn Thuillier sie in Tränen überraschte, entschuldigte er seine Schwester, indem er sagte:
»Sie ist ein vortrefflicher Mensch, aber sie ist zu lebhaft; sie liebt dich auf ihre Art; mit mir macht sie es ebenso.«
Celeste, die daran dachte, wie mütterlich ihre Schwägerin für sie gesorgt hatte, verzieh ihr. Ihren Bruder behandelte Brigitte übrigens als Herrn des Hauses: sie rühmte ihn vor Celeste und machte aus ihm einen Autokraten, einen Ladislaus, einen unfehlbaren Papst. Frau Thuillier, die keinen Vater und Großvater mehr hatte, und ihre Mutter, die nur an den Donnerstagen zu ihr kam, und welche sie im Sommer Sonntags besuchte, nur wenig sah, besaß als Gegenstand ihrer Liebe nur ihren Mann, erstens weil er ihr Mann war und dann, weil er für sie der schöne Thuillier blieb. Er behandelte sie auch manchmal wie seine Frau, und alle diese Gründe machten ihn für sie anbetungswürdig. Er erschien ihr um so vollkommener, als er sie oft verteidigte und mit seiner Schwester schalt, obwohl das nicht aus Interesse für seine Frau geschah, sondern aus Egoismus und um in der kurzen Zeit, die er zu Hause verbrachte, Ruhe zu haben.
Der schöne Thuillier erschien zu Hause nur zum Essen und spät abends zum Schlafen; er besuchte Bälle in seinem Gesellschaftskreise, und zwar immer allein, ganz so, als ob er noch Junggeselle wäre. So waren die beiden Frauen immer mit sich allein. Unmerklich gewöhnte sich Celeste an ihre passive Rolle und wurde das, was Brigitte wollte: ihre Sklavin. Die Königin Elisabeth dieses Haushalts ging nun von ihrem herrschsüchtigen Benehmen zu einer Art mitleidigen Verhaltens gegen dieses Opferlamm, das sich dauernd aufopferte, über. Sie mäßigte schließlich ihr hochmütiges Wesen, ihre verletzenden Redensarten und ihren verächtlichen Ton, nachdem sie sich überzeugt hatte, daß ihre Schwägerin ihr Joch willig trug.
Und als sie bemerkte, daß die Kette den Hals ihres Opfers wund rieb, sorgte sie für es als für eine ihr gehörige Sache, und Celeste lernte bessere Zeiten kennen. Wenn sie diesen Verlauf mit dem Anfang verglich, so fühlte sie eine gewisse Zuneigung für ihren Henker. Um irgendeine Möglichkeit, sich zu verteidigen, zu finden, um irgend etwas in diesem Hause, das ohne ihr Wissen von ihrem Vermögen lebte, ohne daß sie mehr als die vom Tische gefallenen Brosamen bekam, zu werden, dafür bot sich für die arme Sklavin nur eine Aussicht, aber diese Aussicht erfüllte sich nicht.
Nach sechsjähriger Ehe hatte Celeste noch kein Kind bekommen. Diese Unfruchtbarkeit, die sie allmonatlich Ströme von Tränen vergießen ließ, erregte lange Zeit Verachtung bei Brigitte, die ihr vorwarf, daß sie zu gar nichts tauge, nicht einmal zum Kinderkriegen. Die alte Jungfer, die so sehr darauf gerechnet hatte, ein Kind ihres Bruders wie ein eigenes liebhaben zu können, brauchte lange Zeit, um sich an den Gedanken einer solchen unheilbaren Unfruchtbarkeit zu gewöhnen.
Zur Zeit, da diese Geschichte beginnt, im Jahre 1840, hatte Celeste, nun sechsundvierzig Jahre alt, aufgehört, darüber zu weinen, nachdem sie die traurige Gewißheit erlangt hatte, daß sie niemals Mutter werden würde. Merkwürdig! Nach fünfundzwanzig Jahren häuslichen Zusammenlebens, nachdem ihr Sieg den Dolch stumpf gemacht und zerbrochen hatte, liebte Brigitte Celeste ebenso, wie Celeste sie liebte. Die Zeit, die Gewohnheit, das beständige Nebeneinander im Hause, das die Ecken abgestumpft und die Rauheiten abgeschliffen hatte, ihre Ergebung und ihre Lammesgeduld – alles zusammen verschaffte Celeste einen heiteren Lebensherbst. Beide Frauen hatten ja dasselbe gemeinsame Gefühl, das sie belebte: sie beteten beide den glücklichen egoistischen Thuillier an.
Thuillier war als Supernumerar zusammen mit Colleville eingetreten, von dem, als seinem intimen Freunde, schon die Rede gewesen ist. Neben die ruhige und so geregelte Wirtschaft Thuilliers hatte das Geselligkeitsbedürfnis die Collevilles als Kontrast hingesetzt, und wenn man auch unmöglich übersehen kann, daß es ein auf den Zufall gestellter und kein bewußter Kontrast war, so muß doch hinzugefügt werden, daß man Schlüsse daraus besser erst am Ende dieses Dramas zieht, das unglücklicherweise nur allzuwahr, für das im übrigen aber der Erzähler nicht verantwortlich ist.
Dieser Colleville war der Sohn eines talentvollen Musikers, der vordem an der Oper unter Franceur und Rebel die erste Violine spielte. Bei seinen Lebzeiten erzählte er mindestens sechsmal im Monat Anekdoten von den Aufführungen des »Dorfpropheten« und machte Jean-Jacques Rousseau wundervoll nach. Colleville und Thuillier waren unzertrennliche Freunde; sie hatten keine Geheimnisse voreinander, und ihre Freundschaft, die mit fünfzehn Jahren begonnen hatte, war bis zum Jahre 1839 ungetrübt geblieben.
Colleville war einer von den Beamten, die in den Bureaus mit »Betriebsvetter« bezeichnet werden. Diese Beamten zeichnen sich durch ihre Betriebsamkeit aus. Colleville, ein guter Musiker, verdankte dem Namen und dem Einflusse seines Vaters die Stelle als erster Klarinettist an der Komischen Oper, und solange er Junggeselle war, teilte er, da er etwas mehr als Thuillier hatte, häufig mit seinem Freunde. Aber im Gegensatz zu Thuillier schloß Colleville eine Neigungsheirat, indem er zur Frau Fräulein Flavia nahm, die natürliche Tochter einer berühmten Tänzerin an der Oper, ein angebliches Kind von du Bourguier, einem der reichsten Lieferanten dieser Zeit, der, nachdem er sich im Jahre 1800 ruiniert hatte, sich um so weniger um seine Tochter kümmerte, als er Zweifel an der Treue der berühmten Tänzerin hegte.
Ihrem Äußeren und ihrer Herkunft nach sah sich Flavia zu einem ziemlich traurigen Handwerk bestimmt, als Colleville, der häufig mit der reichen ersten Kraft der Oper zu tun hatte, sich in Flavia verliebte und sie heiratete. Der Fürst Galathionne, der im September 1815 der Protektor der berühmten Tänzerin war, die damals am Ende ihrer glänzenden Laufbahn stand, gab Flavia eine Mitgift von zwanzigtausend Franken, und die Mutter fügte dem eine prachtvolle Ausstattung hinzu. Die ständigen Gäste des Hauses und die Kameraden an der Oper schenkten Schmucksachen und Geschirr, so daß Collevilles Haushalt viel reicher an Überflüssigem als an Kapital war. Flavia, im Überfluß aufgewachsen, bezog zuerst eine reizende Wohnung, die der Lieferant ihrer Mutter möblierte, und hier thronte die junge Frau, die voll Geschmack für die Künste, die Künstler und für eine gewisse Eleganz des Lebens war.
Frau Colleville war hübsch und pikant, geistvoll, lustig, liebenswürdig und, alles zusammengenommen, ein guter Kerl. Im Alter von dreiundvierzig Jahren verließ die Tänzerin das Theater und zog sich aufs Land zurück, und so sah sich ihre Tochter der Hilfsquellen beraubt, die ihr ihre verschwenderische Üppigkeit gewährt hatte. Frau Colleville führte ein sehr angenehmes Haus, das aber außerordentlich kostspielig war. Sie gebar zwischen den Jahren 1816 und 1826 fünf Kinder. Abends Musiker, führte Colleville morgens von sieben bis neun Uhr einem Kaufmann die Bücher. Um zehn Uhr erschien er in seinem Bureau. Und indem er so abends in ein Stück Holz blies und morgens an der doppelten Buchführung schrieb, verdiente er sich jährlich sieben- bis achttausend Franken.
Frau Colleville spielte die vornehme Dame; sie empfing Mittwochs, hatte alle Monat ein Konzert bei sich und gab alle vierzehn Tage ein Diner. Colleville sah sie nur beim Essen und spät, wenn er um Mitternacht heimkehrte; oft war sie dann selbst noch nicht zu Hause. Sie ging ins Theater, da sie manchmal Logenplätze geschenkt bekam, und benachrichtigte Colleville mit ein paar Worten, daß er sie in dem und dem Hause, wo sie tanzte oder soupierte, abholen solle. Man speiste vortrefflich bei Frau Colleville, und die etwas gemischte Gesellschaft amüsierte sich dort ausgezeichnet; sie sah berühmte Schauspielerinnen bei sich, Maler, Schriftsteller und einige reiche Leute. Frau Colleville war ebenso elegant wie Tullia, die erste Tänzerin an der Oper, die sie oft besuchte; aber wenn die Collevilles auch alles, was sie hatten, verbrauchten und am Monatsende häufig in Verlegenheit waren, so machte Flavia doch niemals Schulden.
Colleville war sehr glücklich; er liebte seine Frau immer noch und war immer noch ihr bester Freund. Stets mit liebevollem Lächeln und mit gewinnender Herzlichkeit empfangen, unterwarf er sich ihrer reizenden Art und ihrem unwiderstehlichen Zauber. Die wilde Arbeitslust, die er in seinen drei Berufen entwickelte, entsprach übrigens seinem Charakter und seinem Temperament. Er war ein kräftiger Kerl, von frischer Gesichtsfarbe, gutmütig, freigebig und voll guter Laune. Im Verlaufe von zehn Jahren gab es kein einziges Mal Streit in seinem Hause. In den Bureaus galt er als ein Leichtfuß, wofür man dort alle Künstler hielt, und oberflächliche Leute hielten seine beständige Arbeitshast für das Hin und Her eines Wirrkopfes.
Colleville war so klug, sich dumm zu stellen; er rühmte sein häusliches Glück und gab sich die größte Mühe, Anagramme zu fabrizieren, um als ein Mann zu erscheinen, der von dieser Leidenschaft ganz in Anspruch genommen wird. Die Beamten seiner Abteilung im Ministerium, die Bureauchefs, ja selbst die Abteilungsvorsteher kamen zu seinen Konzerten; von Zeit zu Zeit und bei passender Gelegenheit verteilte er unter der Hand Theaterbilletts, denn er war auf eine außerordentliche Nachsicht bei seinem beständigen Wegbleiben vom Dienste angewiesen. Die Proben nahmen ihm die Hälfte seiner Dienststunden weg, aber seine vom Vater ererbten musikalischen Fähigkeiten waren bedeutend genug, um ihm zu erlauben, nur bei den Generalproben anwesend zu sein. Dank den Beziehungen der Frau Colleville genügten das Theater und das Ministerium den Bedürfnissen des ehrenwerten Vielarbeiters, der übrigens seinerseits einen kleinen jungen Menschen, den ihm seine Frau warm empfohlen hatte, verhätschelte, einen Musiker mit großen Zukunftshoffnungen, der ihn im Orchester vertrat und sein Nachfolger werden sollte.
In der Tat wurde um das Jahr 1827, als Colleville seinen Abschied nahm, dieser junge Mann erster Klarinettist. Alle Kritik, die Flavia erfuhr, bestand in dem Satze: Sie ist »eine kleine Spur« kokett, die Frau Colleville! Die älteste Tochter, geboren 1816, war das leibhaftige Ebenbild des guten Colleville. Im Jahre 1818 bevorzugte Frau Colleville die Kavallerie vor allem anderen, selbst vor den Künsten, und zeichnete einen Unterleutnant der Dragoner von Saint-Chamans, den jungen reichen Charles Gondreville aus, der später im spanischen Feldzuge fiel; inzwischen hatte sie ein zweites Kind, einen Sohn, geboren, den sie für die militärische Karriere bestimmte. 1820 erklärte sie die Banken für die Ernährer der Industrie und die Stützen des Staates, und der große Keller, der berühmte Redner, war ihr Idol; sie bekam damals einen Sohn, Franz, den sie später Kaufmann werden lassen wollte, und dem die Protektion Kellers sicher niemals fehlen würde. Gegen Ende des Jahres 1820 fühlte Thuillier, der intime Freund von Herrn und Frau Colleville und Flavias Bewunderer, das Bedürfnis, seinen Schmerz am Busen dieser vortrefflichen Frau auszuweinen; seit sechs Jahren machte er vergebliche Versuche, ein Kind zu bekommen; der liebe Gott segnete seine Bemühungen nicht, denn die arme Frau Thuillier verrichtete ihre neuntägigen Andachten vergeblich; und sie war dazu bis nach Notre Dame de Liesse gegangen! Er schilderte ihr Celeste nach allen Richtungen hin, und die Worte: »Armer Thuillier!« fielen von den Lippen der Frau Colleville, die auch ihrerseits ziemlich betrübt war; sie hatte damals keine ausgesprochene Vorliebe für irgend jemanden. Und so weinte auch sie ihren Kummer an Thuilliers Herzen aus. Der große Keller, dieser Heros der liberalen Partei, war in Wirklichkeit ein kleinlicher Mensch; sie hatte die Kehrseite der Berühmtheiten, die Torheiten der Bankwelt, die Härte eines Volkstribunen kennengelernt. Der Redner sprach nur in der Kammer und hatte sich ihr gegenüber sehr schlecht benommen; Thuillier war darüber entrüstet. »Nur die Einfältigen verstehen zu lieben,« sagte er, »nehmen Sie mich doch!« Es hieß, daß der schöne Thuillier Frau Colleville ein klein wenig den Hof mache, und er wurde einer ihrer »Anbeter«, ein Wort, das aus der Zeit des Kaiserreichs stammte.
»Ach, du bemühst dich um meine Frau!« sagte Colleville lachend zu ihm; »nimm dich in acht, sie wird dich ebenso wie alle die andern abblitzen lassen.«
Eine feine Wendung, mit der Colleville seine Manneswürde in den Bureaus aufrecht erhielt. Von 1820 bis 1821 fühlte sich Thuillier in seiner Eigenschaft als Hausfreund veranlaßt, Colleville, der ihm früher so oft ausgeholfen hatte, beizuspringen, und lieh im Verlaufe von anderthalb Jahren der Familie Colleville etwa zehntausend Franken, wovon niemals die Rede sein sollte. Im Frühjahr 1821 wurde Frau Colleville von einem reizenden Mädchen entbunden, dessen Paten Herr und Frau Thuillier waren; sie wurde deshalb Celeste-Louise-Caroline-Brigitte genannt. Denn auch Fräulein Thuillier wollte dem kleinen Engel einen ihrer Vornamen geben.
Der Name Caroline war eine Aufmerksamkeit für Colleville. Die alte Frau Lemprun nahm es auf sich, das kleine Wesen zu einer Amme nach Auteuil zu geben, wo sie es unter ihrer Aufsicht hatte und wo Celeste und ihre Schwägerin es zweimal wöchentlich besuchten. Sobald Frau Colleville wieder aufgestanden war, sagte sie offen, aber ernsthaft zu Thuillier:
»Wenn wir gute Freunde bleiben wollen, mein Lieber, dann dürfen Sie nicht mehr als unser Freund sein wollen; Colleville liebt Sie ja, und wenn es einer im Hause tut, so genügt das.«
»Erklären Sie mir doch,« sagte der schöne Thuillier zu der Tänzerin Tullia, die sich gerade bei Frau Colleville befand, »weshalb die Frauen mich nicht lieb behalten wollen. Ich bin ja gewiß kein Apollo von Belvedere, aber doch auch kein Vulkan; ich sehe erträglich aus, ich habe Geist, ich bin treu ...«
»Wollen Sie die Wahrheit wissen?« erwiderte Tullia.
»Jawohl«, sagte der schöne Thuillier.
»Also, wenn wir auch mal ein Vieh lieben können, so lieben wir doch nie einen Dummkopf.«
Dieses Wort vernichtete Thuillier, und er kam nicht mehr auf die Sache zurück; er war seitdem melancholisch und schalt auf die Launen der Weiber.
»Habe ich dir das nicht vorhergesagt? ...« sagte Colleville. »Ich bin kein Napoleon, mein Lieber, und ich möchte auch keiner sein; aber ich besitze eine Josephine, ... eine Perle!«
Der Generalsekretär des Ministeriums, des Lupeaulx, dem Frau Colleville mehr Einfluß zugetraut hatte, als er besaß, und von dem sie später zu sagen pflegte: »Der war einer von denen, in welchen ich mich geirrt habe ...«, war damals eine Zeitlang der große Mann im Salon Colleville; aber da er nicht imstande war, Colleville in die Abteilung Bois-Levant zu bringen, war Flavia so klug, seine Bemühungen um Frau Rabourdin, die Gattin des Bureauchefs, übelzunehmen, eine Zierpuppe, wie sie sich ausdrückte, die sie niemals eingeladen und ihr gegenüber zweimal sich herausgenommen hatte, nicht zu ihren Konzerten zu kommen.
Frau Colleville war tief erschüttert von dem Tode des jungen Gondreville; sie war untröstlich; sie erblickte darin, wie sie sagte, die Hand Gottes. Im Jahre 1824 wurde sie häuslich, redete vom Sparen, gab ihre Empfangsabende auf, beschäftigte sich mit ihren Kindern, wollte eine gute Hausmutter sein, und ihre Freunde hörten nicht, daß sie jemanden bevorzugte; sie ging in die Kirche, kleidete sich einfach, in graue Farben, und redete über Katholizismus und über Schicklichkeit; und diese Richtung aufs Geistliche ließ im Jahre 1825 ein reizendes Kind zur Welt kommen, das sie Theodor nannte, das heißt »Gottesgeschenk«.
So wurde auch Colleville im Jahre 1826, der schönen Zeit der Kongregationen, zum Vizechef in der Abteilung Clergeot ernannt und im Jahre 1828 zum Steuereinnehmer eines Pariser Bezirks. Er erhielt das Kreuz der Ehrenlegion, so daß er einmal seine Tochter in Saint-Denis würde erziehen lassen können. Die halbe Freistelle, die Keller für Charles, das älteste Kind Collevilles, im Jahre 1823 durchgesetzt hatte, wurde auf den zweiten Sohn übertragen; Charles erhielt eine volle Freistelle im Gymnasium Saint-Louis, und der dritte Sohn, ein Schützling der Dauphine, bekam eine Dreiviertel-Freistelle am Gymnasium Henri IV.
Im Jahre 1830 war Colleville, der das Glück hatte, daß ihm alle seine Kinder erhalten geblieben waren, genötigt, wegen seiner Anhänglichkeit an die alte Linie des Königshauses seinen Abschied zu nehmen; aber er verstand das so geschickt zu bewerkstelligen, daß er mit Rücksicht auf seine Dienstzeit eine Pension von zweitausendvierhundert und von seinem Nachfolger eine Abfindungssumme von zehntausend Franken erhielt und zum Offizier der Ehrenlegion befördert wurde. Trotzdem befand er sich in schwieriger Lage, und so riet ihm im Jahre 1832 Fräulein Thuillier, in ihr Haus zu ziehen, wobei sie die Aussicht durchblicken ließ, daß er eine Stelle in der städtischen Verwaltung erhalten könne, was ihm auch nach vierzehn Tagen gelang und ihm ein Einkommen von tausend Talern einbrachte.
Charles Colleville war eben in die Marineschule eingetreten. Die Gymnasien, in denen die beiden andern kleinen Collevilles erzogen wurden, lagen in ihrem Stadtviertel. Das Seminar von Saint-Sulpice, in das dereinst der Jüngste kommen sollte, war nur wenige Schritte vom Luxembourg entfernt. Endlich wollten Thuillier und Colleville ihr Leben zusammen beendigen. Im Jahre 1833 zog Frau Colleville, damals fünfunddreißig Jahre alt, mit Celeste und dem kleinen Theodor nach der Rue d'Enfer, an der Ecke der Rue des Deux-Eglises. Colleville hatte es gleich weit nach dem Rathause und nach der Rue Saint-Dominique. So sah sich das Ehepaar nach einem abwechselnd glänzenden und entbehrungsreichen, festlichen und zurückgezogenen ruhigen Leben ins kleinbürgerliche Dunkel mit einem Einkommen von fünftausendvierhundert Franken als einzigem Vermögen zurückgeworfen.
Celeste war damals vierzehn Jahr alt; sie versprach hübsch zu werden; sie mußte Lehrer haben, das erforderte eine Ausgabe von mindestens zweitausend Franken jährlich. Die Mutter hielt es für nötig, daß sie unter den Augen ihrer Paten lebe. Deshalb hatte sie den, im übrigen sehr verständigen





























