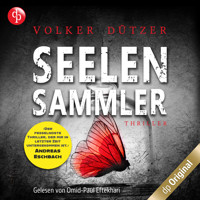5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Kann der Ermittler den skrupellosen Widersachern das Handwerk legen oder wird er selbst in den Abgrund gezogen?
Die spannende Inselkrimi-Reihe um Detective Chief Inspector Steve Cole geht aufregend weiter
Seit Tagen wird an der Küste von Alderney ein Geisterschiff gesichtet, das auftaucht und wieder verschwindet. Als es dann jedoch angeschwemmt wird, ist es einfach nur eine beschädigte Segeljacht und der wahre Horror wartet für Polizeichef Steve Cole an Bord, denn am Steuer steht eine mumifizierte Leiche. Schnell wird klar, dass die Alderney Police es mit Mord zu tun hat: Der Tote wurde erschossen, ans Steuerrad gebunden und auf eine letzte grausige Reise geschickt. Doch das ist nicht der einzige mysteriöse Fall, mit dem Cole konfrontiert wird. Der Bestsellerautor Daniel Jacobs behauptet, seine Frau ermordet zu haben, aber am vermeintlichen Tatort gibt es keine Spur eines Verbrechens. Könnte es eine Verbindung zwischen den beiden Fällen geben? Die Ermittlungen führen den Chief Inspector in die dunklen Abgründe der Inselgemeinschaft und zu allem Überfluss hat auch sein Erzfeind Viktor Sorokin noch eine Rechnung mit ihm offen …
Weitere Titel in der Reihe
Die Flut (ISBN: 9783987789519)
Im Sturm (ISBN: 9783987789540)
Erste Leser:innenstimmen
„Die mysteriöse Segeljacht und die mumifizierte Leiche auf Alderney sind nur der Anfang einer packenden und vielschichtigen Fortsetzung der Krimi-Reihe.“
„Ein atmosphärischer und packend beschriebener dritte Ermittlungsfall auf Alderney!“
„Dieser Fall hat alles, was ein guter Ermittlungskrimi braucht: eine fesselnde Story, interessante Charaktere und jede Menge Spannung.“
„Steve Cole ist ein großartiger Ermittler und ich habe jeden Fall bisher genossen!“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses E-Book
Seit Tagen wird an der Küste von Alderney ein Geisterschiff gesichtet, das auftaucht und wieder verschwindet. Als es dann jedoch angeschwemmt wird, ist es einfach nur eine beschädigte Segeljacht und der wahre Horror wartet für Polizeichef Steve Cole an Bord, denn am Steuer steht eine mumifizierte Leiche. Schnell wird klar, dass die Alderney Police es mit Mord zu tun hat: Der Tote wurde erschossen, ans Steuerrad gebunden und auf eine letzte grausige Reise geschickt. Doch das ist nicht der einzige mysteriöse Fall, mit dem Cole konfrontiert wird. Der Bestsellerautor Daniel Jacobs behauptet, seine Frau ermordet zu haben, aber am vermeintlichen Tatort gibt es keine Spur eines Verbrechens. Könnte es eine Verbindung zwischen den beiden Fällen geben? Die Ermittlungen führen den Chief Inspector in die dunklen Abgründe der Inselgemeinschaft und zu allem Überfluss hat auch sein Erzfeind Viktor Sorokin noch eine Rechnung mit ihm offen …
Impressum
Erstausgabe September 2024
Copyright © 2025 dp Verlag, ein Imprint der dp DIGITAL PUBLISHERS GmbH Made in Stuttgart with ♥ Alle Rechte vorbehalten
E-Book-ISBN: 978-3-98998-395-3 Taschenbuch-ISBN: 978-3-98998-412-7
Covergestaltung: Verena Kern unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com: © ecrafts, © Gosia1982, © studioxzero, © Evannovostro, © modalmodaldewe Lektorat: Birgit Förster
E-Book-Version 12.02.2025, 19:58:27.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Sämtliche Personen und Ereignisse dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Abhängig vom verwendeten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Unser gesamtes Verlagsprogramm findest du hier
Website
Folge uns, um immer als Erste:r informiert zu sein
Newsletter
TikTok
YouTube
Die Klippen
She can kill with a smile
She can wound with her eyes
And she can ruin your faith with her casual lies
And she only reveals what she wants you to see
She hides like a child
But she’s always a woman to me
She’s always a woman to me (Billy Joel)
1
Alderney, 16. September
Das Boot tauchte auf und verschwand wieder im Nebel wie ein Geisterschiff. Als Steve Cole es zum ersten Mal sah, tat er es als Luftspiegelung ab. Wenn er zu lange auf das Meer hinausblickte, glaubte er die seltsamsten Dinge zu sehen. Vielleicht konnte die endlos tiefe, graublaue See in sein gequältes Herz blicken und projizierte die stumme Verzweiflung, die darin wühlte, an den Horizont wie die Fetzen eines Albtraums.
Am Morgen des 16. September narrte ihn das Phantom eine Viertelstunde lang. Etwa eine Seemeile vor der Westküste Alderneys lag eine dichte Nebelbank. Ein nasskalter Wind trieb sie langsam auf die Insel zu und schob die Flut vor sich her. Auf irritierende Weise schien das Meer aus der Bank herauszufließen und drohte den Felsen im Ärmelkanal, auf dem zweitausend Menschen lebten, zu verschlingen.
Steve kniff die Augen zusammen und wagte sich bis an den Rand der schwarzen Klippen vor. Eine Bö fuhr in die Dunstschwaden und trieb sie auseinander. Die Morgensonne blitzte durch die schiefergraue Wolkendecke und zauberte gleißende Lichtreflexe auf das Wasser, die wie die Seelen ertrunkener Seeleute auf den Wellen tanzten.
Da war es wieder! Ein verwischter Fleck, der wie ein Spuk innerhalb von Sekunden größer oder kleiner wurde. Mal schien er weit entfernt zu sein, dann wieder zum Greifen nah. Lewis, der alte Hafenmeister, hatte ihm erklärt, dass es am Nebel lag. Er verzerrte die Konturen, gaukelte dem Beobachter Trugbilder vor und erschwerte es, Entfernungen einzuschätzen.
Doch das Schiff war kein Trugbild. Deutlich erkannte Steve die schlanke Silhouette einer Segeljacht und den marineblauen Streifen am Rumpf. Die Kanalinseln waren ein beliebtes Ziel von Hobbykapitänen, die an den Wochenenden vom Festland herübersegelten. In den Häfen von Guernsey, Jersey und Alderney ankerten Dutzende Jachten und Boote. Während der Sommermonate war die See mit winzigen, weißen Segeln gespickt, die wie Vogelfedern über dem Wasser schwebten.
Das Auftauchen der Jacht hätte ihn nicht weiter beunruhigt, wäre da nicht die Tatsache gewesen, dass der Mast auf halber Höhe gebrochen war und das Großsegel wie ein Leichentuch über dem Deck lag. Sie trieb steuerlos mal hierhin, mal dorthin.
Vor drei Tagen hatte er den Hafenmeister auf den Havaristen aufmerksam gemacht, weil er eine Gefahr für die Schifffahrt darstellte. Lewis hatte den kleinen Rettungskreuzer Roy Barker, der im Hafen der Braye Bay ankerte, losgeschickt, aber die Mannschaft hatte keine Spur der schwer beschädigten Jacht entdeckt. Der alte Mann hatte sich daraufhin die Gelegenheit nicht entgehen lassen, unheimliche Geschichten über Geisterschiffe zum Besten zu geben.
„Die See kann ein verflixter Teufel sein“, hatte Lewis fabuliert. „Ich lebe seit fast siebzig Jahren auf Alderney, und ich habe allerhand seltsames Zeug gesehen, Chief. Ob Sie’s glauben oder nicht, aber da draußen gehen Dinge vor, die nicht in unsere moderne Welt passen.“
Steve war sicher, dass sich der Hafenmeister irrte. Das Boot war real, kein schauriger Gruß aus dem Jenseits. Wieder schoben sich schwarzgraue Regenwolken vor die Sonne und wuschen die kräftige blaugrüne Farbe aus dem Meer. Das Boot verschmolz mit dem Horizont und verschwand wie ein Gespenst zum Ende der Geisterstunde.
Watson, der struppige Hund, der sich vor einigen Wochen entschieden hatte, Steve zu adoptieren, winselte leise. Er streckte die Hand nach ihm aus, aber wie immer hielt der Hund Abstand.
„Du spürst es auch, nicht wahr?“
Watson blickte gebannt auf das Meer hinaus. Ein Zittern lief über sein graubraunes Fell, das nicht von der herbstlichen Kälte herrührte. Etwas lauerte hinter dem Horizont. Etwas, das Tod, Unheil und Verderben brachte.
Die Bö erreichte das Land, strich über die karge Hochebene und verkündete Sturm. Steve schlug den Kragen seiner Jacke hoch und wandte sich um. Der zweite Winter auf Alderney stand ihm bevor. Der zweite Winter ohne Abby.
Er hinkte zum Zig Zag Cliff Path zurück. Das nasskalte Wetter machte seiner alten Hüftverletzung heute mehr als sonst zu schaffen. Jeder Schritt schmerzte.
Er ließ Watson auf den Rücksitz des Streifenwagens klettern, der oberhalb des alten Pfarrhauses stand, in dem er seit seiner Ankunft auf Alderney lebte, und sah ein letztes Mal auf das Meer hinaus. Die Nebelschwaden teilten sich wie ein Theatervorhang und gaben den Blick frei auf die steuerlose Segeljacht. Sie war nun sehr viel näher unter Land als noch vor ein paar Minuten, lag tief im Wasser und schien unmittelbar auf ihn zuzuhalten, als wäre Steve das Ziel ihrer Irrfahrt.
Nachdenklich betrachtete er das näher kommende Boot und versuchte, die machtvolle Vorstellung abzuschütteln, das Wrack verfolge ihn wie ein unheilvolles Omen. Er stieg in den Wagen und fuhr nach Saint Anne.
2
Ein kalter Wind fegte trockenes Laub über das Pflaster der Queen Elizabeth II Street und zupfte das Laub von den Ästen der Bäume auf dem Parish Church Grave Yard.
Steve stellte den Streifenwagen auf dem Parkplatz neben dem Polizeirevier ab, stieg aus und öffnete die hintere Seitentür. Watson schnupperte prüfend und kletterte umständlich aus dem Wagen. Er lief eilig auf die blaue Tür des Reviers zu, die in der feuchten Morgenluft glänzte, als wäre sie frisch poliert worden. Vermutlich freute er sich auf ein Nickerchen im warmen Büro des Chiefs.
Steve hinkte ihm hinterher. Die Strecke vom Parkplatz zur Wache erschien ihm doppelt so lang wie gewöhnlich.
Alderney! Was als Übergangslösung geplant gewesen war, währte nun schon zwanzig Monate, denn so lange lebte und arbeitete er bereits auf der Insel. Inzwischen hatte er beschlossen zu bleiben, wenn auch der einzige Grund dafür war, dass er nicht wusste, wohin er sonst hätte gehen sollen.
Der Hund trottete den Korridor entlang, erledigte seine übliche Kontrollrunde und schob dann mit der Schnauze die Milchglastür mit der Aufschrift Chief auf.
Jeder von uns hat seine lieb gewonnene Routine, dachte Steve belustigt. Watson legte einige skurrile Eigenheiten an den Tag. Bevor er sich nicht überzeugt hatte, dass jedes Ding an seinem gewohnten Platz war, konnte er sich nicht entspannen.
Steve wandte sich nach links und betrat die Wache. Es duftete nach Kaffee, Constable Penny Saunders telefonierte. Er nahm die Kanne aus der Kaffeemaschine und schenkte sich eine Tasse ein. Penny beendete ihr Gespräch und legte den Hörer auf die Gabel.
„Einen wunderschönen Montagmorgen wünsche ich“, sagte er.
Sie erwiderte seinen Gruß mit einem Nicken und notierte etwas auf ihrer Schreibtischunterlage.
„Du bist spät dran“, sagte sie.
„Der Fliegende Holländer ist wieder aufgetaucht.“
„Konntest du diesmal einen Exorzismus durchführen?“
Steve trank einen Schluck Kaffee.
„Nein. Er hat sich aus dem Staub gemacht, bevor ich den Kanister mit dem Weihwasser aus dem Pfarrhaus holen konnte. Ruf bitte Lewis an, er soll den Coastguard alarmieren. Ich befürchte, die Flut wird das Boot auf die Klippen bei den Guns treiben. Sie sollten es besser aufbringen, ehe jemand zu Schaden kommt.“
Penny nickte abwesend, das Telefon klingelt erneut.
„Ganz schön was los heute“, sagte Steve. „Wo steckt denn Gordon?“
„Im Bett. Er hat sich krankgemeldet. Die halbe Insel liegt mit Grippe flach.“
„Kein Wunder bei dem Wetter. Und Dave?“
„Er ist auf Guernsey zu der Fortbildung, auf die er monatelang gewartet hat.“
„Oh, das hatte ich ganz vergessen.“
Penny nahm genervt den Hörer ab und meldete sich. Sie hörte dem Anrufer eine Minute lang zu und schnitt eine Grimasse.
„Wir kümmern uns darum“, sagte sie mit zuckersüßer Stimme und legte auf. „Ich könnte hier Unterstützung gebrauchen“, seufzte sie. „In zehn Tagen beginnt das Food & Drink Festival. Da drehen in jedem Jahr alle durch.“
Wieder klingelte es.
„Alderney Police Station. Was kann ich für Sie tun?“
Penny bedeckte die Sprechmuschel mit der Hand und sagte leise: „Es ist McGinley von der Gemeindeverwaltung. Er will, dass du etwas gegen die Falschparker in der Innenstadt unternimmst.“
„Ich soll Strafzettel schreiben? Das ist entschieden unter der Würde meines hohen Amtes.“
„Solange wir nur zu zweit sind, wird sich das nicht vermeiden lassen. Oder möchtest du lieber meinen Job am Telefon übernehmen?“
„Ich schicke Watson. Er braucht ohnehin mehr Bewegung.“
Penny zog eine so finstere Miene, dass er unwillkürlich grinsen musste.
„Okay, ich kümmere mich um ihn. Stell ihn zu mir durch.“
Sie drückte eine Taste auf ihrem Telefon und legte den Hörer auf. Steve verzog sich in sein Büro. Er hatte sich an den gemächlichen Alltag auf Alderney gewöhnt. Hektisch wurde es nur vor den Veranstaltungswochen im Frühjahr und im Herbst. Er stellte seine Tasse auf den Schreibtisch, setzte sich in den knarrenden, alten Ledersessel und nahm den Hörer ab.
„Guten Morgen, Mr McGinley. Was kann ich für Sie tun?“
„Die Gemeindeverwaltung wünscht einen reibungslosen Ablauf des Festivals. Ich möchte mich versichern, dass Sie gut vorbereitet sind. Chief Henderson hat stets …“
„Seien Sie beruhigt. Wir haben alles im Griff und …“
„Ich hörte, Sie sind nur zu dritt“, unterbrach ihn McGinley.
„Im Augenblick sogar nur zu zweit. Sergeant Lyme hat sich krankgemeldet.“
McGinley gab eine Mischung aus ersticktem Kieksen und Seufzen von sich.
„Constable Bailey ist rechtzeitig zum Beginn des Festivals wieder einsatzbereit.“
Steve imitierte mit Daumen und Zeigefinger eine Pistole und feuerte auf das Foto der versammelten Gemeinderatsmitglieder an der Wand.
„Was gedenken Sie wegen der angespannten Verkehrssituation zu unternehmen?“, fragte McGinley.
„In den nächsten zwei Wochen werden wir auf Alderney nur Pferdekutschen erlauben.“
Der sauertöpfische Mitarbeiter der Verwaltung von Saint Anne keuchte hörbar. Er besaß nicht den geringsten Sinn für Humor.
„Wir nehmen Tradition auf Alderney sehr ernst, Chief Cole. Bill Henderson war sich dessen bewusst.“
„Das bin ich ebenfalls. Berichten Sie dem Stadtrat, dass der Chief sich höchstpersönlich um jeden einzelnen Strafzettel kümmert.“
„Ich verlasse mich auf Sie.“
„Aber immer“, sagte Steve.
„Und verschonen Sie uns eine Weile mit weiteren Mordfällen. Davon hatten wir in letzter Zeit mehr als genug.“
„Ich kläre Verbrechen auf, ich verübe sie nicht.“
„Mmpfh.“
McGinley legte auf. Steve lehnte sich zurück und betrachtete die Fotografien seiner Vorgänger an der Wand. Irrte er sich, oder schaute ihn der alte Bill heute besonders missbilligend an?
„Okay, ich bemühe mich, den Job ein bisschen ernster zu nehmen“, murmelte er.
Er trank seinen Kaffee aus, stand auf und nahm seine Uniformjacke vom Haken. Watson hob den Kopf und blickte ihn erwartungsvoll an.
„Klar kommst du mit. Ich zeige dir, wie man Strafzettel ausstellt. Das gehört zur Ausbildung.“
Mit dem Hund im Gefolge verließ er das Büro und ging an der offenen Tür zur Wache vorbei.
„Wohin des Wegs, Stevie?“, fragte Penny.
„Präsenz zeigen und mich bei den Touristen unbeliebt machen.“
„Viel Spaß. Vergiss den Block mit den Strafzetteln nicht.“
„Wenn ich dich nicht hätte …“
Er kehrte um, suchte in Daves Schreibtisch nach dem Zettelblock und steckte ihn in die Jackentasche.
„Der Stadtrat will eben den Sheriff auf der Straße sehen, das ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit“, sagte Penny.
„Ich fühle mich ein bisschen überqualifiziert“, seufzte er. „Wenn ich die Lust verliere, fahre ich bei Abby vorbei. Falls etwas Wichtiges anliegt, kannst du mich auf dem Diensthandy erreichen.“
„Das wird kaum nötig sein“, grollte Penny. „Ich erledige hier nur unwichtige Sachen.“
Steve verließ das Revier und öffnete die Beifahrertür des Streifenwagens. Watson sprang auf den Sitz und blickte aus dem Fenster. Er schien es zu mögen, wenn sie gemeinsam ihre Runden drehten.
Zwei Stunden und dreizehn Strafzettel später legte Steve eine Pause ein und trank im The Moorings am Hafen einen Kaffee. Er hätte Pennys Angebot annehmen und mit ihr tauschen sollen, anstatt die Straßen von Saint Anne nach Falschparkern abzusuchen. In seiner linken Hüfte wühlte ein dumpfer Schmerz. Noch immer konnte er sich nicht mit den Einschränkungen abfinden, die ihm sein Körper aufzwang; würde es wahrscheinlich nie können. Aber er liebte es nun mal, an der frischen Luft zu sein.
Sein Diensthandy klingelte. Er meldete sich.
„Lewis hier“, dröhnte die Bassstimme des Hafenmeisters aus dem Lautsprecher. „Wir haben das Wrack aufgebracht. Es liegt unterhalb des Zig Zag Paths zwischen den Klippen. Ich wollte anfragen, ob wir auf Sie warten sollen, bevor wir an Bord gehen.“
„Gibt’s dafür einen besonderen Grund?“
Steve verspürte wenig Lust, auf den schlüpfrigen Felsen herumzuklettern.
„Mich zwickt es in den alten Knochen, Chief. Irgendwas stimmt hier nicht. Könnte doch sein, dass wir es mit einem Verbrechen zu tun haben.“
„Das wird dem Stadtrat aber gar nicht gefallen.“
„Mir gefällt’s auch nicht.“
„Okay, ich komme.“
Zehn Minuten später stellte er den Wagen oberhalb der Klippen an der Westküste ab. Das Wrack steckte zwischen den Felsen wie ein Splitter in der Faust eines zornigen Meeresgottes. Die Roy Barker schaukelte in sicherer Entfernung auf den Wellen. Ein Sonnenstrahl durchbrach die Wolken und brachte den blauen Rumpf mit den orangefarbenen Aufbauten zum Leuchten. Lewis stand im Bug und glich geschickt das Auf und Ab der Dünung aus. Er winkte, formte mit den Händen einen Trichter um den Mund und rief ihm etwas zu, aber seine Worte gingen im Rauschen der Brandung unter.
Steve suchte sich einen Weg zwischen den Felsen hinab zu dem winzigen, halbmondförmigen Strand. Der Boden war mit Moosen und Flechten bedeckt, Seetang überdeckte gefährliche Spalten und Löcher im Gestein. Watson blieb zurück und winselte kläglich.
Trotz aller Vorsicht glitt Steve aus und schlitterte das letzte Stück zum Strand hinab. Das Stechen in seiner Hüfte war so stark, dass ihm ein paar Sekunden lang schwarz vor Augen wurde. Er wartete, bis der Schmerz zu einem dumpfen Pochen abebbte, und humpelte dann über den nassen Sand auf das Wrack zu.
Die einlaufende Flut versperrte ihm jedoch den Weg. Das Boot lag unerreichbar etwa zwanzig Meter entfernt zwischen den Riffen im tiefen Wasser. Der Wind spielte mit einem Fetzen Segeltuch, hob es an und enthüllte den Namen der Jacht, der in goldener Schrift am Heck leuchtete: Thetis, die Meeresnymphe und Schönste der Nereiden. Nun, von ihrer Schönheit war wenig geblieben.
Das Beiboot der Roy Barker hatte abgelegt und näherte sich dem Strand. Der Hafenmeister drehte bei.
„Kommen Sie an Bord, Chief!“
Er streckte einladend die Hand aus. Steve ging auf das Boot zu. Eine Welle rollte an den Strand und durchnässte seine Hosenbeine. Das Wasser war kalt wie ein Grab. Lewis half ihm über das Dollbord. In seinem grauroten Bart glitzerten Wassertropfen, seine hellen Augen funkelten unternehmungslustig.
„Es war also doch kein Geisterschiff“, sagte Steve atemlos.
„Ich bin gespannt, was uns erwartet, Chief. So wie’s aussieht, würde es mich nicht wundern, wenn es mehrere Wochen auf See war. Entweder ist der Skipper über Bord gegangen, oder er hat das Boot aufgegeben.“
„Dann hätte er den Verlust dem Coastguard gemeldet“, sagte Steve.
Lewis wischte sich Spritzwasser aus dem Bart. „Wenn er noch Gelegenheit dazu hatte, schon.“
„Kommt Ihnen die Thetis bekannt vor?“, fragte Steve.
„Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich kann mir all die Boote, die während eines Sommers einlaufen und wieder abfahren, nicht mehr merken. Sie wissen ja, dass meine Augen nicht mehr die besten sind.“
Das Beiboot ging längsseits. Skeptisch musterte Steve die havarierte Jacht. Das Deck lag etwa zwei Meter über dem unruhigen Wasserspiegel.
Lewis machte an der Thetis fest und warf eine Strickleiter über die Reling. Er brauchte drei Versuche, bis er sicher war, dass sie sich fest verhakt hatte.
„Nach Ihnen“, sagte er.
Die kleine Jolle schaukelte unter ihm wie ein Korken auf den Wellen, aber Steve wollte sich keine Blöße geben. Er biss die Zähne zusammen und passte den richtigen Moment ab. Endlich bekam er die Strickleiter zu fassen, ignorierte das Stechen in seiner Hüfte und kletterte an Bord. Außer Atem blieb er einen Moment stehen und schloss die Augen, alles drehte sich um ihn.
„Sind Sie okay, Chief?“
Er öffnete die Augen. Der Hafenmeister war ihm gefolgt und musterte ihn besorgt.
„Ja. Ich schätze, solche Klettertouren schmecken meinen verschraubten Knochen nicht besonders gut.“
Steve blickte sich um. Reste des zerfetzten Großsegels bedeckten den Ruderstand und die Aufbauten. Er zerrte an dem steifen Stoff und schlug ihn zur Seite. Lewis stieß einen heiseren Schrei aus.
3
Daniel Jacobs stand vor dem Mansardenfenster. Er beobachtete den Fremden schon eine ganze Weile. Der Mann hatte sein Hemd ausgezogen und warf es gerade achtlos auf den Boden. Auf seinem durchtrainierten Oberkörper glitzerten Schweißperlen. Die noch tief über dem Horizont stehende Morgensonne zauberte scharfe Konturen auf seine Haut und ließ ihn im Gegenlicht schimmern wie eine Marmorstatue. Sein hellbraunes Haar umgab ihn wie ein Heiligenschein. Die Kühle des Septembermorgens schien ihm nichts auszumachen. Er ließ sich Zeit, um ein wärmeres Sweatshirt überzustreifen. Zu viel Zeit.
Dans Blick wanderte weiter zu Heather, die zu dem halb nackten Mann auf dem Dach des Schuppens neben der Garage hinaufschaute. Die Hände in die Hüften gestemmt, warf sie den Kopf zurück und lachte über einen Witz, den er offenbar gerissen hatte. Dan konnte nicht hören, war er antwortete, und er wollte nicht neugierig erscheinen, indem er das Fenster öffnete.
Die Pose, die Heather einnahm, brachte ihre Formen herausfordernd zur Geltung. Sie konnte die Männer verrückt machen, wenn sie es darauf anlegte. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, hatte er sie geheiratet. Er hatte niemals damit gerechnet, dass eine Frau wie sie sich zu ihm hingezogen fühlen würde. Was die körperlichen Vorzüge anging, konnte er mit dem Fremden auf dem Dach nicht mithalten. Im Gegensatz zu ihm war Dan von schmächtiger Gestalt. Wenn er sich anstrengte, geriet er schnell außer Atem, zudem war er kurzsichtig wie ein Maulwurf. Seit einiger Zeit neigte er dazu, einen Bauchansatz zu entwickeln.
Heather fuhr sich durch das lange blonde Haar. Dan liebte dieses Haar, er liebte Heather und ihr Lachen. Ein Stechen durchzuckte seine Brust, als hätte der Fremde ihm ein Messer ins Herz gerammt. Heather hatte schon lange nicht mehr gelacht. Nicht mit ihm.
Der Mann bückte sich und kramte in einem Werkzeugkasten. Er musste der Handwerker sein, den sie aufgetrieben hatte. Das Dach des Schuppens war marode, bei starkem Regen – der auf Alderney häufig auftrat – sammelte sich Wasser in dem Spalt zwischen Dach und Hauswand und drohte die Bausubstanz zu beschädigen. Heather hatte ihn ein paarmal gebeten, sich darum zu kümmern, aber er hatte zwei linke Hände. Sein Gedächtnis schien auch nicht mehr so gut zu funktionieren, denn schließlich hatte er die Sache verschwitzt.
In letzter Zeit vergaß er eine Menge. Er konnte sich schlecht konzentrieren und glaubte manchmal, Dinge und Menschen zu sehen, die es nicht gab. Heather wusste nichts davon. Bisher war es ihm gelungen, seine Gedächtnislücken vor ihr zu verheimlichen.
Sie stieg nun die Leiter zum Schuppendach hinauf, vermutlich, um dem Mann den Schaden zu zeigen. Er schien sie fürsorglich stützen zu wollen, aber seine Hand kam ihrem Po dabei eine Spur zu nahe. Die Berührung erfolgte keinesfalls zufällig, dessen war sich Dan sicher. Heather schien es entweder nicht zu bemerken, oder sie hatte nichts dagegen, von dem schweißbedeckten Adonis angefasst zu werden. Der dumpfe Schmerz in Dans Brust verwandelte sich in das heiße Brennen der Eifersucht.
Er tat das, was er immer tat, wenn er sich mit einem Problem konfrontiert sah. Er verdrängte es, ging zu seinem Schreibtisch und betrat die Welt seiner Fantasie. Dort wusste er stets, was zu tun war. Ganz gleich, wie tief die Grube war, in die er stürzte, er fand einen Weg hinaus. Doch seit einiger Zeit war die Quelle seiner inneren Kraft versiegt. Wie so oft, starrte er auf den blinkenden Cursor und die leere Seite seines Textverarbeitungsprogramms, bis seine Unruhe einen kritischen Punkt erreichte. So lief es schon seit Wochen. Dan ignorierte die sich immer höher auftürmenden Schwierigkeiten und ging Auseinandersetzungen mit Heather aus dem Weg. Ihre Unterhaltungen endeten in letzter Zeit ohnehin meistens im Streit. Streit um Nichtigkeiten. All das führte dazu, dass die Seite vor ihm leer blieb.
Zunächst hatte er seinen Schwierigkeiten, etwas zu Papier zu bringen, keine große Bedeutung beigemessen, es gab gute und schlechte Tage. Zeiten, in denen er schrieb wie ein Besessener – zwanzig, dreißig Seiten am Stück. Dann wieder durchlebte er Phasen, in denen seine Kreativität schlief wie ein Murmeltier. Er hatte genug Erfahrung als Schriftsteller, um Krisen zu überwinden. In den vergangenen Monaten hatte er allerdings eine beängstigende Schreibblockade entwickelt, gegen die kein Kraut gewachsen schien. Inzwischen erfasste ihn regelmäßig Panik, wenn er sich dem Schreibtisch nur näherte. Auch davon wusste Heather nichts.
Dan war sich sicher gewesen, dass sie ihn geheiratet hatte, weil sie ihn liebte. Das hatte sie mehr als einmal bewiesen. Doch in letzter Zeit misstraute er ihr. Der Zweifel war ein Ungeheuer, das sich von Angst ernährte. Seine Zähne schlugen zunächst nur eine kleine, unbedeutende Wunde, die sich jedoch rasch entzündete und am Ende Körper und Geist vergiftete. Hatte sie ihm ihre Verliebtheit nur vorgespielt? Vom ersten Tag ihrer Ehe an hatte ihn die Angst begleitet, dass sie nur an seinem Geld interessiert sein könnte. Wie würde sie reagieren, wenn sein Erfolg und der damit verbundene warme Geldregen ausblieben?
Dan fischte ein einzelnes Blatt mit Notizen aus dem Chaos auf der Tischplatte. Es war eine eilig hingeworfene Idee für einen Roman. Stirnrunzelnd las er die wenigen Sätze durch und fragte sich, ob er unter einer Persönlichkeitsspaltung litt. Die eine Hälfte seines Ichs brachte nichts Brauchbares mehr hervor, während die andere grotesken Unsinn verzapfte, um die Gegenseite zu verspotten. Die Vorstellung, dass zwei Seelen in seiner Brust wohnten und er so enden könnte wie seine an Schizophrenie erkrankte Mutter, jagte ihm einen kalten Schauer über den Rücken. Sie war in geistiger Umnachtung aus demselben Mansardenfenster in den Tod gesprungen, aus dem er vor wenigen Minuten geblickt hatte. Die meisten Menschen hätten einen Ort, an dem die Schrecken ihrer Kindheit lebendig waren, gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Für Dan besaß dieses Zimmer jedoch einen besonderen Zauber, der Rettung aus seinem Dilemma versprach und den er durch seine Rückkehr nach Alderney zu wecken hoffte. Eine Magie, die stärker war als die Erinnerung.
Er zerknüllte das Blatt und stopfte es in den überquellenden Papierkorb. Seine Hand streifte dabei die Brille und schob sie auf seine Nasenspitze herab. Augenblicklich verschwamm das Zimmer um ihn herum, Formen und Konturen lösten sich auf. Hastig rückte er sie wieder gerade. Seit seiner Kindheit litt er unter einer Sehschwäche, die auf eine zu spät behandelte Bindehautentzündung zurückging. Die Brille war zugleich sein Tor zur Welt und der Anlass für zahllose Hänseleien und Kränkungen gewesen. Vermutlich waren die starken Augengläser auch der Grund, warum in seinen Geschichten häufig unglückliche Kinder und Außenseiter die Hauptrollen spielten. Als Folge der eigenen Unsicherheit hatte er sich in die Geborgenheit seines Dachzimmers zurückgezogen und in eine Welt der Fantasie geflüchtet, in der alles möglich war. Dort war er kein ängstlicher, pummeliger Junge mit einer klobigen Brille, sondern Peter Pan, Luke Skywalker und Indiana Jones in einer Person.
Dan verschlang Bücher wie andere Kinder Kekse und begann früh, eigene Geschichten zu erfinden. Lange traute er sich nicht, sie aufzuschreiben, sondern erzählte sich selbst jeden Abend ein neues Kapitel, bis sich seine Vorstellungskraft mit der Traumwelt des Schlafs vermischte, die von Monstern und Dämonen bevölkert war. Und von verrückten toten Müttern, die aus dem Grab zurückkehrten und durch das Mansardenfenster stierten.
Später hatte er sich oft gefragt, ob hier der Ursprung seiner Horrorromane lag, in denen er die Schrecken des Unbewussten in die Realität zerrte. An jenem windigen, regnerischen Herbsttag hatte er sie gesehen, bevor sie von dem schmalen Balkon, der vor ihrem Schlafzimmer und dem von Dan entlanglief, in die Tiefe sprang. Mit flackernden Augen hatte sie durch das regenblinde Fenster gestiert und die Lippen zu einem irren Grinsen verzogen. In den Sekunden vor ihrem Tod war Dan sicher gewesen, einen Wimpernschlag lang ihr wahres, sanftes Wesen zu erkennen, das im kranken Gehirn eines Monsters eingesperrt war; und die Scham und Verzweiflung darüber, ihren kleinen Jungen zurückzulassen.
In den folgenden Monaten hatte er sich vor den dunklen, windigen Nächten gefürchtet, in denen die Zweige der alten Eiche am Fenster kratzten und gespenstische Schatten auf die Scheibe malten. Dann war er davon überzeugt gewesen, dass der Dämon, der seine Mutter überwältigt hatte, zurückkehren würde, um ihn zu holen und mit ihr zu vereinen. Waren es Anzeichen derselben Krankheit, die seine Mutter, ohne es zu wollen, an ihn weitergereicht hatte? Die Angst, dass er ebenfalls an Schizophrenie erkranken könnte, hatte ihn seitdem nie wieder verlassen.
Das grauenvolle Erlebnis hatte indessen eine unheimliche Gabe in ihm freigesetzt: seine Leser mit Haut und Haaren in seine Geschichten hineinzuziehen und sie erst loszulassen, wenn sie ihn auf seiner Reise in die teuflischen Abgründe der menschlichen Seele begleitet hatten. Dieses Talent hatte ihn reich gemacht.
Und doch bezahlte er einen Preis dafür, von dem niemand etwas ahnte, auch Heather nicht. Dan hasste es, im Rampenlicht zu stehen. Er hasste es, wenn die Leute ihn bedrängten und darum baten, ihre zerlesenen Bücher zu signieren; wenn ihre Körperausdünstungen in seine Nase krochen und er einer Panik nahe war, wenn sie sich mit ihm fotografieren lassen wollten. Dann wünschte er sich in die Einsamkeit des Mansardenzimmers zurück, in dem er die meiste Zeit seiner Kindheit und Jugend verbracht und die Geschichten ersonnen hatte, von denen er noch heute zehrte.
Dass er über das Geschenk verfügte, andere Menschen damit zu verhexen, war ihm zum ersten Mal klar geworden, als er dreizehn Jahre alt war. Jeder Tag in der Saint Anne’s School hielt neue Schrecken für ihn bereit, und vor allem fürchtete er Mrs Chambers, seine Englischlehrerin; eine vertrocknete alte Jungfer mit straffem Haarknoten und Hornbrille, die jede Grammatikregel auswendig kannte, die je ersonnen worden war. Ansonsten besaß sie die literarische Fantasie einer Saatkrähe. Sie sezierte die Kurzgeschichten, die der Lehrplan vorsah, wie eine Leichenbeschauerin, verstand aber meist nicht, was der Autor damit ausdrücken wollte. Dan hingegen erkannte instinktiv die Mechanismen einer guten Geschichte, ihre Prämisse und Funktionen.
Der letzte Schultag vor den Sommerferien 1994 legte den Grundstein für seine Karriere als Schriftsteller. Mrs Chambers liebte Verlosungen, die von den Schülern Krähen-Bingo genannt wurden. Zu gewinnen gab es schier unlösbare Sonderaufgaben, Peinlichkeiten und Demütigungen vor versammelter Klasse. Dan war ihr liebstes Opfer. Lange Zeit war er überzeugt davon, dass sie in ihrem Keller teuflische Rituale abhielt und ihn verhext hatte, denn sein Name hüpfte so oft aus dem Lostopf, dass von Zufall keine Rede mehr sein konnte.
Irgendwann dämmerte ihm, dass die Verlosungen ein einziger Schwindel waren und nur dazu dienten, auf den Schwächsten der Klasse herumzuhacken. Bei ihm lag der Fall jedoch anders. Mit seinem angeborenen Gefühl für Sprache brauchte er sich im Gegensatz zu den naturwissenschaftlichen Fächern im Englischunterricht nicht anzustrengen. Selbst die kompliziertesten Grammatikregeln und semantischen Kniffe beherrschte er intuitiv. Damit war er der Krähe ein Stachel im eiternden Fleisch. Ihre Angriffe auf ihn schlugen regelmäßig fehl, was sie in schweigsame Wut versetzte. Dan wusste, dass es ein Fehler war, aber er ließ sie spüren, dass er sich an ihren Niederlagen ergötzte.
An jenem Sommertag 1994 feierte er seinen größten Sieg über Mrs Chambers und vernichtete sie vor den Augen und Ohren der Klasse, womit er sich zum ersten Mal den Respekt seiner Schmäher und Widersacher erwarb.
Der zweifelhafte Gewinn, der diesmal aus dem Lostopf gehüpft war, bedeutete für drei der vier Kandidaten ein zerstörtes Wochenende voller hilfloser Versuche, eine halbwegs lesbare Kurzgeschichte zu Papier zu bringen. Die Wahl des Themas war jedem selbst überlassen. Die Unglücklichen entschieden sich für banale Erzählungen über Besuche im Zoo oder leidlich interessante Begebenheiten der letzten Sommerferien. Dan jedoch tat das, was er am besten konnte: Er schrieb eine Horrorstory, die der Klasse das Blut in den Adern gefrieren ließ. Sie handelte von einer zu Tode gequälten Krähe, die aus dem Jenseits zurückkehrte, um Rache an ihren Peinigern zu nehmen.
Als er nach vorn zur Tafel ging, sah er die Siegesgewissheit in Mrs Chambers Augen. Ihm war klar, dass sie eine Aufgabe gewählt hatte, an der er endgültig scheitern musste. Entgegen ihrer Erwartungen meisterte er sie jedoch mit Bravour. Während er die Geschichte vorlas, herrschte Grabesstille. Mrs Chambers, unschwer als Protagonistin in Form einer Krähe zu erkennen, war totenbleich geworden. Die Wirkung seiner frühen schriftstellerischen Arbeit war so durchschlagend, dass sie bei seinen Mitschülern für wochenlange Albträume und im Lehrerzimmer für Diskussionen über seinen Geisteszustand sorgte.
Vier Jahre später räumte Dan den ersten der zwei Dutzend Preise ab, die die Regale in seinem Arbeitszimmer auf Alderney schmückten. Mit Anfang zwanzig schrieb er einen Bestseller, der sofort verfilmt wurde. Bald verfasste er seine eigenen Drehbücher und gründete mit seinem Freund Maxwell Harper eine Filmproduktionsfirma, weil er nur so sicherstellen konnte, dass seine Werke seiner Vorstellung entsprechend umgesetzt wurden. Verlage und Studios waren skeptisch und begannen zu murren, da sie ihren Einfluss schwinden sahen. Doch Dan ließ sich nicht beirren und arbeitete wie ein Besessener. Nachdem sich der erste Film nach seinem eigenen Drehbuch als Kassenschlager erwies, verstummte die Kritik. Das Wunderkind wurde beklatscht, hofiert und herumgereicht. Er bezog eine Luxusvilla in Chelsea, ging auf Partys, trank zu viel und kam mit Kokain in Kontakt. Er benutzte Drogen, um seine Kreativität weiterhin sprudeln zu lassen, und bemerkte fast zu spät, dass er in eine Abhängigkeit rutschte, aus der er nur schwer wieder herausfand.
Seit jenem heißen Julitag in der Saint Anne’s School im Sommer 1994 hatte Dan gewusst, dass er Erfolg haben würde. Anfangs hatte er die Aufmerksamkeit genossen, doch bald begann er sie zu hassen. Er sehnte sich nach der Stille und Abgeschiedenheit des Mansardenzimmers und mied konsequent jeden öffentlichen Auftritt.
An diesem wichtigen Wendepunkt lernte er Heather kennen. Simon Mayo hatte ihn in The Review Show eingeladen. Der Besuch im Studio veränderte sein Leben. Die Maskenbildnerin, die ihn vor der Sendung betreute, hieß Heather Payne. Sie war bildhübsch, belesen und schien ziemlich intelligent zu sein. Dan hatte sich an jenem Tag Mut angetrunken, um den Auftritt zu überstehen. Wäre er nüchtern gewesen, hätte er sie niemals gefragt, ob sie mit ihm ausgehen wollte. Aber er tat es, und sie sagte: „Klar, warum nicht?“, und strahlte.
Sie landeten noch in derselben Nacht in Dans Hotelbett und heirateten ein halbes Jahr später. Heather befreite ihn von dem Druck, der auf ihm lastete. Sie erkannte instinktiv, worunter er litt, und verschaffte ihm den Freiraum, den er brauchte, um die Geschichten schreiben zu können, mit denen er Mrs Chambers eine Höllenangst eingejagt hatte. Sie war Freundin, Gefährtin, Geliebte, Sekretärin, Testleserin, Lektorin und Büromanagerin. Mit anderen Worten: Sie war das Beste, was ihm je widerfahren war.
Doch dann war ein unvorhergesehenes Ereignis eingetreten, das sein kleines Paradies in einen Ort des Grauens verwandelte. Er begann, unter einer ausgewachsenen Schreibblockade zu leiden, die sich verschlimmerte, so oft er den verdammten Computer einschaltete.
Dan kehrte der glitzernden Filmwelt den Rücken, ließ das mondäne Chelsea hinter sich und kaufte das Haus auf Alderney zurück, in dem er aufgewachsen war; das Fenster zum Balkon, von dem seine Mutter in den Tod gesprungen war, inklusive. Er ließ das Haus nach seinen Vorstellungen umbauen und hoffte, dass seine Muse noch immer das Mansardenzimmer bewohnte. Seine verzweifelte Ohnmacht, auch nur einen brauchbaren Satz zu Papier zu bringen, verschwieg er Heather. Er ließ sie in dem Glauben, dass er aus Heimweh und Sehnsucht nach seinen Wurzeln auf die Insel zurückgekehrt war.
Heather teilte schnell seine Liebe zu Alderney. Was das Schreiben für Dan bedeutete, war der verwilderte Garten mit der knorrigen, alten Eiche hinter dem Haus für Heather. Sie machte aus ihm einen wundervollen Ort voller Wildrosen, Wasserläufe und schattiger Ruheplätze.
Bisher war die heilende Wirkung des Mansardenzimmers ausgeblieben. Wenn Dan es am Morgen betrat, brach ihm kalter Schweiß aus. Er surfte im Internet, las und sah Heather bei der Gartenarbeit zu. Sie glaubte, dass er intensiv an einem neuen Buch arbeitete. Aber das tat er nicht, denn er war unfähig dazu. Er war verzweifelt. Er schlief nicht mehr. Er aß nicht mehr. Er trank.
In eine der Wände seines Schreibzimmers hatte er einen feuersicheren Safe einbauen lassen, in dem zwei von Gummibändern zusammengehaltene Papierstapel ruhten. Er hatte die beiden Manuskripte noch in London geschrieben und vor sieben Monaten zum letzten Mal die magischen Buchstaben ENDE getippt. Seitdem hatte er nichts mehr zustande gebracht.
Dan gab eine Zahlenkombination in das Tastenfeld des Tresors ein, nahm einen der Romane heraus und blätterte mit dem Daumen durch die Seiten. Wann hatte es begonnen? Was war der Auslöser gewesen? Waren es die Spannungen mit Heather? Seit einigen Monaten schienen sie sich zu entfremden. Sie war es gewohnt, dass er oft meilenweit entfernt war, wenn er an einem Buch arbeitete, und akzeptierte es als Teil seiner Arbeit. Aber er hatte sich darüber hinaus verändert, er war nicht mehr der Dan, den er und sie kannten.
Er legte das Manuskript zurück, ging zum Schreibtisch und zog die unterste Lade heraus. In einem versteckten Fach bewahrte er eine Pistole auf. Heather wusste nichts von der Waffe. Er hatte sie in London gekauft, als er eine paranoide Phase durchmachte, und sie ständig bei sich getragen, wenn er das Haus verließ. Dan hatte Angst vor Menschen; vor allem vor verrückten Fans. John Lennon war schließlich keine drei Schritte vor seiner Haustür erschossen worden.
Im vorderen Teil der Lade lag eine halb volle Flasche Chivas Regal. Nach kurzem Zögern nahm er sie heraus, schraubte den Verschluss ab und goss sich zwei Fingerbreit Whisky ein. Dann legte er sie zurück und ging mit dem Glas in der Hand zum Fenster hinüber. Er könnte es ertragen, wenn Gott ihm sein Talent nahm. Er könnte es aushalten, sein Geld zu verlieren.
Heather stand auf dem Schuppendach, ihre schlanke Silhouette zeichnete sich scharf vor dem Morgenhimmel ab. Der Fremde massierte ihre Schultern. Sie schien es sichtlich zu genießen. Dan dachte an die Pistole im Schreibtisch. Er könnte es nicht ertragen, diese Frau zu verlieren.
Der Scotch brannte erst heiß in seiner Kehle, dann breitete sich das vertraute warme Gefühl in seinem Bauch aus und stieg rasch in den Kopf. Er wartete, bis die Wirkung des Alkohols eintrat und er sich leicht benebelt fühlte – ein Zustand, in dem sich beinahe alles ertragen ließ; Fernsehauftritte vor einem Millionenpublikum, vernichtende Kritiken und Schreibblockaden … aber kein halb nackter Dachdecker, der seine Frau massierte.
Er stellte das Glas ab, ging nach unten und verließ das Haus durch die Terrassentür. Der Wind wehte die Stimmen von Heather und diesem Dreckskerl herüber. Dan stapfte den mit Oleander und Lorbeerbüschen gesäumten Kiesweg entlang. Mit jedem Schritt wuchsen Eifersucht und Mordlust. Seine Hand streifte einen Zweig. Reflexartig schloss er seine Finger um ein ledriges Blatt und riss es ab.
Kurz darauf erreichte er die Rückwand des Schuppens. Die Stimmen waren verstummt. Dan griff nach den Holmen der Aluminiumleiter und setzte den Fuß auf die erste Sprosse. Er fürchtete alles, was höher war als ein Hocker – eine Folge seiner Sehschwäche. Der Alkohol half ihm, seine Angst zu überwinden. Er biss die Zähne zusammen und kletterte so schnell hinauf, dass er atemlos auf dem Teerdach anlangte.
Heather drehte sich überrascht um, als sie ihn bemerkte. Sie war allein. Dan stutzte verblüfft. Nun hätte er dem Kerl unweigerlich gegenüberstehen müssen, doch er war verschwunden, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Wie war er vom Dach gelangt?
„Dan! Ich hab dich gar nicht bemerkt, du hast mich erschreckt.“
Heather sah ihn mit ihren großen graugrünen Augen an, das schlechte Gewissen stand ihr ins Gesicht geschrieben.
„Nun, du warst ja auch sehr beschäftigt.“
Er schwankte, alles drehte sich plötzlich um ihn. Körperliche Anstrengungen war er nicht gewohnt. Heather machte einen raschen Schritt auf ihn zu und ergriff seine Hand, sonst wäre er über die Dachkante in die Tiefe gestürzt. Erschrocken keuchte er auf.
„Du hast getrunken“, sagte sie vorwurfsvoll.
„Nur einen Schluck, um die Ideenmaschine anzuwerfen.“
„Es ist 10:00 Uhr morgens!“
Er beugte sich vorsichtig über den Rand des Flachdachs und stierte in die Tiefe. Einen furchtbaren Augenblick lang sah er den leblosen Körper seiner Mutter dort unten liegen. Die gebrochenen Glieder unwirklich verdreht, die blicklosen Augen anklagend auf ihn geheftet. Hätte Heather ihn nicht festgehalten …
„Es läuft nicht gut, oder?“, fragte sie.
„Nein.“
„Es wird leichter werden, wenn du die ersten Seiten geschrieben hast, das weißt du.“
„Ja, vielleicht“, sagte er resigniert.
„Du siehst müde aus, Dan.“
Er zuckte mit den Schultern. Seine Eifersucht war plötzlich verraucht. Der Adrenalinschock hatte sie verdrängt.
„Was ist mit dir los?“
„Gar nichts. Ich habe nur schlecht geschlafen.“
Heather verschränkte die Arme vor dem Oberkörper.
„Schlecht geschlafen? Lüg mich nicht an. Du warst volle zwei Stunden verschwunden.“
Er sah überrascht auf.
„Was meinst du damit?“
„Ich bin gegen 02:00 Uhr aufgewacht, deine Seite des Bettes war leer und kalt.“
„Ich habe gearbeitet, manchmal fallen mir Sachen im Schlaf ein. Wenn ich sie nicht sofort aufschreibe, vergesse ich sie.“
Wovon zum Teufel redete Heather? Er konnte sich nicht an das Geringste erinnern.
„Ich war in deinem Arbeitszimmer, aber da warst du nicht. Wo bist du gewesen, Dan?“
„Ich … ich bin ein bisschen spazieren gegangen“, log er. „Frische Luft schnappen.“
„Um 03:00 Uhr morgens?“
„Na und? Du wusstest doch, dass du keinen Mann heiratest, der einem Bürojob mit festen Arbeitszeiten nachgeht“, entgegnete er giftig.
„Dan, ich mache mir Sorgen. Du hast dich verändert. Die Klippen sind nur dreihundert Meter vom Garten entfernt. Es ist schon tagsüber gefährlich genug, sich dort herumzutreiben. Ich mag nicht daran denken, was in der Dunkelheit passieren könnte … vor allem, wenn du getrunken hast.“
„Du sorgst dich um mich? Ich hatte den Eindruck, dass du dich gerade gut amüsierst. Was treibst du hier oben?“
„Ich repariere das Schuppendach.“
„Das kann ich doch machen.“
„Du hast zwei linke Hände, Dan. Außerdem rede ich seit Wochen davon, dass ich auf Alderney keinen Handwerker finde. Das lockere Geländer der Kellertreppe muss ebenfalls dringend repariert werden, bevor sich einer von uns das Genick bricht.“
„Dann war der Adonis, der sich aus dem Staub gemacht hat, also dein privater Masseur? Du hast gar nichts von ihm erzählt.“ Er funkelte sie wütend an. „Wie ist er denn so? Taugt er was? Besorgt er es dir ordentlich?“
Heather wich vor ihm zurück, als hätte er sie ins Gesicht geschlagen.
„Wovon redest du?“
„Ich habe euch beobachtet. Das Dach hat er jedenfalls nicht gedeckt, aber vielleicht dich?“
Sie drängte sich an ihm vorbei. „Du bist ein Scheusal. Lass deine schlechte Laune nicht an mir aus.“
Dan bedauerte seine Worte bereits, aber was er gesagt hatte, konnte er nicht mehr ungeschehen machen.
„Wenn ich den Kerl noch mal hier erwische, schmeiß ich ihn raus“, rief er.
Heather blieb am Rand des Dachs stehen und drehte sich um. Sie hatte Tränen in den Augen.
„Du bist krank, Dan. Du machst mir Angst, du bist so … anders.“
Er spürte, wie sein Zorn verrauchte.
„Es … tut mir leid. Ich … will nicht, dass er dich … anfasst.“
„Dan, du brauchst Hilfe. Ich habe keinen Dachdecker gefunden. Hier war niemand außer mir. Ich war allein auf dem Dach.“
4
„Good grief!“
Lewis wich unwillkürlich zurück und prallte gegen Steve, dessen Hüfte protestierend schmerzte.
„Kein schöner Anblick“, bestätigte er.
Am Steuer des Wracks stand ein Toter. Jemand hatte ihn mit Leinen an das Speichenrad gefesselt. Es sah aus, als wäre er dazu verdammt, in alle Ewigkeit über die Ozeane zu segeln.
Lewis kniff die Augen zusammen und reckte den Kopf vor, um besser sehen zu können. Gleichzeitig hielt ihn eine morbide Scheu zurück.
„Wie lange ist er wohl schon tot?“, überlegte er.
Steve betrachtete die Leiche. Wind und Sonne hatten sie ausgetrocknet und mumifiziert.
„Mindestens drei bis vier Wochen, vielleicht länger“, antwortete er. „Der Coroner wird uns das genauer sagen können.“
„Sie glauben, es war Mord?“
„Was denken Sie denn? Dass er sich selbst an das Steuerrad gefesselt hat?“
„So etwas habe ich schon erlebt“, bestätigte Lewis. „Wenn sich ein ordentlicher Sturm zusammenbraut, kann ein überkommender Brecher einen Mann von Bord fegen wie einen lockeren Belegnagel. Er reißt alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist, den Skipper eingeschlossen.“
„Können Sie mir auch erklären, wie er es geschafft hat, sich mit gefesselten Händen ein Loch in den Kopf zu schießen?“
Der Hafenmeister trat widerwillig einen Schritt näher. Jeder wusste, dass er kurzsichtig war, sich aber beharrlich weigerte, eine Brille zu tragen.
„Da hol mich doch der Teufel“, murmelte er. „Er wurde tatsächlich ermordet.“
„Sieht ganz danach aus“, sagte Steve.
„Und warum hat der Mörder ihn anschließend an das Steuerrad gebunden?“
„Das gilt es herauszufinden. Wenn wir das verstanden haben, kennen wir vermutlich das Mordmotiv, was uns dann zum Täter führt.“
Er ging an dem Toten vorbei auf den Niedergang zu. Das Holz der Luke war verquollen und klemmte im Süll. Gemeinsam schafften sie es, sich Zugang zu verschaffen, und stiegen unter Deck. In der Kajüte herrschte Chaos. Es war unmöglich zu sagen, ob die raue See das Durcheinander verursacht hatte oder ob eine Auseinandersetzung dazu geführt hatte.
In der winzigen Kombüse stand schmutziges Geschirr. Der Tisch war für zwei Personen gedeckt. Auf den Tellern schimmelten Essensreste. In einem Sektkühler lag eine entkorkte Flasche Champagner, die noch zur Hälfte gefüllt war.
„Was in aller Welt ist hier passiert?“, murmelte Steve.
Lewis rieb sich nachdenklich das Kinn. „Das erinnert mich an den Fund der Mary Celeste.“
„Erzählen Sie mal von der Dame.“
„Keine Frau, sondern eine Schonerbrigg. Die Mary Celeste ist eines der berühmtesten Geisterschiffe. Haben Sie nie von ihr gehört?“
„Nein.“
„Sie wurde von der Bark Dei Gratia auf halber Strecke zwischen den Azoren und Portugal aufgebracht. Die Brigg trieb steuerlos im Atlantik. Bis auf eine defekte Lenzpumpe war sie völlig intakt, von der Besatzung fehlte jede Spur. Unter Deck herrscht ein einziges Durcheinander, Chronometer und Sextant waren nicht aufzufinden, aber angeblich stand in der Kapitänskajüte noch das Frühstück unberührt auf dem Tisch.“
„Und hat man herausgefunden, was geschehen war?“
„Die Mary Celeste wurde von einem Teil der Mannschaft der Dei Gratia nach Gibraltar gesegelt, und es kam zu einer Untersuchung. Aufgeklärt wurde der Fall nie. Die Gerüchte reichen von Versicherungsbetrug bis zur Entführung durch Außerirdische.“
„Letzteres können wir wohl ausschließen“, sagte Steve. „Außerdem haben wir einen Toten. Ich möchte, dass Sie zum Hafen zurückfahren und in den Anmeldelisten nachschauen, ob die Thetis in der Braye Bay vor Anker lag. Mit etwas Glück kennen wir dann den Namen des Besitzers.“
„Sie glauben, dass er der Tote ist?“
„Davon gehe ich im Augenblick aus.“
Lewis deutete auf den gedeckten Tisch. „Er war nicht allein an Bord.“
„Gut beobachtet. Auf mich wirkt das wie ein Candle-Light-Dinner, das überraschend endete“, sagte Steve. „Ich frage mich, wer dafür verantwortlich war – der Gast des Toten oder eine dritte Person, die unerwartet an Bord kam. Was sagt Ihnen denn der Zustand des Bootes?“
„Die Thetis ist in einen schweren Sturm geraten. Ob vor dem Mord oder nachher … Tja, schwer zu sagen.“
„Schauen Sie sich mal um. Vielleicht lässt sich das klären. Ich informiere inzwischen Guernsey.“
Steve ging an Deck und wählte die Nummer des Reviers. Penny meldete sich umgehend.
„Ruf Ian Laney an“, sagte er. „Wir brauchen die Spurensicherung und den Coroner.“
„Sag mir nicht, dass wir einen Mord haben.“
„Leider doch. Unser Fliegender Holländer ist wieder aufgetaucht.“ Er berichtete von der havarierten Segeljacht.
„Laney wird sich die Haare raufen“, sagte Penny, „ein Mordfall hat uns gerade noch gefehlt, gerade jetzt, wo das Food & Drink Festival in den Startlöchern steht.“
„Das ist nicht zu ändern. Die Sache bleibt unter uns, bis wir mehr wissen. Es fehlt noch, dass die Guernsey Press davon Wind bekommt.“
„Was soll ich sagen, wenn ein Reporter anruft? Die riechen einen Mord meilenweit.“
„Vertröste sie damit, dass wir zu gegebener Zeit eine Pressekonferenz abhalten und dass du zu laufenden Ermittlungen keine Informationen geben darfst.“
„Okay.“
Penny legte auf. Lewis erschien schnaufend an Deck.
„Jemand hat versucht, die Jacht zu versenken, aber er hat wohl aufgegeben. Die Thetis ist eine moderne Kunststoffkonstruktion mit einem glasfaserverstärkten Rumpf. Den kann man nicht so einfach aufhacken wie’n altes Holzboot.“ Neugierig wagte er sich in die Nähe der Leiche und studierte die Knoten am Steuerrad. Dann nickte er heftig. „Hab ich mir gedacht.“
„Was denn?“
„Der Mörder hat den armen Kerl ans Ruder gebunden, um es festzulaschen.“
„Können Sie das genauer erklären?“, fragte Steve.
„Aber ja. Er hat die Thetis auf Westkurs gesetzt, damit sie auf den offenen Atlantik hinaustreibt und auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Bei Sturm hat eine solche Nussschale dort draußen keine Chance.“
„Eine Jacht dieser Größe besitzt kein Beiboot, nicht wahr?“
Lewis schüttelte den Kopf. „Ich schätze die Thetis auf dreizehn Meter Länge. Sie ist zu klein für ein Dingi.“
„Das bedeutet, dass der Mörder unterwegs an Bord gekommen sein muss.“
„Und er hat die Thetis in Begleitung wieder verlassen, sonst hätten wir eine zweite Leiche gefunden.“
„Kann sein. Vielleicht gab’s auch einen Streit und sie ging über Bord.“
„Das trifft’s, Chief. Er hat sein dreckiges Handwerk erledigt und sich wieder aus dem Staub gemacht.“ Der Hafenmeister kratzte sich den kahl werdenden Schädel. „Aber warum machte er sich die Mühe, die Thetis versenken zu wollen? Es hätte doch gereicht, sein Opfer ins Wasser zu werfen.“
„Es sei denn, er hat etwas zurückgelassen, was ihn als Täter überführen würde.“
Lewis nickte nachdenklich. „Das wäre eine Möglichkeit. Ich frage mich, was das sein könnte.“
„Die Spurensicherung aus Guernsey wird das Boot untersuchen. Möglicherweise war der Täter lange genug an Bord, um seine DNA zu hinterlassen. Vielleicht landen wir bei einem Abgleich mit unserer Datenbank einen Treffer, oder die Kugel im Kopf des Opfers passt zu einer Waffe, die wir zuordnen können.“
„Sie meinen, sie steckt noch drin?“
„Ich sehe jedenfalls keine Austrittsöffnung am Hinterkopf. Der Coroner wird uns mehr zu Schusskanal und Tatwaffe verraten. Im Augenblick interessiert mich mehr, warum der Plan des Mörders nicht funktionierte. Wieso kam die Thetis zurück?“
„Wahrscheinlich hat sich das Ruder verstellt, als die Leiche anfing zu verwesen“, erklärte Lewis. „Das Boot hat einen großen Kreis beschrieben und ist dann nach Alderney zurückgelaufen.“ Er betrachtete kopfschüttelnd den gebrochenen Mast. „Auf jeden Fall hat’s mächtig geweht. Ich werde die Wetterberichte der vergangenen Wochen durchgehen. Mal schauen, ob es irgendwann einen heftigen Sturm da draußen gab.“
Steve nickte. „Danke. Das wäre eine große Hilfe. Wird der Kurs einer solchen Jacht nicht über GPS aufgezeichnet, um ihn nachverfolgen zu können?“
„Das wird er.“
„Dann lässt sich also rekonstruieren, wo sich die Thetis in den vergangenen Wochen aufgehalten hat?“
Lewis schüttelte den Kopf. „Nein, leider nicht. Kommen Sie mal mit, Chief.“
Sie gingen noch einmal unter Deck. Der Hafenmeister zeigte ihm den Steuerstand.
„Hier hat jemand ganze Arbeit geleistet. Navigationsinstrumente und Funk wurden mit roher Gewalt aus den Halterungen gehebelt. Ich wette, Sie finden die Geräte auf dem Grund des Ärmelkanals.“
„Der Mörder kannte sich demnach aus. Er wusste, was er tun musste, um seine Spuren zu verwischen.“
„Davon sollten Sie ausgehen. Was werden Sie jetzt unternehmen?“, fragte Lewis.
„Wir gehen die Vermisstenmeldungen durch. Wenn wir Glück haben, können wir die Identität des Toten schnell klären. Falls er kein Eremit war, muss jemandem aufgefallen sein, dass er plötzlich verschwunden ist.“
Steve ging an Deck. Die Tide war gestiegen, die Brandung scheuerte das Wrack an den Riffen.
„Sie kommt bald frei“, sagte Lewis.
Skeptisch beobachtete er die Versuche der Besatzung des kleinen Rettungskreuzers, eine Schleppleine an der Jacht zu befestigen. Er stieß einen saftigen Fluch aus.
„Nicht so, ihr Dummköpfe“, schimpfte er. „Um alles muss man sich selbst kümmern.“
Der Alte war in seinem Element. Steve grinste.
„Bringen Sie mich von Bord. Ich fahre ins Revier“, sagte er. „Und denken Sie daran, die Leiche zu bedecken. Wir wollen ja nicht, dass ein Toter geradewegs in den Hafen von Saint Anne segelt.“
Watson empfing ihn mit gebührendem Abstand, aber schwanzwedelnd. Als Steve die Hand nach ihm ausstreckte, um ihn zu begrüßen, wich der Hund zurück.
„Okay, ein Wedeln ist mehr, als ich erwartet habe“, sagte er. „Lass uns nach Hause fahren. Ich spüre meine Zehen nicht mehr. Das Wasser ist verflucht kalt in dieser Jahreszeit.“
Eine halbe Stunde später zog er sich in dem alten Pfarrhaus über den Klippen um und fuhr dann nach Saint Anne. Instinktiv wählte er die nördliche Route über die Tourgis Hill und die Platte Saline Road, die ihn am Mignot Memorial vorbeiführte.
Das Krankenhaus lag unterhalb von Fort Doyle im Norden der kleinen Kanalinsel. Er parkte den Streifenwagen auf dem Wendehammer vor der Klinik und zog den Zündschlüssel ab. Watson winselte leise. Er spürte die Unruhe seines Besitzers.
„Geht mir genauso“, sagte Steve, „aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben.“
Er öffnete die Wagentür. Der Wind hatte stark zugelegt und riss ihm beinahe den Griff aus der Hand.
„Du wartest hier. Sie dulden keine Hunde in der Klinik.“
Watson wuffte empört.
„Nein, auch keine Deputys mit Fell.“
Er stieg aus und näherte sich dem Eingang des Mignot Memorial. Als er die Halle durchquerte und sich auf den gewohnten Weg zu der Station machte, auf der Abby lag, kehrten die Bilder zurück: das Red Door, Cataldo, die alte Granate, die alle für eine Attrappe gehalten hatten, und der brennende Schmerz, als sich die Metallsplitter in seine Hüfte bohrten. Abby, die endlich das Zeugenschutzprogramm verlassen durfte, auf Alderney ankam und keine halbe Stunde später unter den Kugeln aus Cataldos Waffe vor dem Revier zusammenbrach. Ivys große Kinderaugen, die ihn fragend anblickten und darauf hofften, dass er ein Wunder bewirken und ihre Mutter wieder aufwachen lassen könnte.
Steve blieb vor der Zimmertür stehen. Dahinter lag der lebende Leichnam der Frau, die er über alles liebte und deren wunderbare Seele nun durch das einsame Niemandsland zwischen Leben und Tod wanderte.
„Chief Cole?“
Gedankenverloren drehte er sich um. Vor ihm stand Dr. Hopkins, der Klinikleiter.
„Wie geht es ihr?“, fragte Steve.
„Sie wissen, dass ich Sie eigentlich gar nicht darüber informieren darf.“
„Warum tun Sie’s dann?“
„Ich weiß, in welch engem Verhältnis Sie zu ihr stehen. Ihr Zustand hat sich verschlechtert. Wir können sie hier nicht länger behandeln. Das Mignot Memorial ist für Komapatienten nicht ausgerüstet. Auf dem Festland gibt es sehr viel besser geeignete Einrichtungen.“
„Sie beabsichtigen, Abby zu verlegen“, sagte Steve.
„Das ist dringend geboten, aber es gibt ein Problem. Da Sie nicht verheiratet sind und Abby sich nicht selbst äußern kann und mir keine Patientenverfügung vorliegt, muss ihre Mutter entscheiden, was geschehen soll. Sie ist die nächste Angehörige.“
„Haben Sie mit Kate Bonham Kontakt aufgenommen?“
„Ja.“
„Und wo liegt das Problem?“
„Die Dauerbehandlung von Komapatienten ist sehr kostenintensiv.“
„Abby ist doch krankenversichert.“
„Die Kasse übernimmt nur die Grundversorgung. Ich fürchte, Mrs Bonham verfügt nicht über die nötigen finanziellen Mittel, um …“
„Was wollen Sie also tun? Den Stecker ziehen und sie sterben lassen?“, schnitt ihm Steve das Wort ab.
„Nein, natürlich nicht. Ich möchte Sie darüber in Kenntnis setzen, dass sich jemand bereit erklärt hat, die Behandlungskosten zu übernehmen. Er wartet in ihrem Zimmer auf Sie.“
„Auf mich?“
„Er versicherte mir, Sie seien einander bekannt und … nun, er benutzte das Wort verpflichtet.“
Steve beschlich ein böser Verdacht.
„Danke, dass Sie mich vorgewarnt haben“, sagte er.
Hopkins entschuldigte sich, seine Patienten warteten. Steve betrat das Krankenzimmer. Abbys Gesicht hatte eine ätherische, entrückte Schönheit angenommen, ihre Haut schimmerte beinahe durchsichtig, als weilte sie bereits nicht mehr ganz in der materiellen Welt.
Vor dem Fenster stand ein hagerer Mann mit grau meliertem Haar. Steve sah seine schemenhafte Spiegelung in der Fensterscheibe – das asketische Antlitz eines mittelalterlichen Predigers. Die Augen lagen tief in den Höhlen, überspannt von einem vorspringenden Knochenkamm. Zwei messerscharfe Falten rahmten den blutleeren Mund ein und nahmen ihm jeden Zug von Nachsicht. Als er Steve bemerkte, wandte er sich um.
„Sie scheinen nicht überrascht zu sein, mich zu sehen, Chief Cole. Oder soll ich Sie lieber mit Ihrem richtigen Namen anreden, Detective Chief Inspector Thomas McCallum?“
„Chief reicht völlig. Es wird ohnehin ein kurzes Gespräch werden.“
Viktor Sorokin, einer der einflussreichsten Unterweltbosse von London, zeigte ein Lächeln, das einem Piranha alle Ehre gemacht hätte.
„Sie haben sich nicht verändert – noch immer zu stolz, um Hilfe anzunehmen.“
„Das hat nichts mit Stolz zu tun. Ich schließe lediglich keinen Handel mit dem Teufel ab, falls Sie das im Sinn haben.“
„Aber, aber. Wie kommen Sie darauf, dass ich etwas von Ihnen verlangen könnte?“
„Sie geben nichts, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Ihre Motive dürften wohl kaum altruistischer Natur ein.“
Sorokin blickte auf Abbys wächsernes Gesicht.
„Sagen wir, ich bin nicht ganz unschuldig an dieser bedauerlichen Situation“, antwortete er.
„Was wollen Sie?“
„Ohne Sie hätte ich niemals erfahren, dass Juan und Natasha mich hintergangen haben. Nicht nur das. Sie haben mir aufgezeigt, dass die Entscheidung falsch war, Sie meiner Vendetta auszusetzen. Ich stehe in Ihrer Schuld. Einen solchen Zustand kann ich auf Dauer nicht akzeptieren.“
„Keine Sorge, ich bin nicht nachtragend. Wir sind quitt. Verlassen Sie Alderney, und belästigen Sie mich nie wieder.“
„Nicht so hastig, Chief. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen, das Sie nicht ablehnen können. Zumindest sollten Sie sich anhören, was ich zu sagen habe.“
„Dr. Hopkins hat mich bereits über Ihre Absichten aufgeklärt“, sagte Steve.
„Abby wird sterben, wenn sie keine bessere medizinische Versorgung erhält. Sehr bald sogar“, sagte Sorokin.
„Tun Sie, was Sie für richtig halten. Sie brauchen dafür weder meine Erlaubnis, noch kann ich Sie davon abhalten. Kate Bonham muss entscheiden, was mit ihrer Tochter geschieht, nicht ich.“
Sorokin deutete ein Kopfschütteln an, sparsam und wohlüberlegt wie alle seine Bewegungen.
„Das ist nicht ganz korrekt.“
„Sie haben mit ihr gesprochen?“
„Ja. Sie war höchst erfreut über das Hilfsangebot eines alten Freundes von Abby und Ihnen.“
„Wir sind keine Freunde.“
Sorokin lächelte. „Was nicht ist, kann ja noch werden. Wie ich hörte, verstehen Sie sich nach anfänglichen Zwistigkeiten inzwischen auch mit John Baxter recht gut.“
„Ich könnte Kate Bonham darüber aufklären, wer Sie wirklich sind. Wenn ihr klar wird, dass Sie Cataldo beauftragt haben, Abby zu ermorden, um mich zu treffen, wird sie sich überlegen, ob sie Ihre Hilfe annimmt.“
„Unwahrscheinlich. Sie will, dass ihre Tochter lebt. Ihre Enkelin braucht eine Mutter. Abgesehen davon hat Juan auf eigene Faust gehandelt, wie Sie wissen. Ich erteilte ihm nicht den Auftrag, auf Abby zu schießen.“
„Sie haben ihn aber auch nicht zurückgepfiffen.“
„Ich wusste nicht, was er vorhatte. Fehlende Informationen können stets bedrohlich sein. Ein Fehler, der mir nicht noch einmal unterläuft.“
„Das ändert nichts an unserer Beziehung.“
„Das vielleicht nicht, aber die Tatsache, dass Abby eine Patientenverfügung verfasst hat.“
„Woher wissen Sie davon?“
Sorokin lächelte schmal. „Kate Bonham nahm Kontakt zu Abbys Hausarzt in London auf. Sie hatte die Verfügung bei ihm hinterlegt.“ Er griff in die Innentasche seines Sakkos und zog einen Briefumschlag hervor. „Ich habe hier eine beglaubigte Kopie, die mir ihre Mutter freundlicherweise überlassen hat. Ich versprach, sie Ihnen zu geben.“
Steve nahm den Umschlag, riss ihn auf und las. Überrascht sah er auf.
„Sie hat mich als Bevollmächtigten eingetragen?“
„Vielleicht ahnte sie das Unheil voraus. Sie wusste, dass sie sich in Gefahr begab, und setzte offenbar großes Vertrauen in Sie. Sie können meine Unterstützung natürlich ablehnen, aber bedenken Sie, dass Abby sterben wird, wenn sie in diesem Provinzkrankenhaus bleiben muss. Ihr bleibt nicht mehr viel Zeit.“
Steve schwieg entsetzt.
„Dr. Hopkins wird Ihnen bestätigen, dass Eile geboten ist, falls Abby noch eine Chance haben soll“, fuhr Sorokin fort. „Sie verstehen also, warum ich mit Ihnen reden wollte. Ihr Schicksal liegt in Ihrer Hand.“
„Was verlangen Sie von mir?“
„Ich erwarte keine Gegenleistung. Sie haben bereits geliefert, in dem Sie mich mit der Nase auf Natashas Verrat stießen.“
„Das fällt mir schwer zu glauben.“
Sorokin nahm seinen Mantel auf, der über einer Stuhllehne hing.
„Nun, unter Freunden steht man sich bei, nicht wahr? Ich bitte Sie lediglich um eine kleine Gefälligkeit. Lassen Sie John Baxter an der langen Leine laufen, und stecken Sie den Bericht an die Londoner Steuerfahndung in den Reißwolf. Alderney wird es Ihnen danken. Auf der Rückseite der Kopie finden Sie eine Telefonnummer, unter der Sie mich erreichen können. Benutzen Sie dazu das Prepaidhandy, mit dem Sie Kontakt zu Abby aufgenommen haben, als sie im Zeugenschutz war. Es dient unserer Sicherheit. Niemand aus Ihrem Team sollte erfahren, dass wir in Verbindung stehen, nicht wahr? Vor allem nicht Sergeant Lyme. Guten Tag.“
Ohne eine Erwiderung abzuwarten, verließ Sorokin das Zimmer. Steve blickte auf die schlafende Abby. Vielleicht sah er sie zum letzten Mal lebend. Wenn er ablehnte, besiegelte er ihren Tod. Er dachte an das steuerlose Boot, das immer wieder aufgetaucht war wie ein Spuk und ihn zu verfolgen drohte. War es ein Omen gewesen? Ein Schiff, gesteuert von einem Fährmann, der geschickt worden war, um Abby ins Reich der Toten zu geleiten?
Er sank auf den Stuhl neben dem Bett, nahm Abbys Lieblingsroman Sturmhöhe vom Beistelltisch und begann laut zu lesen, so wie er es bei jedem seiner Besuche tat. Nach wenigen Sätzen verstummte er, legte das Buch zurück und verließ das Mignot Memorial. Er musste eine Entscheidung treffen, und zwar schnell. Was war ihm Abbys Leben wert?
Als er hinter dem Steuer des Streifenwagens saß, vermochte er nicht zu sagen, wie er dorthin gekommen war. Watson begrüßte ihn stürmisch, er blieb nicht gerne allein.
„Wenn man sich mit Hunden ins Bett legt, wacht man mit Flöhen auf“, sagte Steve. „Kennst du das Sprichwort?“
Der Hund blickte ihn fragend an.
„Es bedeutet, dass ich entweder so korrupt werde wie Baxter und Sorokin oder Abby sterben wird.“
Watson schnaubte durch die Nase.
„Nein, die Wahl gefällt mir auch nicht.“
Blieb ihm denn überhaupt eine Wahl?
5
17. September