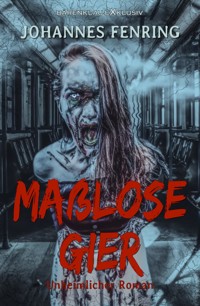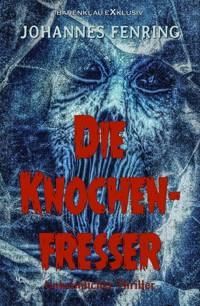
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein gebrochener Finger, ein roter Farbfleck an der Wand, ein vager Duft und eine besondere Ausgabe der Sechs-Uhr-Nachrichten: Das sind die Zutaten für einen hausgemachten Wahnsinn. »Die Knochenfresser« erzählt die Geschichte der zu jungen Mutter Esther Wolf. Entfremdet von ihrem eigenen Leben, geplagt von einem tristen Alltag und in verzweifelter Sehnsucht nach einem Ausweg fällt sie eine folgenschwere Entscheidung, die alles verändern soll. Nur welche Folgen ihr Handeln tatsächlich hat, begreift sie erst, als es zu spät ist. Schon bald gerät ihre Welt aus den Fugen und mit ihr Esthers Verstand …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Johannes Fenring
Die Knochenfresser
Unheimlicher Thriller
Impressum
Neuausgabe
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover: © by Steve Mayer nach Motiven, 2023
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die Handlungen dieser Geschichte ist frei erfunden sowie die Namen der Protagonisten und Firmen. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.
Alle Rechte vorbehalten
Das Copyright auf den Text oder andere Medien und Illustrationen und Bilder erlaubt es KIs/AIs und allen damit in Verbindung stehenden Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren oder damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung erstellen, zeitlich und räumlich unbegrenzt nicht, diesen Text oder auch nur Teile davon als Vorlage zu nutzen, und damit auch nicht allen Firmen und menschlichen Personen, welche KIs/AIs nutzen, diesen Text oder Teile daraus für ihre Texte zu verwenden, um daraus neue, eigene Texte im Stil des ursprünglichen Autors oder ähnlich zu generieren. Es haften alle Firmen und menschlichen Personen, die mit dieser menschlichen Roman-Vorlage einen neuen Text über eine KI/AI in der Art des ursprünglichen Autors erzeugen, sowie alle Firmen, menschlichen Personen , welche KIs/AIs bereitstellen, trainieren um damit weitere Texte oder Textteile in der Art, dem Ausdruck oder als Nachahmung zu erstellen; das Copyright für diesen Impressumstext sowie artverwandte Abwandlungen davon liegt zeitlich und räumlich unbegrenzt bei Bärenklau Exklusiv.
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Die Knochenfresser
1. Teil – Die Nacht, in der ein Wald wuchs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
2. Teil – Ein Ozean aus Eisen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
3. Teil – Das rote Licht
1.
2.
3.
4.
Von Johannes Fenring ist weiterhin erschienen
Das Buch
Ein gebrochener Finger, ein roter Farbfleck an der Wand, ein vager Duft und eine besondere Ausgabe der Sechs-Uhr-Nachrichten: Das sind die Zutaten für einen hausgemachten Wahnsinn. »Die Knochenfresser« erzählt die Geschichte der zu jungen Mutter Esther Wolf. Entfremdet von ihrem eigenen Leben, geplagt von einem tristen Alltag und in verzweifelter Sehnsucht nach einem Ausweg fällt sie eine folgenschwere Entscheidung, die alles verändern soll. Nur welche Folgen ihr Handeln tatsächlich hat, begreift sie erst, als es zu spät ist. Schon bald gerät ihre Welt aus den Fugen und mit ihr Esthers Verstand …
***
Die Knochenfresser
Unheimlicher Thriller von Johannes Fenring
1. Teil – Die Nacht, in der ein Wald wuchs
1.
Windungen, endlos viele, alle greifen ineinander. Sie umschlingen sich, verknoten sich, überlagern sich. Die Stränge laufen in alle Richtungen davon. Ihre Oberfläche ist so weich, dass selbst abgestumpfte Zähne sie durchdringen könnten. Wer weiß, was in ihrem Inneren verborgen liegt. Und dann ist da dieser rote Schleim, der sie umgibt. Sie haben sich damit vollgesogen, sie winden sich darin, sie triefen davon. Einige von ihnen wickeln sich um einen Fremdkörper. Braun und rund, huckelig, wie ein Klumpen, den man aus einem Gehirn gerissen hat. Der rote Schleim hat sich zwischen die Pocken gelegt, die die unebene Außenhülle des Klumpens übersehen. Da liegen noch mehr von ihnen, eingewickelt in die weichen Stränge.
Ich steche mit der Gabel hinein. Meine Oberlippe zuckt, verrät meinen Ekel, obwohl ich ihn verstecken will. Ich drehe das Besteck, sodass einige der Stränge sich um die metallenen Spitzen winden. Einen Moment lang halte ich inne. Zu lang, mir rutscht die Gabel aus den Fingern und sie prallt mit einem klirrenden Geräusch auf den Porzellanteller. Die Spaghetti rollen sich wieder ab.
Seufzend stehe ich auf und greife nach der Papierrolle, die auf der Küchentheke steht. Ich reiße ein Blatt ab und lege es auf die roten Spritzer, die sich über den Tisch verteilt haben. Sofort zieht das Papier sich mit der Tomatensoße voll, es entstehen kleine rote Kreise, die immer weiterwachsen. Ich wische sie hinfort.
»Was machst du da?«
Ohne zu antworten setze ich mich wieder hin und starre weiter auf den Teller. Die Fleischklöße dampfen. Ihr Geruch vermischt sich mit der Luft, ich spüre wie er mir bedrohlich näher kommt, mir in die Nase steigt und sich versucht, in die Poren meiner Haut zu graben. Wie eine unsichtbare Hand greift er nach meiner Kehle, umschließt sie, drückt zu. Mein Hals rebelliert. Ich schiebe den Teller von mir.
»Bist du fertig?«
»Ja. Ich bin fertig.«
Er sieht mich mit großen, fragenden Augen an. Sein Gesicht ist verschmiert. Rot ummalt seinen Mund, es erstreckt sich bis hinunter zu seinem Kinn, einige Spritzer kleben an seiner linken Wange. Wie ein Tier, dass gerade seine scharfen Zähne in das weiche Fleisch eines Opfers gerammt hat und dem nun das fremde Blut literweise aus dem Schlund rinnt. Und seine großen, fragenden Augen bohren sich in meinen Schädel, so tief, dass der Knochen anfängt zu splittern und zu bersten. Ich höre es, das Knacken und Krachen. Gleich werden die spitzen Bruchstücke mein schutzloses Hirn zerstückeln …
»Darf ich das haben?«
»Ja.«
Er rammt die Gabel in einen der Fleischbälle. Er teilt sich in der Mitte und zerfällt in zwei Hälften. Das Innere ist heller, leicht gräulich braun. Es sieht weich und lebendig aus, es kommt mir vor, als würde es noch pulsieren. Er spießt eine der Hälften gierig auf und stopft sie sich in den Mund. Seine Zähne zermalmen das Fleisch. Ich sehe ihm zu, als wäre er ein Außerirdischer.
Der Teller ist leer. Blank, wie ein abgenagtes Skelett. Er wischt sich mit dem Ärmel das Gesicht sauber. Einmal über den Mund, sodass der ganze rote Schleim in der faserigen Wolle seines Pullovers kleben bleibt. Auch sie saugt die Flüssigkeit einfach so auf. Sie alle saugen sie auf, als wäre sie so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen. Er schaut mich wieder an. An seiner linken Wange klebt noch immer etwas Rotes. Ich starre darauf. Er starrt zurück.
»Hier.« Ich reiße ein Blatt von der Papierrolle ab und reiche es ihm. »Wisch dir dein Gesicht damit.«
Er nimmt das Papier, drückt es sich vor die Nase und schnieft. So fest, dass man befürchten könnte, der Inhalt seines Kopfes könnte durch seine Nüstern geschossen kommen. Aber diese Angst habe ich schon vor langem begraben. Nun faltet er das Blatt und wiederholt den Vorgang. Ich schaue ihm dabei zu, diesem Außerirdischem. Und manchmal frage ich mich, ob er das nicht vielleicht auch ist.
2.
In letzter Zeit ähneln sich die Tage mehr und mehr. Es kommt mir so vor, als hätte jemand die Ziffern auf den Kalenderblättern mit Wasserfarbe aufgemalt; und noch ehe sie getrocknet ist, wischt dieser Jemand mit der Hand darüber, sodass die Zahlen verwischen. Die Farben laufen ineinander, vermischen sich, werden eins. Schaue ich zurück, sehe ich nur einen einzigen, schmierigen Farbfilm. Ohne Konturen, ohne Muster. Versuche ich nach vorn zu blicken, dann resignieren meine Augen, weil sie sofort erkennen, wie feucht die Farbe ist, mit der man die Zahlen auf meine Kalenderblätter gemalt hat.
Es regnet. Die Tropfen fallen wie dicke Tränen aus den Wolken und zerplatzen auf der Frontscheibe des Autos. Der Scheibenwischer schiebt die nassen Überreste aus meinem Sichtfeld, drückt sie einfach zu der Seite weg, wo sie sich auftürmen, neu verbinden und schließlich davon fließen. Wohin auch immer. Jedes Mal, wenn ein neuer Tropfen auf der Scheibe auftrifft, glaube ich hören zu können, wie die einzelnen Wassermoleküle auseinanderbrechen. Die Schwingungen vibrieren in meinen Ohren. Jedes Härchen im Inneren meines Gehöres biegt sich, windet sich im Takt des zerschellenden Wassers.
Irgendwo am Rande nehme ich noch etwas anderes wahr. Eine Stimme. Penetrant sticht sie durch alles andere hindurch, versucht den trommelnden Regen zu verdrängen. Wie eine Krankheit, ein durchgehendes, fiependes Geräusch. Hartnäckig beschlagnahmt es Stück für Stück die tanzenden Härchen, die sich willenlos ergeben und jede Erinnerung an die platzenden Wassertropfen fallen lassen. Als würden sie gegen mich arbeiten. Dabei haben sie doch gar keinen Willen. Sie funktionieren nur. Und im Moment funktionieren sie, um seine Stimme in meinen Kopf zu lassen.
»…und dann male ich heute noch ein Bild, und dann …«
Wir halten an einer Ampel. Das kreisrunde, rote Licht bricht sich zunehmends, weil ich den Scheibenwischer ausgestellt habe. Die Tropfen zersplittern in ihre Einzelteile, doch nun gibt es niemanden, der sie aufräumt. Sie bleiben liegen. Wie auf einem blutigen, dampfenden Schlachtfeld nach einem brutalen Massaker. Das rote Licht windet sich durch die letzten, freien Rillen zu uns hinein in das Auto. Irgendwann sehen wir nur noch ein getrübtes Abbild, verschleiert von einem Film aus kaputtem Wasser.
Ich setze den Blinker. Das Geräusch beruhigt mich. Es ist konstant und gleichmütig. Für einen Moment schließe ich die Augen. Hier, in der Dunkelheit gibt es nur mich und das Geräusch des Blinkers. Klick, Klack, Klick, Klack … Ich atme aus. Klick, Klack …
»… und heute Abend … Es ist grün!«
Nein. Ich bin nicht allein. Auch hier nicht. Nirgendwo.
»Es ist grün, das heißt wir können fahren, oder?«
Ich schlage die Augen auf. Das Rot ist verschwunden, wurde ersetz durch ein unnatürliches, grünes Leuchten. Es frisst sich durch die oberen Schichten des Wassers auf der Frontscheibe, bis sich alles damit vollgesogen hat. Die Farbe verschwimmt, ihre Ausläufer breiten sich aus. Es gibt keine Chance noch richtig zu beurteilen, wo das grüne Licht tatsächlich seinen Ursprung hat. Ich tippe den Scheibenwischer an und alles ist wieder verschwunden. Kupplung, schalten, Gas.
»Was heißt Gelb?«, fragt er.
»Es heißt Vorsicht.«
»Vorsicht?«
»Ja, weil die Ampel doch umspringt.«
»Aber vorhin bist du gefahren, obwohl es gelb war.«
»Ja.« Ich höre meiner eigenen Stimme an, dass sie müde ist. Ich hasse sie dafür. Sie sollte nicht müde sein. Sie sollte unablässlich versuchen ihm die Welt zu erklären. Damit er sie begreift.
»Aber …«
»Ich war vorsichtig. Okay? Das ist es, was gelb bedeutet. Man soll vorsichtig sein. Und das war ich doch, oder?«
»Nein. Du hast doch nur auf die Scheibe gestarrt.« Er zeigt auf die Regentropfen, die immer noch unablässig auf das Glas prallen.
Ich muss lächeln, unweigerlich. Ob aus Verzweiflung oder Vergnügen, das kann ich selber nicht so genau erkennen. Auch das ist verschwommen. Alles mit der gleichen, billigen Wasserfarbe gemalt.
»Wir sind gleich da«, sage ich.
»Haben die Papier?«
»Natürlich haben die Papier, das weißt du doch, du gehst jeden Tag …« Mein Satz verliert sich irgendwo auf halber Strecke.
»Ich will nämlich ein Bild malen.«
»Ja. Ich weiß.« Wie auch nicht? Er hat es mindestens einhundertfünfzig Mal erwähnt.
»Gut.« Er lacht.
»Wieso lachst du?«
»Du bist an der Einfahrt vorbeigefahren.«
Ich atme aus. Man hat mir gesagt, ich soll nicht wütend werden. Und ich soll bloß nicht seufzen. Er würde das verstehen. Er wäre ja nicht dumm. Deswegen atme ich einfach aus. Was will er schon aus einem Ausatmen machen? Er kann mich unmöglich dafür anklagen, dass ich ausatme. Jeder Mensch muss ausatmen.
»Dann muss ich wenden.«
»Ja, du musst wenden.«
Ich setze wieder den Blinker. Diesmal versuche ich nicht einmal mehr ihn auszublenden und so zu tun, als gäbe es keine anderen Geräusche als das Klicken und das Klacken.
»Aber die Ampel ist rot.«
»Ja, das ist richtig. Die Ampel ist rot.«
»Dann musst du halten.«
»Ja. Richtig.«
»Hältst du?«
»Ja.«
Wir stehen und warten. Das rote Licht scheint auf uns hinab. Der Regen hat nachgelassen.
»Immer noch?«
Mir ist, als würde ein Brennen durch meinen Kopf fahren. Es sucht einen Ausweg, und die einzige Möglichkeit scheinen meine Augen zu sein. Es flieht, und es hinterlässt dabei ein beißendes Prickeln auf meinen Augäpfeln, die sich daraufhin in Flüssigkeit ertränken wollen.
»Ja. Immer noch«, sage ich. Und atme aus.
»Da sind sie ja.« Eine Frau hält uns die Tür auf, während wir durch den Regen gelaufen kommen. Ich muss meine Kapuze mit beiden Händen festhalten, weil der Wind sie sonst von meinem Kopf weht. Der Regen prasselt schwer auf uns hinab. Meine Haare sind nass, da ich immer wieder die Kapuze loslassen musste, um ihm zu helfen seine eigene wieder aufzusetzen.
»Entschuldigen Sie, wir sind ein bisschen spät …«, sage ich, während wir hinein gehen. Wir betreten einen breiten Flur, dessen Wände aus Fensterfronten bestehen. Der Korridor führt in beide Richtungen.
»Jonsi kommt mit mir, nicht wahr?«
»Ja, Frau Dings.«
Sie lacht. »Du weißt doch meinen richtigen Namen, oder?« Die Frau hat sich zu ihm hinuntergebeugt und sieht ihn mit einem gutmütigen Lächeln an. Ich schaue ihr zu und befürchte für einen kurzen, unsinnigen Moment lang, dass ihre großen Brüste sie vornüberkippen lassen könnten.
»Ja, Frau Dings.«
Sie lächelt gutmütig und richtet sich wieder auf. Nun schaut sie mich an »Sie holen ihn dann heute Nachtmittag ab?«
»Ja. Ich versuche pünktlich zu sein.«
Da ist noch ein Schimmer der Gutmütigkeit in ihren Zügen, aber das scheint nur eine blasse Erinnerung zu sein. Oder Farbe, die sich nicht ganz herausgewaschen hat. Ihre Haut ist faltig, jetzt, wo sie nicht mehr lächelt, sieht man das ganz genau, da alles schlaff herunterhängt. Ihr Kinn ist wuchtig. Es scheint mir, als wäre ihr Kiefer viel zu weit nach vorne versetzt. Und ihre Augen starren mich aus finsteren Einhöhlungen an. Die Wärme ist gewichen, sie scheint nun genauso kühl wie das Wetter draußen.
»Sie wissen ja …«
»Ja«, würge ich sie ab. »Ich weiß.«
Sie nickt.
»So.« Und schon dreht sich das Kinderkarussell in ihrer Stimme wieder. »Dann komm mal mit, mein Kleiner.« Sie nimmt Jonsi an der Hand und er folgt ihr widerstandslos. Schon fängt er an zu erzählen, was er heute alles vorhat. Überraschenderweise scheint er heute ein Bild malen zu wollen … Ich sehe ihnen hinterher. Die Frau, mit ihrem breiten Hinterteil, der einen eigenen Knochenbau zu haben scheint, und ihm. Seine Gestalt ist so zierlich, manchmal glaube ich kaum, dass in etwas so Kleinem, schon so viel drinstecken kann. Und dann wiederum kann ich es nicht fassen, dass aus dem winzigen Etwas, dass er einmal war, etwas so Großes geworden ist. Und wie groß er noch werden kann. Es ist mir unheimlich. Fraglich, ob die Gänsehaut von diesem Gedanken herrührt, oder von dem Fakt, dass meine nassen Haare an meinem Rücken kleben und dass Wasser, mit denen sie sich vollgesogen haben, sich langsam auf meinem Pullover ausbreitet.
Am Ende des Flures höre ich die Frau etwas flüstern. Ich schaue auf und sehe, wie Jonsi sich zu mir umdreht und die Hand hebt. Er winkt »Hallo Mama.«
Die Frau flüstert wieder.
»Achso. Tschüß Mama!«
Ich hebe die Hand. Meine Finger sind widerwillig, es fühlt sich an, als müsste ich jeden einzelnen von ihnen brechen, damit sie sich bewegen und zurückwinken. Dann verschwinden die Beiden hinter einer Tür. Das Geräusch, als diese ins Schloss fällt, schallt durch den Flur und ebbt nur langsam ab. Als ich in völliger Stille dastehe, seufze ich.
3.
Ich arbeite in einem der hohen Türme, die im innersten Herzen der Stadt aus dem Boden wachsen. Das bedeutet, dass ich jeden Morgen in einem Fahrstuhl stehe und nicht anders kann, als mein Spiegelbild anzustarren. Meine Haare sind immer noch nass. Ich habe sie zu einem Zopf gebunden und versuche sie zu vergessen. Ich trage zu wenig Schminke, als dass ich damit meine Augenringe hätte verstecken können. Mein Gesicht wirkt eingefallen und langgestreckt. Es ist eine hilflose Anstrengung sich einzureden, dass dies durch eine Zerrung im Glas nur so wirken würde. Oder dass ich ein schiefes Selbstbild hätte. Nicht, dass dies nicht zutreffen würde, aber es wäre doch unfair dem Spiegel vorzuwerfen, er würde die Realität entstellen.
Ich fahre alleine. Nicht verwunderlich, denn ich bin eine halbe Stunde später als alle anderen. Es dauert genau eine Minute und dreiundfünfzig Sekunden, bis ich mein Stockwerk erreiche, dabei ist mindestens ein Zwischenhalt eingerechnet. Man fühlt sich so klein und unbedeutend, wie ein einzelner Sauerstoffpartikel, der durch das endlos scheinende Arteriensystem eines Menschenkörpers reist.
Mit einem klingelnden Geräusch öffnen sich vor mir die Fahrstuhltüren. Wie zwei schwere Eisenvorhänge gleiten sie zur Seite davon und entblößen, was dahinter liegt. Eine weitläufige Bürofläche erstreckt sich vor mir, unterbrochen von kalkweißen Wänden, die wie die Mauern eines Labyrinths erscheinen. Der Raum ist voller Menschen, voll von Stimmen, die durch die Luft schwirren, voll von dem hämmernden Geräusch unzähliger Finger, die auf Tastaturen einschlagen und vollgestopft mit hunderten von Gerüchen, die einen Krieg gegeneinander zu führen scheinen. Parfüm versus Menschenschweiß in der einen Ecke, am anderen Ende Putzmittel versus Kaffeedunst. Ein Raum, so weit und doch zerstückelt in viele Einzelteile. So überfüllt mit Menschen, und doch so schrecklich unbeseelt.
Jedes Mal, wenn ich das Büro betrete, übermannt mich ein Bruchstück der Überwältigung, die mich an meinem ersten Tag hier überrollt hatte. Es war nicht lange nach dem Jonsi zur Welt gekommen war, als ich die Anzeige für den Job in der Zeitung gesehen hatte. Ich weiß nicht, wieso sie aus all den Bewerbern mich ausgesucht hatten. Vielleicht weil die Frau in dem engen Gesprächsraum in dem ich mich vorgestellt hatte, meine Situation verstehen konnte. Oder weil der Mann in dem gleichen Raum, mein enges Kleid betrachten konnte. Damals hatte ich ja keine Ahnung gehabt, worauf ich mich einlassen würde. Erst als ich mit der Frau von dem Vorstellungsgespräch gemeinsam im Fahrstuhl stand und sich vor meinen Augen die eisernen Vorhänge zur Seite schoben und den Blick auf meinen zukünftigen Arbeitsplatz freigaben, legte sich der Geschmack meiner Zukunft auf meine Zunge. Und er war fahl und staubig, als hätte ich in eine Hand voll Mörtel gebissen. Oder meine Zähne in die Betonwände des Gebäudes geschlagen. Damals schluckte ich es einfach herunter. Das bisschen Speichel in meinem Mund konnte nicht viel von dem steinernen Staub binden und das Gefühl eines röchelnden Erstickungstodes machte sich in meiner Kehle breit. Und noch heute trocknet mein Inneres aus, wenn ich nur einen Fuß auf den beigegrauen Teppich des Bürokomplexes setze.
Ich schreite voran. Niemand bemerkt, dass ich zu spät bin. Das bemerken sie nie und wenn doch jemand fragt, schaue ich ihn verwundert und ein bisschen verletzt an und frage, ob er mich denn heute noch gar nicht gesehen hat. Die Person wird meine blasse Erscheinung mit einem mitleidigen Blick bedenken und sich den Rest der angebrochenen Stunde ein wenig dafür schämen, seine arme Mitarbeiterin so fahrlässig übersehen zu haben. Ungehindert passiere ich mehrere der Büroboxen, in denen die vielen Mitarbeiter hocken und ihrer Tätigkeiten nachgehen. In der drittletzten Reihe biege ich ein und verschwinde zwischen vier weißen Wänden. Die Geräusche aus den umliegenden Boxen sind hier noch wie fahle Gespenster zu hören. Die Gerüche wandern wie schwebende Schleier ein und aus.
Auf meinem Schreibtisch liegt ein Stapel Akten. Die erscheinen hier immer wie von Geisterhand. Jemand muss sie heute Morgen schon hereingebracht haben. Unsicher sehe ich mich um. Hat dann jemand bemerkt, dass ich schon wieder zu spät bin? Ich suche die Wände und Tischflächen nach einem Zettel ab. Irgendein Zeichen dafür, dass mich jemand ob meiner Unzuverlässigkeit sprechen möchte. Doch ich finde nichts. Kein Anzeichen dafür, dass irgendjemand bemerkt haben könnte, dass es mich gibt. Alles läuft wie immer. Ein perfekt geöltes Uhrwerk aus hunderten von namenlosen Zahnrädern.
Ich arbeite ganz nah am schlagenden Herzen des Unternehmens. Drei Reihen aus Büroschachteln trennen mich von dem großen, spiegelblank polierten Raum mit Fensterfront und Aussicht über die gesamte Stadt in dem die großen Entscheidungen getroffen werden. So knapp daneben liege ich. Also bin ich beinah so wichtig wie, sagen wir, die Milz. Ich bin kein Teil einer Niere, von der man sich ganz einfach trennen könnte, aber ich bin auch nicht überlebenswichtig. Ich bin die Milz dieses Unternehmens. Das Organ, über dessen Funktion sich niemand bewusst ist. Aber sicher, ohne die Milz würde der Korpus versagen und absterben.
Das Unternehmen ist ein Fernsehsender. Einer der ganz großen. Dazu gehören noch zwei Lokalsender, ein Radiokanal und eine Zeitschrift. Alle vereint in diesem Gebäude. Meine Aufgabe ist es, eingegangene Artikel zu bearbeiten. Auf Richtigkeit überprüfen, Rechtschreibung, Grammatik, all diese Dinge, die die Sprache in ein Korsett zwingen. Ich bin diejenige, die das Korsett zuschnürt. Unritterlich. Ich zerre an den Strängen, bis die Lungen so abgequetscht sind, dass kaum noch Luft in den Körper gelangt. Erst dann darf ich zufrieden sein. Natürlich gibt es noch andere, die das Gleiche tun. Und dann wiederum andere, die das noch einmal überprüfen. Wie gesagt, ich bin ein Teil der Milz. Sicher nicht die Ganze, nein, das wäre ja viel zu viel Verantwortung. Kein Organ besteht nur aus einer Zelle.
»Frau Wolf?«
Ich schrecke innerlich zusammen. Nun werden sie mich dafür aufschlitzen, dass ich zu spät gekommen bin. Sie werden mich an die Wand pressen und vom Bauchnabel aufwärts öffnen, sodass all meine Innereien aus mir herausfallen und mit einem klatschenden Geräusch auf den Boden prallen.
Ruhig drehe ich mich um, versuche mir nichts anmerken zu lassen. »Ja?«
Die gleiche Frau, die damals mein Vorstellungsgespräch geleitet hatte, steht nun in der einzigen Öffnung der weißen Bürowände. Ihre Haare sind hochgesteckt, sie trägt eine Brille mit kleinen, runden Gläsern auf der Nase und ihr Körper ist in einen Hosenanzug geschossen.
»Haben Sie den Bericht über den Aufruhr in Libyen schon bearbeitet?«
»Ich … also …«
Sie sieht mich fragend an.
»Nein.«
»Gut. Der soll sowieso aus dem Programm genommen werden. Der Produzent will ihn noch einmal überarbeiten. Sie können mir die Akte geben und …« Sie schreitet voran und greift nach einem Ordner, der auf dem Stapel neben mir liegt.