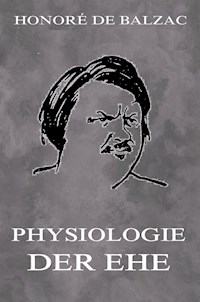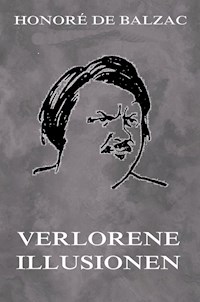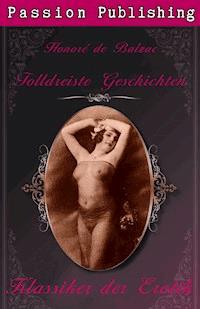2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1799, als die französische Armee im Krieg nach neuen Rekruten verlangt, greifen die Chouans in der Bretagne erneut zu den Waffen, um gegen die Republik zu kämpfen. Ein neuer Anführer mit dem Spitznamen “Le Gars” wird vom König ins Exil geschickt, um sie anzuführen. Er scheint besonders geschickt und gerissen zu sein, doch der Polizeiminister Fouché kennt seine Schwäche: seine Liebe zu schönen Frauen. Er wählt Marie de Verneuil, eine verführerische junge Frau, aus, um ihn zu bezirzen und dann verhaften zu lassen. Zwischen dem Anführer der Chouan und der jungen Republikanerin entsteht bald eine zerstörerische und verbotene Leidenschaft… Dies ist der zweite von zwei Bänden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Honoré de Balzac
Die Königstreuen
Roman
Band Zwei
DIE KÖNISGTREUEN wurde im französischen Original (Les Chouans) zuerst im Jahr 1829 veröffentlicht.
Diese Ausgabe in zwei Bänden wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
1. Auflage 2022
V 1.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
Band 2
ISBN 978-3-96130-539-1
Buchgestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen sehr kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
***
BUCHTIPPS
Entdecke unsere historischen Romanreihen.
Der erste Band jeder Reihe ist kostenlos!
DIE GEHEIMNISSE VON PARIS. BAND 1
MIT FEUER UND SCHWERT. BAND 1
QUO VADIS? BAND 1
BLEAK HOUSE. BAND 1
Klicke auf die Cover oder die Textlinks oben!
Am Ende des Buches findest du weitere Buchtipps und kostenlose eBooks.
Und falls unsere Bücher mal nicht bei dem Online-Händler deiner Wahl verfügbar sein sollten: Auf unserer Website sind natürlich alle eBooks aus unserem Verlag (auch die kostenlosen) in den gängigen Formaten EPUB (Tolino etc.) und MOBI (Kindle) erhältlich!
* *
*
Inhaltsverzeichnis
Die Königstreuen. Band Zwei
Impressum
Band Zwei
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
Links
Zu guter Letzt
Band Zwei
Erstes Kapitel
All diese Ereignisse hatten Fräulein von Verneuil so im tiefsten Grunde aufgewühlt, daß sie sich kraftlos und wie tot in den Wagen zurücksinken ließ, nachdem sie befohlen hatte, nach Fougères zu fahren. Auch Francine schwieg. Der Postillon für sein Teil fürchtete irgendein neues Abenteuer und trieb seine Pferde zu solcher Eile an, daß bald der Gipfel der Pèlerine erreicht war.
Das schöne, breite Couësnon-Tal, in dem sich der Anfang unserer Geschichte zugetragen, lag in dichtem, weißlichem Morgennebel da, als Fräulein von Verneuil hindurchfuhr, so daß sie von dem hohen Punkt aus kaum den Schieferfelsen zu unterscheiden vermochte, auf dem die Stadt Fougères erbaut ist. Noch waren sie etwa drei Meilen davon entfernt. Als sie vor Kälte zu erstarren begann, fiel Marie plötzlich der arme Soldat ein, der hinten aufgesprungen war, und sie bestand trotz seiner Einwände darauf, daß er sich neben Francine setzte. Die Ankunft in Fougères riß sie dann wieder für einen Augenblick aus ihrem Hinbrüten, denn da der am Sankt Leonhardstor aufgestellte Wachtposten die Fremden nicht in die Stadt hineinlassen wollte, sah sie sich genötigt, den Brief des Ministeriums vorzuzeigen. Im Inneren der Stadt angelangt, deren Einwohner damals ihre eigenen Verteidiger waren, war sie endlich vor allen feindlichen Überfällen geschützt. Da der Postillon keine andere Unterkunft für sie wußte, stieg sie im Posthause ab.
»Gnädiges Fräulein,« sagte Beau-pied, »sollten Sie einmal mit irgend jemand eine Rechnung haben, die nur mit ’nem Säbelhieb beglichen werden kann, so stehe ich zu Ihren Diensten. Auf so was verstehe ich mich nämlich. Ich heiße Jean Falcon, genannt Beau-pied, und bin Sergeant der ersten Kompagnie von Hulots Jungen, zweiundsiebzigste Halbbrigade. Die Mainzer haben sie uns getauft. Entschuldigen Sie, daß ich so dreist und anmaßend bin. Aber ich kann Ihnen außer meinem Soldatenherzen nichts anbieten – habe augenblicklich nichts weiter zur Hand …«
Und er drehte sich auf dem Absatz um und ging pfeifend fort.
»Je tiefer man in die Gesellschaft hinabsteigt,« sagte Fräulein von Verneuil bitter, »um so hochherzigere Gefühle findet man, ohne daß irgendein Wesen davon gemacht würde. Ein Marquis vergilt mir das Leben mit dem Tode, und ein Sergeant … Doch schweigen wir davon!«
Als Marie in ihrem warmen Bette lag, wartete ihre treue Gefährtin umsonst auf das freundliche Wort, an das sie gewöhnt war. Das einzige, was die Herrin ihr in ernstem Tone sagte, da sie sie so beunruhigt bei sich stehen sah, war:
»Das nennt man einen Tag, Francine. Ich bin um zehn Jahre älter geworden.«
Am folgenden Morgen in aller Frühe klopfte Corentin bei Marie an, und sie erlaubte ihm, einzutreten.
»Francine,« verspottete sie sich selbst, »wie groß muß mein Unglück sein, wenn Corentins Anblick mir nicht ganz zuwider ist!«
Nichtsdestoweniger verspürte sie beim Wiedersehen dieses Mannes eine unwillkürliche Abneigung, die selbst eine zehnjährige Bekanntschaft nicht zu mildern vermocht hatte.
»Nun!« sagte er lächelnd. »Ich hatte geglaubt, es würde gelingen. Er war es also nicht, den Sie zwischen den Fingern hielten?«
»Corentin,« antwortete sie in schmerzvoll zögerndem Tone, »reden Sie nicht hiervon, bis ich selbst davon reden werde.«
Er schwieg und begann im Zimmer auf und ab zu gehen, wobei er schielende Blicke auf Fräulein von Verneuil warf, denn er hätte gern die geheimen Gedanken des jungen Mädchens erraten, dessen Anblick allein genügte, um auch den gewandtesten Mann zuzeiten aus der Fassung zu bringen.
»Diesen Mißerfolg habe ich vorausgesehen,« sagte er nach einer kurzen Pause. »Falls es Ihnen belieben sollte, Ihr Hauptquartier hier in der Stadt aufzuschlagen, so habe ich auch schon die nötigen Erkundigungen eingezogen. Wir sind im Mittelpunkte der Chouannerie. Wollen Sie da bleiben?«
Sie nickte bejahend, was Corentin Veranlassung gab, teilweise richtige Schlüsse über die Ereignisse des vergangenen Abends anzustellen.
»Ich habe ein nicht verkauftes Nationalhaus für Sie requiriert,« sagte er. »Die Leute hier sind recht weit in der Kultur zurück. Kein Mensch hat es gewagt, diese Baracke zu erwerben, weil sie einem Emigranten gehört, der als roh verschrien ist. Sie liegt bei der Sankt Leonhardskirche, und man hat von dort, so wahr ich Corentin heiße, eine herrliche Aussicht. Man kann sich das Loch zunutze machen, es ist bewohnbar. Wollen Sie hinkommen?«
»Augenblicklich!« rief sie.
»Ein paar Stunden brauche ich aber noch, um Ordnung und Sauberkeit zu schaffen, so daß Sie es nach Ihrem Geschmacke finden.«
»Ach, was liegt daran!« gab sie zurück. »Ich würde ohne Besinnen in ein Kloster oder Gefängnis ziehen. Immerhin, sorgen Sie dafür, daß ich mich heute abend in völliger Einsamkeit und Ungestörtheit dort ausruhen kann. Gehen Sie jetzt, lassen Sie mich allein. Ihre Gegenwart ist mir unerträglich. Ich will nur Francine um mich haben. Mit ihr kann ich mich vielleicht besser verständigen, als mit mir selber. Adieu. Gehen Sie, gehen Sie!«
Diese rasch hingeworfenen Worte, die sie teils in kokettem, teils herrischem und leidenschaftlichem Tone an ihn richtete, ließen darauf schließen, daß die Ruhe in ihr vollkommen wiederhergestellt war. Der Schlaf hatte zweifellos die Eindrücke des vorhergehenden Tages allmählich geordnet, und beim Nachdenken mochte sie zu dem Entschlüsse gekommen sein, sich zu rächen. Wenn dann und wann noch ein düsterer Ausdruck über ihre Züge glitt, so zeugte er eher von der manchen Frauen eigenen Fähigkeit, auch die heftigsten Empfindungen in ihrer Brust zu verschließen, und von der Verstellung, die es ihnen erlaubt, freundlich zu lächeln, indes sie auf den Untergang ihres Opfers sinnen.
Sie blieb allein, unablässig mit dem Gedanken beschäftigt, wie es ihr gelingen könne, den Marquis lebend in die Hände zu bekommen. Zum ersten Male hatte sie so gelebt, wie es von je ihre Sehnsucht gewesen war. Aber das einzige Gefühl, das ihr aus diesem Erlebnis blieb, war das der Rache, einer unendlichen, völligen Rache. Dies war ihr einziger Gedanke, ihre einzige Leidenschaft. Francines Worte, ihre Fürsorge fanden keinen Widerhall bei ihr. Sie schien mit offenen Augen zu schlafen. Und der ganze lange Tag verstrich, ohne daß eine Gebärde oder Handlung das äußere Leben bekundet hätte, das von unseren Gedanken Zeugnis gibt. Sie blieb auf einer Ottomane liegen, die sie aus Stühlen und Kissen gebildet hatte, und nur gegen Abend sprach sie nachlässig, zu Francine gewandt, die wenigen Worte:
»Gestern, liebes Kind, begriff ich gar wohl, daß man leben könnte, um zu lieben; heute begreife ich, daß man sterben kann, um sich zu rächen. Ja, mein Leben würde ich drum geben, ihn aufzusuchen, wo er auch ist, ihn von neuem zu treffen, zu verführen und für mich zu haben. Und wenn ich ihn nicht in wenigen Tagen demütig und unterwürfig zu meinen Füßen sehe, diesen Mann, der mich so verachtet, und ihn zu meinem Knecht mache, dann bin ich das geringste Geschöpf auf Erden, dann verdiene ich nicht mehr den Namen Frau, dann bin ich nicht mehr ich selbst!«
Das Haus, das Corentin Fräulein von Verneuil vorgeschlagen hatte, enthielt alles, was nötig war, um die ihr angeborene Neigung für Luxus und Vornehmheit zu befriedigen. Er raffte mit dem Eifer eines Liebenden für seine Geliebte, oder richtiger mit der Dienstfertigkeit eines mächtigen Mannes, der einem ihm gerade schwer entbehrlichen Untergebenen zu schmeicheln sucht, alles zusammen, wovon er wußte, daß es ihr gefallen würde, und kam am nächsten Morgen mit der Nachricht zu Fräulein von Verneuil, ihr vorläufiger Wohnsitz sei bereit.
Obwohl sie nur ihre schlechte Ottomane mit einem altertümlichen Sofa vertauschte, das Corentin für sie aufgetrieben hatte, nahm das phantastische Mädchen sogleich Besitz von diesem Hause wie von, einer Sache, die ihr von rechtswegen gehörte. Mit königlichem Gleichmut betrachtete sie alles, was sie sah, und faßte eine plötzliche Zuneigung für die kleinsten Gegenstände, mit denen sie sich alsbald einrichtete, als seien sie ihr seit langem lieb – kleine, alltägliche Züge, die indes für die Schilderung eines so außergewöhnlichen Charakters nicht ohne Bedeutung sind. Es war, als habe ein Traum sie im voraus mit dieser Wohnung vertraut gemacht, in der sie von ihrem Hasse lebte, wie sie darin von ihrer Liebe gelebt haben würde.
»Wenigstens«, sprach sie bei sich selbst, »habe ich in ihm nicht jenes schmachvolle, tödliche Mitleid erregt; ich verdanke ihm nicht das Leben. O du meine erste, meine einzige und letzte Liebe – was für ein Ende!«
Plötzlich stürzte sie heftig auf die erschrockene Francine zu:
»Liebst du? Ach ja, du liebst, ich entsinne mich! Ich bin sehr glücklich, daß ich eine Frau bei mir habe, die mich versteht. Sag’, armes Kindchen, scheint der Mann dir nicht ein fürchterliches Wesen? Ha – er sagte, er liebe mich, und er hat nicht einmal die einfachste Probe bestanden. Wäre er von der ganzen Welt verstoßen worden, in meinem Herzen hätte er eine Zuflucht gefunden. Wenn das Weltall ihn angeklagt hätte, würde ich ihn verteidigt haben. Früher sah ich in der Welt nichts als gleichgültige Geschöpfe, die kamen und gingen; die Welt war traurig, aber nicht schrecklich. Aber jetzt, was ist mir jetzt die Welt ohne ihn? Er soll leben, ohne daß ich bei ihm bin, ihn sehe, mit ihm rede, ihn fühle, ihn halte, ihn an mich reiße? Nein, lieber will ich selbst ihn im Schlafe erwürgen!«
Entsetzt sah Francine sie einen Augenblick lang schweigend an.
»Den töten, den man liebt!« sagte sie dann sanft.
»Ja, ja, gewiß, wenn er nicht mehr liebt!«
Nach diesen furchtbaren Worten warf sie die Hände über das Gesicht, setzte sich wieder und schwieg.
Am nächsten Tage erschien plötzlich und unangemeldet ein Mann mit strengem Gesicht bei ihr. Es war Hulot. Sie blickte ihn an und erbebte.
»Sie kommen gewiß, um Rechenschaft über Ihre Freunde von mir zu fordern?« sprach sie. »Sie sind tot.«
»Ich weiß,« antwortete er. »Aber sie sind nicht im Dienste der Republik gefallen.«
»Nein. Für mich und durch mich. Sie wollen mir vom Vaterlande sprechen! Gibt das Vaterland denen das Leben wieder, die dafür fallen? ja, rächt es sie auch nur? Ich – ich werde sie rächen!« rief sie.
Alle die finsteren Bilder der Katastrophe, deren Opfer sie gewesen, erstanden mit einem Male wieder lebhaft in ihrem Geiste. Und so wurde dieses anmutige Geschöpf, das unter allen weiblichen Tugenden die Keuschheit obenan setzte, wie von plötzlichem Wahnsinn ergriffen und stürzte auf den ganz betroffenen Hulot zu.
»Für ein paar ermordete Soldaten werde ich Euch ein Haupt unters Beil legen, das tausend andere Häupter aufwiegt! Wir Frauen führen selten Krieg, aber das versichere ich Ihnen, daß Sie in meiner Schule einige gute Listen werden lernen können.
Ich liefere Ihren Bajonetten eine ganze Familie aus, ihre Ahnen, ihre Zukunft, ihre Vergangenheit. So gut und wahr ich gegen ihn war, so falsch und hinterlistig werde ich von nun an sein. Herr Kommandant, ich will ihn in mein Bett locken, und er soll von da aus in den Tod gehen! So soll es geschehen! Nie werde ich eine Nebenbuhlerin haben! Bei Gott, er hat sich sein Urteil selbst gesprochen: ein Tag ohne Morgen! Ihre Republik und ich, wir beide werden zu unserer Rache kommen. – Die Republik!« fuhr sie mit einer Stimme fort, deren sonderbarer Klang schwer zu schildern ist. »Er wird also sterben, weil er die Waffen gegen sein Vaterland geführt hat! Frankreich wird mir meine Rache stehlen! Ach, wie wenig ist doch ein Lehen – ein Tod sühnt nur ein Verbrechen! Aber da er nur einen Kopf herzugeben hat, will ich ihm zuvor eine Nacht schenken, daß er glauben wird, mehr als ein Leben zu verlieren! Vor allem sorgen Sie dafür, Herr Kommandant – denn Sie werden ihn ja töten« – (hier seufzte sie auf) – »daß nichts meinen Verrat verrät, und daß er die Überzeugung meiner Treue mit in den Tod nimmt. Das ist das einzige, worum ich Sie bitte. Nur mich soll er vor sich sehen, mich und meine Küsse, mich und meine Zärtlichkeiten.« Sie verstummte. Doch durch den Purpur ihrer Wangen hindurch bemerkten Hulot und Corentin, daß Zorn und Raserei ihre Schamhaftigkeit nicht ganz erstickt hatten. Bei ihren letzten Worten durchlief sie ein Schauder. Sie horchte auf sich selbst, als zweifle sie daran, daß sie sie ausgesprochen, und erzitterte kindlich, indem sie sich unwillkürlich betrug wie eine Frau, der ihr Schleier entgleitet.
»Sie hatten ihn ja aber doch in Ihren Händen,« warf Corentin ein.
»Wahrscheinlich,« erwiderte sie bitter.
»Warum haben Sie mich gehindert, als ich ihn festnehmen wollte?« fragte Hulot.
»Ach, Herr Kommandant, wir wußten ja noch nicht, ob er es sei.«
Mit einem Schlage beruhigte sich die Aufgeregte, nachdem sie eine Zeitlang mit heftigen Schritten im Zimmer auf und ab gegangen war und den beiden Anwesenden verzehrende Blicke zu geworfen hatte.
»Ich erkenne mich selbst nicht wieder,« sagte sie in männlichem Tone. »Was nützt das Reden? Wir müssen ihn aufsuchen!«
»Ihn aufsuchen!« wiederholte Hulot. »Sehen Sie sich vor, liebes Kind! Wir sind nicht Herr des Geländes, und sobald Sie sich aus der Stadt wagten, würden Sie nach hundert Schritten gefangen oder erschossen werden.«
»Für jemand, der sich rächen will, gibt es keine Gefahr,« antwortete sie mit einer verächtlichen Gebärde, um die beiden Männer, die zu sehen sie sich schämte, aus ihrer Gegenwart zu verbannen. Sie zogen sich zurück und waren kaum allein, als Hulot ausrief: »Ist das ein Weib! Auf welche Idee sind diese Pariser Polizeileute nur verfallen! – Nie wird sie ihn uns ausliefern,« setzte er kopfschüttelnd hinzu.
»O doch!« entgegnete Corentin.
»Sehen Sie denn aber nicht, daß sie ihn liebt?«
»Freilich,« sagte Corentin und sah den Kommandeur verwundert an. »Aber ich bin doch da, um zu verhindern, daß sie Dummheiten macht. Denn meiner Meinung nach, Kamerad, gibt es keine Liebe, die zweihunderttausend Franken wert ist.«
Als dieser Seelendiplomat den Offizier allein gelassen, folgte Hulot ihm mit den Augen und stieß, nachdem der Lärm seiner Schritte verhallt war, einen Seufzer aus.
»Zuweilen ist es also doch wohl gut,« sprach er zu sich selbst, »nur ein Dummkopf zu sein wie ich! Gottsdonner – wenn ich dem Gars wieder begegne, wollen wir uns Mann gegen Mann schlagen, sonst will ich nicht Hulot heißen. Denn wenn dieser Fuchs ihn mir zum Richten vorführte, nachdem sie jetzt ja Kriegsgerichte geschaffen haben, käme ich mir so schmutzig vor, wie das Hemd eines feigen Soldaten.«
Die von den Königstreuen begangenen Morde und der Wunsch, seine beiden Freunde zu rächen, hatten Hulot ebenso stark zur Wiederaufnahme des Kommandos seiner Halbbrigade bestimmt, wie das Antwortschreiben, in dem ein neuer Minister, Berthier, ihm erklärte, seine Entlassung könne unter den gegebenen Umständen nicht genehmigt werden. Der ministeriellen Depesche war ein vertraulicher Brief beigeschlossen, worin er ihm – ohne ihm übrigens Näheres über den Auftrag des Fräuleins von Verneuil mitzuteilen – schrieb, daß dieser Nebenumstand, der gar nichts mit dem Kriege an sich zu tun habe, die Operationen nicht verzögern dürfe. Die Teilnahme der militärischen Befehlshaber müsse sich, so hieß es, in dieser Angelegenheit darauf beschränken, der ehrenwerten Bürgerin im gegebenen Falle beizustehen.
Als er darauf in Erfahrung gebracht hatte, daß die Bewegungen der Königstreuen eine Zusammenziehung ihrer Streitkräfte in Fougères ankündigten, hatte der Kommandant durch Eilmarsch heimlich zwei Bataillone seiner Halbbrigade nach diesem wichtigen Orte geführt. Die Gefahr, in der das Vaterland schwebte, der Haß auf die Aristokratie, deren Parteigänger eine beträchtliche Strecke Landes bedrohten, die Freundschaft, das alles hatte dazu beigetragen, dem alten Militär das Feuer der Jugend wiederzugeben.
»Hier habe ich nun das Leben, das ich so ersehnte!« rief Fräulein von Verneuil, sobald sie mit Francine allein war. »So rasch die Stunden auch verfliegen, bergen sie doch Jahrhunderte von Gedanken!«
Plötzlich ergriff sie Francines Hand, und mit einer Stimme wie der des ersten Rotkehlchens, das nach dem Sturme singt, sprach sie langsam:
»Ich habe gut reden, Kind. Ich sehe doch immer diese beiden köstlichen Lippen, dieses kurze, leicht vorstehende Kinn, die feurigen Augen vor mir und höre das ›Hüh‹ des Postillons. Ich träume … und warum empfängt mich beim Erwachen soviel Haß?«
Sie stieß einen schmerzvollen Seufzer aus und erhob sich. Und nun erblickte sie zum erstenmal das Land, das dem Bürgerkrieg ausgeliefert war durch den grausamen Edelmann, den sie ganz allein angreifen wollte. Von der weiten Aussicht über die Landschaft verlockt, ging sie hinaus, um unter freiem Himmel leichter atmen zu können. Und wenn sie auch aufs Geratewohl vorwärts schritt, ward sie dennoch durch die unglückselige Neigung unserer Seele, sich ihre Hoffnungen im Sinnlosen zu suchen, nach der Promenade der Stadt gelenkt. Oft verwirklichen sich die unter der Herrschaft dieses Zaubers gefaßten Gedanken; aber dann schreibt man es der Macht zu, die man Vorahnung nennt, einer unerklärten, jedoch wirklichen Macht, die die Leidenschaften stets gefällig finden, einem Schmeichler gleich, der unter all seinen Lügen zuweilen auch die Wahrheit sagt.
Zweites Kapitel
Da die letzten Begebnisse dieser Geschichte eng mit der Lage der Orte verknüpft sind, wo sie sich abspielten, ist es unerläßlich, hier eine genaue Beschreibung einzuschieben, ohne die die Handlung ihr Hauptinteresse verlieren würde.
Die Stadt Fougères liegt zum Teil auf einem Schieferfelsen, der aussieht, als sei er vor die Berge hingefallen, die nach Westen zu das weite Couësnontal abschließen und je nach den Ortschaften verschiedene Namen führen. Nach dieser Gegend hin wird die Stadt von den Bergen durch eine Schlucht getrennt, in deren Grunde der Nançonbach dahinfließt. Von dem östlichen Teile des Felsens überblickt man die gleiche Landschaft wie vom Gipfel der Pèlerine, gegen Westen nur das gewundene Nançontal. Es gibt jedoch eine Stelle, von der aus man gleichzeitig einen Abschnitt des von dem großen Tale gebildeten Kreises und die hübschen Umrisse des kleinen sehen kann, das in das andere einmündet. Diese Stelle, zu der ein Spazierweg der Bewohner führte, und wohin auch Fräulein von Verneuil sich jetzt begab, war der Schauplatz, auf dem das in La Vivetière begonnene Drama sich weiter entwickelte, so daß bei aller malerischen Anlage der übrigen Punkte von Fougères die Aufmerksamkeit ausschließlich auf die Teile der Landschaft gelenkt werden muß, die man von der Höhe der Promenade aus erblickt.
Um eine Vorstellung von dem Anblick zu geben, den der Felsen von Fougères, von dieser Seite aus gesehen, bietet, könnte man ihn vielleicht mit einem jener ungeheuren Türme vergleichen, an deren Außenseite die sarazenischen Baumeister von Stockwerk zu Stockwerk durch Wendeltreppen verbundene Galerien angebracht haben. Wirklich wird der Felsen auch von einer kleinen gotischen Kirche gekrönt, deren Turm, Spitze und Strebepfeiler das ihre tun, ihm das Aussehen eines Zuckerhutes zu geben. Vor dem Portal dieser dem heiligen Leonhard geweihten Kirche liegt ein kleiner unregelmäßiger Platz, dessen Erdreich von einer balustradenförmigen Mauer zusammengehalten wird, die durch eine Treppe mit der Promenade in Verbindung steht. Einem zweiten Kranzgesims ähnlich, zieht sich dieser Spazierweg, einige Klafter unterhalb des Kirchplatzes, rund um den Felsen als ein breites, mit Bäumen bestandenes Stück Land, das bei den Befestigungen der Stadt endigt. Etwa zehn Klafter unterhalb der Mauern und Felsen, die, dank der glücklichen Anordnung des Schiefergesteins, die Terrasse stützen, kommt dann ein in den Felsen gehauener, gewundener Weg, der »die Treppe der Königin« heißt und zu einer von Anna von Bretagne über den Nançon gebauten Brücke führt. Und noch tiefer als dieser Weg, der ein drittes Kranzgesims darstellt, ziehen sich Gärten, gleich blumigen Stufen, von Terrasse zu Terrasse bis zum Flusse hinab.
In gleicher Richtung mit der Promenade erstrecken sich hohe, nach der benachbarten Vorstadt die Berge von Saint-Sulpice genannte Felsen längs des Flusses und senken sich in sanften Hängen in das große Tal, von wo sie dann jäh nach Norden umbiegen. Diese steilen, unbebauten, düsteren Felsen scheinen sich mit dem Schiefergestein der Promenade zu berühren, von der sie an manchen Stellen nur einen Flintenschuß weit entfernt sind, und bilden einen Windschutz für ein enges, hundert Klafter tiefes Tal, in dem der Nançon sich in drei Arme teilt, die eine entzückend angepflanzte, mit Fabrikbauten bestandene Wiesenfläche bewässern.
Gegen Süden, da, wo die eigentliche Stadt aufhört und die Vorstadt Saint Léonard anfängt, macht der Felsen von Fougères eine Biegung, wird weniger rauh, nimmt an Höhe ab und wendet sich dem großen Tale zu, den Fluß entlang, den er dabei dicht an die Berge von Saint-Sulpice drängt, indem er einen Engpaß bildet, dem das Wasser in zwei Bächen entströmt, um sich dann in den Couësnon zu ergießen. Diese gefällige Gruppe felsiger Hügel heißt Nid-aux-crocs; das Tal, das sie bilden, ist das Tal von Gibarry, dessen fette Weiden einen großen Teil der den Feinschmeckern unter dem Namen Butter von Pré-Valaye bekannten Butter liefern.
An der Stelle, wo die Promenade in den Befestigungen endigt, erhebt sich der sogenannte Papageienturm. Um diesen viereckigen Bau, auf dem das von Fräulein von Verneuil bewohnte Haus stand, zieht sich hier eine Mauer, dort die glatte Felswand selbst, und der auf dieser hohen, uneinnehmbaren Basis gelegene Teil der Stadt beschreibt einen weiten Halbmond, an dessen Ende die Felsen sich neigen und aushöhlen, um den Nançon durchzulassen. Dort liegt das Tor, das zu der Vorstadt Saint-Sulpice führt, von der es seinen Namen hat. Weiterhin erheben sich auf einem Granithügel, der drei Täler beherrscht, in denen mehrere Landstraßen zusammenlaufen, die alten Zinnen und Türme des Lehensschlosses Fougères, eines der riesigsten von den Bauten der Herzöge der Bretagne, mit fünfzehn Klafter hohen und fünfzehn Fuß dicken Mauern. Im Osten ist es durch einen Teich befestigt, aus dem der Nançon kommt, der sich in seine Gräben ergießt und die Mühlen zwischen dem Tor von Saint-Sulpice und den Zugbrücken der Festungswerke treibt; nach Westen hin verteidigen es die starren Granitblöcke, auf denen es ruht.
So bilden die Stadt und ihr durch geradwandige Mauern oder durch spitzige Abdachungen geschützter Felsen von der Promenade an bis zu diesem großartigen, von Efeuwänden bedeckten Überrest aus dem Mittelalter mit seinen viereckigen und runden Türmen, in deren jedem ein Regiment Platz hat, ein riesiges Hufeisen voller Schluchten, über die die Bretonen mit Hilfe der Zeit ein paar schmale Fußwege gezogen haben. Da und dort stehen Felsblöcke vor, wie Verzierungen; hier sickert Wasser aus Felssprüngen, aus denen rhachitische Bäume herauswachsen; ein paar weniger schroffe Granitplatten nähren ein Grün, das Ziegen anlockt; und Heidekraut, aus den feuchten Ritzen wuchernd, überzieht die schwarzen Krümmungen mit seinen rötlichen Kranzgewinden. Im Grunde dieses ungeheuren Trichters schlängelt sich das Flüßchen durch eine immer frisch wie ein Teppich daliegende Wiese.
Am Fuße des Schlosses erhebt sich zwischen mehreren Granitblöcken die Kirche Saint-Sulpice, die den gleichen Namen führt wie die jenseits des Nançon gelegene Vorstadt. Diese Vorstadt liegt da, als sei sie in die Tiefe eines Abgrunds hineingeschleudert worden, und wird samt ihrer Kirche und den Hütten um sie her malerisch von den baumbeschatteten, gärtengezierten Nebenflüssen des Nançon umspült, die unregelmäßig in den von der Promenade der Stadt und dem Schlosse gebildeten Kreis hineinschneiden und einen schlichten Gegensatz zu dem gegenüberliegenden, ernst ansteigenden Amphitheater bilden. Endlich sind ganz Fougères, seine Burg, die Vorstadt und deren Kirche von den Bergen von Rillé eingefaßt, die ihrerseits einen Teil des großen gürtelförmigen Couësnontales ausmachen.
Dies sind die hervorspringendsten Züge einer Natur, deren Hauptcharakter eine herbe Wildheit ist, gemildert durch die lachendsten Bilder, durch eine glückliche Mischung der erhabensten Menschenwerke mit den Launen eines an unerwarteten Kontrasten reichen Bodens, an dem ein unbeschreibliches Etwas erstaunt und verwirrt. Nirgends sonst findet der Reisende in Frankreich so großartige Gegensätze wie in dem großen Becken des Couësnon und den zwischen die Felsen von Fougères und die Berge von Rillé eingestreuten Tälern. Hier hat man es mit den unerhörten Schönheiten zu tun, bei denen der Zufall zum Meister wird.
Hier gibt es klare, durchsichtige Gebirgsbäche, Berge, die von dem üppigen Pflanzenwuchs jener Landstriche bedeckt sind, düstere Felsen, schmucke Fabriken, natürliche Befestigungen und von Menschenhand erbaute Granittürme; hier findet man alle künstlichen Wirkungen von Licht und Schatten, das Widerspiel der verschiedenen Laubarten, wie die Zeichner es aufsuchen; Häusergruppen, die von lebhaften Bewohnern wimmeln, und öde Stellen, wo der Granit nicht einmal das weiße Steinmoos duldet; kurz alle anmutigen und wilden Einzelheiten, die man von einer Landschaft verlangen kann – ein ganzes Gedicht von unbeschreiblichem Zauber, voll herrlicher Bilder köstlicher Ländlichkeit! Hier entfaltet sich die Bretagne zu ihrer schönsten Blüte.
Der sogenannte Papageienturm, auf dem das zu jener Zeit von Fräulein von Verneuil bewohnte Haus steht, ruht auf dem Grunde der Schlucht und erhebt sich bis zu dem karniesartig vor der St. Leonhardskirche liegenden Platze. Von diesem nach drei Seiten hin isolierten Hause kann man sowohl das große Hufeisen erblicken, das bei dem Turme seinen Anfang nimmt, wie das gekrümmte Nançontal und den St. Leonhardsplatz. Es gehört zu einer Reihe von dreihundertjährigen Holzhäusern, die sich auf einer gleichlaufenden Linie an der Nordseite der Kirche hinziehen und mit ihr eine Sackgasse bilden, deren Ausgang nach einem abschüssigen Gäßchen führt. Dieses läuft an der Kirche entlang zum Sankt Leonhardstore, auf das Fräulein von Verneuil jetzt zuging. Natürlich unterließ sie es, den über ihr liegenden Kirchplatz zu betreten, und richtete ihre Schritte nach der Promenade.
Als sie die kleine, von grünangestrichenen Pfählen errichtete Schranke hinter sich gelassen, die sich vor dem damals beim Sankt Leonhardstor aufgestellten Wachtposten befand, ließ die Großartigkeit des Bildes einen Augenblick lang ihre Leidenschaften schweigen. Voll Bewunderung umfaßten ihre Augen den riesigen Abschnitt des großen Couësnontales vom Gipfel der Pèlerine bis zu der Hochebene, über die der Weg nach Vitré führt; dann ruhte der Blick auf dem Nid-aux-crocs und auf den Windungen des Tals von Gibarry, dessen Kämme sich in dem dunstigen Lichte der untergehenden Sonne badeten. Fast erschreckte sie die Tiefe des Nançontales, dessen höchste Pappeln kaum an die Gartenmauern unterhalb der Treppe der Königin hinaufreichten. So schritt sie mit immer wachsendem Erstaunen bis zu dem Punkte, von wo aus sie, durch das kleine Tal von Gibarry hindurch, sowohl das große Tal wie die köstliche, von der hufeisenförmigen Stadt, den Felsen von Saint-Sulpice und den Bergen von Rillé umrahmte Landschaft überschauen konnte. Zu dieser Tageszeit bildete der aus den Häusern der Vorstadt und dem Tale aufsteigende Rauch in der Luft eine Wolke, die die Gegenstände nur wie durch einen bläulichen Dunsthimmel hervorschimmern ließ; die zu lebhaften Farben des Tages begannen matter zu werden; das Firmament nahm einen perlgrauen Ton an, und der Mond warf seine Lichtschleier über die entzückende Landschaft; kurz, alles trug dazu bei, die Seele in Träume zu verstricken und die Erinnerung an teure Wesen heraufzubeschwören.
Doch plötzlich schwand ihre Anteilnahme an diesem Bilde völlig dahin. Sie hatte keinen Blick mehr für die Schindeldächer der Vorstadt Saint-Sulpice noch ihre Kirche mit der kühnen Spitze, die sich in der Tiefe des Tales verlor, als Marie nun einen Schritt zurücktrat, noch für die jahrhundertealte Efeu- und Klematisbekleidung der alten Festungsmauern, wo der Nançon unter den Mühlenrädern brauste. Vergebens warf die sinkende Sonne ihren Goldstaub und ihre roten Glanzlichter auf die zwischen den Felsen verstreuten anmutigen Wohnhäuser, die Wasserläufe und rasigen Flächen. Reglos blieb sie vor den Felsen von Saint-Sulpice stehen: die unsinnige Hoffnung, die sie auf die Promenade getrieben, hatte sich wunderbar verwirklicht.
Durch Dorngestrüpp und Ginster hindurch, womit die gegenüberliegenden Höhen überwachsen sind, glaubte sie, trotz der sie umhüllenden Ziegenfelle mehrere der Gäste aus La Vivetière zu erkennen, unter ihnen den Gars, dessen Bewegungen sich gegen das milde Licht der untergehenden Sonne abzeichneten. Einige Schritte hinter dieser Hauptgruppe erkannte sie ihre furchtbare Feindin, Frau von Gua. Einen Augenblick lang vermeinte Fräulein von Verneuil zu träumen; doch bald sollte der Haß ihrer Nebenbuhlerin ihr beweisen, daß in diesem Traume alles auf Wirklichkeit beruhte. Die gespannte Aufmerksamkeit, die sie den geringsten Gebärden des Marquis schenkte, verhinderte sie zu gewahren, wie sorgfältig Frau von Gua mit einer langen Flinte auf sie zielte. Erst ein Schuß, der das Echo der Berge weckte, und die Kugel, die an ihr vorbeipfiff, belehrten sie darüber, daß sie erkannt worden sei. Zugleich ertönte der sich fortpflanzende Ruf: »Wer da?« von Schildwache zu Schildwache von der Burg bis zum Sankt Leonhardstor und zeigte den Königstreuen an, wie sehr die Einwohner von Fougères auf ihrer Hut waren, da selbst der uneinnehmbarste Teil ihrer Wälle so gut bewacht war.
»Sie sind es – beide!« sagte sie.
Mit Blitzesschnelle wurde sie von dem Gedanken erfaßt, ihn aufzusuchen, ihm zu folgen, ihn zu überraschen.
Doch dann dachte sie daran, daß sie ohne Waffen sei.
Plötzlich aber fiel ihr ein, daß sie im Augenblick ihrer Abreise von Paris in eine ihrer Schachteln einen zierlichen Dolch geworfen hatte, den einst eine Sultanin getragen und den sie vor ihrem Auftreten auf dem Kriegsschauplatze an sich nahm, wie so mancher Kauz vor Antritt einer Reise ein Büchlein zu sich steckt, um darin die Gedanken aufzuzeichnen, die ihm etwa kommen mögen; doch verlockte sie weniger die Aussicht, Blut zu verspritzen, als das Vergnügen, einen hübschen, mit Edelsteinen verzierten Hanjar tragen zu können und mit seiner reinen Klinge zu spielen. Drei Tage zuvor hatte sie es aufs lebhafteste bedauert, ihn in ihrer Schachtel liegen gelassen zu haben, als sie sich gern den Tod gegeben hätte, um sich der schmählichen Marter zu entziehen, die ihre Nebenbuhlerin ihr antun wollte.
Kurz entschlossen kehrte sie nach Hause zurück, holte den Dolch, steckte ihn in den Gürtel, warf einen großen braunen Schal um, zog einen schwarzen Spitzenschleier über ihr Haar und setzte einen breitrandigen Chouanhut auf, der einem Diener ihres Hauses gehörte. Mit der Geistesgegenwart, die die Leidenschaft zuweilen verleihen kann, steckte sie noch den ihr von Marche-à-terre als Reisepaß gegebenen Handschuh des Gars zu sich. Dann kehrte sie zur Promenade zurück, nachdem sie der erschreckten Francine erwidert hatte: »Was willst du? Ihn würde ich in der Hölle aufsuchen!«
Der Gars war noch auf demselben Platze, jedoch allein. Nach der Richtung seines Fernrohres zu urteilen, schien er mit der gewissenhaften Genauigkeit des Kriegsmannes die verschiedenen Wasserläufe des Nançon, die Treppe der Königin und den Weg zu durchspähen, der sich vom Tore von Saint-Sulpice aus nach der gleichnamigen Kirche zieht und sich unterhalb der Burg mit den Landstraßen vereinigt.
Fräulein von Verneuil durcheilte die von den Ziegen und ihren Hirten getretenen schmalen Pfade am Abhang der Promenade, erreichte die Treppe der Königin, kam dann in die Tiefe der Schlucht und am Nançon vorbei, durchquerte die Vorstadt, erriet wie der Vogel in der Wüste ihren Weg durch die gefährlichen Felsschroffen von Saint-Sulpice hindurch und sah nun einen über Granitblöcke führenden schlüpfrigen Weg vor sich, den sie, seiner stechenden Ginsterbüsche und spitzen Steine ungeachtet, mit jener Tatkraft zu erklimmen begann, die der Mann nicht kennt, während die leidenschaftlich bewegte Frau sie für Augenblicke besitzt.
Die Nacht überraschte sie in dem Augenblick, da sie, auf der Höhe angelangt, beim bleichen Lichte des Mondes den Weg zu erkennen suchte, den der Marquis eingeschlagen haben mußte. Eine hartnäckige, jedoch erfolglose Rundschau und das Stillschweigen, in dem die Landschaft vor ihr lag, belehrten sie von dem Rückzuge der Königstreuen und ihres Anführers.
Die Spannung der Leidenschaft fiel plötzlich mit der Hoffnung, die sie eingeflößt hatte, in sich zusammen. Da Marie sich nachts in einem unbekannten Lande, wo der Krieg wütete, allein sah, fing sie an, nachzudenken, und die Warnungen Hulots, der Schuß der Frau von Gua, ließen sie vor Angst erbeben.
In der Stille der Nacht, die hier im Gebirge so vollkommen war, konnte man selbst auf weite Entfernungen hin das leise Rascheln eines fallenden Blattes hören, und diese schwachen Nachtgeräusche zitterten in den Lüften nach, als wollten sie der Einsamkeit oder dem Schweigen den traurigen Takt angeben. Auf den Bergeshöhen blies der Wind und jagte die Wolken heftig vor sich her, wodurch er ein Licht- und Schattenspiel erzeugte, dessen Wirkungen das Grauen noch erhöhten, indem sie selbst den belanglosesten Gegenständen ein phantastisches, furchterregendes Aussehen gaben. Sie wandte die Augen nach den Häusern von Fougères, deren freundliche Lichter wie irdische Sterne blinkten, und plötzlich sah sie deutlich den Papageienturm vor sich. Nur ein kleiner Zwischenraum trennte sie von ihrer Wohnung, aber dieser Zwischenraum war ein Abgrund. Sie erinnerte sich der Schluchten zu beiden Seiten des schmalen Fußpfades, auf dem sie gekommen, zu gut, um nicht zu wissen, daß es gefahrvoller für sie sein würde, nach Fougères zurückzukehren, als ihre Unternehmung fortzusetzen. Auch dachte sie, der Handschuh des Gars würde alle Gefahren ihres nächtlichen Spaziergangs beseitigen, sofern die Königstreuen das Gelände besetzt hätten. Nur Frau von Gua konnte ihr verderblich werden. Bei diesem Gedanken griff sie nach ihrem Dolch. Dann nahm sie die Richtung auf ein Landhaus zu, dessen Dach sie von den Felsen von Saint-Sulpice aus gesehen hatte. Sie ging ganz langsam, denn jetzt verspürte sie zum ersten Male die düstere Majestät, die sich lastend auf den Menschen senkt, wenn er sich mitten in der Nacht allein in einer wilden Gegend sieht, rings umgeben von hohen Bergen, die, versammelten Riesen gleich, ihre Häupter neigen. Das Rascheln ihres Kleides, das am Ginster hängen blieb, ließ sie mehr als einmal erschauern, und mehr als einmal beschleunigte sie den Schritt, um ihn dann, im Glauben, ihre letzte Stunde sei nahe, wieder um so mehr zu verlangsamen. Bald aber nahmen die Umstände einen Charakter an, bei dem auch der unerschrockenste Mann vielleicht nicht standhaft geblieben wäre, und versetzten sie in einen jener Schreckenszustände, die derart auf die Spannkraft des Menschen einwirken, daß alles den äußersten Punkt erreicht, Kraft wie Schwäche. Dann können die Schwächsten unerhört kraftvolle Handlungen begehen, während die Stärksten vor Angst sich wie toll gebärden.