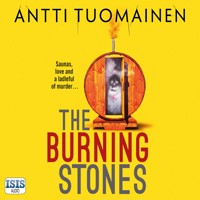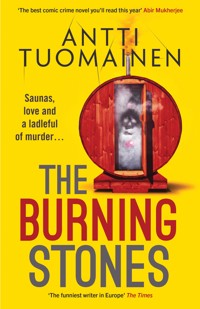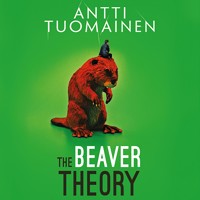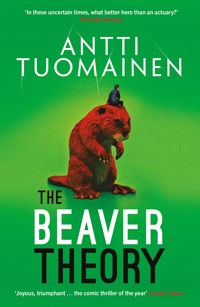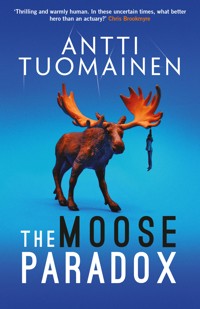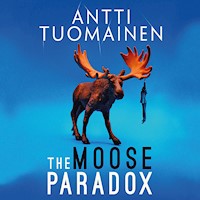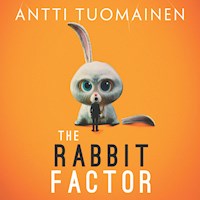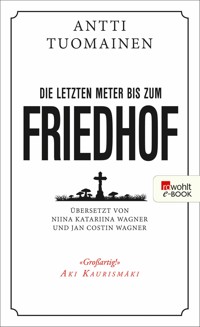
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Großartig!» Aki Kaurismäki Jaakko ist 37, als sein Arzt ihm eröffnet, dass er keine Grippe hat, sondern sterben wird, und zwar sehr bald: Jemand hat ihn über längere Zeit hinweg vergiftet. Das an sich ist schon geeignet, einem Mann so richtig den Tag zu verderben. Leider wird Jaakko bei der Rückkehr nach Hause außerdem noch Zeuge, wie ihn seine Frau mit Petri betrügt, dem jungen, knackigen Angestellten ihrer gemeinsamen Firma. Der Firma, die in jüngster Zeit gefährlich Konkurrenz bekommen hat. Jaakko beschließt herauszufinden, wer ihn um die Ecke bringen will. Und er wird sein Unternehmen für die Zeit nach seinem Tod fit machen. Der Handel mit den in Japan zu Höchstpreisen gehandelten Matsutake-Pilzen läuft nämlich ausgezeichnet, und in Finnlands Wäldern wachsen nun einmal die besten. Doch das neue Konkurrenzunternehmen kämpft wirklich mit harten Bandagen. Ist es da Jaakos Schuld, wenn es zu Toten kommt? Und hat er überhaupt Zeit für anderer Leute Sorgen? Denn so viel ist klar: Mit dem Tod vor Augen geht alles leichter, gilt es doch, jede Minute zu genießen. «Die letzten Meter bis zum Friedhof» ist nicht einfach ein Kriminalroman, sondern ein besonderes Buch: lustig und tragisch, berührend und skurril, lebensklug und nachdenklich, ein Roman, der trotz seines makabren Themas die Lebensgeister weckt, und eine schräge Lektüre, bei der man sich fühlt, als befände man sich in einem Film von Aki Kaurismäki.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Antti Tuomainen
Die letzten Meter bis zum Friedhof
Roman
Über dieses Buch
«Großartig!» Aki Kaurismäki
Jaako ist 37, als sein Arzt ihm eröffnet, dass er keine Grippe hat, sondern sterben wird, und zwar sehr bald: Jemand hat ihn über längere Zeit hinweg vergiftet. Das an sich ist schon geeignet, einem Mann so richtig den Tag zu verderben. Leider wird Jaako bei der Rückkehr nach Hause außerdem noch Zeuge, wie ihn seine Frau mit Petri betrügt, dem jungen, knackigen Angestellten ihrer gemeinsamen Firma. Der Firma, die in jüngster Zeit gefährlich Konkurrenz bekommen hat. Jaako beschließt herauszufinden, wer ihn um die Ecke bringen will. Und er wird sein Unternehmen für die Zeit nach seinem Tod fit machen. Der Handel mit den in Japan zu Höchstpreisen gehandelten Matsutake-Pilzen läuft nämlich ausgezeichnet, und in Finnlands Wäldern wachsen nun einmal die besten. Doch das neue Konkurrenzunternehmen kämpft wirklich mit harten Bandagen. Ist es da Jaakos Schuld, wenn es zu Toten kommt? Und hat er überhaupt Zeit für anderer Leute Sorgen? Denn so viel ist klar: Mit dem Tod vor Augen geht alles leichter, gilt es doch, jede Minute zu genießen.
«Die letzten Meter bis zum Friedhof» ist nicht einfach ein Kriminalroman, sondern ein besonderes Buch: lustig und tragisch, berührend und skurril, lebensklug und nachdenklich, ein Roman, der trotz seines makabren Themas die Lebensgeister weckt, und eine schräge Lektüre, bei der man sich fühlt, als befände man sich in einem Film von Aki Kaurismäki.
Vita
Antti Tuomainen, Jahrgang 1971, ist einer der angesehensten und erfolgreichsten finnischen Schriftsteller. Er wurde u.a. mit dem Clue Award, dem finnischen Krimipreis, ausgezeichnet, seine Romane erscheinen in über 25 Ländern. Antti Tuomainen lebt mit seiner Frau in Helsinki.
Der Übersetzer Jan Costin Wagner, 1972 geboren, lebt als freier Schriftsteller und Musiker in der Nähe von Frankfurt. Seine Romane wurden in 14 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Finnland, der Schauplatz der Romane um den jungen Ermittler Kimmo Joentaa, ist seine zweite Heimat.
Niina Katariina Wagner wurde 1975 in einer kleinen Küstenstadt im Südwesten Finnlands geboren. Sie studierte Soziologie, Psychologie und Kulturgeschichte in Turku und lebt seit 2000 als freie Künstlerin in der Nähe von Frankfurt.
Impressum
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel «Mies joka kuoli» im Verlag Like, Helsinki, 2016.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Februar 2018
«Mies joka kuoli» Copyright © by Antti Tuomainen, 2016
Umschlaggestaltung und Motiv: bürosüd, München
ISBN 978-3-644-00137-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Anu, in Liebe, ein weiteres Mal
Anmerkung
Der Autor hat sich große künstlerische Freiheiten im Hinblick auf geographische, medizinische, naturwissenschaftliche Fakten genommen. Ansonsten ist die Geschichte vollkommen korrekt.
«He was some kind of man.
What does it matter what you say about people?»
MARLENE DIETRICH, Touch of Evil
IDer Tod
1
«Es war gut, dass Sie uns auch eine Urinprobe gegeben haben.»
Das ovale Gesicht des Mannes hinter dem Schreibtisch strahlt eine ernste, gewichtige Ruhe aus. Das dunkle Gestell seiner Brille betont noch das intensive Blau seines Blicks, der auf mich gerichtet ist.
«Das Ganze, nun, lassen Sie mich ein wenig ausholen. Ich habe Rücksprache gehalten mit meinen Kollegen in Kotka und Helsinki. Ihre Erkenntnisse entsprechen unseren. Und ich möchte betonen, dass wir nichts hätten ändern können, selbst wenn wir die Sache schon bei Ihrem letzten Besuch klarer gesehen hätten. Wie geht es Ihnen heute? Erzählen Sie ein wenig.»
Ich zucke mit den Schultern und wiederhole mehr oder weniger, was ich schon beim letzten Mal erzählt habe. Dass alles mit plötzlicher Übelkeit begann, die mich buchstäblich aus den Socken gehauen hat. Dass ich in regelmäßigen Abständen das Gefühl habe, jeden Moment in Ohnmacht zu fallen. Ich erleide heftige Hustenanfälle. Der Stress raubt mir den Schlaf. Wenn ich dann doch irgendwann eindöse, habe ich Albträume. Und Kopfschmerzen, die sich anfühlen, als würde jemand mit einem scharfen Messer an meinen Augen entlangstreichen. Mein Hals ist trocken. Und immer wieder diese Übelkeit, die mich überfällt, von einem Moment auf den anderen.
Und das alles ausgerechnet jetzt, wo unsere Firma vor der größten Herausforderung ihrer noch jungen Existenz steht.
«Ja», sagt der Arzt, er nickt. «Ja, ich verstehe.»
Ich schweige, und auch er schweigt für eine Weile, bevor er fortfährt. «Nun, es ist so, es handelt sich nicht um einen hartnäckigen grippalen Infekt, wie wir anfänglich vermutet haben. Der Urintest hat uns auf die Spur gebracht, und die MRT und die Sonographie haben die Verdachtsdiagnose bestätigt. Ihre Nieren sowie die Leber und die Bauchspeicheldrüse, mit anderen Worten, wichtige innere Organe, sind schwer geschädigt. Aus dem, was Sie berichten, entnehmen wir, dass auch das zentrale Nervensystem bereits beeinträchtigt ist. Möglicherweise auch das Hirn. Wir haben es mit einer ausgeprägten Vergiftungssymptomatik zu tun. Die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung sind, nun, bemerkenswert. Diese Werte könnten selbst ein Nilpferd niederstrecken. Dass Sie mir hier gegenübersitzen und zur Arbeit gehen können, verdanken Sie vermutlich der Tatsache, dass sich die Gifte über einen längeren Zeitraum hinweg in Ihrem Körper angereichert haben, schleichend. Ihr Körper hat sich, so weit das möglich ist, daran gewöhnt.»
Etwas in mir reißt. So fühlt es sich an. Ich falle, stürze, in einen kalten Abgrund. Einige Sekunden lang. Dann ist es vorbei. Ich sitze auf einem Stuhl, mir gegenüber sitzt der Arzt hinter seinem Schreibtisch, es ist Dienstag. Bald werde ich mich auf den Weg machen, zur Arbeit. Ich habe mal gelesen, dass Menschen, die in einem brennenden Haus stehen, plötzlich die Ruhe selbst sein können. Menschen, die von einer Pistolenkugel getroffen worden sind, können noch ganz vernünftige Gedanken haben, obwohl sie literweise Blut verlieren. Ähnlich scheint es bei mir zu sein. Ich sitze einfach nur da, als würde ich auf den nächsten Bus warten.
«Sie erwähnten einmal, dass Sie beruflich mit Pilzen zu tun haben», sagt der Arzt.
«Ja, aber Matsutake ist nicht giftig», entgegne ich. «Und die Erntezeit beginnt ja erst.»
«Matsutake?»
Ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll.
Ich entscheide mich für die Kurzfassung. Meine Frau hat in Helsinki in der Großküche eines Caterers gearbeitet, ich war in derselben Firma Verkaufsleiter. Vor drei Jahren wurden große Teile der Belegschaft abgebaut, wir verloren beide unseren Job. Also brauchten wir eine neue Idee. In Hamina suchten sie gerade – wie in so vielen finnischen Kleinstädten – nach neuen Geschäftsmodellen, weil der Hafen und die Papierfabrik stillgelegt worden waren. Wir handelten schnell, erhielten einen großzügigen Existenzgründerzuschuss und nahezu zum Nulltarif unsere Firmenräume. Wir fanden Mitarbeiter, die die Felder und Wälder in der Umgebung kennen wie ihre Westentaschen. Wir verkauften unsere Wohnung in Oulunkylä und erwarben ein Einfamilienhaus in Hamina sowie ein kleines Boot und eine Anlegestelle, siebzig Meter von unserem Briefkasten entfernt.
Unsere Geschäftsidee: Matsutake. Kieferduftritterlinge.
Die Japaner sind verrückt nach diesen Dingern, und Finnlands Wälder sind voll davon.
Es gibt Japaner, die tausend Euro fürs Kilo hinblättern, wenn Matsutake-Pilze in ihrer frühen Blüte stehen. Und in den Wäldern im Norden und Osten von Hamina kann man sie pflücken wie vom Präsentierteller. Unsere Räume sind bestens ausgestattet, wir trocknen und lagern die Pilze, und während der Erntezeit geht einmal wöchentlich eine Sendung nach Tokio raus.
Ich atme durch. Der Arzt wirkt nachdenklich.
«Gut. Wie ist, abgesehen davon, Ihr Lebenswandel?»
«Mein Lebenswandel?»
«Wie ernähren Sie sich? Treiben Sie Sport?»
Ich entgegne, dass ich mit gutem Appetit esse. Seit ich Taina kennengelernt habe, vor sieben Jahren, habe ich nicht ein einziges Mal gekocht. Und Taina serviert keineswegs Teller, auf denen eine teelöffelgroße Portion Selleriepüree nach einem einsamen Halm Weizengras sucht. Taina kocht gerne mit Sahne, Salz, Butter, Käse und Schweinefleisch. Ich mag, was sie kocht, habe es immer gemocht. Das sieht man mir auch an, ich wiege 24 Kilogramm mehr als am Tag unseres Kennenlernens.
Taina hat merkwürdigerweise nicht zugenommen. Es könnte daran liegen, dass sie ohnehin von stattlicher Statur ist. Sie sieht ein wenig aus wie eine Gewichtheberin auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Ich meine das auf eine gute Weise: Ihre Oberschenkel sind rund, muskulös und straff. Ihre Schultern breit, die Arme stark, ohne männlich zu wirken. Ihr Bauch ist flach wie ein Waschbrett.
Wenn ich Fotos von Bodybuilderinnen sehe, die es mit dem Trainieren nicht allzu wild treiben, dann denke ich an Taina. Sie hält sich regelmäßig fit, bei der Gymnastik, im Studio, und seitdem wir in Hamina sind, rudert sie sogar im Meer. Ich habe ja anfänglich versucht mitzumachen, aber der Ehrgeiz hat sich ein wenig verflüchtigt.
Das alles erzähle ich dem Arzt. Ich weiß gar nicht, warum ich so schnell und so viel rede, warum ich so detailreich von Taina erzähle. Fehlt nur noch, dass ich zentimetergenau ihre Maße herunterbete.
Dann, als der Arzt seinen wohlwollenden Blick ein wenig zur Seite abgleiten lässt, frage ich ihn, was wir denn nun tun werden. Der Arzt sieht mich an, als habe er gerade erst begriffen, dass ich ihm nicht zugehört und keines seiner Worte verstanden habe. Hinter den Brillengläsern blinzeln seine Augen.
«Nichts», sagt er. «Da ist nichts, was wir tun können.»
Der Raum ist wie überbelichtet, angefüllt mit Sonne, mit Sommer. Auch ich blinzle.
«Es tut mir leid», sagt er. «Vielleicht war ich nicht klar genug. Wir konnten nicht feststellen, um welche Art Gift es sich handelt. Es scheint eine Kombination verschiedener Substanzen zu sein. Und wenn wir die Symptome betrachten und das, was Sie berichten, so ist davon auszugehen, dass die Gifte so exakt dosiert eingeschlichen wurden, dass wir nichts tun können. Wir sehen keine Möglichkeit, einen Normalzustand wiederherzustellen. Keine Möglichkeit, wie soll ich sagen, die eingeschlagene Richtung umzukehren. Es ist eher die Frage, wie lange es dauert, bis Ihre Körperfunktionen eine nach der anderen aussetzen werden. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber diese Vergiftung wird unweigerlich den Tod herbeiführen.»
Das Sonnenlicht, das den Raum flutet, verstärkt noch die Absurdität dieser finalen Worte. Die Worte sind am falschen Platz. Und ich bin am falschen Ort. Ich bin hierhergekommen wegen einer Grippe, wegen Magenbeschwerden und gelegentlicher Übelkeit. Ich möchte hören, dass ich Ruhe und ein paar Antibiotika brauche, von mir aus, im schlimmsten Fall, irgendeine Magenspülung, und dann geht es aufwärts, und ich werde …
«Es ist mit Bauchspeicheldrüsenkrebs oder einer Leberzirrhose vergleichbar», sagt der Arzt. «Wenn lebenswichtige Organe über ihre Kapazität hinaus strapaziert werden, ist eine Regeneration nicht möglich. Das Organ brennt gewissermaßen aus, es erlischt, wie eine Kerze. Wir können da nichts machen. Eine Transplantation kommt nicht in Betracht, weil auch die umgebenden Organe geschädigt sind. Es würde also keine Besserung eintreten, sondern im Gegenteil das Organversagen eher beschleunigt werden. In Ihrem Fall scheinen die betroffenen Organe alle in einem vergleichbar fortgeschrittenen Stadium der Schädigung zu sein. Möglicherweise ist das, also gewissermaßen dieses Gleichgewicht des Schreckens, sogar der Grund dafür, dass Sie momentan noch in einem augenscheinlich recht guten Allgemeinzustand sind.»
Ich betrachte den Arzt. Sein Kopf bewegt sich kaum merklich. Wackelt hin und her.
«Natürlich ist alles relativ», sagt er.
Der Arzt sitzt hinter seinem Schreibtisch. Heute und morgen und kommende Woche wird er da sitzen. Der Gedanke füllt mich ganz aus. Nach einem Moment weiß ich auch, warum.
«Wie …?» Ich zögere. Mir liegt die Frage auf der Zunge, die man vermutlich nur ein Mal im Leben stellt. «Wie lange? Wie viel Zeit habe ich noch?»
Der Arzt, der seinen Beruf vermutlich noch zehn Jahre ausüben und seinen Ruhestand weitere zehn oder zwanzig Jahre genießen wird, mustert mich mit ernster Miene.
«Unter Berücksichtigung aller Faktoren, Tage. Höchstens Wochen.»
Ich möchte schreien. Irgendetwas. Dann will ich um mich schlagen. Dann kommt die Übelkeit. Ich schlucke, atme durch.
«Ich begreife einfach nicht, wie das möglich ist», sage ich.
«Es ist so, dass verschiedene Faktoren zusammen …»
«Das meine ich nicht.»
«Ja.»
Wir schweigen.
Es fühlt sich an, als würde der Sommer enden, der Herbst beginnen. Dann der Winter, der Frühling. Dann ist der Sommer wieder da. Der Arzt mustert mich fragend, während seine Finger an einem blauen Blatt Papier entlangstreichen, das auf seinem Schreibtisch liegt. Auf dem Blatt sind mein Name und diverse Informationen zu lesen. Jaakko Mikael Kaunismaa. Sozialversicherungsnummer 081178–073H.
«Haben Sie irgendwelche Wünsche?»
Ich sehe offenbar verwirrt aus, der Arzt präzisiert seine Frage. «Psychotherapeutische Begleitung? Sterbebegleitung? Ambulante oder häusliche Pflege? Medikamente zur Beruhigung? Schmerzmittel, Sedativa?»
Ich muss zugeben, dass ich an dergleichen noch nicht gedacht habe. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, wie ich die letzten Tage verbringe, es gibt keine To-do-Liste. Der Tod kommt ja nur ein Mal im Leben. Vielleicht hätte ich mich im Vorfeld ein wenig intensiver mit dem Thema befassen sollen. Ich habe die letzten Dinge immer gerne verdrängt, vermieden. Jetzt begreife ich, dass es große Fragen sind, geknüpft an wichtige Entscheidungen. Und wichtige Entscheidungen habe ich in den vergangenen sieben Jahren immer gemeinsam mit meiner Frau getroffen. Von Helsinki nach Hamina zu ziehen. Das Mondäne gegen Matsutake einzutauschen.
«Ich muss es mit meiner Frau besprechen», sage ich.
Während ich die Worte ausspreche, spüre ich, wie wahr sie sind. Ich muss mit ihr sprechen, und dann werde ich wissen, was zu tun ist.
2
Der Asphalt unter meinen Füßen scheint zu vibrieren. Der Wind scheint vergessen zu haben, dass seine Aufgabe darin besteht zu wehen. Alles um mich herum ist grün, die Luft ist stickig, ich habe das Gefühl, in dichtem Moos zu versinken. In meiner Hand liegt schweißnass das Telefon. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe nicht vor zu telefonieren. Das, was ich zu erzählen habe, erzählt man nicht am Telefon. Das Hemd klebt an meiner Haut, ich hebe es ein wenig an, aber es klebt sofort wieder fest.
Ich setze mich in den Wagen, starte den Motor und stelle die Klimaanlage auf die kälteste Stufe ein. Das Lenkrad liegt feucht und weich in meinen Händen. Ich fühle mich vollkommen ruhig, vielleicht fühlt man sich so unter Schock, es soll mir recht sein.
Ich fahre, biege vom Parkplatz des Krankenhauses nach rechts ab. Schneller käme ich ans Ziel, würde ich nach links abbiegen, aber ich brauche ein paar Minuten. Ich möchte ein wenig nachdenken, in Ruhe, Gedanken sammeln, Gedanken ordnen.
Unsere Firma befindet sich auf der anderen Seite des Wasserturms, in Hevoshaka. Ich fahre in Richtung Salmenvirta, immer geradeaus, dann biege ich links ab und folge der Küstenstraße nach Savilahti. Zwischen Bäumen und Häusern blitzt das Meer auf, so blau wie die Uniformen von Polizisten. Ein Mann erneuert die Pflastersteine in seiner Auffahrt, obwohl alles tadellos aussieht. Eine Frau fährt auf ihrem Fahrrad vorüber, mit wallendem Haar, vermutlich kehrt sie vom Markt zurück, den Korb voller Einkäufe. Es ist fünf Minuten vor elf. Später Vormittag in Hamina.
Ich erreiche die Mannerheimstraße und biege nach links ab. Dann in den Mullinkoskenweg und wieder links ab in die Industriestraße. Der Stadtteil Hevoshaka ist klein und ziemlich heterogen bebaut. Hier findet sich alles. Einfamilienhäuser, Hochhäuser, Firmen, Imbissbuden, Industrieanlagen.
Unsere Firma ist in einem bräunlich gelben Bungalow untergebracht, ausgestattet mit einer kleinen Pack- und Verladegarage auf der einen und einer Sauna inklusive Terrasse auf der anderen Seite. Tainas Wagen ist nicht zu sehen. Vielleicht ist sie noch zu Hause oder zum Mittagessen gefahren. Das macht sie gerne. Ich selbst gehe ungern während des Arbeitstages nach Hause, das bringt meine innere Uhr durcheinander, es bringt mich aus dem Rhythmus. Es ist einfacher und klarer, den Tag in der Firma zu verbringen und den Feierabend zu Hause. So bleibt beides fein säuberlich voneinander getrennt. Arbeit bleibt Arbeit, Zuhause bleibt Zuhause.
Ich wende im Hof und fahre nach Pappilansaari. Das Handy liegt auf dem Fahrersitz, zwischen meinen Beinen.
Hamina wird oft als «Kreiselstadt» bezeichnet, weil angeblich alles kreisrund sei, das gilt allerdings nur für den Stadtkern. Also für Rathaus und Umgebung. Abgesehen von dieser Gegend sieht Hamina aus der Luft ebenso schachbrettartig aus wie jede andere Stadt in Finnland.
Auf dem Marktplatz wimmelt es von Leuten.
Die lokalen Händler bieten ihre Waren an, außerdem sind die in den Sommermonaten unvermeidlichen Verkäufer von Meterlakritze und diesen unverschämt überteuerten Saunahandtüchern aus Leinen vor Ort. Einer verkauft sogar Unterhosen, in Packungen zu zehn, zwanzig oder hundert Stück.
Von Zeit zu Zeit schießt mir der Gedanke an den Tod durch den Kopf, aber er bleibt vage und fern. Es erscheint mir unmöglich, daran zu denken, insbesondere, wenn es um den eigenen Tod geht. Der Gedanke kommt, und eine Sekunde später denke ich an irgendetwas Alltägliches: an die Einkaufsliste oder an Anschaffungen für die Firma. Ich überquere die Brücke von Pappilansalmi. Hamina ist an kleinen Halbinseln, Inseln und Feldern entlang erbaut worden, an vielen Stellen schlängelt sich das Meer zwischen die Häuser, die hier und da verstreut in der Landschaft stehen. Es sieht aus, als würde das Wasser des Meeres blaue Teilchen aus der weiten Landschaft herausbeißen.
Tainas weinroten Hyundai sehe ich schon aus der Ferne. Hinter ihrem Wagen steht ein schwarz glänzender, frisch gewaschener Corolla. Ich parke am Straßenrand.
Hat Taina erwähnt, dass Petri zu Besuch kommt?
Manchmal bleibt Taina zu Hause, weil sie neue Rezepte ausprobieren möchte, Petri hilft ihr dann gerne. Petri haben wir kurz nach der Firmengründung als ersten Mitarbeiter eingestellt. Er ist unser Experte für Maschinentechnik und kann alles reparieren, wenn es nötig ist. Darüber hinaus ist er ein Segen für unsere Logistik, da er jede Straße, jeden Hügel, jede Kurve im Umkreis von fünfzig Kilometern kennt.
Gut, also, denke ich, während ich aus dem Wagen steige. Ich werde Petri darum bitten, ins Büro zurückzukehren, unter irgendeinem Vorwand. Irgendein Problem mit der Reinigungsanlage. Ja. Mir wird schon was einfallen. Dann werde ich Taina darum bitten, auf dem Sofa Platz zu nehmen, und dann sage ich … ich weiß nicht genau, was. Immerhin wird es sicher nicht nötig sein, etwas hinzuzuerfinden.
Unser Haus ist das letzte in einer zum Ende hin immer schmaler werdenden Sackgasse. Die Fassade ist hell und gelb, und hinter dem Haus erstreckt sich ein blühender grüner Garten mit Beerensträuchern und Blumenbeeten, der an einen kleinen Strand und ans Wasser hinabführt. Im Zentrum des Gartens haben wir eine etwa zehn Quadratmeter große Terrasse, auf der man gemütlich sitzen und das Meer betrachten kann, ohne gestört zu werden. Sehen können uns nur Leute, die jenseits des Wassers am anderen Ufer stehen, und das ist ziemlich weit weg.
Ich gehe die Treppe hinauf zur Tür. Seit einiger Zeit gerate ich dabei immer außer Atem. Ich dachte, dass es mit der Grippe zu tun hat. Mit einer Bronchitis. Von mir aus, im schlimmsten Fall, mit einer Lungenentzündung, die ich ein wenig verschleppt habe. Ich lege eine Hand auf das Geländer und halte für eine Weile inne. Ich höre das Dröhnen eines Wasserflugzeugs, das näher kommt.
Betuchte Russen haben sich an den Stränden regelrechte Schlösser erbaut. Einige von ihnen besitzen Schiffe oder sogar Flugzeuge, mit denen sie einen oder zwei Sommer lang Lärm machen. Dann bieten sie den ganzen Ramsch zum Verkauf an, die Villa, das Flugzeug, ohne einen Käufer zu finden.
In einer Stadt, die unter der Rezession leidet, mit hoher Arbeitslosigkeit und einer stetig älter werdenden Bevölkerung, gibt es nicht allzu viele Millionäre.
Das Wasserflugzeug kommt immer näher.
Das Geländer fühlt sich plötzlich kalt an, ich löse meine Hand, öffne die Haustür und rufe: «Hallo.» Keine Antwort. Vielleicht sind sie in der Küche. Ich gehe durch den Flur, der Holzboden knirscht unter meinen Füßen. In der Küche ist niemand. Sie ist blitzblank sauber. Da ist auch kein Eintopf, der einsam vor sich hin köchelt, kein Geruch von garenden Speisen. Die Arbeitsplatten glänzen im Sonnenlicht. Ich rufe nach Taina.
Das Wasserflugzeug ist jetzt über dem Haus, es brummt und dröhnt, übertönt meine Stimme. Ich laufe zur Hintertür, öffne sie, bleibe auf der höchsten Stufe der Treppe stehen. Über mir das Flugzeug.
Der Boden schwankt.
Oder bin ich es, der schwankt?
Nein, der Boden unter meinen Füßen ist in Bewegung.
Ich nehme es mit geschärften Sinnen wahr. Über mir lärmt das Flugzeug, das jetzt eine scharfe Kurve fliegt, im blauen, warmen Himmel. Der Sonnenstuhl der Firma Masku wird gleich zerbrechen, die Polster, die rot und weiß gestreift sind, werden fest gegen das Metallgestänge gepresst. Der Grill, ein deutsches Fabrikat, rollt langsam, wie in Zeitlupe, Millimeter für Millimeter, in Richtung der Rasenfläche. Die Hollywoodschaukel vibriert kaum merklich, auch die Blumentöpfe sind auf dem Sprung, gleich werden sie loslaufen.
Petri liegt auf dem Sonnenstuhl, auf dem Rücken. Er streckt mir die Fußsohlen entgegen. Sein Kopf ist nach hinten gekippt, in eine unnatürliche Position, er hängt wie ein Fremdkörper über der Stuhlkante. Er kann das Meer sehen, aber falsch herum, falls er die Augen überhaupt geöffnet hat. Taina gibt sich alle Mühe, seine Augen geschlossen zu halten.
Sie wendet mir ihren breiten, schweißnassen Rücken zu, ihr Hintern glänzt rot in der Sonne. Sie reitet auf Petri, als würde sie einen hohen Berg erklimmen wollen. Ihre Füße heftet sie fest an den Boden, ihre Hüften tanzen und pumpen, ihr Blick ist gen Himmel gerichtet. Vermutlich sieht sie dasselbe Wasserflugzeug, das auch ich sehe.
Taina beschleunigt den Takt, den Rhythmus. Schneller und schneller, fast nicht vorstellbar, dass das überhaupt möglich ist.
Ich sehe eine Eisenstange an der Wand des Gartenschuppens.
Dann erbreche ich mich. Die Übelkeit kommt so plötzlich und so massiv, dass ich mich nur mit Mühe auf den Beinen halten kann. Ich greife fest nach dem Geländer, mit beiden Händen.
Ein Teil des Erbrochenen fliegt im hohen Bogen in Richtung der Terrasse.
Das Dröhnen des Flugzeugs lässt das Haus erzittern. Ich wende mich ab, gehe zurück, intuitiv, wie ferngesteuert. Ich ziehe die Tür hinter mir zu, stehe im Schatten des Hauses.
Ich spüre, wie Luft meine Lungen füllt. Ich habe für eine Weile nicht geatmet. Ich richte mich auf. Kerzengerade.
Das Wasserflugzeug lärmt jetzt in der Ferne. Wie eine Fliege, die im Nebenzimmer summt. Ich weiß, dass ich das, was ich Taina erzählen wollte, nicht erzählen werde. Es ergibt keinen Sinn. Was ich am meisten vermisse, ist die Klimaanlage meines Wagens.
3
Ich drifte von Zeit zu Zeit auf die Gegenfahrbahn ab, fahre Schlangenlinien. Gut, dass die Straßen kaum befahren sind. Die Touristen sind am Strand oder auf dem Markt. Auch die Einheimischen machen sich entweder vormittags oder gegen Abend auf den Weg in die Stadt. Mittagszeit. Ruhige Zeit.
Meine Gedanken allerdings rasen. Aus Wut wird Erschütterung, aus Erschütterung Enttäuschung. Aus Enttäuschung eine kühle, bodenlose Leere.
Dann kehrt die Wut zurück. Ich habe das ernste Gesicht des Arztes vor Augen, seinen weißen Kittel. Dann Tainas dicke Schenkel, die sich auf und ab bewegen.
Die Klimaanlage habe ich voll aufgedreht.
Die kalte Luft beruhigt mich ein wenig, das Brennen in den Augen und der Schweißausbruch lassen nach.
Mein Gesicht fühlt sich wieder so an, als sei es mein eigenes.
Sogar eine Richtung kristallisiert sich heraus, die ich einschlagen könnte.
Ich finde direkt vor dem Polizeigebäude einen Parkplatz. Das zweistöckige Haus vermittelt den Eindruck einer konzentrierten Stille, es ist das mit Abstand modernste in der Umgebung. Neben dem Rathaus stehen, zur Linken und zur Rechten, zwei Kirchen. In Richtung Südosten eine russisch-orthodoxe, nach Nordwesten eine lutherische. Ansonsten wird der Platz von bis zu 150 Jahre alten, aufwendig restaurierten, sehr ansehnlichen Holzhäusern dominiert. Würden diese Häuser in Helsinki stehen, müsste man im Lotto gewinnen, um eines von ihnen bewohnen zu dürfen.
Ich bin erst ein Mal auf dem Polizeirevier gewesen, vor einem Monat, um einen Diebstahl zu melden. Vom Hof unserer Firma waren Verpackungsmaterialien entwendet worden, die Mitarbeiter von der Logistik einfach hatten liegen lassen. Ich weiß, wer sie genommen hat, habe ein wenig Detektivarbeit geleistet. Ich hatte aber keine Beweise und konnte deshalb die Polizisten nicht sonderlich für meine Theorie begeistern. Also hielt ich meinen Mund, erhielt eine Kopie der Strafanzeige gegen unbekannt für die Versicherung. Als ich zurück in die Firma kam, sagte Taina, dass ich zu schnell aufgeben und die Dinge mal wieder nicht zu Ende bringen würde.
Was, bei Lichte besehen, in diesem Moment ein wenig merkwürdig klingt.
Ich sitze im stillen Wagen, habe den Motor ausgeschaltet. Das Rauschen der Klimaanlage ist verstummt, und an dessen Stelle tritt eine wundersame Ruhe. Ich bin ganz sicher, dass ich hören kann, wie ein Mädchen im Sommerkleid über die Straße radelt. Ihr Kleid wölbt sich ein wenig im Wind, die Reifen beißen sich in den Asphalt, vor dem Blumenladen wird ein Gespräch geführt, über blaue Stiefmütterchen. Im Eiswagen surrt eine Tiefkühltruhe. Ich frage mich, was mit mir los ist, und ich kenne die Antwort.
Die Tür zur Polizeistation geht auf.
Ein Mann in meinem Alter tritt auf die Straße hinaus, wutschnaubend um sich blickend, er läuft zu seinem Wagen, steigt ein und fährt mit quietschenden Reifen los. Genau das passiert, denke ich vage. Wenn man voreilig handelt, von Wut gesteuert, aufgewühlt.
Vor Sekunden habe ich allen Ernstes vorgehabt, dieses Polizeigebäude zu betreten. Um was zu berichten?
Ich sterbe. Ich bin vergiftet worden. Nein, beweisen kann ich es nicht. Meine Frau vögelt einen meiner Mitarbeiter. Ja, in unserem Garten. Können Sie mir weiterhelfen?
Wie lächerlich das klingen würde, wie armselig.
Falls ich in Kürze sterben werde, wann genau auch immer, habe ich keine Lust, den kleinen Rest meiner Tage auf dem Polizeirevier einer Kleinstadt zu verbringen und dort intimste Erlebnisse und Empfindungen zu offenbaren. Offenbarungen, mit denen ich gar nichts erreichen könnte. Was hilft es denn, wenn sich meine wirren Gedanken als zutreffend erweisen? Wenn meine Frau und ihr zehn Jahre jüngerer Lover auf die Idee gekommen sind, mich zu vergiften?
Das immerhin ist der Gedanke, der mir in den Sinn gekommen ist, er ist mir gewissermaßen zugeflogen. Er entbehrt ja nicht einer gewissen Logik. Wir schaffen uns den Fettsack vom Hals, der stört nur. Was aber die Frage aufwirft, warum Taina nicht einfach die Scheidung einreicht. Keine Ahnung.
Wenn ich nun also den Verdacht erfolgreich auf die beiden lenken könnte, würde das Ganze tatsächlich jemals aufgeklärt werden? Und wann? Und was würde mir das noch bringen?
Nichts. Ich bin ja dann längst tot.
Ich bin ein toter Mann, egal was kommt.
Ich steige aus dem Wagen. Die Hitze hüllt alles ein, es ist windstill. Ich betrachte die Bäume, ihr leuchtendes Grün, der Sommer hat seinen Scheitelpunkt erreicht.
Aus dem Polizeigebäude kommen zwei Uniformierte. Junge Männer, sie tragen Waffen an ihren Gürteln. Einer der beiden blickt in meine Richtung. Ich lächle intuitiv und nicke ihm zu. Der Polizist scheint darüber nachzudenken, ob er mich kennt. Aber er kennt mich nicht, kann mich nicht kennen. Er hat den Blick auch schon wieder abgewendet, konzentriert auf das, was sein Kollege sagt, sie gehen an mir vorüber.
Die Eisverkäuferin ist jung, vermutlich eine Schülerin im Ferienjob. Sie hat lange braune Haare. Ihr Lächeln ist freundlich und fühlt sich nach Sommer an.
Ich bestelle eine Kugel Rum-Rosine und eine Lakritz-Banane, und als sie mir gerade die Tüte geben möchte, bestelle ich noch eine. Vanille. Wie in guten, alten Zeiten. Das Mädchen presst die Kugeln fest gegeneinander, das Eis ist dennoch fast einen halben Meter hoch. Ich zahle mit einem Fünfzigeuroschein und schiebe das Wechselgeld in den kleinen Behälter fürs Trinkgeld. Das Mädchen bedankt sich, perplex, ihre Stimme ist hell, ich wünsche ihr alle Sonne dieser Erde.
Mit dem Eis in der Hand setze ich mich auf einen naheliegenden Stein. Ich lecke erst die schmelzenden Ränder ab, an den Seiten des Turms aus Speiseeis. Ich fühle nichts. Nichts Außergewöhnliches. Ich bin einfach hier. Ich denke, dass es schon immer so gewesen ist, ich habe es nur nie verstanden und nie darüber nachgedacht.
Ich sehe zur Polizeistation hinüber. Ich muss mit irgendjemandem reden. Nicht gerade jetzt in dieser Sekunde, nicht mit vollem Mund, das Eis ist süß, cremig und lecker, aber bald. Ab sofort ist alles bald.
Meine Eltern sind gestorben. Ich war das einzige Kind betagter Eltern, ich habe keine Geschwister und auch keine sonstigen nahestehenden Angehörigen. Ich habe keine Freundschaften aus der Kindheit bewahrt. Ich bin in keinem Verein, in keiner Mannschaft. Ich gehe die Leute aus meinem Leben einzeln durch, halte sie mir vor Augen. Gesichter, Stimmen, Gestik. Einer nach dem anderen steht auf, um irgendetwas zu sagen. Berührung. Einander in die Augen sehen. Jemand ist neben mir, kommt zu mir. Nein, keiner kommt. Einer nach dem anderen steht auf und geht, entfernt sich. Keiner möchte hören, was ich zu sagen habe. Ich bin dabei, die Hoffnung zu verlieren.
Das Eis hebt meine Stimmung. Es fühlt sich an wie ein Aufputschmittel, wie eine Injektion, die direkt durch meine Venen fließt. Also, so stelle ich es mir vor, ich habe keine Erfahrung damit. Sollte sich keine Gelegenheit ergeben, mir in diesem Leben noch Drogen intravenös zu verabreichen, wird es eine Vermutung bleiben. Aber ist es so nicht mit allen Dingen? Was ist unser Leben letztlich anderes als eine Ansammlung von Gedanken, Vorstellungen, Erwartungen, Hoffnungen, Vermutungen und Schlussfolgerungen, die wir alle aus demselben Hut ziehen?
Gedanken dieser Art habe ich mir noch nie gemacht, ich weiß nicht recht, ob das eher gut oder schlecht ist.
Die Eiscreme fühlt sich gut an, wie ein Sieg fühlt sie sich an.
Ich lasse noch einmal die Menschen, die ich kenne, vor meinen geschlossenen Augen auf und ab laufen, und immerhin der Gedanke an einen von ihnen bleibt haften.
Dann fahre ich zur Firma, ruhig, anders als zuvor. Ich halte mit der rechten Hand das Lenkrad und lasse die linke aus dem Fenster baumeln, lasse den Sommer mein Gesicht bescheinen.
Die Stadt ist still und warm. Ich fahre die Mannerheimstraße entlang. Zum ersten Mal betrachte ich den Park, rechts und links von der Straße, mit wachem Blick. Nach links fällt das Gelände etwas ab, ich sehe den kleinen Teich, der von Bäumen umsäumt ist. Rechts ist der Park hügelig und grün.
Ich biege in die Industriestraße ab, halte aber nicht auf Höhe der Firma an, sondern rolle vorbei. Ich höre aus der Ferne Tainas Stimme. Sie spricht in diesem Ton, in dem sie mir auch sagte, dass ich unfähig sei, Dinge zu Ende zu bringen, dass ich zu schnell aufgeben würde. Diese Stimme und dazu der Gedanke an den Anblick, den sie mir geboten hat. Ich spüre die Wut.
Ich fahre noch einige hundert Meter. Bis zu der Stelle, an der die Industriestraße abzweigt und ihren Namen wechselt. Ich passiere ein dunkelblaues Gebäude.
Pilz GmbH Hamina.
Drei Männer, die vor etwa einem halben Jahr auf der Bildfläche erschienen sind, wie aus dem Nichts.
Sie haben Kontakt zu unseren japanischen Kunden aufgenommen, haben bessere Qualität und günstigere Konditionen geboten. Was natürlich unmöglich ist, leere Versprechungen. Aber Musik in den Ohren der Kunden. Ich habe keine Ahnung, wie sie Mitarbeiter anwerben und die Rahmenbedingungen schaffen wollen. Mit Geld werden sie kaum locken können, denn die Großkunden haben nach wie vor wir.
Der Hof der Pilz GmbH ist leer. Eigentlich steht hier immer ein dekorativ mit Klebeband geflickter Kleintransporter. Manchmal steht auch eine der breiten Hebetüren offen, dann dudelt mir finnischer Pop oder Schlager entgegen, und mindestens einer der Firmeneigentümer lümmelt, Zigarette paffend, auf einem ramponierten Sofa herum. Jetzt ist alles still, das Gebäude wirkt verlassen.
Ich fahre vorbei und wende. Während ich mich wieder dem blauen Gebäude nähere, schärfe ich meinen Blick. Niemand da. Ich halte kurz am Straßenrand, bevor ich kurzentschlossen auf den Hof fahre.
Mittag. Hier bin ich. Was am Morgen passiert ist, liegt in weiter Ferne. Ich hebe meinen Fuß von der Kupplung, fahre noch ein paar Meter, bis zum Haus, und steige aus.
Neben dem breiten Tor befindet sich auch eine ganz normale Tür, mit einem Klingelknopf. Ich klingle. Einmal, zweimal. Niemand kommt, ich höre auch keine Schritte im Haus. Ich drücke die Türklinke hinunter. Die Tür lässt sich öffnen. Ich trete ein und rufe. «Hallo, jemand da?» Keine Antwort.
Ich stehe in einem Büro. Ein merkwürdiges Büro, die Tische sind kahl, die Regale leer. Auf einem der Tische steht einsam ein Laptop, und ein mir zugewandter Drehstuhl lässt erahnen, dass irgendwer da mal gesessen und gearbeitet haben könnte. An der Wand hängt ein großes, dominantes Porträt des ehemaligen Präsidenten, Kekkonen. Kekkonens starrer Blick prägt sich ein, setzt sich fest hinter meiner Stirn, obwohl ich mich schon abgewendet habe. Ich laufe, öffne eine Tür, betrete den nächsten Raum.
Die Küche, in die ohne Zweifel einiges investiert wurde. Eine Einrichtung, wie nur Männer sie planen können. Eine hohe Theke und ein gläserner Schrank für Bier und Hochprozentiges. Das Bier stammt vorwiegend aus Estland, jede Menge davon.
Die Küche ist sehr sauber und mündet in einen großen Aufenthaltsraum mit Sofa, einem fetten Fernseher und riesigen Lautsprechern. Ich stöbere ein wenig im bestens sortierten Platten- und DVD-Regal. Schlager und Action. Arttu Wiskari und Vin Diesel. In der Mitte des Raums baumelt einer dieser Sandsäcke, an dem Boxer trainieren. Rote Boxhandschuhe hängen an der Wand. Darunter eine beträchtliche Auswahl an Hanteln. An der gegenüberliegenden Wand entdecke ich etwas ganz anderes.
Ich trete näher und denke unwillkürlich an einen Samurai-Film, den ich irgendwann mal gesehen habe. Die ernsten Helden dieses Films haben mit diesen Dingern ihre Kämpfe ausgetragen. Ich hebe eines der Schwerter vorsichtig aus der Halterung, ziehe es aus der Scheide. Die Klinge ist lang und schmal, sie glänzt. Ihre Schärfe verursacht mir Schüttelfrost, als ich meine Finger daran entlangstreichen lasse. Kühl und unangenehm. Ich schiebe das Schwert zurück in seine Hülle, hänge es wieder an die Wand.
Ich habe noch nichts gesehen, was auch nur das Geringste mit Pilzen zu tun hat. Wenn ich raten sollte, was das hier sein soll, würde ich an einen Klub von Schwertkämpfern denken, der mit dem ehemaligen Präsidenten Kekkonen sympathisiert. Das Büro, die Küche und der Aufenthaltsraum sind aber natürlich nicht alles. Ich öffne eine weitere Tür und laufe durch eine Halle zu den Produktionsräumen.
Nach etwa dreißig Sekunden bin ich ziemlich neidisch und überrascht wie lange nicht.
Nun ja, sicher, alles ist relativ, ich bin heute schon einige Male überrascht worden. Die Gerätschaften und Maschinen sind nagelneu und unseren überlegen. Sie leuchten, glänzen. Sie wirken noch unbenutzt, ich kann nicht einen Kratzer entdecken, keine einzige Schmutzstelle. Ich schlendere durch den Raum, schlucke schwer, denke nach.
Es sieht danach aus, dass …
a) unser Konkurrent die Sache ernst meint.
b) alles ganz anders ist, als ich dachte.
c) ich heute schon zum dritten Mal, sozusagen, mit heruntergelassenen Hosen erwischt wurde.
Nein, Unsinn, ich ziehe die Metapher zurück. Ich bin kein einziges Mal mit heruntergelassenen Hosen erwischt worden. Ich nicht. Aber vielleicht ist dennoch alles mein Fehler.
Wir haben in jedem Fall einen ernstzunehmenden Konkurrenten.
Bemerkenswert, dass ich immer noch von wir spreche, an unsere Firma denke. Aber letztlich doch kein Wunder. Taina und ich haben dieses Unternehmen gemeinsam gegründet, aufgebaut, zu einem kleinen, feinen Erfolg gemacht. Das fühlt sich immer noch richtig an, richtig und wichtig. Vielleicht bleibt diese Firma das Wichtigste in meinem Leben, jetzt erst recht. Sie ist es zumindest in diesem Moment, sie ist es den ganzen Vormittag schon, was unter den gegebenen Umständen einigermaßen merkwürdig erscheint.
Sonnenlicht flutet die Halle, es fällt durch ein Fenster hinein. Hier drinnen ist es kühl. Vermutlich habe ich alles gesehen. Ich bleibe noch für eine Weile stehen, dann gehe ich auf demselben Weg zurück, auf dem ich gekommen bin. Präsident Kekkonen gibt die Richtung vor.
Ich laufe zügig, steige in den Wagen und fahre forsch an, biege vom Hof auf die Industriestraße ab.
Das ist auch gut so. Der Kleintransporter der Pilz GmbH Hamina kommt mir entgegen. Die drei Eigentümer sitzen, Seite an Seite, in der Fahrerkabine. Sie sehen mich an, während ich an ihnen vorüberfahre.
4
«Eine Woche», sagt Olli und bestreicht sein Roggenbrot mit Pilzpastete. Ein Zentimeter Pastete auf einem Brot, das etwa die Länge eines Langlaufskis hat. «Dann ist die erste Marge bereit für den Versand. Also, meiner Einschätzung nach.»
Olli ist ein echter Pilz-Profi, er ist schon lange im Geschäft. Ein Profi darin, gute von schlechten Pilzen zu unterscheiden, ein Profi beim Verpacken, Trocknen, Einlegen, Einfrieren, ein Profi auch in Sachen Logistik. Er ist 51 Jahre alt und Großvater und derjenige, an den ich gedacht habe, als ich mein Eis gegessen habe. Er ist derjenige, mit dem ich zumindest über einen Teil meiner Probleme sprechen könnte.
«Also, dann avisiere ich den Japanern eine Lieferung Ende der Woche?», frage ich.
«Mach das», sagt Olli. «Aber das letzte Wort hat natürlich der Wald, wie immer.»
«Selbstverständlich», sage ich. Man muss das, was Olli sagt, immer ein wenig interpretieren, im übertragenen Sinn betrachten, manchmal muss ich mir seine Aussagen auch erst mal in eine Sprache übersetzen, die ich verstehe.
«Man weiß es nicht, bis man es weiß.»
Wir sitzen im Maschinenraum. Olli isst mit gutem Appetit eine Portion Fleisch-Kartoffel-Auflauf mit Brot. Kaffee der Marke Goldkatriina tröpfelt zischend durch die Maschine. Ich bin noch gut gesättigt von dem Eis. Kein Hunger. Oder vielleicht doch. Auf Kekse. Ich nehme einen aus einer Schale, breche ein Stück ab, schiebe es in meinen Mund.
«Olli», sage ich. «Darf ich dich etwas fragen?»
«Klar. Du zahlst ja mein Gehalt.»
«Es hat nichts mit dem Job zu tun. Es ist persönlich und ziemlich aktuell. Sozusagen akut. Ab sofort ist alles akut. Ich möchte, dass du das weißt.»
Olli sieht mich mit seinen braunen Augen an. Sein dichtes, dunkles Haar hat er mit Gel nach hinten gekämmt, er hat ein kantiges, aber angenehmes Gesicht. Er sieht aus, wie George Clooney aussehen würde, wenn er in Hamina geboren wäre, zu viele Kohlenhydrate essen und in der Pilzbranche arbeiten würde.
«Also, diese Frage», sage ich, «hat mit dem anderen Geschlecht zu tun. Mit Frauen.»
Ausgezeichnet, dass ich das so treffend präzisiert habe, denke ich. Nur für den Fall, dass Olli noch nicht wusste, dass ich ein Mann bin. Olli verzieht keine Miene. Er nickt. Ich lasse meinen Blick zur Seite gleiten, zum Nachbargrundstück. Das graue Gebäude, die Industriehalle gegenüber, steht irgendwie schief.
«Du hast ja sicher ein wenig Erfahrung auf diesem Gebiet», sage ich.
«Reiche Erfahrung aus fünf Jahrzehnten.»
Mir liegt eine Entgegnung auf der Zunge, ich betrachte Olli, suche seine Augen. «Du müsstest doch, in all diesen Jahren, auch das eine oder andere Mal enttäuscht worden sein.»
Olli atmet tief ein und aus.
«Reiche Erfahrung aus fünf Jahrzehnten. Allesamt enttäuschend.»
Ich versuche erst gar nicht, mein Erstaunen zu verbergen.
«Aha. Ich verstehe.»
«Ja», sagt Olli. Er stützt sich mit sonnengebräunten Ellenbogen auf der Tischplatte ab. Auch er betrachtet jetzt das graue Gebäude auf der anderen Straßenseite, das im Sonnenlicht fast weiß zu sein scheint.
«Ja, ich habe Erfahrung. Mit Frauen. Ich habe mit neunzehn zum ersten Mal geheiratet. Fünf Jahre später hat sie mich verlassen. Die zweite ging nach drei Jahren. Die danach hat es nur ein Jahr mit mir ausgehalten.»
«Das tut mir leid», sage ich.
«Kein Problem», sagt Olli. Sein Blick zielt melancholisch ins Leere.
Dieses Gespräch verläuft in keiner Weise wie erwartet. Ich hatte gehofft, von meiner eigenen Enttäuschung berichten zu dürfen, natürlich ohne allzu sehr ins Detail zu gehen. Tainas Pobacken und Petris Körperhaltung hätte ich ausgespart. Und jetzt habe ich das Gefühl, Olli trösten zu müssen. Olli wendet sich wieder mir zu.
«Du wolltest mir etwas erzählen, oder?»
«Ja. Richtig. Also, ich vermute, befürchte, dass meine Frau einen anderen hat.»
Olli atmet wieder ein. Möglicherweise bin ich sogar Zeuge des längsten Einatmens aller Zeiten.
«Nein!», sagt er.
«Doch», sage ich.
«Bist du sicher?»
Ich denke an schweißtriefendes, hart aneinanderreibendes Fleisch, spüre Brechreiz, könnte mich auf der Stelle übergeben. Ich nicke.
«Verdammte Frauen», sagt Olli.
«Ja», sage ich.
Wir schweigen.
«Was wirst du tun?»