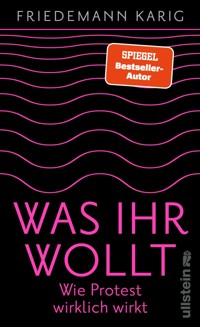10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einer abgeschiedenen Privatklinik sitzt eine Frau und behauptet schier Unglaubliches: Sie könne so gut lügen, dass alles, was sie erzählt, über kurz oder lang wahr wird. Mit jeder Sitzung, in der sie ihre Lebensbeichte ablegt - eine spektakuläre Geschichte voller Betrug und Bereicherung, unheimlicher Zufälle und überirdischen Glücks - wird ihre Therapeutin unsicherer. Was, wenn die Frau die Wahrheit sagt? Und auch sie selbst kann sich dem Einfluss dieser hochbegabten Erfinderin alternativer Realitäten kaum mehr entziehen. Als in der Klinik selbst die seltsamsten Dinge geschehen, beginnt die Therapeutin, das Ausmaß dieser fantastischen Kraft zu verstehen. Und auch, dass sie längst Teil davon geworden ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Die Lügnerin
Der Autor
Friedemann Karig, geboren 1982, studierte Medienwissenschaften, Politik, Soziologie und VWL und schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, das SZ-Magazin, Die Zeit und jetzt. Er moderierte das für den Grimme-Preis nominierte Format „Jäger&Sammler“ von „funk“, dem jungen Online-Angebot von ARD und ZDF. Mit Samira El Ouassil betreibt er den Podcast "Piratensender Powerplay". Dschungel war sein literarisches Debüt, zuvor erschien 2017 sein Buch Wie wir lieben. Vom Ende der Monogamie. Das von ihm 2021 zusammen mit Samira El Ouassil verfasste Buch Erzählende Affen wurde zum Bestseller und für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. Karig lebt in Berlin und in München.
Friedemann Karig
Die Lügnerin
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© 2023 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlaggestaltung: Jorge SchmidtAutorenfoto: © Marie StaggatE-Book powered by pepyrus
ISBN 978-3-8437-3020-4
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Epilog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dank
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Epilog
Widmung
Für meine ehrlichen ElternMotto
»I said in my haste, All men are a lie.«Psalm 116, King James BibelEinsamkeit ist wie ein Durst, der nie gestillt wird. Als Kind war ich lange einsam, ohne ein Wort dafür zu haben. Ich starrte an die Wand. Nicht metaphorisch, ich musterte tatsächlich die Tapete, zählte wie eine Forscherin die Gipfel eines fernen Planeten und blieb für mich. Wenn man mich gefragt hätte, ob mir jemand fehlt, hätte ich die Frage nicht verstanden. Niemand fragte. Meine Mutter war nicht da, meine Großmutter war in ihrer eigenen Welt, mein Bruder unterwegs. Freundinnen hatte ich kaum. Ich hätte ihnen nur erzählt, wer sie sein wollten, wer sie aber leider waren. Das ging nie lange gut. Die Gebirge an der Wand hingegen waren immer da. Eine Welt voller Gletscher und Schnee, unendlich und jenseits. Wenn ich auf sie schaute, fühlte ich eine tiefe Ruhe. Einmal fand meine Mutter mich so. Sie schüttelte nur den Kopf. Damals verstand ich, was Einsamkeit war. Und dass niemand meine stillen konnte. Trinken wollte ich trotzdem. Ich begann, den Mädchen freundliche Lügen zu erzählen. Und wurde zur Forscherin ihrer Landschaften und Abgründe.
Meistens denken wir, eine Lüge sei schlecht und die Wahrheit gut. Dabei kommt es eher darauf an, was man damit bezweckt. Was man damit versucht und noch mehr, was man damit verursacht, nicht? Ist es nicht entscheidend für die Bewertung einer Person, ob diese in böser Absicht lügt, um sich selbst zu bereichern oder jemand anderen? Was in meinem Fall zutrifft, aber, wenn ich ehrlich bin, viel eher noch: weil ich eben so bin. Eine Lüge als böse zu bewerten beinhaltet die Annahme, dass die Lügnerin eine Wahl gehabt hätte. Was aber, wenn man keine Wahl hat? Was, wenn man buchstäblich lügt, sobald man den Mund aufmacht? Wenn einem das Erfundene nun einmal viel näher, viel natürlicher ist als das Erwiesene? Ist man dann ein schlechter Mensch? Schlechter als jemand, der nur einmal in seinem Leben bewusst und zum eigenen Vorteil gelogen hat? Sind wir Menschen dafür zu verurteilen? Oder nicht eher unsere Natur, die uns mit dem freien Willen auch einen frei begehbaren Spielraum jenseits der Wahrheit gegeben hat? Wenn mein Spielraum größer ist als der aller anderer Menschen, so wie manche eben blonde Haare haben oder andere sehr klein sind; wenn die Menschen meine Lügen so viel lieber hörten als alles andere? Hätte ich meinen Kundinnen sagen sollen, dass ihr Leben wahrscheinlich immer so weitergehen würde, dass sie nichts Besonderes waren? Sollte ich ihnen einen Spiegel vorhalten? Oder lieber, wie ich es getan habe, ein Porträt zeichnen, das ihnen schmeichelte? Ist eine Lüge, die nur Gutes tut, eine Lüge?
Dies alles frage ich mich heute mehr denn je. Ich habe keine Antwort darauf. Deshalb erzähle ich Ihnen davon, vielleicht entdecken wir gemeinsam eine. Vielleicht ist es auch nicht an mir, eine zu finden. Vielleicht haben die Sterne etwas anderes für mich vorgesehen. Was glauben Sie?
Aber nun möchte ich beginnen.
1
Ich sitze auf dem Bett meines Bruders. Er ist an seinem Computer und sieht mich nicht an, hört mir aber zu. Seit zwei Wochen habe ich nicht mehr geschlafen. Ich bin zum ersten Mal verliebt. Was soll ich tun?
Was mag er?, fragt mein Bruder.
Wasserball.
Dann magst du das jetzt auch.
Am nächsten Tag gehe ich in die Schwimmhalle. Das Wasser ist kühl, auch hier drinnen, wo sonst alles zu warm ist. Er schaut mich an wie einen entlaufenen Hund. Alle anderen im Wasser können perfekt schwimmen. Ich ertrinke fast, oder tue nur so. Er zieht mich aus dem Wasser, reißt sich die blaue Badekappe vom Kopf, drückt mir auf die Brust. Ich stelle mich bewusstlos, sehe durch den Spalt meiner Lider seine blonden Haare, er hält mir die Nase zu und presst seine Lippen auf meine. Ich atme ihn ein. Komme zu mir. Küsse ihn zurück, er setzt sich auf. Seine Augen weit. Alle hauen ihm auf die Schulter. Ich lege meinen Kopf in seinen Schoß. Hat er etwas gemerkt? Wer weiß das schon. Wir gehen zwei Monate miteinander.
Zehn Jahre nach dem Hallenbad wurde ich entlarvt. Als ich aus dem Bus stieg, wartete die Frau schon auf mich. Es war ein kalter Tag im Januar. Die Sterne standen im Zeichen des Wassermanns, dem Haus der einfallsreichen, erfinderischen Menschen. Unser Element ist die Luft und unsere Waffe der Wind, unsichtbar und doch mächtig wie ein Zauberspruch, der Bäume ausreißt und Meere aufpeitscht und erst zu entlarven ist, wenn es zu spät ist. Welches ist Ihr Zeichen? Waage, habe ich recht? Sagen Sie es mir später, wenn Sie verstehen, was mir die Sterne bedeuten. Mein siebenundzwanzigster Geburtstag lag knapp zwei Wochen zurück, als mich die Frau aufspürte.
Kaum stieg ich aus, traf mich ihr Blick, und ich wusste sofort, was sie wollte. Wie oft ich mir diesen Moment ausgemalt hatte. Wie oft ich in Gedanken geflohen war. Seit Jahren träumte ich davon, schreckte nachts auf und wollte rennen. Immer begann die Jagd mit der Unsicherheit, ob es jetzt wirklich so weit war. Jetzt genügte ein Blick. Ihr Wunsch, auf der Stelle mit mir zu sprechen, koste es, was es wolle, spiegelte sich neben ihr im Glas der Haltestelle. Widerwillig erkannte ich in der Silhouette mich selbst. Ich erkannte die junge Frau, die ich damals war: dunkle Kleidung, schwarze Haare, spitze Nase, bleiche Haut und die großen, immer etwas verschreckt wirkenden Augen, wie man sie nachts im Scheinwerferlicht sieht. Ich sah meinen eigenen Geist und erschrak. Woher kannte sie mich? Was wusste sie von mir? Das Aufleuchten in ihrem Gesicht bei meinem Anblick genügte, um mich fliehen zu lassen.
Ich verließ den Bus und lief in Richtung der Treppen in den Untergrund. Während der Fahrt hatte ich gestanden, zwischen Menschen, die geschäftig die Stirn runzelten und dabei schon morgens erschöpft wirkten. Getrieben vom Gefühl, bei der Arbeit erwartet zu werden, von einer existenziellen Eile, nur weil einige zufällige Zahlen die Zeit einteilten und darüber richteten, ob man pünktlich oder zu spät kam, deshalb schneller eine Treppe hinunterlief, eine abfahrende Bahn verfluchte, alle zwanzig Sekunden auf die Uhr starrte. Ich liebte dieses Theater. Oft kam ich zu spät, wenn ich auch hätte pünktlich sein können. Aber jeder braucht eine Rolle, und mir standen die Falte auf der Stirn, die schnellen Schritte, die hektischen Bewegungen und gemurmelten Entschuldigungen besonders gut.
Ich eilte die Stufen hinunter zur U-Bahn. Die Frau nahm sofort die Verfolgung auf, ich spürte ihre Blicke in meinem Rücken. Durch das Zwischengeschoss und weiter hinab zu den Gleisen, die Bahn stand schon bereit. Ich sprang hinein und lief nach links, durch den leeren Gang; nicht zu schnell, damit nicht auffiel, dass jemand hinter mir her war und mich ein braver Bürger womöglich noch festhielt. An dieser Endstation wartete der Zug einige Minuten, bevor er die Richtung wechselte. Als die Stimme des Zugführers erklang – Zurückbleiben bitte –, war ich bereit. Ich sprang durch die schließenden Türen wieder hinaus. Ich riskierte einen Blick, sah niemanden auf dem Bahnsteig, lief die Treppen hoch ins Freie, ins Licht. Ich wollte den Sternen gerade wieder einmal versprechen, mit allem aufzuhören, mich zu bessern, und abzubitten und fürzubitten und alle meine unehrlichen Umtriebe einzustellen, wenn sie mich noch einmal davonkommen ließen – da hörte ich die Absätze der Frau auf den unteren Stufen. Wie geistesgegenwärtig war sie? Und wieso trug sie für eine Verfolgung hohe Schuhe?
Da rief sie zum ersten Mal nach mir, außer Atem, aber freundlich. Als ginge es hier nicht um eine Treibjagd, sondern als hätte sie gute Absichten.
Clara Konrad?
Er hatte mir immer gefallen, dieser Name. Er hatte einen öffnenden Beginn und einen sanften Abschluss, einen Rhythmus: Clara, Pause, Konrad – so wurde er zu Melodie. Als kleines Mädchen freute ich mich, ihn zu sagen, wenn mich jemand fragte: Und, wer magst du wohl sein?, säuselten die Verkäuferinnen und Kassiererinnen selbst in den Läden, die wir besuchten. Clara, strahlte ich ihnen entgegen, sie strahlten zurück, nur meine Mutter wunderte sich über mich. Sag deinen richtigen Namen, zischte sie. Sie dürften es schon wissen, Clara ist ein, sagen wir: Künstlername. Auch wenn mich nur spezielle Menschen als Künstlerin bezeichnen würden. Menschen aus ähnlichen Berufen, falsche Propheten und fahrendes Volk. Aber was ist das schon, Kunst? Eine Behauptung, die man rahmt? Und was ist ein Name mehr als ein Rahmen um einen Menschen? Wir bekommen diese paar Buchstaben hingeschmissen wie einen Packen Gefängniskleidung. Ein Name kann erdrücken, Hän-seleien anziehen, eine Wunde schlagen, in die immer wieder Salz gestreut wird, zu einem Stigma der Fremde werden, aus der man kommt. Nur gar kein Name ist schlimmer. Ohne sind wir nicht ansprechbar, und wer nicht ansprechbar ist, von dem wird geschwiegen, und von wem geschwiegen wird, der ist kein Mensch. Pfercht man die Leute in Lager, was nimmt man den Insassen als Erstes? Sie werden zu Nummern, zu Strichen in einer Tabelle, bevor sie Staub werden.
Clara Konrad jedoch, das gefiel mir, weil es nichts vorbestimmte, ich sogar mein Geschlecht wechseln konnte, indem ich ein paar Zeichen verschob: Konrad Clara, noch besser: Konrad Klarer, so konnte es gehen. Noch einmal hörte ich es hinter, unter mir: Clara Konrad! Aus ihrem Mund klang mein Name wie eine Diagnose, nach allerlei Tests über ein Röntgenbild gesprochen. Clara Konrad? zum dritten Mal, nun lag ein Hauch Befehl darin. War sie gewohnt, dass man auf sie hörte?
Wichtiger: Wie hatte sie mich gefunden? Was wusste sie? Wie gefährlich konnte sie mir werden? An diesem Tag war ich eine Frau von durchschnittlicher Größe und Gewicht, nicht mehr ganz jung, noch nicht alt. Hatte nie Kampfsport betrieben, kannte weder Griffe noch Schläge, hatte Angst vor Schmerzen wie wir alle. Zu selten musste ich Gewalt erdulden, um ein Gefühl von ihr zu haben jenseits des metallischen Geschmacks auf der Zunge bei einer der seltenen Ohrfeigen, die meine Mutter verteilte. Einmal machte ich, nachdem ich meinen Namen gesagt hatte, einen Knicks an der Supermarktkasse, wie ich es im Fernsehen gesehen hatte. Ihr Schlag fegte mich um. Hör auf mit dem Theater, zischte sie in unserer alten Sprache und rieb ihre Hand. Ich weinte nicht einmal, verstummte nur und knickste nie wieder.
Verzeihung. Sie wollen, dass ich weitererzähle. Also: An der Erdoberfläche angekommen, hastete ich über die Straße, in das Vergnügungsviertel hinein. Ich wohnte am Stadtrand, deshalb die Busfahrt, danach einige Stationen mit der Bahn bis zum Zentrum, das war mein Weg. Ansonsten hatte ich hier wenig verloren. Wahllos bog ich in die erste kleine Straße, Kopfsteinpflaster, kurze Treppen hoch zu Cafés und Restaurants mit Fensterfronten. Die meisten waren noch geschlossen. Ich beschleunigte meinen Schritt auf ein Tempo, das bei Olympia gerade noch als Gehen gegolten hätte. Manchmal hoben beide meiner Füße gleichzeitig ab, ich wäre disqualifiziert worden, so wie seinerzeit Lionel Libuda, bester Läufer in der Geschichte der Sowjetunion, der sich auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges anschickte, als erster Kommunist und Russe olympisches Gold im Laufen zu holen, den der Schiedsrichter aber aus dem Wettbewerb verbannte, eben weil er angeblich zu weit abgehoben habe, mit den Worten Du bist Sportler, kein Sputnik. Für mich genügte es, um eilig, aber nicht panisch zu wirken. Fight or flight, sagt man. Ich verteidige mich selten, greife nie an. Ich laufe weg.
Frau Konrad?, schallte es hinter mir über das Pflaster, und ich zuckte zusammen. Rechts hinter den Fenstern war schon Licht, oder immer noch? Was auch immer passieren würde, dort waren Zeugen.
Ich zog die Tür halb auf und glitt hindurch. Vielleicht würde sie mich aus den Augen verlieren. Dahinter ein länglicher Raum mit einem Holztresen, unzählige Flaschen vor Spiegeln. Hunderte Arten, sich zu verlieren: Wodka, Rum und Whiskey, Amaretto, Martini, Campari und Kirschwasser, Strohrum, Likör und Gin. Daneben die Gläser, aufgereiht nach Einsatzgebiet. An den Wänden Spirituosenwerbung. Die Theke zum Verschanzen, dahinter eine Frau, unschätzbar alt mit den gelblichen Locken, die ihren Kopf schützten wie ein Helm. Sie trug eine Schürze um den Bauch und einen Ausdruck ewiger Müdigkeit im Gesicht. Sie sah mich ruhig an. Niemand verstummte, als ich eintrat, weil ohnehin alle schwiegen. Außer der Wirtin und mir waren nur Männer da, in unterschiedlichen Stadien der Verwitterung.
Ich legte die Hände vor mir auf den Tresen, wie um zu sagen: Ich komme unbewaffnet. Hab ich dir doch gesagt, murmelte einer, niemand antwortete. Ich kannte diese Orte, weil ich mir nichts anderes leisten konnte, jemals hatte leisten können. Als ich klein war, gingen wir niemals in ein Café oder gar ein Restaurant. Ein einziges Mal nahm mich die Mutter mit in den Zirkus. Ich weinte laut über den Clown, dessen Schatten gekrümmt war wie der eines alten Mannes, weil er so müde war von all den Vorstellungen, weinte über die Artisten, die nur einige Sekunden glücklich waren, weinte über die Dompteure, die ihre Tiere quälten und es auch wussten, schluchzte immer lauter, bis meine Mutter mich noch vor der Pause hinauszog. Wer bist du, sagte sie, weil sie immer schon mit mir redete wie mit einer Erwachsenen, vermutlich, weil sonst kaum jemand da war, und ich wollte antworten: viele, aber ich hatte gelernt, wann man schwieg.
Bitte, sagt die Wirtin.
Was Klares, sagte ich.
Harte Nacht gehabt?
Notfallambulanz. Autounfall. Eine ganze Familie. Acht Stunden operiert.
Sie nickte. Ich blickte zu den Flaschen.
Sie nahm eine heraus.
Hier, Frau Doktor, sagte die Wirtin. Der Wodka schwappte im Glas, einem großen wie für Wasser. Ich blickte zu Boden. Hätte ich an irgendetwas geglaubt, hätte ich gebetet. Doch wenn ich ehrlich war, musste ich zugeben: Es war lange nur eine Frage der Zeit. Heute war ein ebenso guter Tag wie jeder andere.
Die Tür öffnete sich. Ich blickte mich nicht um, ich spürte es: Meine Jägerin betrat das Lokal. Die Männer an der Bar drehten ihre Köpfe, schauten dann wieder in ihre Gläser. Nun trafen wir also aufeinander. Und doch wurde ich ruhig. Jeder Schluck ein Vergessen. Jeder Tag ein Traum. Hier war ich sicher.
Verzeihung. Sind Sie Clara Konrad?
Ich drehte mich um und sah sie zum ersten Mal an. Wie sie auf mich zukam, langsam jetzt, da ich nicht mehr fliehen konnte. Ich wollte meinem Verhängnis in die Augen schauen. Sie waren grün. Dunkle Locken fielen auf ihre schmalen Schultern. Sie sah harmlos aus.
Nein, sagte ich in die Stille hinein. Wenigstens versuchen. Ich hatte es immer wieder versucht. Wer oft scheitert, scheitert immer besser. Dann nie mehr. Seit drei Jahren hatte man mir geglaubt, was immer ich gesagt hatte. Drei Jahre, sechsunddreißig Monate, dreimal alle Sternzeichen hindurch. Und was hatte ich davon? Eine Tennisspielerin, die drei Jahre lang kein Spiel verlor, war eine Legende. Man jagte sie nicht in Kneipen, man schrieb ihren Namen in Gold. So wie jenen der kleinen Schwester des Läufers Libuda, Solana Libuda, die in den 1980er-Jahren rekordverdächtige zwei Jahre und zehn Monate ungeschlagen blieb, bis ihr im Viertelfinale von Roland Garros ausgerechnet im Gehen eine Sehne riss und sie aufgeben musste.
Die Frau musterte mich. Sie war sorgfältig geschminkt. Fünfzehn, vielleicht fünfundzwanzig Jahre älter als ich. So will ich später aussehen, dachte ich.
Sind Sie sicher?, fragte sie.
Sie rutschte auf den Hocker neben mir.
Ich werde wohl meinen eigenen Namen kennen, sagte ich und warf der Wirtin, die näher gekommen war, einen Blick zu, der meinte: Wer ist die Irre?
Aber Ihre Stimme, sagte die Frau. Ich bin mir hundert Prozent sicher, dass Sie es sind.
Worum geht es überhaupt?, fragte ich, um Zeit zu gewinnen. Seltsamer Ausdruck, dachte ich, und meine Gedanken entwischten in eine andere Richtung, wie ein Reh, das über eine Straße sprang, während ein anderes erstarrte und starb. Freeze. Das war die dritte Option, fight or flight or freeze, die Schockstarre, aber weiter kam ich nicht, denn die Frau griff in ihre Handtasche. Hatte sie eine Waffe? Einen Dienstausweis?
Sie zog ein Bündel Bargeld heraus, das von einer Manschette aus Papier gehalten wurde, wie im Film.
Um Ihren Anteil, sagte sie.
Ich erschrak und fiel ihr in den Arm, schob ihre Hand nach unten, außer Sichtweite der anderen. Es mag unglaublich klingen, aber ich versichere Ihnen: In dieser Spelunke saß eine fremde Frau vor mir und hielt mir so viel Bargeld unter die Nase, wie ich es in einem Jahr nicht verdiente. Ich suchte in ihren Augen nach einem Trick, einer Finte. Wartete sie nur, dass ich zugriff? Schnappten Handschellen um meine Handgelenke, sobald ich die Scheine berührte? Aber weshalb? Verdächtigte jemand das Zentrum, meinen Arbeitgeber, Menschen um ihre Ersparnisse zu betrügen?
Der Anteil für Clara Konrad?, fragte ich.