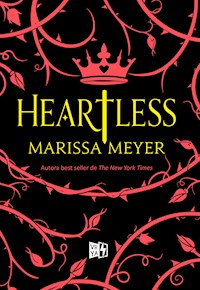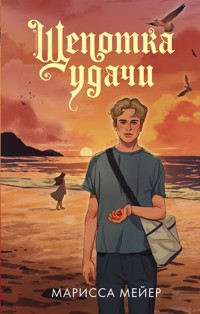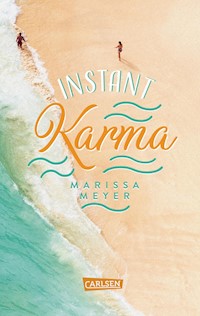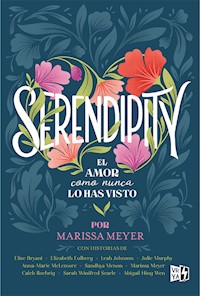9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Romantisch-fesselnde Neuinterpretation: das modernste Schneewittchen ever! Das kann Königin Levana, Herrscherin des Mondes, nicht dulden: Ihre Stieftochter, Prinzessin Winter, wird täglich schöner und ihr Zauber immer mächtiger! Wütend zwingt die böse Königin sie dazu, sich das Gesicht mit Schnitten zu verunstalten – doch die Narben können Winters Schönheit nichts anhaben. Schließlich versucht Levana sogar, sie umbringen zu lassen. Da fasst Winter einen verzweifelten Plan: Sie muss die rechtmäßige Thronfolgerin Selene finden, um gemeinsam mit ihr die böse Königin zu stürzen … »Umwerfend!« Los Angeles Times Marissa Meyers Serie über Märchen, die in eine fantastische Sci-Fi Welt in der Zukunft verlegt sind, haben bereits jede Menge gühende Fans! So modern wurde die Geschichten von Cinderella, Rotkäppchen, Rapunzel und Schneewittchen noch nie erzählt ... Alle vier Bände der packenden Luna-Chroniken – jeder Band einzeln lesbar: Wie Monde so silbern (Band 1) Wie Blut so rot (Band 2) Wie Sterne so golden (Band 3) Wie Schnee so weiß (Band 4)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1098
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Marissa Meyer
Die Luna-Chroniken 4: Wie Schnee so weiß
Aus dem Englischen von Bettina Arlt
Das kann Königin Levana, Herrscherin des Mondes, nicht dulden: Ihre Stieftochter, Prinzessin Winter, wird täglich schöner und ihr Zauber immer mächtiger! Wütend zwingt die böse Königin sie dazu, sich das Gesicht mit Schnitten zu verunstalten – doch die Narben können Winters Schönheit nichts anhaben. Schließlich versucht Levana sogar, sie umbringen zu lassen. Da fasst Winter einen verzweifelten Plan: Sie muss die rechtmäßige Thronfolgerin Selene finden, um gemeinsam mit ihr die böse Königin zu stürzen …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Danksagung
Viten
Für Jesse,mit dem jeder Tag ein Happy End hat.
Erstes Buch
Die junge Prinzessin war so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst.
1
Winters Zehen fühlten sich an wie Eiswürfel. Sie waren so kalt wie der Weltraum. So kalt wie die dunkle Seite von Luna. So kalt wie …
»… Überwachungskameras zeigen, wie er um 23:00 Uhr Weltzeit das Tiefgeschoss der AR-Zentral-Klinik betreten hat …«
Der Thaumaturg Aimery Park sprach in feierlichem, gemessenem Tonfall; es klang, als würde er singen. Man konnte sich leicht von seiner Stimme einlullen lassen und die Worte verloren an Bedeutung und verschmolzen ineinander. Winter rollte ihre Zehen in den dünnen Schuhen ein. Wenn sie noch kälter wurden, bevor der Prozess vorüber war, würden sie sicher abbrechen.
»… versuchte, sich an einer der Hüllen zu schaffen zu machen, die wir zurzeit dort aufbewahren …«
Sie würden abbrechen. Eine nach der anderen.
»… laut unserer Aufzeichnungen handelt es sich bei dem Kind um den Sohn des Angeklagten, der am 29. Juli des letzten Jahres geholt wurde. Er ist fünfzehn Monate alt.«
Winter verbarg die Hände in den Falten ihres Kleides. Sie zitterten schon wieder. Winter zitterte ständig in letzter Zeit. Sie presste ihre Finger zusammen, um sie ruhig zu halten, und drückte ihre Fußsohlen auf den harten Fußboden. Sie bemühte sich verzweifelt, einen klaren Blick zu behalten, denn der Thronsaal verschwamm langsam vor ihren Augen.
Dieser Saal, der sich im Hauptturm des Palastes befand, hatte den herrlichsten Ausblick der ganzen Stadt. Von ihrem Platz aus konnte Winter den See von Artemisia sehen, in dem sich der weiße Palast und die Stadt spiegelten und der bis an den Rand der gigantischen transparenten Kuppel reichte, die sie vor den Elementen auf der Außenseite schützte – oder besser gesagt, vor dem Mangel an Elementen. Der Thronsaal selbst erstreckte sich über die Wände des Turms hinaus, und wenn man über den Rand des Mosaikbodens hinaustrat, stand man auf einem gläsernen Vorsprung, der ganz und gar durchsichtig war. Es war, als hinge man in der Luft und würde jeden Augenblick in die Tiefen des Kratersees stürzen.
Zu ihrer Linken konnte Winter die spitzen Fingernägel ihrer Stiefmutter sehen, die sich in die Lehne des imposanten Throns bohrten, der aus weißem Stein gehauen war. Normalerweise war ihre Stiefmutter bei solchen Prozessen immer ganz ruhig und lauschte, ohne eine Gefühlsregung zu zeigen. Winter war gewohnt zu sehen, wie Levana den polierten Stein liebevoll streichelte, nicht wie sie ihn mit den Nägeln malträtierte. Doch seit Levana mit ihrem Gefolge von der Erde zurückgekehrt war, war die Stimmung angespannt, und ihre Stiefmutter hatte in den letzten Monaten noch häufiger Wutanfälle bekommen als sonst.
Seit diese flüchtige Lunarierin – der Cyborg – aus ihrem irdischen Gefängnis entkommen war.
Seit zwischen der Erde und Luna Krieg ausgebrochen war.
Seit der Verlobte der Königin entführt worden war und man Levana der Chance beraubt hatte, zur Kaiserin gekrönt zu werden.
Der Blaue Planet hing am Horizont und sah aus, als wäre er halb durchgeschnitten. Luna hatte die lange Nacht erst zur Hälfte hinter sich gelassen, und die Stadt Artemisia war von blassblauen Laternen und strahlenden Kristallfenstern erleuchtet, deren Spiegelbilder auf der Wasseroberfläche tanzten.
Winter vermisste die Sonne und ihre Wärme. Die künstlichen Tage auf Luna waren nicht das Gleiche.
»Woher wusste er von den Hüllen?«, fragte Königin Levana. »Warum hat er nicht geglaubt, dass sein Sohn nach der Geburt getötet wurde?«
Rings um den Saal saßen in vier Reihen die Familien. Das war der Hofstaat der Königin. Die Adeligen von Luna, die in der Gunst Ihrer Majestät standen, dank jahrhundertelanger Treue, dank ihres außerordentlichen Talents im Umgang mit der lunarischen Gabe oder einfach weil sie das Glück hatten, in Artemisia geboren worden zu sein.
Und dann war da noch ein Mann, der neben Thaumaturg Park auf dem Boden kniete. Er hatte bei seiner Geburt nicht so viel Glück gehabt.
Er hatte die Hände gefaltet und flehte um Gnade. Winter wünschte, sie könnte ihm sagen, dass es keinen Sinn hatte. All sein Flehen war umsonst. Es würde ihn vielleicht trösten, wenn er wüsste, dass er nichts mehr tun konnte, um dem Tod zu entgehen. Diejenigen, die ihr Schicksal bereits angenommen hatten, wenn sie vor die Königin gebracht wurden, schienen es leichter zu haben.
Sie sah auf ihre eigenen Hände hinab, die sich noch immer um den Gazestoff ihres Rockes krallten. Sie hatte Frostbeulen an den Fingern. Es sah eigentlich ganz hübsch aus. Sie funkelten und schillerten und waren kalt, so kalt …
»Deine Königin hat dir eine Frage gestellt«, sagte Aimery.
Winter zuckte zusammen, als hätte er sie angeschrien.
Konzentrieren. Sie musste sich konzentrieren.
Sie hob den Kopf und atmete ein.
Aimery war in Weiß gekleidet, seit er Sybil Miras Platz als Levanas Oberthaumaturg eingenommen hatte. Die Goldstickerei auf seinem Mantel glitzerte, während er den Gefangenen umkreiste.
»Es tut mir leid, Eure Majestät«, sagte der Mann. »Meine Familie und ich dienen Eurem Königshaus seit Generationen. Ich bin Hausmeister der Klinik und habe Gerüchte gehört … Es ging mich nichts an, also war es mir egal und ich habe nie zugehört. Aber … als mein Sohn als Hülle geboren wurde …« Er fing an zu wimmern. »Er ist doch mein Sohn.«
»Konntest du dir nicht denken«, fragte Levana mit lauter und scharfer Stimme, »dass es einen guten Grund hat, wenn deine Königin deinen Sohn und alle anderen unbegabten Lunarier von unseren Bürgern trennt? Dass es dem Wohl aller unserer Bürger dient, wenn wir sie in den Labors aufbewahren?«
Der Mann schluckte so schwer, dass Winter sehen konnte, wie sein Adamsapfel hoch- und runterhüpfte. »Ich weiß, meine Königin. Ich weiß, dass Ihr das Blut der Hüllen für … Experimente braucht. Aber … aber Ihr habt so viele, und er ist doch noch ein Baby, und …«
»Nicht nur ist sein Blut unerlässlich für den Bestand unserer politischen Bündnisse, wovon du als Hausmeister der äußeren Sektoren nichts verstehen dürftest, sondern überdies ist er eine Hülle, und Hüllen haben sich als gefährlich und nicht vertrauenswürdig erwiesen, falls du dich an die Ermordung von König Marrok und Königin Jannali vor achtzehn Jahren erinnerst. Und solch einer Bedrohung willst du unsere Gesellschaft aussetzen?«
Die Augen des Mannes weiteten sich ängstlich. »Bedrohung, meine Königin? Er ist ein Baby.« Er hielt inne. Er wirkte zwar nicht besonders aufmüpfig, aber dass er keine Reue zeigte, würde Levana über kurz oder lang zur Weißglut treiben. »Und die anderen in den Behältern … so viele von ihnen sind Kinder. Unschuldige Kinder.«
Die Temperatur im Raum sank merklich.
Er wusste zu viel. Mit der Kindstötung der Hüllen hatte schon Levanas Schwester Königin Channary begonnen, nachdem eine Hülle in den Palast geschlichen war und Channarys Eltern ermordet hatte. Dass ihre Babys nicht getötet, sondern eingesperrt und als Blutkörperchen-Fabrik missbraucht wurden, würde den Lunariern gar nicht gefallen.
Winter zwinkerte und stellte sich vor, wie es sein musste, als Blutkörperchen-Fabrik zu fungieren.
Sie sah nach unten. Das Eis hatte inzwischen ihre Handgelenke erreicht.
Das wäre sicher nicht so günstig für die Blutkörperchen-Großproduktion.
»Hat der Angeklagte Familie?«, fragte die Königin.
Aimery nickte. »In den Unterlagen ist die Rede von einer neunjährigen Tochter. Außerdem hat er noch zwei Schwestern und einen Neffen. Sie alle leben in Sektor RM-12.«
»Keine Frau?«
»Starb vor fünf Monaten an Regolithvergiftung.«
Der Gefangene hatte den Blick starr auf die Königin gerichtet, und die Verzweiflung sammelte sich in einer Pfütze um seine Knie.
Die Hofleute begannen, auf ihren Stühlen herumzurutschen, und ihre farbenfrohen Kleider raschelten. Dieser Prozess zog sich schon viel zu lange hin. Sie fingen an, sich zu langweilen.
Levana lehnte sich auf ihrem Thron zurück. »Hiermit wirst du des Einbruchs und versuchten Diebstahls an der Krone für schuldig befunden. Die Strafe dafür ist der Tod und wird unverzüglich vollstreckt.«
Der Mann zuckte zusammen, doch sein Gesicht behielt den flehenden Blick. Es dauerte immer ein paar Sekunden, bis sie die Tragweite des Urteils begriffen.
»Jedes deiner Familienmitglieder bekommt ein Dutzend öffentliche Peitschenhiebe als Warnung für deinen Sektor, dass ich es nicht dulde, wenn meine Entscheidungen angezweifelt werden.«
Der Kiefer des Mannes klappte herunter.
»Deine Tochter wird der Familie eines meiner Höflinge geschenkt. Dort wird sie den Gehorsam und die Demut lernen, die ihr während deiner Erziehung sicherlich abgegangen sind.«
»Nein, bitte. Lasst sie bei ihren Tanten leben. Sie hat doch nichts verbrochen!«
»Aimery, fahren Sie fort.«
»Bitte!«
»Deine Königin hat gesprochen«, sagte Thaumaturg Aimery. »Ihr Wort ist endgültig.«
Aimery zog ein Messer aus Obsidian aus einem seiner glockenförmigen Ärmel und streckte dem Gefangenen den Griff entgegen, der ihn panisch anstarrte.
Im Saal wurde es noch kälter. Winters Atem gefror in der Luft. Sie drückte die Arme fest an den Körper.
Der Gefangene nahm den Messergriff entgegen. Seine Hand war ganz ruhig. Sein restlicher Körper zitterte stark.
»Bitte. Mein kleines Mädchen – sie hat doch keinen außer mir. Bitte. Meine Königin. Eure Majestät!«
Er hob die Klinge an den Hals.
Da sah Winter weg. In diesen Augenblicken sah sie immer weg. Sie sah zu, wie sich ihre Finger ins Kleid gruben und die Fingernägel über den Stoff kratzten, bis sie es auf den Oberschenkeln spüren konnte. Sie sah zu, wie das Eis über ihre Handgelenke hinaus und zu ihren Ellbogen wanderte. Die Stellen, die schon vom Eis überzogen waren, wurden taub.
Sie stellte sich vor, wie sie mit ihren zu Eis gefrorenen Fäusten nach der Königin schlagen würde. Sie stellte sich vor, wie ihre Hände in tausend Eisstücke zerbrechen würden.
Das Eis wanderte zu ihren Schultern. Und zu ihrem Hals.
Selbst über das Knacken und Bersten des Eises hinweg konnte sie hören, wie das Messer ins Fleisch schnitt. Sie hörte das Blubbern und gedämpfte Würgen. Und wie der Körper hart auf den Boden aufschlug.
Die Kälte war in ihre Brust eingedrungen. Winter drückte die Augen fest zu und ermahnte sich, ruhig zu bleiben und weiterzuatmen. Sie konnte Jacins ruhige Stimme in ihrem Kopf hören und spürte seine Hände auf ihren Schultern. Es ist nicht real, Prinzessin. Es ist bloß Einbildung.
Normalerweise half es ihr, wenn sie sich daran erinnerte, wie er ihr geholfen hatte, die Panik zu überwinden. Aber diesmal schien es den Vorgang noch zu beschleunigen. Das Eis umschloss ihren Brustkorb, fraß sich in ihren Magen hinein und verhärtete sich um ihr Herz.
Sie gefror von innen nach außen.
Hört auf meine Stimme, Prinzessin.
Jacin war nicht hier.
Bleibt bei Bewusstsein.
Jacin war fort.
Es ist alles nur in Eurem Kopf.
Sie hörte die Stiefel der Wächter, die sich dem Leichnam näherten. Wie der Tote zum Vorsprung geschleift wurde. Wie er hinuntergeworfen wurde und weit unten platschend ins Wasser fiel.
Der Hofstaat klatschte leise und höflich Beifall.
Winter hörte, wie ihre Zehen abbrachen. Eine nach der anderen.
»Sehr gut«, sagte Königin Levana. »Thaumaturg Tavaler, sorgen Sie dafür, dass die restlichen Urteile ebenfalls vollstreckt werden.«
Nun war das Eis in ihrer Kehle und kletterte ihren Kiefer herauf. Ihre Tränen gefroren in den Kanälen. Der Speichel kristallisierte auf ihrer Zunge.
Sie hob den Kopf, als ein Diener begann, das Blut von den Fliesen zu wischen. Aimery, der sein Messer mit einem Tuch reinigte, warf Winter einen Blick zu. Er lächelte vernichtend. »Ich fürchte, die Prinzessin ist zu zartbesaitet für die Prozesse.«
Die Adeligen im Publikum kicherten. Winters Abscheu vor den Prozessen belustigte den Großteil von Levanas Hofstaat.
Die Königin wandte sich zu ihr um, doch Winter konnte den Blick nicht heben. Sie war ein Mädchen aus Eis und Glas. Ihre Zähne waren zerbrechlich und ihre Lunge konnte jeden Augenblick zerspringen.
»Ja«, sagte Levana. »Manchmal vergesse ich sogar, dass sie hier ist. Du bist so nutzlos wie eine Stoffpuppe, Winter.«
Das Publikum kicherte erneut, aber diesmal lauter, so als käme die Bemerkung der Königin der Erlaubnis gleich, die junge Prinzessin zu verspotten. Doch Winter konnte nicht reagieren, weder auf die Worte der Königin noch auf das Gelächter des Hofstaats. Sie konzentrierte sich stattdessen auf den Thaumaturgen und versuchte, ihre Panik zu verbergen.
»So nutzlos ist sie gar nicht«, entgegnete Aimery. Während Winter ihn anstarrte, bildete sich eine dünne blutrote Linie quer über seinem Hals, und aus der Wunde begann Blut zu tropfen. »Das hübscheste Mädchen auf ganz Luna wird sicher eines Tages ein Mitglied dieses Hofes zum glücklichen Bräutigam machen.«
»Das hübscheste Mädchen, Aimery?« Durch ihren beiläufigen Tonfall gelang es Levana fast, das Knurren in ihrer Stimme zu überspielen.
Aimery verbeugte sich sogleich. »Nur die hübscheste, meine Königin. Kein sterbliches Wesen kann sich mit Eurer Perfektion messen.«
Der Hofstaat pflichtete eilig bei und sprach hundert Komplimente auf einmal aus, obwohl Winter noch immer die lüsternen Blicke mehrerer Adeliger auf sich spürte.
Aimery tat einen Schritt auf den Thron zu und sein abgetrennter Kopf kippte nach vorne, fiel auf den Marmorboden und rollte, rollte ein ganzes Stück, bis er vor Winters gefrorenen Füßen liegen blieb.
Er lächelte noch immer.
Sie wimmerte, doch der Klang ihrer Stimme wurde vom Schnee in ihrem Hals erstickt.
Es ist alles nur in Eurem Kopf.
»Ruhe«, rief Levana, nachdem man sie genug gepriesen hatte. »Sind wir fertig?«
Schließlich erreichte das Eis Winters Augen und sie hatte keine andere Wahl, als sie zu schließen, um den Anblick von Aimerys kopfloser Erscheinung nicht mehr ertragen zu müssen. Kälte und Dunkelheit schlossen sie ein.
Sie würde an Ort und Stelle sterben und sich nicht beklagen. Sie würde unter dieser Lawine von Leblosigkeit begraben werden. Sie würde nie wieder einem Mord beiwohnen müssen.
»Wir haben noch einen Gefangenen, dem der Prozess gemacht werden muss, meine Königin.« Aimerys Stimme hallte im kalten Hohlraum von Winters Kopf wider. »Sir Jacin Clay, königlicher Wächter und Pilot, der mit dem Schutz von Thaumaturgin Sybil Mira betraut war.«
Winter rang nach Luft, das Eis zersprang und eine Million glitzernde spitze Eisstückcken stoben auseinander, verteilten sich im Thronsaal und schlitterten über den Fußboden. Niemand außer ihr hörte es. Niemand außer ihr bemerkte es.
Aimery, dessen Kopf wieder fest auf seinem Rumpf thronte, beobachtete sie wieder, so als hätte er auf ihre Reaktion gelauert. Mit leicht spöttischem Lächeln wandte er sich wieder der Königin zu.
»Ach ja«, sagte Levana. »Bringt ihn herein.«
2
Die Türen des Thronsaals öffneten sich und er trat herein, ein Wächter an jeder Seite und die Hände hinter dem Rücken gefesselt. Sein blondes Haar war zerzaust und verfilzt, und ein paar Strähnen klebten an seinem Kinn. Es sah aus, als hätte er sich länger nicht mehr gewaschen, doch Winter fand keine Anzeichen von Misshandlungen an ihm.
Ihr Magen drehte sich um. Alle Wärme, die das Eis aus ihr herausgesogen hatte, strömte auf einmal zurück in ihre Haut.
Bleibt bei Bewusstsein, Prinzessin. Hört auf meine Stimme, Prinzessin.
Er wurde in die Mitte des Saals geführt und sein Gesicht zeigte keine Regung. Winter vergrub die Fingernägel in den Handflächen.
Jacin sah sie nicht an. Nicht ein einziges Mal.
»Jacin Clay«, sagte Aimery. »Ihnen wird Verrat an der Krone vorgeworfen, weil Sie weder die Thaumaturgin Mira beschützen noch eine bekannte flüchtige Lunarierin dingfest machen konnten, obwohl Sie zwei Wochen lang in ihrer Gesellschaft waren. Sie sind ein Verräter an Luna und an Ihrer Königin. Auf Ihre Verbrechen steht die Todesstrafe. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung zu sagen?«
Winters Herz schlug gegen ihre Rippen wie eine Trommel. Flehentlich sah sie zu ihrer Stiefmutter hinüber, doch die würdigte sie keines Blickes.
»Ich bekenne mich in allen Punkten schuldig«, sagte Jacin, und Winter sah ihn verwundert an. »Bis auf den Verrat.«
Levanas Fingernägel tanzten auf der Armlehne des Throns. »Was heißt das?«
Jacin stand aufrecht und unerschütterlich da, als wäre er in Uniform im Dienst, nicht vor Gericht. »Wie ich bereits sagte, habe ich die Flüchtige nur deshalb nicht gefangen genommen, weil ich ihr Vertrauen gewinnen und Informationen für meine Königin einholen wollte.«
»Ach ja, ich erinnere mich: Sie haben sie und ihre Gefährten ausspioniert«, sagte Levana. »Das war Ihre Ausrede, als Sie gefangen genommen wurden. Außerdem weiß ich noch, dass Sie keine brauchbaren Informationen für mich hatten, nur Lügen.«
»Keine Lügen, meine Königin. Aber ich gebe zu, dass ich das Cyborgmädchen und ihre Fähigkeiten unterschätzt habe. Sie hat sie vor mir verborgen.«
»Dann scheint das mit dem Vertrauen ja nicht so recht geklappt zu haben.« Im Tonfall der Königin schwang leichter Spott mit.
»Einzelheiten über die Gabe des Cyborgs waren nicht die einzigen Informationen, auf die ich es abgesehen hatte, meine Königin.«
»An Ihrer Stelle würde ich mit den Wortklaubereien aufhören. Meine Geduld mit Ihnen ist fast am Ende.«
Winters Herz zog sich zusammen. Nicht Jacin. Sie konnte nicht hier sitzen und zusehen, wie sie Jacin umbringen würden.
Sie würde ihnen einen Handel vorschlagen, beschloss sie; doch der Plan hatte einen Haken. Was hatte sie schon, was sie im Gegenzug anbieten konnte? Nichts, außer ihrem eigenen Leben, und darauf würde sich Levana nicht einlassen.
Sie könnte einen Anfall bekommen. Hysterisch werden. Dazu müsste sie sich nicht einmal groß anstrengen, und es würde die anderen eine Weile ablenken. Aber es würde das Unvermeidliche nur hinausschieben.
Sie hatte sich in ihrem Leben schon oft hilflos gefühlt, aber noch nie so sehr wie jetzt.
Es blieb ihr nur eins übrig: Sie musste sich zwischen Jacin und das Messer werfen.
Aber das würde Jacin gar nicht gefallen.
Ohne Winters Pläne zu ahnen, verneigte Jacin sich respektvoll. »Als ich mit Linh Cinder zusammen war, erfuhr ich von einer Vorrichtung, die die Wirkung der lunarischen Gabe aufhebt, wenn man sie mit dem Nervensystem der betreffenden Person verbindet.«
Die Hofleute begannen, sich unbehaglich zu winden. Manche saßen stocksteif da, andere beugten sich ungläubig vor.
»Unmöglich«, sagte Levana.
»Linh Cinder hat den Beweis dafür, dass es funktioniert. Bei Erdbewohnern soll es verhindern, dass man ihre Bioelektrizität manipulieren kann. Aber bei einem Lunarier führt es dazu, dass er seine Gabe gar nicht erst einsetzen kann. Linh Cinder hatte das Gerät selbst installiert, als sie in Neu-Peking auf den jährlichen Ball des Asiatischen Staatenbundes kam. Erst als die Vorrichtung zerstört worden war, konnte sie ihre Gabe nutzen – was Ihr ja mit eigenen Augen beobachten konntet, meine Königin.«
Seine Worte hatten einen impertinenten Unterton. Levanas Fingerknöchel wurden weiß.
»Und wie viele von diesen angeblich existierenden Vorrichtungen gibt es?«
»Soweit ich weiß, gibt es nur das zerstörte Gerät, das im Cyborg installiert war. Aber ich nehme an, dass es noch irgendwo Pläne und Entwürfe gibt. Der Erfinder war Linh Cinders Adoptivvater.«
Die Königin lockerte ihren Griff um die Armlehne. »Das sind faszinierende Informationen, Sir Clay. Aber die Geschichte kommt mir eher so vor wie der verzweifelte Versuch, sich zu retten, als wie der Beweis Ihrer Unschuld.«
Jacin zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Wenn mein Verhalten gegenüber dem Feind und die Tatsache, dass ich diese Information beschafft und Thaumaturgin Mira von dem Plan unterrichtet habe, Imperator Kaito zu entführen, Euch nicht von meiner Loyalität überzeugen, dann weiß ich nicht, welchen Beweis meiner Treue ich noch erbringen soll, meine Königin.«
»Ja, ja, der anonyme Hinweis, der Sybil angeblich über Linh Cinders Pläne in Kenntnis gesetzt hat.« Levana seufzte. »Sehr praktisch, dass diese Tele, die Sie geschickt haben wollen, kein anderer gesehen hat als Sybil selbst, die jetzt tot ist.«
Zum ersten Mal schien Jacins Selbstsicherheit unter Levanas strengem Blick zu schwinden. Er hatte Winter noch nicht ein einziges Mal angesehen.
Die Königin wandte sich an Jerrico Solis, den Hauptmann der Königlichen Garde. Wie bei vielen anderen von Levanas Wächtern wurde Winter bei seinem Anblick unbehaglich, und in ihren Visionen sah sie oft, wie sein orangerotes Haar in Flammen aufging und der Rest seines Körpers verbrannte, bis nur noch ein schwelendes Häufchen Kohle übrig war. »Sie waren bei Sybil, als sie an jenem Tag dem feindlichen Raumschiff auflauerte, aber Sie haben gesagt, Sybil hätte keine Tele erwähnt. Haben Sie dem irgendetwas hinzuzufügen?«
Jerrico trat einen Schritt vor. Er hatte eine gehörige Portion Beulen und blaue Flecken von der Erdmission mitgebracht, aber sie fingen schon an zu heilen. »Meine Königin, Thaumaturgin Mira schien zuversichtlich zu sein, dass wir Linh Cinder auf dem Dach finden würden, aber sie erwähnte keine Informationen von Außenstehenden, weder anonymer noch anderer Art. Als das Raumschiff landete, befahl Thaumaturgin Mira, Jacin Clay festzunehmen.«
Jacins Augenbraue zuckte. »Vielleicht war sie noch wütend, weil ich sie angeschossen habe.« Er machte eine Pause, bevor er weitersprach. »Aber das geschah unter Linh Cinders Einfluss, muss ich zu meiner Verteidigung sagen.«
»Sie scheinen viel zu Ihrer Verteidigung zu sagen zu haben«, bemerkte Levana.
Jacin antwortete nicht. Er war der ruhigste Gefangene, den Winter je gesehen hatte. Dabei wusste er ganz genau, welch schreckliche Dinge sich für gewöhnlich auf diesem Boden abspielten – an derselben Stelle, auf der er gerade stand. Seine Dreistigkeit hätte Levana eigentlich zur Weißglut treiben müssen, doch sie wirkte bloß nachdenklich.
»Bitte um Erlaubnis, sprechen zu dürfen, meine Königin.«
Die Hofleute raschelten mit ihren Kleidern und es dauerte einen Augenblick, bis Winter die Stimme dem Sprecher zuordnen konnte. Es war ein Wächter. Eine der stummen Verzierungen des Palastes. Sie erkannte ihn zwar, wusste aber nicht, wie er hieß.
Levana warf ihm einen vernichtenden Blick zu und Winter vermutete, dass sie überlegte, ob sie den Mann sprechen lassen oder ihn für seine Impertinenz bestrafen sollte. Schließlich sagte sie: »Wie heißen Sie und was fällt Ihnen ein, den Prozess zu unterbrechen?«
Der Wächter trat vor und starrte an die Wand; immer starrten sie an die Wand. »Ich heiße Liam Kinney, meine Königin. Ich habe geholfen, den Leichnam von Thaumaturgin Mira zu bergen.«
Die Königin warf Jerrico einen Blick zu und hob fragend eine Augenbraue; er nickte zustimmend. »Fahren Sie fort«, befahl Levana.
»Sybil Mira hatte einen Portscreen bei sich, als wir sie fanden, und obwohl er bei dem Sturz zerbrochen ist, wurde er als Beweisstück für die Untersuchung ihrer Ermordung beschlagnahmt. Ich weiß nicht, ob schon jemand versucht hat, die mutmaßliche Tele wiederherzustellen.«
Levana wandte sich zu Aimery um, dessen Gesicht wie eine Maske war. Winter hatte gelernt, sie zu deuten; je freundlicher sein Gesichtsausdruck, desto ärgerlicher war er. »Wir waren tatsächlich in der Lage, ihre letzten Nachrichten abzurufen. Ich wollte den Beweis gerade vorlegen.«
Das war eine Lüge, und das gab Winter Hoffnung. Aimery log gerne und oft, vor allem wenn es in seinem eigenen Interesse war. Und er hasste Jacin. Er hätte nichts von sich aus vorgebracht, das ihm helfen konnte.
Hoffnung. Schwache, zerbrechliche, erbärmliche Hoffnung.
Aimery winkte in Richtung Tür und ein Diener eilte herein, der einen demolierten Portscreen und eine Hologrammstation auf einem Tablett hereintrug. »Das ist der Portscreen, den Sir Kinney erwähnt hat. Unsere Untersuchungen haben ergeben, dass Sybil Mira an jenem Tag tatsächlich eine anonyme Tele erhalten hat.«
Der Diener schaltete die Station ein und das Hologramm baute sich schimmernd im Saal auf. Hinter ihm verblasste Jacin wie ein Geist.
Das Hologramm beinhaltete eine einfache Text-Tele.
Linh Cinder will den Imperator des Asiatischen Staatenbundes entführen.
Sie wollen bei Sonnenuntergang vom Dach des Nordturms fliehen.
So viel wichtiger Inhalt in so wenige Worte gepresst. Das sah Jacin ähnlich.
Levana las die Nachricht mit zusammengezogenen Augenbrauen. »Danke, Sir Kinney, dass Sie uns hierüber informiert haben.« Dass sie Aimery nicht dankte, sprach für sich.
Der Wächter Kinney verneigte sich und begab sich zurück an seine Position. Für den Bruchteil einer Sekunde sah er zu Winter herüber, bevor er wieder auf die Wand ihm gegenüber starrte. Sein Blick war undurchdringlich.
Levana fuhr fort: »Ich nehme an, Sie sagen mir jetzt, dass Sie diese Tele geschickt haben, Sir Clay.«
»Ganz recht.«
»Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen, bevor ich mein Urteil spreche?«
»Nichts, meine Königin.«
Levana lehnte sich in ihrem Thron zurück und der Saal verstummte, während alle darauf warteten, wie sich die Königin entscheiden würde.
»Meine Stieftochter möchte bestimmt, dass ich Sie verschone.«
Jacin zeigte keine Reaktion, doch Winter ging der Hochmut im Tonfall ihrer Stiefmutter durch Mark und Bein. »Bitte, Stiefmutter«, flüsterte sie und die Worte klebten an ihrer trockenen Zunge. »Es ist doch Jacin. Er ist nicht unser Feind.«
»Deiner vielleicht nicht«, sagte Levana. »Aber du bist auch nur ein naives, dummes Mädchen.«
»Das stimmt nicht. Ich bin eine Fabrik für Blut und Blutkörperchen und mein Mechanismus ist gerade dabei einzufrieren …«
Der Hofstaat brach in Lachen aus, und Winter fuhr erschrocken zusammen. Selbst Levanas Lippen zuckten leicht, auch wenn sich Verärgerung in ihre Belustigung mischte.
»Ich habe mich entschieden«, sagte sie und ihre laute Stimme ließ die Hofleute verstummen. »Ich habe beschlossen, dem Gefangenen das Leben zu schenken.«
Winter stieß einen Schrei der Erleichterung aus. Sie schlug sich die Hand vor den Mund, doch es war zu spät, um den Ton zu unterdrücken.
Wieder kam Kichern von den Zuschauern.
»Hast du noch andere Erkenntnisse beizusteuern, Prinzessin?«, fragte Levana mit zusammengebissenen Zähnen.
Winter versuchte, so gut wie möglich ihre Gefühle unter Kontrolle zu bringen. »Nein, meine Königin. Eure Richtersprüche sind weise und endgültig, meine Königin.«
»Ich bin noch nicht fertig.« Die Stimme der Königin wurde härter, als sie erneut Jacin ansprach: »Dass Sie nicht in der Lage waren, Linh Cinder zu töten oder zu fangen, wird nicht ungestraft bleiben, denn Ihre Unfähigkeit hatte zur Folge, dass sie meinen Verlobten entführt hat. Für dieses Verbrechen verurteile ich Sie zu dreißig selbst beigebrachten Peitschenhieben auf der Hauptbühne. Danach folgen vierzig Stunden Buße. Das Urteil soll morgen beim ersten künstlichen Tageslicht vollstreckt werden.«
Winter krümmte sich zusammen, doch selbst diese Bestrafung konnte das Gefühl der Erleichterung in ihrem Magen nicht zerstören. Er würde nicht sterben. Und sie war kein Mädchen aus Eis und Glas, sondern ein Mädchen aus Sonnenschein und Sternenstaub, denn Jacin würde leben.
»Und, Winter …«
Ruckartig wandte sie sich wieder ihrer Stiefmutter zu, die sie verächtlich musterte. »Falls du versuchen solltest, ihm etwas zu essen zu bringen, wird er für deine Freundlichkeit mit seiner Zunge bezahlen.«
Sie rutschte tief in ihren Stuhl zurück und einer ihrer Sonnenstrahlen verlosch. »Ja, meine Königin.«
3
Winter war wach, lange bevor das Licht den künstlichen Himmel der Kuppel erleuchtete; sie hatte kaum geschlafen. Sie wohnte der Auspeitschung Jacins nicht bei, weil sie wusste, dass er seine Schreie unterdrücken würde, wenn er sie in der Menge sah. Das wollte sie ihm nicht antun. Er sollte ruhig schreien. Er war trotzdem stärker als alle anderen.
Sie knabberte pflichtbewusst an dem Käse und geräucherten Fleisch, die man ihr zum Frühstück brachte. Sie ließ sich von den Dienerinnen baden und in blassrosa Seide kleiden. Sie ließ eine ganze Unterrichtsstunde mit Meister Gertman, einem Thaumaturgen dritten Ranges und ihrem langjährigen Lehrer, über sich ergehen, versuchte, ihre Gabe zu benutzen, und entschuldigte sich, wenn es zu schwer für sie war, wenn sie zu schwach war. Ihm schien das nichts auszumachen. Die meisten Stunden verbrachte er damit, sie mit herunterhängendem Kinn anzustarren, und Winter wusste nicht, ob er überhaupt merken würde, wenn sie tatsächlich einmal ihren Zauber einsetzte.
Der künstliche Tag war gekommen und wieder gegangen. Eine ihrer Zofen hatte ihr einen Becher warme Milch mit Zimt gebracht und schlug das Bett um, und endlich war Winter allein.
Ihr Herz schlug vor freudiger Erwartung.
Sie schlüpfte in ein Paar leichte Leinenhosen und ein lockeres Oberteil; dann zog sie ihre Nachtrobe darüber, damit es so aussah, als würde sie ihre Schlafkleidung darunter tragen. Sie hatte den ganzen Tag darüber nachgedacht und der Plan hatte sich in ihrem Kopf zusammengesetzt wie kleine Puzzleteile. Ihre Entschlossenheit hatte die Halluzinationen unterdrückt.
Sie verstrubbelte sich die Haare, damit es so aussah, als wäre sie gerade aus tiefem Schlummer erwacht, machte die Lichter aus und kletterte aufs Bett. Der hin und her schwingende Kronleuchter traf sie an der Stirn und sie zuckte zusammen, trat einen Schritt zurück und versuchte, auf der dicken Matratze ihr Gleichgewicht zu halten.
Winter hielt den Atem an und machte sich innerlich bereit.
Sie zählte bis drei.
Dann schrie sie.
Sie schrie, als würde ihr ein Meuchelmörder ein Messer in den Bauch rammen.
Sie schrie, als würden tausend Vögel auf sie einhacken.
Sie schrie, als würde der Palast um sie herum in Flammen stehen.
Der Wächter vor ihrer Tür stürmte mit gezogener Waffe herein. Winter schrie weiter. Sie stolperte über ihre Kissen, drückte sich mit dem Rücken an das Kopfende des Bettes und raufte sich die Haare.
»Prinzessin! Was ist? Was habt Ihr?« Seine Augen suchten hektisch das Zimmer ab, auf der Suche nach einem Eindringling, nach einer Bedrohung.
Sie griff hinter sich, kratzte an der Tapete und riss ein Stück heraus. Fast glaubte sie selbst, dass sie in Todesangst war. Sie redete sich ein, dass die Gespenster und Mörder immer näher kämen.
»Prinzessin!« Ein zweiter Wächter kam ins Zimmer. Er schaltete das Licht an, und Winter hob geblendet die Arme über den Kopf. »Was ist passiert?«
»Ich weiß nicht.« Der erste Wächter war auf die andere Seite des Zimmers gegangen und sah hinter den Vorhängen nach.
»Ein Ungeheuer!«, kreischte Winter und schluchzte dabei herzzerreißend. »Ich bin aufgewacht und es beugte sich über mein Bett. Es war ein Soldat der Königin!«
Die beiden Wächter sahen sich an, und ihr stummes Einverständnis war deutlich, selbst für Winter.
Es ist nichts. Sie hat sie nur nicht alle.
»Eure Hoheit …«, setzte der zweite Wächter an, während ein dritter Wächter im Türrahmen erschien.
Gut. Es hielten also nur drei Mann Wache im Flur zwischen ihrem Schlafzimmer und der Haupttreppe.
»Er ist dorthin!« Winter hielt immer noch einen Arm schützend über sich und zeigte mit dem anderen auf ihre Ankleidekammer. »Bitte. Er darf nicht entkommen. Findet ihn!«
»Was ist denn los?«, fragte der Neuankömmling.
»Sie glaubt, einen der Mutanten gesehen zu haben«, murmelte der zweite Wächter.
»Er war hier«, kreischte sie, und ihre Stimme überschlug sich fast. »Warum beschützt ihr mich nicht? Was steht ihr herum? Sucht ihn!«
Der erste Wächter wirkte verärgert, so als hätte ihr Theater ihn bei etwas Wichtigem unterbrochen, obwohl er nur im Gang gestanden und die Wand angestarrt hatte. Er steckte seine Pistole wieder in das Halfter, sagte aber im Brustton der Überzeugung: »Gewiss, Prinzessin. Wir werden den Eindringling finden, damit Ihr wieder sicher seid.« Er nickte dem zweiten Wächter zu, und die beiden stapften in das Ankleidezimmer.
Winter wandte sich an den dritten Wächter und ging in die Hocke. »Sie müssen mitgehen«, drängte sie ihn, und ihre Stimme war schwach und zitterte. »Das ist ein Ungeheuer, riesig groß, mit scharfen Zähnen und Klauen. Damit wird er sie in Stücke reißen. Sie können ihn nicht allein bezwingen, und dann …!« Ihre Worte wurden zu einem entsetzten Wimmern. »Dann kommt er mich holen, und nichts kann ihn aufhalten. Keiner wird mich retten!« Sie raufte sich die Haare und zitterte am ganzen Körper.
»Na gut, na gut. Gewiss, Hoheit. Wartet hier und … versucht, Euch zu beruhigen.«
Der Wächter wirkte erleichtert, dass er die Prinzessin verlassen konnte, und ging hinter seinen Kameraden her ins Ankleidezimmer.
Kaum war er durch die Tür verschwunden, stieg Winter vom Bett herunter und warf ihre Nachtrobe ab, die zerknüllt auf einem Stuhl landete.
»Hier ist keiner!«, rief einer der Wächter.
»Sucht weiter!«, schrie sie zurück. »Ich weiß, dass er da drin ist!«
Dann nahm sie den schlichten Hut und die Schuhe, die sie neben der Tür abgestellt hatte, und lief aus dem Zimmer.
Anders als ihre persönlichen Wächter, die ihr tausend Fragen gestellt und darauf bestanden hätten, sie in die Stadt zu eskortieren, zuckten die Wächter an den Türmen außerhalb des Palastes kaum mit der Wimper, als sie sie bat, das Tor zu öffnen. Ohne ihre Wächter und feinen Kleider, mit ihrem hastig hochgesteckten Haar und dem zu Boden gerichteten Blick konnte man sie im Dunkeln leicht für eine Dienstmagd halten.
Kaum war sie draußen vor dem Tor, fing sie an zu laufen.
Auf den Kopfsteinpflasterstraßen der Stadt flanierten, lachten und flirteten die Aristokraten, gehüllt in teure Kleider und ihren Zauber. Aus offenen Türen drang Licht auf die Straße und Musik tanzte auf den Fenstersimsen; die Luft war erfüllt vom Duft des Essens und vom Klirren der Gläser, und aus dunklen Gassen drang das Geräusch von Küssen und Stöhnen.
So war es in der Stadt immer. Frivolität und Vergnügungssucht. Die weiße Stadt Artemisia – ihr kleines Paradies unter dem schützenden Glas.
Im Zentrum befand sich ein erhabener Platz, eine runde Plattform, wo Theaterstücke aufgeführt und Versteigerungen abgehalten wurden, wo Zauberkunststücke und derbe Komödien die Familien aus ihren Villen lockten, um zu feiern und zu prassen.
Auch öffentliche Demütigungen und Bestrafungen standen hier häufig auf der Tagesordnung.
Winter keuchte erschöpft und war zugleich aufgeregt, weil sie sich erfolgreich davongeschlichen hatte. Dann sah sie ihn, und das Verlangen nach ihm ließ ihre Knie schwach werden. Sie musste ihren Schritt verlangsamen und Luft holen.
Er saß mit dem Rücken zur riesigen Sonnenuhr, die in der Mitte der Bühne stand und in den langen Nächten genauso nutzlos wie eindrucksvoll war. Seine nackten Arme waren gefesselt und sein Kinn war auf sein Schlüsselbein gefallen; sein helles Haar fiel ihm ins Gesicht. Als Winter näher kam, sah sie die erhabenen, mit getrockneten Blutspritzern übersäten Rautenmuster, die die Peitschenschläge auf seiner Brust und seinem Bauch hinterlassen hatten. Auf seinem Rücken würden noch mehr Wunden sein. Und seine Hand war sicher voller Blasen vom Umklammern der Peitsche. Selbst beigebracht hatte Levana bei der Urteilsverkündung gesagt, aber jedermann wusste, dass Jacin dabei unter dem Einfluss eines Thaumaturgen stehen würde. Die Bezeichnung selbst beigebracht war also der reinste Hohn.
Sie hatte gehört, dass sich Aimery freiwillig für diese Aufgabe gemeldet hatte. Wahrscheinlich hatte er jeden einzelnen Schlag genossen.
Jacin hob den Kopf, als sie den Rand der Bühne erreichte. Ihre Blicke trafen sich und sie sah einen Menschen, der ausgepeitscht und gefesselt worden war und den ganzen Tag Spott und Folter hatte ertragen müssen, und einen Moment lang glaubte sie, er sei ein gebrochener Mann. Noch ein zerbrochenes Spielzeug der Königin.
Doch dann hob er einen Mundwinkel und ein Lächeln ließ seine unglaublich blauen Augen erstrahlen; er wirkte heiter und offen wie die aufgehende Sonne.
»Hallo, Sorgenkind«, sagte er und lehnte den Kopf an die Sonnenuhr.
In dem Augenblick fiel der ganze Schrecken der vergangenen Wochen von ihr ab. Er lebte. Er war zu Hause. Er war noch immer Jacin.
Sie kletterte auf die Bühne. »Weißt du überhaupt, was ich mir für Sorgen gemacht habe?«, fragte sie, während sie auf ihn zuging. »Ich wusste nicht, ob du tot warst oder entführt oder ob dich ein Soldat der Königin gefressen hat. Die Ungewissheit hat mich wahnsinnig gemacht.«
Er hob eine Augenbraue und sah sie an.
»Sag nichts«, befahl sie mürrisch.
»Das würde ich nie wagen.« Trotz der Fesseln versuchte er, seine Schultern zu lockern; dabei klafften seine Wunden auseinander und für den Bruchteil einer Sekunde verzog er vor Schmerz das Gesicht.
Winter tat so, als hätte sie es nicht gesehen, setzte sich im Schneidersitz vor ihn hin und inspizierte seine Verletzungen. Sie wollte ihn so gerne berühren. Aber sie hatte auch Angst davor. Daran hatte sich also nichts geändert. »Tut es sehr weh?«
»Besser, als auf dem Grund des Sees zu liegen.« Seine aufgesprungenen Lippen verzogen sich zu einem schiefen Lächeln. »Morgen Abend komme ich in ein Genesungsbecken. Ein halber Tag, und ich bin so gut wie neu.« Er zog die Augenbrauen zusammen. »Vorausgesetzt Ihr seid nicht hier, um mir Essen zu bringen. Ich würde meine Zunge nämlich gerne behalten, wenn es geht.«
»Kein Essen. Nur ein freundliches Gesicht.«
»Freundlich.« Er verschlang sie förmlich mit den Augen, auch wenn er weiterhin gelassen lächelte. »Das ist eine Untertreibung.«
Sie senkte den Blick und wandte sich ab, um die drei Narben auf ihrer Wange zu verbergen. Jahrelang war Winter davon ausgegangen, dass die Leute sie anstarrten, weil sie die Narben so abstoßend fanden. In ihrer Welt der Perfektion waren solche Entstellungen selten. Aber eines Tages hatte eine Dienstmagd ihr gesagt, dass es nicht Abscheu war, der die Leute dazu brachte, sie anzugaffen, sondern Bewunderung. Sie sagte, dass die Narben Winter interessant machten und – so seltsam es klang – noch schöner aussehen ließen. Schön. Das Wort hatte Winter in ihrem Leben schon oft gehört. Ein wunderschönes Kind, ein wunderschönes Mädchen, eine wunderschöne junge Dame, so schön, zu schön … Das Starren der anderen, das das Wort begleitete, sorgte dafür, dass sie am liebsten auch einen Schleier getragen hätte – genau wie ihre Stiefmutter –, um sich vor dem Geflüster zu verstecken.
Jacin war der Einzige, bei dem sie sich schön fühlte, ohne dass es ihr wie etwas Schlechtes vorkam. Sie konnte sich nicht erinnern, dass er das Wort jemals gebraucht oder ihr irgendwelche Komplimente gemacht hatte. Und wenn doch, waren sie hinter beiläufigen Witzen versteckt, die ihr Herz schneller schlagen ließen.
»Hör auf, mich aufzuziehen«, sagte sie, denn es war ihr unangenehm, wie er sie ansah.
»Habe ich gar nicht«, sagte er lässig.
Winter streckte den Arm aus und boxte ihn auf die Schulter.
Er zuckte zusammen und sie hielt erschrocken inne, als sie sich an seine Verletzungen erinnerte. Doch Jacin kicherte amüsiert. »Das ist ein unfairer Kampf, Prinzessin.«
Sie konnte sich die in ihr aufkeimende Entschuldigung gerade noch verkneifen. »Es wird langsam Zeit, dass ich auch einmal im Vorteil bin.«
Er sah an ihr vorbei auf die Straße. »Wo ist Euer Wächter?«
»Den habe ich im Palast gelassen. Er sucht in meiner Kammer nach einem Ungeheuer.«
Das sonnige Lächeln verschwand und stattdessen bildeten sich ärgerliche Falten auf Jacins Stirn. »Prinzessin, Ihr dürft nicht allein ausgehen. Wenn Euch etwas zustößt …«
»Wer sollte mir denn hier in der Stadt etwas tun? Hier weiß doch jeder, wer ich bin.«
»Es braucht bloß ein Idiot daherzukommen, der sich einfach nimmt, was er will, und zu betrunken ist, um sich zu bezähmen.«
Sie wurde rot und biss die Zähne aufeinander.
Jacin runzelte die Stirn, und sofort tat ihm leid, was er gesagt hatte. »Prinzessin …«
»Ich werde den ganzen Weg zum Palast zurück rennen. Dann passiert mir nichts.«
Er seufzte. Sie legte den Kopf schief und wünschte, sie hätte eine Salbe für seine Verletzungen mitgebracht. Levana hatte nichts von Medizin gesagt, und ihn hier gefesselt, verwundbar und mit nacktem Oberkörper zu sehen, ließ ihre Finger auf seltsame Weise zucken – auch wenn er ganz blutverschmiert war.
»Ich wollte mit dir allein sein«, sagte sie und sah ihm ins Gesicht. »Das sind wir nämlich in letzter Zeit nie.«
»Es schickt sich nicht für siebzehnjährige Prinzessinnen, mit jungen Männern allein zu sein, die fragwürdige Absichten hegen.«
Da lachte sie. »Und was ist mit jungen Männern, mit denen sie schon befreundet waren, bevor sie laufen konnten?«
Er schüttelte den Kopf. »Das sind die schlimmsten.«
Sie lachte und schnaubte regelrecht dabei, was Jacins Gesicht sofort wieder aufhellte.
Doch sie fand es nur bedingt lustig. Tatsächlich berührte Jacin sie immer nur dann, wenn er ihr half, eine ihrer Halluzinationen zu überstehen. Sonst vermied er schon seit Jahren jeden Körperkontakt. Beim letzten Mal war sie vierzehn und er sechzehn gewesen und sie hatte ihm beigebracht, zu dem Musikstück Eclipse Waltz zu tanzen, was zu peinlichen Ergebnissen geführt hatte.
In diesen Tagen hätte sie die ganze Milchstraße gegeben, wenn dafür seine Absichten etwas weniger ehrenhaft gewesen wären.
Ihr Lächeln erstarb. »Ich habe dich vermisst«, sagte sie.
Er wandte den Blick ab und rutschte an der Sonnenuhr herum, um es sich ein wenig bequemer zu machen. Dabei biss er die Zähne zusammen, damit sie nicht sah, welche Schmerzen ihm jede kleinste Bewegung bereitete. »Wie geht es Eurem Kopf?«, fragte er.
»Die Visionen kommen und gehen«, sagte sie. »Aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie schlimmer werden.«
»Hattet Ihr heute schon eine?«
Sie zupfte an einer Faser ihrer Leinenhose, die ein wenig dicker als die anderen war, und versuchte, sich zu erinnern. »Nein, nicht seit den Prozessen gestern. Ich habe mich in ein Mädchen aus Eis verwandelt und Aimery hat den Kopf verloren. Buchstäblich.«
»Von mir aus könnte die letzte Vision ruhig wahr werden.«
»Pscht«, zischte sie ängstlich.
»Es ist mein Ernst. Es gefällt mir nicht, wie er Euch immer ansieht.«
Winter wandte den Kopf, doch die Plätze um die Bühne herum waren leer. Nur der entfernte Lärm von Musik und Gelächter erinnerte sie daran, dass sie sich in einer Großstadt befanden.
»Du bist wieder auf Luna«, ermahnte sie ihn. »Du musst aufpassen, was du sagst.«
»Ihr gebt mir Ratschläge, wie man sich unauffällig verhält?«
»Jacin …«
»Auf diesem Platz gibt es drei Kameras. Zwei auf den beiden Laternenpfählen hinter Euch und eine in der Eiche hinter der Sonnenuhr. Aber die können keinen Ton aufnehmen. Oder meint Ihr, dass sie jetzt Leute in ihrem Dienst hat, die Lippen lesen?«
Winter starrte ihn böse an. »Woher weißt du das?«
»Überwachung war eine von Sybils Spezialitäten.«
»Die Königin hätte dich gestern ebenso gut töten können. Du musst vorsichtig sein.«
»Ich weiß, Prinzessin. Ich habe nicht die Absicht, in den Thronsaal zurückzukehren, außer als loyaler Wächter.«
Über ihnen zog ein lautes Brummen Winters Aufmerksamkeit auf sich. Durch die Kuppel hindurch konnte sie sehen, wie ein Dutzend Raumschiffe durch das sternenübersäte All flogen und in der Ferne verblassten. Sie flogen in Richtung Erde.
»Soldaten«, murmelte Jacin. Sie konnte nicht sagen, ob es eine Feststellung oder eine Frage war. »Wie ist der Stand des Krieges?«
»Mir erzählt keiner etwas. Ihre Majestät scheint zufrieden mit unseren militärischen Erfolgen … Doch sie ärgert sich noch immer furchtbar über die Entführung des Imperators und die abgesagte Hochzeit.«
»Nicht abgesagt. Bloß verschoben.«
»Versuch ihr das mal klarzumachen.«
Er brummte.
Winter stützte sich mit den Ellbogen auf und legte ihr Kinn in die Handflächen. »Hatte der Cyborg wirklich solch eine Vorrichtung, von der du gesprochen hast? Die verhindert, dass Menschen manipuliert werden?«
Da blitzten seine Augen auf, als hätte sie ihn an etwas Wichtiges erinnert, aber als er versuchte, sich zu ihr herüberzubeugen, wurde er von den Fesseln zurückgehalten. Er verzog das Gesicht und fluchte leise.
Winter rutschte näher an ihn heran, um die Distanz zwischen ihnen zu überbrücken.
»Das ist nicht alles«, sagte er. »Angeblich kann sie Lunarier davon abhalten, ihre Gabe überhaupt einzusetzen.«
»Ja, das hast du im Thronsaal schon erwähnt.«
Seine Augen bohrten sich tief in ihre. »Und es schützt ihren Geist. Es verhindert, dass sie …«
Verrückt werden.
Er brauchte es nicht laut auszusprechen. Er schaute so hoffnungsvoll, als hätte er das größte Problem der Welt gelöst. Die Bedeutung des Gesagten schwebte zwischen ihnen.
Eine solche Vorrichtung könnte sie heilen.
Winter legte die Hand wieder unter ihr Kinn. »Aber du hast gesagt, dass es keine mehr davon gäbe.«
»Nein. Aber wenn wir das Patent dafür finden würden … Allein zu wissen, dass so etwas möglich ist …«
»Die Königin wird alles tun, um zu verhindern, dass neue hergestellt werden.«
Sein Gesichtsausdruck verfinsterte sich. »Ich weiß, aber ich musste ihr irgendetwas anbieten. Wenn mich die undankbare Hexe Sybil bloß nicht verhaftet hätte.« Winter lächelte, und als Jacin das sah, ebbte seine Wut ab. »Macht nichts. Jetzt, da ich weiß, dass es möglich ist, werde ich einen Weg finden.«
»Wenn du bei mir bist, sind die Visionen nie so schlimm. Jetzt, wo du zurückgekommen bist, wird es bestimmt besser.«
Er biss die Zähne aufeinander. »Tut mir leid, dass ich Euch zurückgelassen habe. Kaum begriff ich, was ich tat, da bereute ich es auch schon. Es ging so schnell, und dann konnte ich nicht mehr zurück, um Euch zu holen. Ich habe Euch einfach hier oben zurückgelassen. Bei ihr. Bei denen.«
»Du hast mich nicht zurückgelassen. Du wurdest als Geisel genommen. Du hattest doch keine Wahl.«
Er wandte den Blick ab.
Sie streckte den Rücken. »Wurdest du gar nicht manipuliert?«
»Nicht die ganze Zeit«, flüsterte er, als würde er ein Geständnis ablegen. »Als Sybil und ich ihr Schiff bestiegen, habe ich beschlossen, mich auf ihre Seite zu schlagen.« Er machte ein schuldbewusstes Gesicht und es sah so merkwürdig bei ihm aus, dass Winter unsicher war, ob sie seine Miene richtig interpretierte. »Und dann habe ich sie verraten.« Er stieß mit dem Kopf gegen die Sonnenuhr, und zwar stärker, als nötig gewesen wäre. »Ich bin so ein Idiot. Ihr solltet mich hassen.«
»Du bist vielleicht ein Idiot, aber ein sehr liebenswerter.«
Er schüttelte den Kopf. »Ihr seid die Einzige in der gesamten Galaxie, die mich als liebenswert bezeichnen würde.«
»Ich bin die Einzige in der gesamten Galaxie, die verrückt genug ist, das auch wirklich zu finden. Jetzt erzähl mir, was du getan hast, dass ich dich hassen sollte.«
Er schluckte schwer. »Der Cyborg, den Ihre Majestät jagt …«
»Linh Cinder.«
»Ja. Zuerst dachte ich, das wäre nur ein verrücktes Mädchen auf einem Himmelfahrtskommando. Ich dachte, sie würde uns alle mit in den Tod reißen mit ihren Wahnvorstellungen, dass sie den Imperator entführen und die Königin stürzen will. Wenn man ihr so zuhörte, hätte das jeder gedacht. Also beschloss ich, lieber zu Euch zurückzukehren und sie ihrem Schicksal zu überlassen.«
»Aber Linh Cinder hat tatsächlich den Imperator entführt. Und sie konnte entkommen.«
»Ich weiß.« Nun sah er Winter wieder an. »Sybil hat eine ihrer Freundinnen als Geisel genommen. Ein Mädchen namens Scarlet. Ihr wisst nicht zufällig …«
Winter strahlte. »Doch. Die Königin gab sie mir als Haustier. Sie wird im Tiergarten gehalten. Ich habe sie sehr gern.« Sie zog die Augenbrauen zusammen. »Aber ich weiß nicht, ob sie mich mag oder ob sie mich hasst.«
Plötzlich zuckte er zusammen, als hätte ihn ein unerwarteter Schmerz übermannt, und versuchte, sich bequemer hinzusetzen. »Könnt Ihr ihr eine Nachricht von mir übermitteln?«
»Natürlich.«
»Aber Ihr müsst vorsichtig sein. Wenn Ihr die Nachricht nicht für Euch behalten könnt, sage ich sie Euch nicht – um Eurer selbst willen.«
»Ich kann sie für mich behalten.«
Jacin musterte sie skeptisch.
»Das kann ich. Ich werde so verschwiegen sein wie ein Spion. Genauso verschwiegen wie du.« Winter rutschte noch ein Stück näher an ihn heran.
Plötzlich sprach er ganz leise, als wäre er auf einmal nicht mehr sicher, ob die Kameras nicht doch den Ton aufnahmen. »Sagt ihr, dass sie kommen, um sie zu befreien.«
Winter riss die Augen auf. »Dass sie kommen … Hierher?«
Er nickte mit einer kurzen, knappen Kopfbewegung. »Und ich glaube, sie haben sogar eine Chance.«
Winter runzelte die Stirn und strich Jacin ein paar verschwitzte und schmutzige Haarsträhnen hinter die Ohren. Bei der Berührung spannte sich sein ganzer Körper an, doch er wich nicht zurück. »Jacin Clay, du sprichst in Rätseln.«
»Linh Cinder.« Seine Stimme war kaum mehr als ein Hauch und sie kam noch näher, um ihn verstehen zu können. Eine Locke ihres Haars streifte seine Schulter. Er befeuchtete sich die Lippen. »Sie ist Selene.«
Jeder Muskel ihres Körpers spannte sich an. Dann wich sie zurück. »Wenn Ihre Majestät das hören würde …«
»Ich werde es niemand sonst sagen. Aber Euch musste ich es sagen.« Kleine Fältchen bildeten sich in seinen Augenwinkeln und er sah sie voller Mitgefühl an. »Ich weiß, dass Ihr sie sehr lieb hattet.«
Ihr Herz schlug laut. »Meine Selene?«
»Ja. Aber … Es tut mir leid, Prinzessin. Ich glaube nicht, dass sie sich noch an Euch erinnert.«
Winter blinzelte und ergab sich einen versunkenen Augenblick lang dem schönen Tagtraum. Selene, am Leben. Ihre Cousine, ihre Freundin. Am Leben.
Dann hob sie die Schultern, so als wollte sie die Hoffnung wegfegen. »Nein. Sie ist tot. Ich war dort, Jacin. Ich habe das Zimmer nach dem Feuer gesehen.«
»Aber Ihr habt sie nicht gesehen.«
»Man fand doch …«
»Verkohltes Fleisch, ich weiß.«
»Einen Haufen Asche in der Form eines kleinen Mädchens.«
»Das war bloß Asche. Hört mir zu. Ich habe es erst auch nicht geglaubt, aber jetzt tue ich es.« Ein Mundwinkel hob sich leicht, als würde ihn Stolz erfüllen. »Sie ist unsere tote Prinzessin. Und sie kommt nach Hause zurück.«
Hinter Winter räusperte sich jemand, und sie glaubte, ihr Herz würde stehenbleiben. Sie wirbelte herum und fiel dabei auf ihren Ellbogen.
Ihr persönlicher Wächter stand neben der Bühne und sah sie vorwurfsvoll an.
»Ah!« Winters Herz klopfte wie tausend aufgeschreckte Vögel und sie lächelte erleichtert. »Habt ihr das Ungeheuer gefangen?«
Er lächelte nicht zurück; seine Wangen röteten sich nicht einmal wie sonst, wenn sie ihn mit ihrem besonderen Blick bedachte. Stattdessen fing seine Augenbraue an zu zucken.
»Eure Hoheit. Ich bin gekommen, um Euch zu holen und zum Palast zurückzubegleiten.«
Winter erhob sich und verschränkte die Arme vor der Brust. »Gewiss. Wie freundlich von Ihnen, dass Sie sich um mich gesorgt haben.« Sie wandte sich zu Jacin um, der den Wächter misstrauisch beäugte. Was nichts Neues war. Denn er beäugte alle und jeden misstrauisch. »Ich fürchte, morgen wird es noch schwerer für Sie, Sir Clay. Denken Sie an mich, wenn Sie können.«
»Wenn ich kann, Prinzessin?« Er warf ihr einen schelmischen Blick zu. »Ich kann an nichts anderes denken.«
4
Cinder lag auf dem Boden und betrachtete die riesigen Triebwerke der Albatros, ihre Lüftungsanlage und das Lebenserhaltungs-Modul. All die Systempläne, die sie sich vor Wochen heruntergeladen hatte, hatte sie auf ihrem Netzhaut-Display aufgerufen; ein Cyborg-Trick, der ihr schon gute Dienste geleistet hatte, als sie noch in Neu-Peking als Mechanikerin gearbeitet hatte. Sie vergrößerte die Pläne und zoomte auf einen Zylinder von der Größe ihres Armes. Er befand sich nicht weit von der Maschinenraumwand. Auf beiden Seiten sprossen Spulen mit Röhren heraus.
»Das muss das Problem sein«, murmelte sie, schob sich unter das Modul, wobei sich Wollmäuse auf ihre Schultern legten, und richtete sich wieder auf. Es war gerade genug Platz, dass sie in dem Labyrinth von Kabeln, Spulen, Röhren und Schläuchen sitzen konnte.
Sie hielt die Luft an und drückte das Ohr gegen den Zylinder. Das Metall war eiskalt.
Sie wartete. Und lauschte. Stellte die Lautstärke ihrer Audiosensoren höher.
Sie hörte, wie die Tür zum Maschinenraum aufging.
Sie sah über die Schulter und erkannte im gelblichen Licht, das vom Flur hereinschien, die grauen Hosen einer Militäruniform. Das hätte jeder auf dem Schiff sein können – wenn er keine edlen schwarzen Lackschuhe getragen hätte …
»Hallo?«, rief Kai.
Ihr Herz schlug schneller. Das passierte ihr jedes Mal.
»Hier hinten.«
Auf der anderen Seite des Maschinenraums schloss Kai die Tür und hockte sich hin, umrahmt von einem Gewirr aus pulsierenden Kolben und wirbelnden Ventilatoren. »Was machst du da?«
»Ich überprüfe die Sauerstofffilter. Einen Augenblick.«
Wieder legte sie ein Ohr an den Zylinder. Da hörte sie ein schwaches Knattern, als würde ein Kieselstein im Innern hin und her springen. »Aha.«
Sie holte einen Schraubenschlüssel aus der Tasche und fing an, die Schrauben an beiden Seiten des Zylinders zu lösen. Kaum hatte sie den Zylinder abgenommen, wurde es ganz still im Schiff, geradezu unheimlich. Wie ein Summen, das man erst bemerkt, wenn es aufhört. Kais Augenbrauen schossen in die Höhe.
Cinder schaute erst in den Zylinder, bevor sie die Hand hineinsteckte und einen kompliziert aussehenden Filter herausholte. Er bestand aus kleinen Poren und Ritzen, die alle von einem feinen grauen Film überzogen waren.
»Kein Wunder, dass die Starts so holperig waren.«
»Ich nehme nicht an, dass du meine Hilfe gebrauchen kannst?«
»Nö. Außer du willst mir einen Besen suchen.«
»Einen Besen?«
Cinder hob den Zylinder in die Höhe und fing an, mit dem oberen Ende gegen ein Rohr über ihrem Kopf zu schlagen. Eine Staubwolke hüllte ihre Haare und Arme ein. Hustend verbarg Cinder ihre Nase in der Armbeuge und schlug weiter, bis sich die größten Staubknäuel gelöst hatten.
»Ah. Einen Besen. Vielleicht ist einer in der Küche … Ich meine, in der Kombüse.«
Cinder blinzelte, um den Staub von ihren Wimpern zu schütteln, und grinste ihn an. Sonst war er immer so selbstsicher, und in den seltenen Augenblicken, wenn er nicht ganz Herr der Lage war, hatte sie das Gefühl, als würde sich ihr Innerstes um sich selbst drehen. In letzter Zeit kam das häufiger vor. Von dem Augenblick an, als er auf der Albatros erwachte, war klar, dass sich Kai zwölftausend Kilometer außerhalb seines Elementes befand; doch dafür hatte er sich in den vergangenen Wochen gut angepasst. Er lernte die Schiffssprache, aß das gefriergetrocknete Essen aus Dosen, ohne sich zu beklagen, und tauschte seinen Hochzeitsstaat gegen die Standard-Militäruniform ein, die sie alle trugen. Er bestand darauf, zu helfen, wo immer er konnte, und hatte sogar schon ein paar der fade schmeckenden Mahlzeiten zubereitet, obwohl Iko betonte, dass er als ihr kaiserlicher Gast eigentlich von ihnen bedient werden müsste. Thorne lachte nur darüber, und Kai schien bei dem Vorschlag noch unwohler zu sein.
Obwohl Cinder nicht glaubte, dass er auf seinen Thron verzichten würde, um den Rest seines Lebens der Raumfahrt und gefährlichen Abenteuern zu widmen, fand sie es geradezu niedlich, wie sehr er sich bemühte, sich einzufügen.
»Das war ein Scherz«, sagte sie. »Maschinenräume müssen schmutzig sein.« Sie unterzog den Filter einer gründlichen Prüfung, und als sie zufrieden war, steckte sie ihn wieder in den Zylinder und schraubte ihn zu. Das Summen setzte wieder ein, doch das Knattern blieb aus.
Cinder wand sich mit den Füßen voraus unter dem Modul und den Leitungen hervor. Kai hockte immer noch vornübergebeugt da und musste schmunzeln. »Iko hat vollkommen Recht. Du kannst keine fünf Minuten lang sauber bleiben.«
»Das gehört zu meiner Stellenbeschreibung.« Sie setzte sich auf, wobei ein ganzer Haufen Flusen und Krümel von ihren Schultern herabrieselte. Kai zupfte ein paar größere Stücke aus ihrem Haar. »Wo hast du das eigentlich gelernt?«
»Was? Das? Einen Sauerstofffilter reinigen kann doch jeder.«
»Ganz bestimmt nicht, glaub mir.« Er stützte seine Ellbogen auf den Knien ab und ließ den Blick über den Maschinenraum schweifen. »Weißt du, wofür das alles da ist?«
Sie folgte seinem Blick über die Kabel, die Rohre und die Kompressionsspulen und zuckte mit den Achseln. »Schon. Außer bei dem großen Ding in der Ecke, das sich dreht. Da blicke ich nicht durch. Aber das wird schon nicht so wichtig sein.«
Kai verdrehte die Augen.
Cinder griff nach einem Rohr und zog sich daran hoch; dann steckte sie den Schraubenschlüssel wieder in die Tasche. »Ich hab das nirgendwo gelernt. Ich seh mir die Dinge einfach nur an und überlege mir, wie sie funktionieren könnten. Und sobald man weiß, wie etwas funktioniert, kann man es auch reparieren.«
Sie versuchte, die letzten Staubflusen aus ihrem Haar zu schütteln, aber der Staubvorrat schien nicht versiegen zu wollen.
»Also du siehst dir nur etwas an und weißt sofort, wie es funktioniert?« Kai stand neben ihr und verzog keine Miene.
Cinder zog ihren Pferdeschwanz zurecht und zuckte die Achseln; plötzlich war ihr das Gespräch peinlich. »Es ist bloß Mechanik.«
Kai legte einen Arm um ihre Hüfte und zog sie zu sich heran. »Nein, es ist verflixt eindrucksvoll«, sagte er und wischte mit dem Daumen einen Krümel von Cinders Wange. »Oder sollte ich sagen ›auf seltsame Art attraktiv‹?«, fuhr er fort, bevor er sie auf die Lippen küsste.
Cinder verkrampfte sich einen kurzen Augenblick, bevor sie sich dem Kuss hingab. Jedes Mal verspürte sie den gleichen Rausch, gemischt mit Überraschung und einem leichten Taumel. Es war ihr siebzehnter Kuss (ihre Gehirn-Schnittstelle führte gegen ihren Willen Buch), und sie fragte sich, ob sie sich jemals an dieses Gefühl gewöhnen würde; das Gefühl, begehrt zu werden. Ihr Leben lang hatte sie geglaubt, dass nie jemand etwas anderes in ihr sehen würde als ein bizarres Wissenschaftsexperiment.
Vor allem kein junger Mann.
Und schon gar nicht Kai, der kluge, ehrenhafte und liebenswürdige Kai, der jedes Mädchen auf der ganzen Welt haben konnte. Jedes.
Sie seufzte und lehnte sich an seine Schulter. Kai griff nach einem Rohr über sich und presste Cinder gegen das Hauptsteuerpult. Sie wehrte sich nicht. Obwohl sie nicht erröten konnte, wurde ihr Innerstes jedes Mal, wenn er ihr so nahe kam, von einer Hitzewelle überflutet. Jedes Nervenende funkte und summte, und sie wusste, dass er sie noch siebzehntausend Mal so küssen konnte, ohne dass sie es je leid werden würde.
Sie legte die Arme um seinen Nacken und schmiegte sich an seinen Körper. Die Wärme seiner Brust sickerte in ihre Kleidung ein. Es fühlte sich so gut an. Einfach perfekt.
Doch dann kam dieses Gefühl, das immer im Hintergrund lauerte und ihr Glück überschattete; das Wissen, dass es nicht so bleiben konnte.
Nicht solange Kai mit Levana verlobt war.
Sie ärgerte sich über diesen lästigen Gedanken und küsste Kai umso heftiger, doch ihre Gedanken rebellierten weiter. Selbst wenn sie erfolgreich waren und Cinder den Thron an sich reißen könnte, würde von ihr erwartet, dass sie als neue Königin auf Luna bleiben würde. Sie hatte zwar keine Erfahrung auf dem Gebiet, aber eine Fernbeziehung zwischen zwei Planeten könnte sich eventuell als schwierig erweisen.
Besser gesagt, zwischen einem Planeten und einem Mond.
Oder so ähnlich.
Jedenfalls würden 384000 Kilometer Weltraum zwischen ihr und Kai liegen, und das war eine ganze Menge …
Kai lächelte. »Was ist los?«, murmelte er, sein Mund noch immer nahe an ihrem.
Cinder lehnte sich zurück und sah ihn an. Sein Haar wurde länger und sah fast ein wenig unordentlich aus. Als Prinz war er immer perfekt frisiert gewesen. Aber dann wurde er Imperator, und seit seiner Krönung hatte er versucht, einen Krieg zu verhindern, einen gesuchten Cyborg zu fangen, einer Heirat aus dem Weg zu gehen, und schließlich war er entführt worden. Vor diesem Hintergrund war Haarpflege ein verzichtbarer Luxus.
Sie zögerte kurz, bevor sie ihn fragte. »Denkst du manchmal an die Zukunft?«
Sein Gesichtsausdruck wurde wachsam. »Natürlich tue ich das.«
»Und … bin ich Teil dieser Zukunft?«
Sein Blick wurde weich. Er ließ das Rohr über seinem Kopf los und strich ihr eine Haarsträhne hinter das Ohr. »Das hängt davon ab, ob es die gute oder die schlechte Zukunft ist.«
Cinder legte den Kopf an seine Brust. »Hauptsache, ich bin in einer von beiden.«
»Es wird klappen«, sagte Kai in ihr Haar. »Wir werden gewinnen.«
Sie nickte und war froh, dass er ihr Gesicht nicht sehen konnte.
Levana zu besiegen und die Königin von Luna zu werden, war erst der Anfang einer ganzen Galaxie voller Sorgen. Sie wäre am liebsten für immer im sicheren Schoß des Raumschiffes geblieben, zusammen mit ihm, sicher und allein. Aber das war unmöglich. Sobald sie Levana gestürzt hätten, würde Kai als Imperator in den Asiatischen Staatenbund zurückkehren und früher oder später würde er eine Kaiserin brauchen.
Auf den lunarischen Thron mochte sie vielleicht einen Anspruch haben und sie hoffte, dass die Lunarier jede andere Herrscherin Levana vorziehen würden – selbst einen politisch völlig unbedarften Teenager, der zu 36,28 Prozent aus kybernetischem und künstlich gefertigtem Material bestand. Aber sie kannte die Vorurteile der Bewohner des Staatenbundes und hatte den leisen Verdacht, dass sie sie nicht wie ihr Herrscher mit offenen Armen empfangen würden.
Sie war nicht einmal sicher, ob sie überhaupt Kaiserin sein wollte. Sie musste sich noch immer an den Gedanken gewöhnen, Prinzessin zu sein.
»Eins nach dem anderen«, flüsterte sie und versuchte, ihre durcheinanderwirbelnden Gedanken zu beruhigen.
Kai küsste sie auf die Schläfe (doch ihr Gehirn wertete diesen Kuss nicht als Nummer achtzehn) und löste sich dann von ihr. »Wie geht es mit deinem Training voran?«
»Gut.« Sie befreite sich aus seinen Armen und sah sich im Maschinenraum um. »Oh, wo du schon mal hier bist … Kannst du mir mal helfen?« Cinder flitzte um ihn herum, klappte eine Schalttafel auf und legte ein Knäuel aus verknoteten Kabeln frei.
»Das war ja ein sehr subtiler Themenwechsel.«
»Ich wechsele gar nicht das Thema«, sagte sie, doch ein plötzlicher Räusperzwang verriet sie. »Ich verkabel nur die Orbital-Standardeinstellung neu, damit das Schiff weniger Treibstoff verbraucht, während wir in der Umlaufbahn sind. Diese Frachtschiffe sind für häufige Landungen und Starts konzipiert und nicht für ständiges …«
»Cinder.«
Sie spitzte die Lippen und zog ein paar Kabelverbindungen auseinander. »Das Training läuft gut«, wiederholte sie. »Könntest du mir die Drahtzange da auf dem Boden geben?«
Kai suchte den Boden ab, streckte die Hand nach zwei Werkzeugen aus und hielt sie hoch.
»Links«, sagte sie, und er reichte sie ihr. »Das Kampftraining mit Wolf ist jetzt viel leichter als vorher. Allerdings weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass ich stärker werde, oder daran, dass er … Du weißt schon.«
Sie wusste nicht, wie sie es sagen sollte. Wolf war nur noch ein Schatten seiner selbst, seit Scarlet gefangen worden war. Das Einzige, was ihn durchhalten ließ, war seine Entschlossenheit, so bald wie möglich nach Luna zu gelangen und sie zu befreien.