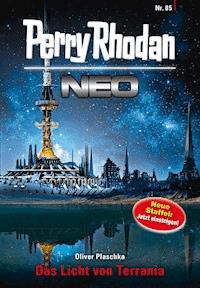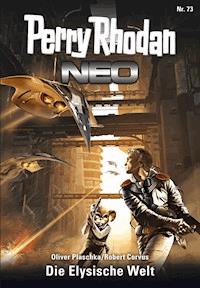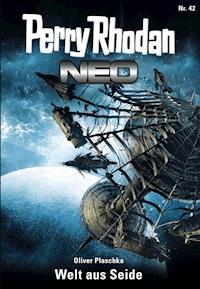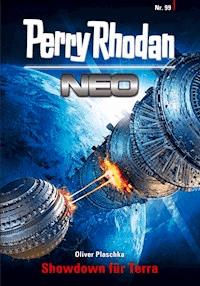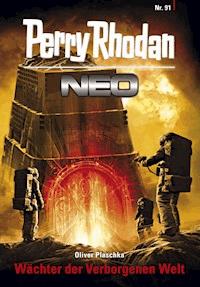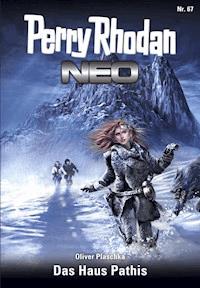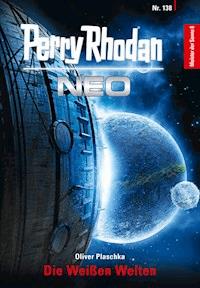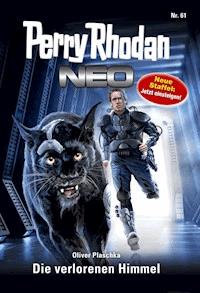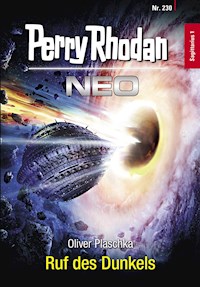6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Justine, die junge Kellnerin des »Jardin«, der bärbeißige Wirt Alphonse und der glücklose Schriftsteller Gaspard - keiner von ihnen weiß, warum sich plötzlich ein seltsames Dämmerlicht über Paris legt. Die geheime Société, die über alle Magie wacht, ist alarmiert und hat bereits ihre Vertreter entsandt, um den abtrünnigen Zauberkünstler Ravi und seine bezaubernde Assistentin Blanche zu bestrafen. Im »Jardin«, dem kleinen Hotel am Boulevard Raspail treffen sie schließlich aufeinander, um zu klären, was unerklärlich scheint. Der Kampf zwischen Wirklichkeit und Traum, der nun entbrennt, hält nicht nur Gaspard und Justine in Atem, sondern verschlingt die gesamte Stadt: Paris steht still, keine Glocke schlägt die Zeit. Das Pendel im Chor von Saint-Martin-des-Champs schwingt aus, und niemand weiß, ob sich die Welt noch dreht ... Der Autor hat den Deutscher Phantastikpreis 2008 erhalten und ist der Co-Autor des »Narnia« Rollenspiels.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 638
Ähnliche
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Besuchen Sie uns im Internet: www.klett-cotta.de/hobbitpresse Hobbit Presse © 2009/2010 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart Alle Rechte vorbehalten Cover: HildenDesign, München, www.hildendesign.de Illustration: © Isabell Hirtz Karten: Harry Rey, Kartoplan, www.kartoplan.de Printausgabe: ISBN 978-3-608-93874-6 E-Book: ISBN 978-3-608-10134-8
Inhalt
Vor dem Fall
Der erste Tag
Das Herz einer Kellnerin
Der zweite Tag
Von Mäusen und Magiern
Der dritte Tag
Ein unerwarteter Trauerfall
Der vierte Tag
Gaslichtromanzen
Der fünfte Tag
Magische Nächte
Der sechste Tag
Der Tag der Toten
Der siebte Tag
Dieses eine Mal, für immer
Solang wir uns wiedersehen
Nachwort
Karte von Paris – Montparnasse
Karte von Paris – Carrefour Vavin
… sollst du verharren zweiundvierzig Stunden
und dann erwachen wie von süßem Schlaf.
WILLIAM SHAKESPEARE
Sie öffnete die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe,
und richtete sich auf, und war wieder lebendig.
»Wo bin ich?«, rief sie.
Der Königssohn erwiderte voll Freude:
»Du bist in Sicherheit bei mir.«
GEBRÜDER GRIMM
I’ll be seeing you
In all the old familiar places
That this heart of mine embraces
All day through
In that small café
The park across the way
The children’s carousel
The chestnut trees
Die Ereignisse jenes Sonntags im September, die in ein solches Tohuwabohu münden sollten, dass später niemand seine Verwicklung in sie eingestehen mochte (besonders nicht die Mitglieder der Société Silencieuse), entzündeten sich an einer unbedeutenden Kleinigkeit, welche sich unglückseligerweise gerade zum Abschluss unserer sonst recht erfolgreichen Reihe von Vorstellungen im Bobino zutrug.
Ein Engagement im Bobino konnte man zu dieser Zeit getrost als Krönung einer jungen Karriere bezeichnen. Ich weiß nicht, was Blanche – ich bin in Geschäftsdingen nicht erfahren – Philbert, dem Direktor, versprochen hatte, der aus dem übergroßen Café gerade erst wieder ein Varieté gemacht hatte, wie es bereits Mitte des vorigen Jahrhunderts eines gewesen war. Allerdings war mein Eindruck, dass von all den Menschen, die in diesen verrückten Jahren nach Montparnasse strömten, allenfalls ein Zehntel ernsthaft am Talent der Künstler interessiert war, die hier ihr Refugium gefunden hatten. Die übrigen neun waren gekommen, um nackte Brüste und fliegende Beine zu sehen – und dann erklären Sie mal einem Varietédirektor, weshalb er einen altmodischen Zauberkünstler wie Sie engagieren sollte.
Wir bekamen eine ganze Woche. Blanche kam freudestrahlend aus Philberts Büro und wedelte aufgeregt mit einem Blatt Papier, auf dem die Grundzüge unseres Programms festgehalten waren, wie wir es voriges Jahr auf den Kleinbühnen Montmartres gespielt hatten. Nicht allzu verwunderlich, dass die Hälfte der Tricks nun durchgestrichen und durch andere ersetzt war. Kopfschüttelnd überflog ich die neue Liste. Amor vincit omnia, stand in Blanches schwungvoller Mädchenschrift darüber.
»Das ist unser neues Programm«, verkündete sie und umarmte mich.
»Bei allen Geistern, Blanche«, wand ich mich, »viele dieser Nummern haben wir noch nie hinbekommen! Wieso hast du ihm nicht gleich den indischen Seiltrick verkauft?«
Sie legte die Stirn in Falten, als schmolle sie. Der indische Seiltrick endete traditionell mit der Verstümmelung der Assistentin, und es gab sehr geteilte Auffassungen darüber, ob es überhaupt möglich war, ihn mehr als einmal aufzuführen.
»Vertrau deinen Fähigkeiten, Ravi«, redete sie mir zu. »Wir schaffen das, wenn wir uns Mühe geben. Die Liebe besiegt alle Hindernisse!«
Ich seufzte. Meine Fähigkeiten waren nicht das Problem. Das Problem war, den Leuten einen Trick zu verkaufen. Keine echte Magie. Blanche wusste das sehr gut, doch Menschen das Unmögliche glauben zu machen, ohne das Unmögliche zu vollbringen, war genau das, was sie an unserem Beruf so liebte. Ich wäre ohne sie völlig hilflos gewesen.
»Wir müssen sofort die Liste durchgehen«, entschied ich, und so machten wir uns an die Arbeit.
Die kleineren Wünsche Philberts waren leicht zu berücksichtigen. Blanche kürzte ihr Kleid an den entscheidenden Stellen, und die Show wurde noch mehr zu ihrer als meiner. Mir machte das nichts; der Zauberer sollte auf der Bühne Ruhe ausstrahlen, so dass man ihm im entscheidenden Moment vertraut, und je mehr Aufmerksamkeit auf seiner Assistentin liegt, um so besser. Wir bekamen ein kleines Orchester – ein Streichquartett, ein Schlagzeug, der Ablenkung zuliebe, und eine Klarinette für die Schlange – sowie einige Bühnenarbeiter, die sich um die komplexen Lichteffekte kümmerten. Die Arbeiter unterschrieben alle einen Vertrag, dass sie kein Wort über das verlieren durften, was sie hinter dem Vorhang erlebten. Dasselbe galt für die beiden ägyptischen Tänzerinnen, die wir für den letzten Auftritt benötigten und die natürlich nicht aus Ägypten stammten. Mir behagte das Ganze nicht; ich hatte nie mit anderen Assistenten als mit Blanche gearbeitet. Aber für Romeo und Julia im Land der Pharaonen waren sie unabdingbar. »Wer sonst sollte dich in dein Grab sperren, wenn ich nicht mehr bin?«, witzelte Blanche. Ich persönlich hielt die Nummer für eigensinnig und gefährlich.
Ich liebe die leisen Töne der Bühnenmagie. Ich habe jahrelang den Trick mit den sich verhakenden Ringen geübt, bis niemand mehr den Moment sah, in dem sie ineinander glitten. Ich habe ein gutes Händchen für Mentalistenstücke – die richtige Karte aus einem Stapel zu ziehen, oder mir den Inhalt eines Zettels aus dem Publikum zu merken, während ich so tue, als lese ich den vorherigen vor; mit dem richtigen Tempo, der richtigen Musik und der richtigen Assistentin können Sie die Aufmerksamkeit des Publikums für Stunden fesseln, und Sie brauchen kaum mehr als einen Hut und ein wenig Spielzeug dafür. Es ist faszinierend, wie selten Menschen an das Offensichtliche denken; sie freuen sich, drei Seiten eines Kastens solide zu wissen, und fragen gar nicht erst nach der vierten, die immer von ihnen abgewandt ist. Menschen können sich vorstellen, dass ein Magnet an einem Gummiband im Ärmel hängt, aber nicht, dass dieses Band wiederum von einem unsichtbaren Faden am Finger des Zauberers betätigt wird. Und sie schwören Stein und Bein, dass Sie sie nie berührt haben, keine zwei Minuten, nachdem Sie ihnen bei der Begrüßung beiläufig die Hand gaben.
Philbert aber wollte nur die lauten Töne – je schriller, desto besser. Die Männer, die sich überlegten, ob sie ihren Lohn nicht eher für einen Abend im Jockey mit Kiki oder eine Zechtour am Carrefour Vavin sparen sollten, wollten Blanche und mich von Speeren und Schwertern durchbohrt sehen, sie wollten Flammen und Blitze, Elefanten und Strauße, und zehn nackte Tänzerinnen dazu; und Philbert wollte ihr Geld, und zwar mehr als alles andere.
Also übten wir.
Wir nutzten die Möglichkeiten, die das Bobino uns bot, und ersetzten den alten Schwebetrick, bei dem Blanche unter wehenden Tüchern verschwand, durch die eindrucksvollere Variante, bei der Gesicht und Füße unbedeckt blieben und sie nicht von mir, sondern einer Mechanik hinter dem Vorhang in die Luft gehoben wurde. Blanche mochte diesen Trick wegen des Märchenkleides, das sie dazu trug und das sie wie die schlafende Prinzessin Perraults aussehen ließ, und ich freute mich, mein Geschick mit dem Reifen unter Beweis stellen zu können. Eine Hebebühne kann jeder betätigen; es aber so aussehen zu lassen, als kreise ein Reifen um eine schwebende Frau, erfordert etwas mehr Geschick.
Die Hypnotisierte steigt empor und wieder herunter, dann lässt der Prinz von dem Spiel ab, küsst sein Dornröschen, und sie erwacht.
Das Publikum nahm Philberts Änderungen dankbar auf, und mit den Einnahmen stieg seine Stimmung. Wir für unseren Teil versuchten, die Not zur Tugend zu machen, und Philberts Liebe zum Kitsch eine Reise durch die Zeitalter als Thema zur Seite zu stellen. Blanche huschte nach fast jedem Trick hinter die Bühne, um sich umzuziehen, und ich unterhielt die Menge mit kleineren Kunststücken, bis ich wieder die Rolle eines Barrikadenstürmers der Julirevolution, eines Höflings des Sonnenkönigs oder eines römischen Tribuns annahm, um ein weiteres Kapitel aus der großen Geschichte zu erzählen, wie zwei Menschen gegen alle Widerstände zusammenfinden.
Mein Lieblingsstück ist das des verzweifelten Malers, der auf einer leeren Bühne ein sehnsuchtsvolles Portrait seiner Liebsten aus dem Gedächtnis malt, während das Streichquartett mit ihm klagt, bis die Angebetete wie aus dem Nichts durch die Leinwand bricht und ihn in die Arme schließt.
Blanches Geschicklichkeit kommt ihr auch als Opfer des finsteren Kerkermeisters zugute, wenn ich Metallplatten durch sie gleiten lasse und bald ihren Kopf zur einen, die Hüfte zur anderen Seite verschiebe. Dieser Trick wird immer gut aufgenommen, weil er eigentlich keiner ist und alles vor den Augen des Publikums geschieht, das nur nicht glauben mag, was es doch sieht.
So lief es also Tag für Tag, und selbst die unsägliche Land-der-Pharaonen-Nummer klappte entgegen meiner Befürchtungen sechs Mal in Folge. Sechs Mal standen wir im Licht der Kohlebogenlampen und verneigten uns, und sechs Mal konnte ich fühlen, wie Blanches Herz ihr vor Freude bis zum Hals schlug, während Philberts Männer die Begleiterscheinungen dessen, was wir angerichtet hatten, zusammenfegten. Und sie so zu sehen – Blanche, nicht die Arbeiter –, ließ mich alle Zweifel, die ich hatte, vergessen.
Dann kam der siebte Abend. Der Sonntag, die Abschlussvorstellung. Und mit ihm das ganze Missgeschick.
Romeo und Julia im Land der Pharaonen entstand eines Mittags im Café de la Rotonde, als wir verzweifelt nach einem Ersatz für die Schneewittchennummer suchten, mit der wir uns in Montmartre unsere Sporen verdient hatten und der Blanche ihren Bühnennamen, Blanche-Neige, schuldete. Damals hatten wir einen gläsernen Sarg für sie gehabt, und einen Zwerg als Totengräber obendrein, und ich hatte einen klassischen Entfesselungstrick vorgeführt, um sie zu retten. Das Ganze war vor allem ein Märchen gewesen, ein Schauspiel. Philbert aber wollte den Zeitdruck, den Nervenkitzel; der Zwerg war entgegen seiner Beteuerungen nicht mehr auffindbar, und so hatten wir mit unserem alten Grundsatz gebrochen, keinen Trick aufzuführen, der einen von uns jemals in Lebensgefahr bringen könnte. Blanches Sarg wurde zu einem metallverstärkten Sarkophag umgebaut, der mittels eines reichlich spektakulären Tanksystems mit Sand gefüllt werden konnte. Mir selbst baute man ein Gegenstück, das jedoch einen entscheidenden Unterschied aufwies: Es hatte eine aufklappbare Rückwand (deshalb durfte das Publikum auch ihren Sarkophag untersuchen, nicht aber meinen). Lassen Sie mich zunächst erklären, wie der Trick im Idealfall funktioniert:
Blanche wird nach einer kurzen Umbaupause von zwei Sklavinnen auf die Bühne geschoben. Sie ist eine ägyptische Prinzessin, die sich augenscheinlich das Leben nahm, und nur die fast völlige Nacktheit der beiden Sklavinnen lenkt davon ab, dass sie selbst so gut wie keine Kleidung trägt, dafür reichlich Glitzer und nilblauen Lidschatten. Dass sie trotz allem mit ihrem weißblonden Haar in etwa so ägyptisch wie die Schneekönigin persönlich aussieht, hat noch nie jemanden gestört. Zur Linken und zur Rechten der Bühne drohen die beiden aufrechtstehenden Sarkophage, so tödlich und strahlend wie stahlgefasste Bernsteintropfen.
Ich betrete die Bühne als Prinz, wozu ich meinen blauen Umhang zugunsten eines albernen ärmellosen Hemdes ablege, das mit allerlei Anch-Kreuzen und Sonnenemblemen bestickt ist. Wie Blanche bin ich barfuß und trage weite, geschlitzte Beinkleider – so sieht das Publikum den Menschen in mir und kein geheimnisvolles Wesen mit Ärmeln voller Gurte und Hosen voller Verstecke (außerdem müssen wir uns danach nicht den Sand aus den Schuhen schütteln). Ich entdecke meine vermeintlich tote Liebste, und nach einem kurz gehaltenen dramatischen Akt (ich bin kein allzu guter Darsteller großer Emotionen) bereite ich mich auf meinen eigenen Tod vor. Eine der Sklavinnen reicht mir den Tonkrug mit Cleo, unserer zahmen Python, und ich spiele zu den östlichen Weisen des Klarinettisten, als ließe ich mich beißen, und stelle mich in meinen Glassarkophag, worauf mich die Sklavinnen unnötigerweise festbinden (das Publikum erwartet das einfach), den Deckel schließen und sich entfernen.
Das Licht changiert, Blanche erwacht. Sie findet ihren Prinzen reglos und verfällt in Trauer. Blanche weigert sich, mit Cleo zu arbeiten – die beiden sprechen einfach nicht dieselbe Sprache –, dafür ist ihre schauspielerische Leistung um so überzeugender, wenn sie sich an mein Gefängnis schmiegt und mir Lebewohl sagt. Ihr Tanz vor den Fenstern des Tanks gibt mir Gelegenheit, mich unauffällig meiner Fesseln zu entledigen. Danach wirft sie sich stolz in Pose, betätigt den Hebel, der den Sand hinabrieseln lässt, zieht eine weiße Leinenrolle von der Decke und geht davon. Die Leinenrolle wirkt wie ein Leichentuch; gleichzeitig gehen Scheinwerfer hinter mir an, und man sieht nur noch meinen Schatten auf dem Tuch und den Schatten des Sands, der sich zu meinen Füßen sammelt und langsam, aber stetig steigt.
Der Moment, in dem sich das Tuch senkt und das Schlagzeug einen kurzen Tusch spielt, ist aber auch der Moment, in dem ich den Tank mit einem knappen Schritt durch die Rückwand verlasse und mich hinter ihn stelle, damit es im nächsten Augenblick, wenn der Scheinwerfer erstrahlt, auf der Leinwand so aussieht, als wäre ich noch gefangen. Alles, die Größe des Tanks, die gläsernen Wände, die Entfernung der Lichtquelle, der Einsatz der Musiker, die Klappe in der Rückwand, ist so sorgfältig aufeinander abgestimmt, dass die Illusion völlig glaubhaft wirkt. Sechs Tage hatte ich nur ein paar Handvoll Sand in die Haare bekommen und hinter dem Kasten posiert, bis wir zum Finale den toten Prinz wieder erwachen ließen, um dem Paar und dem Publikum sein Happy End zu bescheren – et amor vincit omnia.
Am siebten Tag aber ließ sich die Rückwand nicht öffnen.
Ich war für einen Moment einfach verdutzt und trat ein weiteres Mal auf den kleinen Fußschalter, der den zweiflügeligen Rücken des Tanks nach hinten aufschnappen lassen sollte (wir brauchten diese Sperre, damit die Wand nicht von selbst unter dem Druck des Sands aufschwang). Das war recht gefährlich, denn mir blieb nicht viel Zeit – abermals passierte nichts, und dann war es endgültig zu spät, der Tusch war gespielt, der Scheinwerfer ging an, das Publikum sah, wie es sein sollte, meine Silhouette, und Blanche war schon auf dem Weg zum anderen Sarkophag auf der gegenüberliegenden Seite der Bühne.
Ich aber war noch gefangen, und der Sand rieselte stetig.
Ich war mir nicht sicher, ob Blanche den Fehler bemerkt hatte, denn meine Besorgnis störte meine sonst so feinen Sinne. Vielleicht waren auch ihre Gedanken in Aufruhr. Wenn sie sich an den Zeitplan hielt, betrat sie soeben den anderen Sarg – der, wie mir und sicher auch ihr schmerzlich bewusst war, keine aufklappbare Rückwand besaß –, um sich lebendig mit ihrem Liebsten begraben zu lassen. Die Sklavinnen schlossen den Deckel und legten den Hebel um. Der Sand begann in Blanches Tank zu strömen, als der in meinem mir schon zu den Hüften reichte. Dann wurde auch über sie ein Tuch gezogen, und Scheinwerfer malten ihre Umrisse darauf.
Ich hatte zwar die Arme frei, durfte sie aber noch nicht bewegen, um mich nicht zu verraten. Selbst wenn der Schalter noch funktionieren würde, hätte ich mittlerweile ernste Probleme, meine Beine aus der steigenden Flut zu ziehen. Fieberhaft suchte ich nach einem Ausweg. Von fern hörte ich das Spiel des Orchesters, das sich dramatisch zum Erwachen des Prinzens vorarbeitete – zu langsam für mich, denn der Sand stieg schneller, als wir für einen leeren Tank berechnet hatten. Ich war zum Abwarten verdammt.
Noch hatte niemand die Nummer abgebrochen. Die Tänzerinnen standen abseits, hinter dem Vorhang, und von Philbert, dem großen Meister in Frack und Zylinder, erhaschte ich nur einen Schatten; wahrscheinlich kaute er wie immer auf seiner Zigarre und hatte entweder den Fehler nicht bemerkt oder schwitzte wie wir Blut und Wasser. Oder er hielt alles für einen guten Witz und amüsierte sich königlich.
Da fasste ich den Entschluss, die Regeln zu brechen.
Keine echte Magie.
Das war immer Teil unseres Kodex gewesen; der oberste Leitsatz der verborgenen Welt. Ebenso, wie gewöhnliche Varietékünstler ihre Geheimnisse hüteten, hütete die Société die ihren. Sich auf eine Bühne zu stellen und bloß so zu tun, als zaubere man, musste aber ihren zynischen Sinn für Humor getroffen haben, denn bislang hatte man uns nicht behelligt. Uns war immer bewusst gewesen, dass dieses Leben vorbei sein würde, sobald wir die Regeln missachteten. Die Augen und Ohren der Société waren überall, und die Anwendung großer Magie war wie ein Leuchtfeuer für ihre Agenten. Sie sahen es am Horizont blitzen, rochen es wie den Rauch eines Waldbrands, oder spürten es in ihren Träumen.
Ich wartete angespannt und bereitete mich vor. Alles musste wie ein Teil der Nummer aussehen. Auf keinen Fall durften die Leute von ihren Stühlen springen und davonlaufen – das wäre das Ende für uns, nicht nur in beruflicher Hinsicht.
Als das Orchester eine neue Tonlage anschlug, bewegte ich, für alle deutlich zu sehen, meinen Arm. Der Sand reichte mir nun bis zur Brust. In Blanches Kabine musste er in etwa ihre Taille erreicht haben. Ich tat, als wäre ich noch benommen, käme erst allmählich zu mir, dann begann ich, mir die Fesseln, derer ich mich in Wahrheit schon lange entledigt hatte, von den Handgelenken zu streifen. All das geschah für das Publikum; die Zuschauer sollten nie sicher sein, ob sie Zeuge eines gespielten oder echten Befreiungsversuchs wurden. Der Schatten auf der Leinwand bekam die Hände frei und reckte sie hilfesuchend nach oben, als der Sand schon sein Kinn erreichte. Ich schloss Mund und Augen und wartete darauf, dass sie bedeckt sein würden. Nur eine Hand des Prinzen regte sich noch und zuckte flehentlich umher. Dann wurde auch sie von Dunkelheit geschluckt. Das Publikum, das konnte ich spüren, hielt den Atem an.
Ich verließ die Kabine.
Es war eigenartig, dieser Moment, in dem ich vor aller Augen die Naturgesetze außer Kraft setzte, selbst wenn die Menschen nicht begriffen, was gerade geschah. Ich hoffte inbrünstig, dass niemand mich bemerkte, wie ich in den Schatten hinter Blanches Sarkophag aus dem Nichts erschien und mich auf den Boden kauerte. Woran ich nicht gedacht hatte, war, dass der Sand in meinem Tank über dem plötzlich entstandenen Hohlraum zusammensackte und das Publikum es auf der Leinwand deutlich mitansehen konnte. Unruhe breitete sich aus.
Als mein Blick sich klärte, schaute ich in die verdutzten Augen eines Bühnenarbeiters, der sich, wie ich, hinter einigen strategisch platzierten Kulissen versteckt hielt. Hatte er mich gesehen? Oder vielmehr, hatte er nicht gesehen, wie ich, in der geschickten Manier eines Einbrechers, von Schatten zu Schatten gehuscht war, wie ich es die Abende zuvor getan hatte? Keine Zeit, darüber nachzudenken, denn nun lief ein aufgeregtes Gemurmel durch die Ränge. Ich bedeutete dem Arbeiter, zurück an seine Arbeit zu gehen, denn jeden Moment musste der vereinbarte Blitzeffekt kommen. Er zögerte kurz, gehorchte dann aber. Es blitzte, und das weiße Tuch vor Blanches Tank schnellte an seiner Rolle empor.
Im Publikum brach beinahe Panik aus, als offensichtlich wurde, dass Blanche sich immer noch in ihrem Gefängnis befand. Die Überraschung war kalkuliert, doch heute drohten die Emotionen der Gäste unserer Kontrolle zu entgleiten; viele fühlten, dass etwas nicht stimmte, fast so deutlich, wie ich nun Blanches Angst fühlen konnte. Der Sand hatte ihren Hals erreicht – wir hatten keine Zeit mehr zu verlieren.
Ein weiterer Blitz, ich verließ mein Versteck, präsentierte mich kurz dem aufjubelnden Publikum und packte dann den Hebel an Blanches Sarkophag, der den Deckel an der Vorderseite aufstemmte. Ein Berg glitzernden Sandes ergoss sich auf die Bühne. Blanche machte einen Schritt und hob die Arme; ich reichte ihr die Hand, damit sie heraussteigen konnte. Die Geigen jauchzten, und wir fielen uns in die Arme.
Das Publikum erhob sich und applaudierte – die meisten wenigstens. Einige Gestalten aber standen auf und verließen den Saal. Wir verneigten uns, der Vorhang fiel, und bevor er sich wieder öffnete, hatte man uns ein paar Handtücher und etwas zum Anziehen gebracht. Die Bühnenarbeiter warfen uns finstere Blicke zu, denn der Sand, der überall an mir klebte (daran war nur die Bühnenschminke schuld), sprach Bände. Keine Zeit, der Vorhang öffnete sich abermals, das Licht ging an, wir dankten, dankten, einige Blumensträuße wurden Blanche zu Füßen geworfen, und wir lächelten und dankten abermals. Philbert kam auf die Bühne, eine Tänzerin an jedem Arm, und applaudierte uns zu, mit einem Gesicht, das nur schwach seinen Ärger verbarg.
»Mesdames et Messieurs, La Blanche-Neige und der unvergleichliche Monsieur Ravi!« Dann fiel der Vorhang ein letztes Mal, und es war vorbei. Philbert starrte uns kopfschüttelnd an. Draußen wurde ein Klavier auf die Bühne geschoben, und die Band stimmte einen Ragtime an.
Wir verabschiedeten uns rasch und taumelten in meine Garderobe, wo Blanche zitternd auf ihren Stuhl niedersank und uns im Spiegel betrachtete.
»Was ist geschehen, Ravi?«
»Der Schalter hat nicht funktioniert. Jemand muss ihn beschädigt haben, oder ein Riemen hat sich gelöst.«
»Du warst im Sarkophag gefangen?«
Ich nickte, und sie umschlang meine Taille. »Oh Ravi! Wenn ich mir vorstelle, wie du in dem Sarg eingesperrt warst!«
Ich strich ihr beruhigend übers Haar. »Ich habe mir nur Sorgen um dich gemacht.«
Sie blickte auf und lächelte zu mir empor. »Das ist süß von dir. Ich wusste, dass du kommen würdest – ich hatte keinen Moment Angst.«
»Es tut mir nur leid, dass es so lange gedauert hat.«
»Die Vorstellung musste zu Ende geführt werden«, pflichtete sie bei. »Du hast alles genau richtig gemacht.«
»Houdini hätte auch nicht abgebrochen«, sagte ich, und sie lachte.
»Hat Philbert etwas gemerkt?«
»Einer seiner Leute vielleicht. Und ein paar Gäste im Publikum – die üblichen, Kinder und alte Frauen. Doch das wird nicht unser größtes Problem sein.«
»Ach, Ravi.« Sie schmiegte sich an mich.
»Man wird bemerkt haben, dass ich einen … Schritt zu weit gemacht habe. Eigentlich sollten wir nun in unseren Särgen gefangen sein, mit Sand in den Lungen – doch wir sind hier, und wohlauf.«
»Das ist Magie«, lächelte sie. »Der Große Ravi und Blanche-Neige sterben nicht so schnell.«
»Die Société wird kommen und Fragen stellen. Vielleicht werden sie uns verbieten, weiterzumachen.«
»Lass sie nur kommen«, sagte sie trotzig. Dann drehte sie sich von mir weg und suchte etwas in dem Korb, in dem sie ihre persönliche Habe aufbewahrte.
»Ravi?« Sie klang auf einmal sehr ernst. Ich spürte, dass sie etwas im Schilde führte. Als sie gefunden hatte, was sie suchte, und sich wieder umdrehte, hielt sie einen herbstfarbenen Apfel in der Hand. Er sah aus wie einer von denen, die wir in unserer Herberge, dem Jardin, bekamen – aber ich hatte ein ungutes Gefühl bei der Art, wie sie mich ansah.
Dann dämmerte es mir. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte.
»Du erinnerst dich an unser Versprechen?«, fragte sie.
»Natürlich. Wie könnte ich es jemals vergessen?«
»Der Zeitpunkt ist gekommen. Ich halte meinen Teil.« Sie biss in den Apfel, kaute und schluckte, nahm aber keinen Moment die Augen von mir. Dann reichte sie ihn an mich weiter.
»Dies will ich dir geben«, sagte sie. »Nimmst du es an?«
»Das ist große Magie, Blanche«, zögerte ich. »Vielleicht die stärkste Magie, die es gibt.«
»Es ist mein Wille.«
»Man wird uns das auf gar keinen Fall durchgehen lassen.«
»Hab Vertrauen, Ravi! Was geschehen ist, ist geschehen – das hier macht alles wett.«
»Das tut es in der Tat«, nickte ich. »Aber Blanche … bist du dir sicher? Hier und jetzt?«
»Hier und jetzt«, bekräftigte sie. »Glaub mir, ich habe lange darüber nachgedacht. Ich habe Jahre für diesen Moment gearbeitet.«
»Und wann wusstest du, dass es soweit ist?«
»Das ist egal«, lächelte sie. »Worauf es ankommt, ist, ich bin bereit. Bist du es auch?«
Ich nickte und streckte die Hand nach dem Apfel aus. Was blieb mir anderes, als zu gehorchen? In ihren Augen war nichts als Freude. Freude, am Leben zu sein, Freude über diesen Moment, und die Vorfreude auf alle Momente, die noch kommen sollten.
»Nimm den Apfel von mir, Ravi. Iss.«
Ich vergaß meine Zweifel. Dies war der Augenblick, auf den ich so lange gewartet hatte. Ich führte den Apfel zum Mund und biss hinein. Er schmeckte wie ein gewöhnlicher Apfel.
Doch gleichzeitig konnte ich sehen, wie ihre Lider schwer wurden – der Zauber begann schon zu wirken.
Ein warmes Gefühl breitete sich in mir aus.
Blanche sank in meine Arme.
»Ravi …«
Ich hob sie empor und blickte sie an. Sie hatte wieder dieses Lächeln, wie ein Kätzchen, das in die Sonne blinzelt und sich auf dem Boden ausstreckt. Ihr Haar hatte sich in meinen Armen verfangen. Ich erhaschte einen Blick auf uns im Spiegel; in meinem halbbekleideten Zustand sah ich aus wie ein wahnsinniger Inkapriester.
Sie hatte unser beider Schicksal in meine Hände gelegt. Nun lag es an mir.
Ich werde schlafen.
Bring mich zurück ins Jardin, Ravi.
Morgen wecke mich mit einem Kuss. Hörst du?
Wenn ich erwache, fängt ein neues Leben für uns an – und was für ein Leben das sein wird!
Mit diesen Worten fiel sie in Schlaf.
Justine
Bevor Monsieur Ravi im Jardin abstieg, hatte ich mich noch nie mit einem Zauberkünstler unterhalten. Ich habe normalerweise nicht mit solchen Leuten zu tun. Nicht, weil es mich oder gar meine Eltern geängstigt hätte. Wenig von dem, was ich die letzten beiden Jahre am Carrefour Vavin erlebt hatte, war geeignet, es auf den Postkarten zu erwähnen, die ich Weihnachten und Ostern und an Geburtstagen nach Hause schrieb. Auch nicht, weil Alphonse etwas dagegen gehabt hätte; wenn es nach Alphonse ginge, würde ich ohnehin kein Wort mit den Gästen wechseln, außer: Bonjour Monsieur, wie geht es Ihnen heute? Und: Kann ich Ihnen helfen, Madame?
Nein, das Problem mit Zauberern (oder überhaupt den ganzen Künstlern) ist, dass sie nicht in derselben Welt leben wie wir. Sie haben nicht unsere Sorgen und unsere Träume. Sie machen sich den ganzen Tag Gedanken darüber, wie sie uns unterhalten, täuschen und über den Tisch ziehen können. Ein paar schaffen es gelegentlich, einen für ein paar Momente vergessen zu machen, dass man nichts im Magen und keinen Centime in der Tasche hat, und das ist eine Gabe, die mir ein wenig unheimlich ist, obwohl ich sie natürlich auch bewundere. Aber man sollte nicht den Fehler machen, sich ihnen anzuvertrauen. Im Endeffekt könnten die meisten von ihnen kein Omelette zubereiten, wenn ihr Leben davon abhinge.
Oder nehmen Sie die Sache mit den Äpfeln.
Ich bringe die Äpfel jeden Morgen, wenn ich die Zimmer mache. Alphonse lässt sie mich verteilen, weil das seinem Sinn von Gastlichkeit entspricht. Er schert sich nicht viel um die Nöte der Leute, die unter seinem Dach schlafen. Aber ein Apfel zum Start in den Tag, eine kleine Aufmerksamkeit auf einem gemachten Bett, das muss sein. Den Kaffee und die Croissants sollen sich die Gäste schon selbst holen; außerdem will Esmée nicht, dass auf den Zimmern etwas verkleckert wird. Das ist genau die Art von Überlegenheit, die sie braucht: Ich kann den Lachs filetieren und die Tageseinnahmen wegbringen, aber sie traut mir nicht zu, eine Kaffeekanne auf die Zimmer zu tragen, ohne etwas zu verschütten. Mischa sagt, es geht ihr nur darum, dass ich nichts mache, was sie nicht selbst tun könnte. Ich mache mich ja nicht gern über die Schwächen anderer Leute lustig, aber in diesem Fall hat er vielleicht sogar recht.
Ich trug also den Korb mit den Äpfeln nach oben, ganz wie jeden Tag: die kleine, steile Treppe hoch, auf der es immer zu dunkel war und die knarrte wie morsche Schiffsplanken. Dann den engen Korridor entlang, in dem Esmées kostbarer Teppich lag, der noch aus dem vorigen Jahrhundert stammte und aufgeschwemmt und an den Rändern weich war und in der Mitte ausgetreten; hinüber zu dem kleinen Verschlag mit der Bettwäsche. Es passte nicht viel Mobiliar in diesen Flur außer einem Schirmständer, einem winzigen Schränkchen, das Esmée von ihrer Mutter und diese schon von ihrer eigenen geerbt hatte, und der alten Standuhr, die sie in den Winkel neben dem Wäscheschacht verbannt hatte und die fast bis an die Decke stieß, so dass es aussah, als müsse sie sich bücken.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!