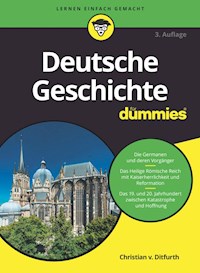4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Stell dir vor, es ist Diktatur – und alle machen mit: der Polit-Roman »Die Mauer steht am Rhein« von Christian v. Ditfurth jetzt als eBook bei dotbooks. Natürlich sind wir Demokraten. Natürlich sind wir sicher, dass wir für unsere Freiheit Widerstand leisten würden. Aber was passiert, wenn es tatsächlich so weit kommt? – Endlich wächst zusammen, was zusammengehört: Unter Federführung der DDR entsteht ab 1989 die »Demokratische Republik Deutschland«. Viele West-Politiker wechseln mühelos die Fronten, die Medien rollen den Machthabern den roten Teppich aus. Und das Volk? Arrangiert sich mit den neuen Gesetzen. Auch Arthur Becker ist sicher, sein Leben halbwegs normal weiterführen zu können. Doch dann gerät der Journalist wegen einer Reportage in das Fadenkreuz der Staatsmacht – und erlebt, wie die »schöne neue Welt« zum Albtraum wird … »Eine atemberaubende Lektüre.« Die Zeit Jetzt als eBook kaufen und genießen: In »Die Mauer steht am Rhein – Deutschland nach dem Sieg des Sozialismus« verwebt Christian v. Ditfurth Fakten und Fiktion zu einem hochspannenden alternativen Geschichtsroman wie dem internationalen Bestseller »Vaterland« von Robert Harris – jetzt mit einem Nachwort des Autors. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
Natürlich sind wir Demokraten. Natürlich sind wir sicher, dass wir für unsere Freiheit Widerstand leisten würden. Aber was passiert, wenn es tatsächlich so weit kommt? – Endlich wächst zusammen, was zusammengehört: Unter Federführung der DDR entsteht ab 1989 die »Demokratische Republik Deutschland«. Viele West-Politiker wechseln mühelos die Fronten, die Medien rollen den Machthabern den roten Teppich aus. Und das Volk? Arrangiert sich mit den neuen Gesetzen. Auch Arthur Becker ist sicher, sein Leben halbwegs normal weiterführen zu können. Doch dann gerät der Journalist wegen einer Reportage in das Fadenkreuz der Staatsmacht – und erlebt, wie die »schöne neue Welt« zum Albtraum wird …
»Eine atemberaubende Lektüre.« Die Zeit
Über den Autor:
Christian v. Ditfurth, Jahrgang 1953, ist Historiker, Lektor, Journalist und Autor. Seine Romane handeln von der deutschen Geschichte – teilweise mit einem alternativen Verlauf.
Bei dotbooks erschienen bereits seine Romane »Der 21. Juli«, »Der Consul« und »Das Rosa-Luxemburg-Komplott«.
Die Website des Autors: www.cditfurth.de
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2021
Copyright © der Originalausgabe 1999 by Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Copyright © der mit einem Nachwort versehenen Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, Memmingen, unter Verwendung verschiedener Bildmotive von Shutterstock/Sharkshock und Shutterstock/Musicheart7
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-873-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Mauer steht am Rhein« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Christian v. Ditfurth
Die Mauer steht am Rhein
Deutschland nach dem Sieg des SozialismusRoman
dotbooks.
Für Gisela
Prolog
Glücklich, wer’s in Zürich aushält. Heute bin ich über den Utoquai zur Bellerivestrasse spaziert, strahlender Sonnenschein, links vorn, leicht ansteigend, der Riesbach, knapp 500 Meter hoch, rechts der Zürichsee, blau mit weißen Tupfen – Segelboote, Ausflugsschiffe. Gestern hatte ich die andere Route genommen, bin von der Nordspitze des Sees zum Belvoir-Park gelaufen, habe dort auf einer Bank dem munteren Treiben zugesehen: spielende Kinder, turtelnde Pärchen, alte Menschen auf der Flucht vor der Einsamkeit. Am Strandbad Geschrei, wildes Treiben, Gespritze, weit draußen ein Schwimmer mit blau-weißer Badekappe, der mit kräftigen Zügen das Wasser teilt. Hoffentlich überfährt ihn nicht ein unvorsichtiger Segler. Hier ist es immer wärmer, als es die Breitengrade eigentlich zulassen. 1963, vor 36 Jahren also, ist der See das letzte Mal zugefroren, hat man mir erzählt. Ich stelle mir Schlittschuhläufer vor, die den See wiegenden Schritts vom Mythenquai zum Zürichhorn überqueren. Ob ich das noch einmal erlebe? Wann kommt der nächste Eiswinter? Wo werde ich dann sein? In Deutschland? Kaum.
In der Stadt strotzt es vor Reichtum. Viel davon verdankt sie der Haupterwerbstätigkeit der Zürcher, dem Geldvermehren. Ein wenig aber auch »seinen« Flüchtlingen, Menschen, die Krieg und Unterdrückung in die ewig friedliche Schweiz trieben, viele davon nach Zürich. Richard Wagner und Georg Büchner waren hier, der große deutsche Baumeister Gottfried Semper schuf Mitte des vergangenen Jahrhunderts das Polytechnikum, das später als Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Albert Einstein aufnehmen sollte. Zürich war in der Zeit des Sozialistengesetzes das Zentrum der sozialdemokratischen Emigration. Julius Motteier, der »rote Feldpostmeister«, fand immer Wege, den »Sozialdemokrat«, das illegale Parteiblatt, über die deutsche Grenze zu schmuggeln. Heute wäre das ein selbstmörderisches Unterfangen.
Lenin war verschiedentlich in Zürich. Von hier aus durchquerte er 1917 in einem plombierten Eisenbahnwaggon mit Genehmigung von Hindenburgs Oberster Heeresleitung Deutschland, um in Rußland seine »Aprilthesen« zu verkünden: Die Bolschewiki wollten mit friedlichen Mitteln an die Macht. Was aus dieser Absicht wurde, wissen wir. Und auch, was dem Putsch in Petrograd im Oktober folgen sollte. Ein Schlüsseldatum der Weltgeschichte, in den folgenden Jahrzehnten kamen Millionen von Menschen um oder wurden eingesperrt. Wie viele Menschen mögen noch in den Isolierungslagern der Demokratischen Republik Deutschland (DRD) sitzen, obwohl die Aprilkrise, der Aufstand von 1993, schon sechs Jahre zurückliegt?
Nur eine vergleichsweise kleine Minderheit konnte sich vor Tod oder Haft durch Flucht retten. So wie ich. Insofern hatte ich Glück. Oder ich hatte besser vorausgesehen, was kommen würde. Vielleicht aber war ich einfach nur ängstlicher als die meisten Mitmenschen. Nur gab dieses Mal die Wirklichkeit meiner Angst recht.
Aber warum klage ich? Es geht mir besser als vielen jener knapp 40000 deutschen Emigranten in Zürich und auch besser als jenen 300 000 Frauen, Männern und Kindern, die seit 1989 in die Schweiz geströmt sind. Ich lebe nicht nur von der kärglichen Flüchtlingsunterstützung und bin auch nicht ohne Arbeit, sondern kann immerhin manchmal einen Artikel in einer schweizerischen oder österreichischen Zeitung unterbringen, und für diesen Bericht habe ich sogar einen Verlag gefunden.
Inzwischen gelingt es nur noch wenigen Wagemutigen, das neue Deutschland zu verlassen. Die meisten Flüchtlinge werden von den deutschen Grenzsoldaten ergriffen. Jedes Jahr sterben zig Menschen unter den Schüssen der Grenzposten oder im Splitterhagel der Minen und Selbstschußanlagen. Man hört auch immer wieder von Leuten, die an der Schweizer Grenze abgewiesen und nach Deutschland zurückgeschickt werden. Aber darüber findet man kein Wort in den deutschen Zeitungen, auch nicht in den schweizerischen. Es scheint fast so, als gäbe es ein stillschweigendes Einvernehmen zwischen den Deutschen und den Schweizern, die Lage an der Grenze nicht eskalieren zu lassen. Überhaupt halten sich die Politiker und Medien hier zurück. Kaum ein schlechtes Wort über den Nachbarn. Statt dessen immer wieder Verständnis und der Verweis darauf, daß Konfrontation die Reformkräfte in Deutschland nur schwächen würde. Erst wenn die Deutschen das Gefühl bekämen, sie wären respektierte, gleichberechtigte Nachbarn, könne sich der Sozialismus reformieren, behaupten einige Schweizer Politexperten. Viele wollen das glauben, aber diese Hoffnung ist auch ein Ergebnis der massiven Kritik der Berliner Regierung an den Eidgenossen, die nach deutscher Auffassung ihre Grenze zu lange als »Schweizer Käse« betrachtet hatten, wie die »Frankfurter Allgemeine Zeitung« hämisch kommentierte: zu viele Löcher für zu viele Menschen. Von einer »böswilligen Einmischung in die inneren Angelegenheiten des souveränen Deutschlands« hatte DRD-Ministerpräsident Karsten D. Voigt gesprochen, und das klang in manchen Schweizer Ohren wie das Rasseln von dreißig Panzerregimentern. Voigt beklagte sich vor allem über die deutschen Flüchtlingsvereinigungen in der Schweiz, die sich mühten, Kontakte nach drüben aufzubauen und Menschen bei der Flucht zu helfen. Tunnel waren gebaut worden, und Fesselballons waren nachts über die Grenze geschwebt, bis deutsche Grenzsoldaten einige mit Maschinengewehrsalven heruntergeholt hatten.
Aber inzwischen ist die Entspannung weit fortgeschritten. Sieht man ab von wenigen »unerfreulichen Zwischenfällen an der gemeinsamen Grenze«, so die Regierung in Bern, gibt es keine Streitpunkte mehr zwischen Deutschland und der Schweiz. Außer uns Emigranten. Über uns zanken sich mehr und mehr auch die Schweizer. Wir kosten Geld, auch wenn man meinen sollte, davon gäbe es hier genug. Wir sind der Grund für Ärger mit der deutschen Regierung, die mit Penetranz von Bern fordert, den »friedensfeindlichen Sumpf trockenzulegen«. Ohne uns würden die Geschäfte mit dem mächtigen Nachbarn besser laufen, behaupten einige, ohne aber Beweise anführen zu können. Außerdem nähmen wir Schweizern Arbeitsplätze weg. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis Gruppen, nicht nur aus dem rechten politischen Lager, einen Volksentscheid erzwingen darüber, ob wir hierbleiben dürfen oder gehen müssen. Und wenn wir gehen müssen, wohin?
Hier in Zürich lebe ich zwar in der Fremde, fühle ich mich eingeschnürt und abgelehnt von vielen Einheimischen, aber die Menschen sprechen Deutsch, wenn es auch oft schwer verständlich ist. Bei aller geschäftstüchtigen Selbstbeschränkung-Zeitungen, Radio und Fernsehen berichten immerhin aus Deutschland, und wer zwischen den Zeilen lesen kann, entdeckt aufschlußreiche Facetten der deutschen Wirklichkeit. Natürlich lese ich jeden Montag den »Spiegel« und bewundere es fast, mit welch ausgefeilter Rabulistik das Blatt die Kurve kriegte. Fast so elegant wie die »Zeit«, aber unterhaltsamer. Ex-»Spiegel«-Herausgeber Rudolf Augstein sitzt irgendwo im Tessin, und der neue, jugendliche Chefredakteur, Günter Quirl, zeigt Biß, wenn auch mit begrenztem Feindbild. Soviel Lob über die Regierung hat man im Hamburger Magazin nie zuvor gelesen – alles im Zeichen der »Verantwortung für den Frieden«. Um so heftiger drischt das Blatt auf uns ein. Gerade diesen Montag wurde der »Emigrantenmafia in der Schweiz« mal wieder nachgewiesen, daß sie sich auf Kosten der braven Eidgenossen ihren fruchtlosen Intrigen gegen das neue Deutschland widme, wenn sie nicht gerade Skandälchen hervorbringe. In Österreich und anderen westeuropäischen Ländern sei es nicht besser. Und dann stand da als ein Beweis für diese Unterstellung Süffisantes über Helmut Kohl und seine einstige Bürovorsteherin Juliane Weber, die beide in Österreich, am Wolfgangsee, leben, während Hannelore Kohl in Oggersheim geblieben ist. »Ich und meine Kinder, wir sind und bleiben Deutsche und kehren unserem Vaterland auch in schweren Zeiten nicht den Rücken«, zitiert der »Spiegel« die Gattin des Ex-Kanzlers.
Die meist weniger geschickten Beschimpfungen und Lügen der großen und der kleinen Blätter aus Deutschland, der Radio- und TV-Sender schmerzen mich kaum noch. Aber immer wieder bitter ist es, die »Rheinische Post« zu lesen. Es gibt sie im Zeitschriftenladen im Hauptbahnhof. Bei der »Rheinischen Post« in Düsseldorf habe ich bis zu meiner Flucht im Frühjahr 1996 gearbeitet. Ich war keine der berühmten Edelfedern, die sich heute, wenn sie nicht emigriert sind, für die durchsichtigen Schmeicheleien von ZK-Sekretär Peter Boenisch mit gefälligen Artikeln bedanken. Ich war Sportredakteur und erfreute mich des Respekts meiner Kollegen, sofern sie mich denn wahrnahmen. Ich war einer jener fleißigen und zuverlässigen Schreiberlinge, ohne die eine Zeitung nicht funktioniert. Ich war austauschbar, aber warum hätte man mich austauschen sollen? Ich wußte eine Menge über Fußball, Reiten oder Leichtathletik, und meine Berichte kamen an. Das zeigten jedenfalls hin und wieder Leserbriefe.
Für Politik hatte ich mich damals kaum mehr interessiert als Otto Normalverbraucher. Lange hatte ich geglaubt, mich mit den neuen Umständen arrangieren zu können. Natürlich paßte mir die deutsche Vereinigung nicht, jedenfalls nicht so, wie sie durchgeführt wurde. Sicher, ich hatte den Diskussionen der Kollegen in der politischen Redaktion zugehört, von denen einige die Zukunft in schwärzesten Farben malten. Aber hatte nicht unser Chefredakteur, Gerhart Gerstig, erklärt, es werde nichts so heiß gegessen, wie es gekocht werde? Hatte er nicht geraten, ruhig zu bleiben, die neue Regierung nicht zu provozieren und seine »Pflicht als Deutscher« zu tun?
Ich hatte in dem Glauben gelebt, daß mir sowieso nichts passieren könne. Auch in der »antimonopolistischen Demokratie« würde Sport getrieben und mußte es Leute geben, die darüber berichteten. In der Tat ließ mich der Betreuer des Informationsministeriums, einige nannten ihn Uhu, lange Zeit unbehelligt, länger jedenfalls als meine Kollegen von der Politik. Aber dann war auch ich an der Reihe.
Kapitel 1
Es ging los, als ich über das Endspiel der deutschen Fußballmeisterschaft am 23. Juli 1995 zwischen dem BFC Dynamo Berlin und dem FC Vorwärts Dortmund berichtete. Die Dortmunder hatten im Mai 1994 zu aller Überraschung erklärt, den Namen »Borussia« abzulegen, weil dieser an finsterste preußische Traditionen erinnere und dazu an den Wiener Kongreß 1814/15, auf dem die reaktionären Kräfte Europas Westfalen den Preußen zugeschlagen hätten. Dann kam noch die Sprache auf die Befreiungskriege, die man dialektisch vom reaktionären Preußentum trennen müsse, aber das habe ich nicht ganz verstanden, so, wie mein Begriffsvermögen mitunter aussetzt, wenn irgend etwas dialektisch begründet wird.
Wie dem auch sei, es war das Endspiel, in dem die Sieger der Westliga und der Ostliga aufeinandertrafen. Mit der Begründung, Reisekosten zu sparen, wurden die einstige DDR-Oberliga und die Bundesliga unter anderen Namen weitergeführt. In Wahrheit hatte ich es selbst miterlebt, wie Spiele zwischen ostdeutschen und westdeutschen Mannschaften zu politischen Demonstrationen der »Wessis« gegen die Vereinigung wurden, und manche »Ossis« hatten sich den Protesten gegen Partei und Regierung angeschlossen. Also blieben die Ligen getrennt. Der BFC Dynamo war all die Jahre Spitzenreiter im Osten, 1995 wurde Vorwärts Dortmund »Westmeister« mit einem Punkt Vorsprung vor dem FV 09 Weinheim, einem der großen Gewinner der »Befreiung des deutschen Fußballs vom Diktat des Profits«.
Das Spiel war merkwürdig. Obwohl die Dortmunder Mannschaft fast alle ihrer einstigen Profis verloren hatte – zwei von ihnen spielen in der Schweiz, die anderen in Frankreich, Belgien und Holland –, war sie haushoch überlegen. Wenn es mit rechten Dingen zugegangen wäre, hätten die Dortmunder 5:1 oder höher gewinnen müssen, aber sie verloren 0:1. Nationalstürmer Andreas Thom verwandelte in der 86. Minute einen Elfmeter, der nie hätte gegeben werden dürfen.
Ich durfte zum erstenmal über das Endspiel berichten. Eine große Ehre, die mir aber auch deshalb zugekommen war, weil viele meiner Kollegen die »RP« verlassen hatten. Ich war gewissermaßen übriggeblieben und galt schon deshalb als loyal. Das Spiel war in jeder Hinsicht denkwürdig. So viele Fehlentscheidungen eines Schiedsrichters waren mir noch nie untergekommen. Die Berliner waren einfach grottenschlecht, vielleicht hatten sie gerade einen Katastrophentag erwischt. Die Zuschauer im Berliner Olympiastadion waren trotzdem begeistert, aber die kamen fast alle aus den alten Bezirken, und auch die »Sportschau« im 1. Programm des Demokratischen Deutschen Fernsehens (DDF) berichtete offenbar von einer anderen Begegnung. Heribert Faßbender sabbelte nach seinem obligatorischen »Guten Abend, allerseits« von einer »überlegenen, erfolgsorientierten BFC-Spielkultur«, in der sich »dokumentiert, wie der Sport hierzulande unter Führung der Arbeiterpartei gedeiht«. Er hatte in seinem Filmbeitrag fast alle Dortmunder Torchancen herausgeschnitten und bemühte sich nach Kräften, die mehr als fragwürdige Elfmeterentscheidung des Magdeburger Schiedsrichters Bernd Eiermann gutzureden.
Das Spiel endete kurz vor Redaktionsschluß. Ich hackte die letzten Zeilen meines Artikels in den Robotron-Laptop – in Kollegenkreisen wegen seines rückenmordenden Gewichts auch als »Dresdener Klavier« bezeichnet – und schickte den Text per Fax nach Düsseldorf zur Redaktion. Niemand in der Redaktion, auch nicht der Uhu, schaute noch einmal darauf. Dazu war auch keine Zeit mehr, und Sport nahm man damals bei der »Rheinischen Post« noch nicht so ernst. Das sollte sich erst nach meinem Artikel ändern.
Als ich am nächsten Vormittag in der Redaktion auftauchte, fing mich der Pförtner ab, ich solle gleich zum Chefredakteur kommen. Seine Sekretärin erwartete mich mit unheilverkündendem Blick; unter diesem müssen vor der Einheit Kollegen erzittert sein, wenn sie angeblich zu freundlich über die sozialdemokratische Landesregierung geschrieben hatten. Ich mußte nicht warten, sondern wurde gleich zu Gerstig gerufen. Der empfing mich in seinem eichenvertäfelten Zimmer hinter einem mächtigen Jugendstilschreibtisch, an den Wänden rheinische Heimatmotive. Am Konferenztisch saß der Uhu, ein kleiner grauer Mann mit wachen Augen.
Der Kitsch im geräumigen Chefzimmer sollte wohl gemütlich wirken, aber gemütlich war es an diesem Tag nicht. Jedenfalls nicht für mich. Statt einer Begrüßung schmetterte Gerstig mir »Sie sind wohl wahnsinnig geworden!« entgegen, als ich die Tür gerade hinter mir geschlossen hatte. Vor ihm auf dem Schreibtisch lag die aktuelle Ausgabe der »Rheinischen Post«, die Seite mit meinem Artikel aufgeschlagen. »Fragwürdiger BFC-Sieg« lautete die Headline. Der gute Mann hatte einen hochroten Kopf und – Angst. Die schaute neben dem Zorn aus seinen Augen, aber das habe ich erst später begriffen. Ich sagte erst einmal gar nichts. Wie soll man auch sprechen, wenn einen eine Dampfwalze überrollt? Von der tobsuchtsähnlichen Tirade des Chefredakteurs sind mir nur wenige Details im Ohr geblieben: »illoyal zur neuen Regierung«, »feindlichen Einflüsterungen erlegen«, »Fußball ist mehr als Fußball«, »es geht um prinzipielle Fragen, ja, auch um den Weltfrieden«.
Beim Weltfrieden klickte etwas in meinem Gehirn, und ich wagte ein kurzes »Was hat denn der Weltfrieden …?«
Ich hätte nicht fragen sollen, denn nun wurde ich unter einer verbalen Sturmflut begraben: »Ach, das kapier’n Sie nicht?! Hätte ich mir denken können. Hat nur Bälle im Kopf, aber kein Hirn. Mann, Sie müßten doch wissen, wie wichtig der Fußball den Deutschen ist. Und wenn da Streit zwischen Ost und West aufkommt, ja, was glauben Sie denn, stärkt das die gerade errungene Einheit? Natürlich nicht! Und wenn unser Volk sich streitet, dann freut sich der Imperialismus. Und mehr noch. Wenn wir schwach werden, werden die stark. So einfach ist das. Und das wollen Sie nicht kapieren? Sind Sie zu dumm, sind Sie auf den Feind hereingefallen, oder wollen Sie einfach nur stänkern, Sie Miesmacher? Und noch etwas, damit Sie sehen, daß ich die Hoffnung bei Ihnen noch nicht ganz aufgegeben habe: Es sollte sich sogar schon bis zu Ihnen herumgesprochen haben, daß der BFC nicht irgendein Fußballverein ist. Sie wissen doch, die Leute im Politbüro und im Ministerrat, die sind genauso fußballbegeistert wie Sie und ich. Ist das nicht sympathisch? Und weil die in Berlin wohnen, sind sie BFC-Fans. Und wenn, sagen wir mal, der Genosse Krenz Ihren Artikel liest, ja, was wird er dann denken? Daß hier in der Redaktion die Einheitsbegeisterung überschäumt?«
Während ich über den Weltfrieden und die deutsche Einheit belehrt wurde, saß der Uhu schweigend am Konferenztisch. Er verzog keine Miene, sondern schaute mich nur fortwährend an. Er prüfte meine Reaktionen. Und, so glaubte ich zu spüren, er prüfte auch den Chefredakteur. War da noch etwas vom alten Zusammenhalt aus Vorwendezeiten? Ich hatte keinen Zweifel, am Ende würde nicht Gerstig, sondern der Uhu entscheiden, was aus mir würde. Ob ich mit einer Verwarnung wegkäme oder ob ich mich »in der Produktion bewähren« durfte. Wobei das mit der Produktion nicht wörtlich zu nehmen war. Ein Kollege aus der Lokalredaktion durfte sich als Friedhofsarbeiter bewähren. Nachdem ein Sarg mit einem Unfallopfer in die Grube gefallen war und sich geöffnet hatte, haute er nach Frankreich ab. Aber das war 1991, als die Grenzen noch nicht hermetisch geschlossen waren.
Es wurde weder eine Verwarnung noch die Bewährung in der Produktion. Ich wurde gefeuert. Ich könne von Glück sagen, nicht in einem Lager gelandet zu sein, flüsterte mir die Chefsekretärin zu, das hätte ich allein Gerstigs Mut zu verdanken. Der habe für mich gekämpft wie ein Löwe.
Nach meiner fristlosen Entlassung traf ich den Chefredakteur zufällig noch einmal, als ich am Rheinufer unter der Theodor-Heuss-Brücke spazierenging. Erst wollte Gerstig so tun, als erkenne er mich nicht. Aber dann hielt er doch an, auch wenn ich ihm ansah, wie peinlich ihm das Treffen war. Er schaute sich, während wir miteinander sprachen, auch fortwährend nach allen Seiten um wie eine Katze, die beim Fressen die Umgebung sichert. Ummalt vom Verkehrsgedröhn, das von der Brücke zu uns hinunterdrang, bemühte er die alten Zeiten, um mir zu erklären, daß ich zu meinem Schutz gefeuert worden sei. »Verstehen Sie das bitte, ich konnte Sie als langjährigen Kollegen doch nicht ins Messer laufen lassen. Was sollte ich tun, der Betreuer bestand darauf, daß Sie gehen müssen. Boenisch hat getobt: ›Der Artikel richtet sich nur vordergründig gegen den BFC, in Wahrheit ist er ein Anschlag auf die Einheitsregierung, auf alle nationalen Kräfte. Das hat mit Fußball nichts mehr zu tun.‹ Hätte ich Sie nicht entlassen, beim nächsten Vorfall wären Sie verhaftet worden. Und wissen Sie, was Sie mir noch eingebrockt haben? Kapluck höchstpersönlich hat mir einen Rüffel verpaßt. Im ZK hätten einige schon von feindlichen Positionern im Bezirk Essen-Düsseldorf gesprochen, und er, Kapluck, habe alle Mühe gehabt, die Gemüter zu beruhigen. Das habe ihm gerade noch gefehlt, die Westgenossen hätten es schwer genug im ZK.«
Manfred Kapluck, i. Sekretär der Bezirksleitung Essen-Düsseldorf, Mitglied des ZK der Sozialistischen Einheitspartei der Demokratischen Republik Deutschland (SEdDRD) und Abgeordneter des DRD-Volkstags, des gesamtdeutschen Parlaments, das war ein schweres Kaliber. Selbstbewußt, eitel, linientreu und gnadenlos. Wer ihm vor die Flinte kam, hatte nichts zu lachen. Denn Kaplucks Humor war so phantasievoll wie einseitig. Mit beißendem Spott stürzte er sich auf seine wehrlosen Gegner oder auf Leute, die er dafür hielt, und vergnügte sich daran, wie sich jene wanden, die seiner argumentativen Heimtücke ausgeliefert waren. Der Mann war gerade mal ein gutes Jahr Bezirkschef, aber diese Zeit hatte genügt, um die unglaublichsten Geschichten über ihn in Umlauf zu bringen. Vielleicht wollte er das auch, weil es in seinen Augen zur Aura eines kommunistischen Funktionärs in revolutionärer Zeit gehörte. Es war Revolution in Deutschland, wenigstens in seinem westlichen Teil, in dem die antimonopolistische Demokratie aufgebaut, die Macht des Großkapitals gebrochen wurde.
Auch wenn ich alles tat, um kein Mitleid mit Gerstig in mir aufkommen zu lassen, schwante mir, daß dieser Mann nur noch aus Angst bestand, Angst um sich, um seinen Job, um seine Familie. Er bemühte sich nach Kräften, mir klarzumachen, daß er mir ja eigentlich einen Gefallen getan hätte, mich klug »aus der Schußlinie gezogen« habe, aber er redete vor allem gegen die eigenen Zweifel an in der Hoffnung, sich von der Angst zu befreien, wenn er seine Zweifel besiegte.
Ich muß ziemlich ungläubig geguckt haben. Aber Gerstig war nicht davon abzubringen, daß ich ihm dankbar sein müsse. »Und außerdem, Sie werden schon sehen. Kopf hoch, Junge!« Dann schaute er sich noch einmal um und verschwand eiligen Schrittes in einem Auflauf blauhemdiger FDJler.
Vielleicht war Dankbarkeit nicht völlig unangebracht. Denn kurz nach meinem Rausschmiß klingelte es eines Morgens an meiner Tür. Ich wohnte im Erdgeschoß einer geräumigen, leicht vergammelten Altbauvilla im Stadtteil Oberkassel; schließlich hatte ich nicht schlecht verdient als Sportredakteur. Als ich im Bademantel öffnete, stand da eine ganz in Grau gekleidete ältere Dame, vornehm, mit weißen Haaren, Silberspange im Dutt, auf der Nase eine Brille mit schmalem Silberrand. Sie lächelte freundlich, übersah taktvoll meine nicht mehr ganz fabrikneue Morgenbekleidung und stellte sich vor als Mitarbeiterin des Bistums Essen, Frau Grützel. Sie komme von ihrer Kirchengemeinde an der Heiligen-Schutzengel-Kirche im Dekanat Essen-Stoppenberg. Sie habe gehört, daß ich meine Arbeit verloren hätte.
Ich war überrascht. Erst ein paar Stunden später begann ich zu ahnen, was dahintersteckte. In Vorwendezeiten hatte die »Rheinische Post« glänzende Beziehungen zu den beiden großen Landeskirchen. Kein Wort der Kritik war jemals in ihren Zeilen zu lesen gewesen. Aber nun, seit der Einheit, sah man weder Herausgeber noch Chefredakteur jemals eine Kirche betreten. Trotzdem schien die Verbindung nicht gänzlich abgerissen zu sein, und vielleicht fühlten sich die Kirchenleute ja auch noch ein bißchen in der Schuld der »RP«.
Frau Grützel gab gleich zu, sie kenne meinen Namen nicht, aber der Herr Pfarrer und auch Bedienstete im Dekanat seien sportbegeistert, sie hätten viele Artikel von mir gelesen und fänden es schade, daß ich nun keine mehr schreiben würde. Offenbar waren die frommen Sportfans keine Anhänger von Fortuna Düsseldorf, denn sonst hätten sie sich nicht so freundlich an meine Artikel erinnert.
Ich bat Frau Grützel herein, führte sie in die Küche, entschuldigte mich für den schlampigen Zustand meiner Wohnung, aber das überhörte sie und ignorierte auch die Gläser und schmutzigen Teller, die ich rasch vom Tisch räumte, um sie im Spülbecken verschwinden zu lassen. Gestern abend waren Johannes und Elvira hiergewesen, wir hatten wenig gegessen und viel getrunken, Wodka. Johannes und Elvira kannte ich vom gemeinsamen Germanistikstudium, sie waren die letzten Freunde, die mich besuchten seit meinem Rausschmiß. Von meinen Kollegen in der Redaktion hatte ich nichts mehr gehört und gesehen. Sonst telefonierte ich nur noch ab und zu mit meinem Bruder Willi. Er sah mir zwar verblüffend ähnlich, so daß viele uns für Zwillinge hielten. Aber innen drin waren wir ganz verschieden gestrickt. Willi war Funktionär der DKP gewesen, seit ihrer Verschmelzung mit SED und SPD arbeitete er für die Sozialistische Einheitspartei und war schon deshalb nicht mein Lieblingsgesprächspartner.
Frau Grützel strich ihren grauen Rock glatt und setzte sich auf den Stuhl, den ich ihr angeboten hatte. Sie trug im Gesicht ein feines Lächeln, und mit freundlicher, fast tonloser Stimme sagte sie: »Wissen Sie, wir können Ihnen leider keine Arbeit als Redakteur anbieten. Sie sind zwar Mitglied unserer Kirche, aber gesehen haben wir Sie bisher nie, weder im Gottesdienst noch bei einer unserer zahlreichen Veranstaltungen.«
»Woher wissen Sie das, Sie kommen doch aus Essen, wie Sie sagen?«
»Der Glaube kennt keine Grenzen. Natürlich haben wir mit unseren Freunden in Düsseldorf über Sie gesprochen. Und die kennen Sie leider nicht.«
Diese Feststellung schmerzte sie, jedenfalls verlor ihr Gesicht kurz das feine Lächeln, und sie schaute mich streng an. Aber Frau Grützel fing sich gleich wieder, und das feine Lächeln kehrte in ihr Gesicht zurück. »Sie verstehen, daß wir Ihnen schon deshalb keine größere Aufgabe im ›Frohen Boten‹ übertragen können – vielleicht kennen Sie ja unsere Bistumszeitung?« Ich bemühte mich um einen nichtssagenden Gesichtsausdruck. »Und außerdem wäre es unserem Herrn Bischof auch nicht recht, die Regierung zu verärgern. Die Herren in Berlin sind ja so sensibel. Unsere Kirche bemüht sich mit aller Kraft, ein Auskommen mit ihnen zu finden. Aber das ist manchmal schwer.« Sie schaute betrübt auf die Tischplatte. »Wir als Kirche sind ja für Ausgleich und Harmonie, Feindesliebe …« Frau Grützel schaute sich erschreckt um, als hätte sie sich bei etwas Furchtbarem ertappt. »Selbstverständlich sehen wir in den Regierenden keine Feinde. Sie verstehen?«
Ich verstand.
Frau Grützel bot mir an, freiberuflicher Korrektor des »Frohen Boten« zu werden. Das war, bei allem Respekt vor dem Korrektorberuf, nicht die Aufgabe, die ich mir ersehnt hatte. Aber eine andere würde ich kaum bekommen. Es war besser, als Arbeitslosengeld zu beziehen. Dieses Relikt aus kapitalistischer Zeit gab es noch, wenn auch die Sozialistische Einheitspartei auf ihrem letzten Parteitag angekündigt hatte, daß diese »Erblast des Imperialismus« mit seinen Grundlagen, nämlich der Macht der Monopole, mit dem ersten gesamtdeutschen Fünfjahrplan 1999 auf dem Müllhaufen der Geschichte landen würde.
Wie sich das kirchliche Streben nach Harmonie und Ausgleich gestaltete, sollte ich Buchstabe für Buchstabe erleben, als ich meinen neuen Job als Korrektor beim »Frohen Boten« antrat. Die Bezahlung war kläglich. Ich mußte mich daran gewöhnen, Fehler zu suchen, Wörter und Sätze also nicht instinktiv richtig zu lesen, sondern erst einmal für falsch zu halten. Ich war auf der Jagd nach Fehlern und triumphierte, wenn ich mal einen besonders gut versteckten fand. Glücklicherweise vergaß ich darüber manchmal, was ich las. Ich konnte mit frommen Worten noch nie etwas anfangen, und manche klangen so verquast und gedrechselt, daß gegen meinen Willen fast eine Art Bewunderung in mir aufkam angesichts dieser stilistischen Kunstfertigkeit. Ich hätte mich noch so mühen können, aber Theologendeutsch hätte ich nie hingekriegt.
Der Job war nervenaufreibend. Nicht wegen der Fehler, sondern weil ich den Inhalt der zu korrigierenden Texte doch nie ganz ignorieren konnte. Da war die Rede von der »Kirche im Sozialismus«, von der Vorbildrolle der Kirchen der ehemaligen DDR, die im streitbaren Einvernehmen mit dem Staat »zum Wohle aller Menschen« gewirkt hätten, von der Notwendigkeit, im Weltkirchenrat für den Weltfrieden einzutreten, von den »gemeinsamen geistigen Wurzeln von Christentum und Sozialismus« und von »kritischer Partnerschaft«. Der ehemalige evangelische Thüringer Landesbischof Moritz Mitzenheim wurde als Vorbild dargestellt, weil er sich in den fünfziger und sechziger Jahren »neuen Herausforderungen für seine Kirche« nicht verschlossen habe (das Ehrenmitglied der Block-CDU hatte, wie ich heute weiß, sein Kirchenamt mißbraucht, um Walter Ulbricht zu preisen). Selbstkritik wurde geübt, daß die Kirche sich in der Vorwendezeit zu oft und zu leichtfertig mit allzu weltlichen Kräften verbunden habe, mit dem Verweis auf Jesus, der die Händler aus der Kirche verjagte. »Wir haben in den sieben fetten Jahren zuwenig für die Armen und Entrechteten getan, die sieben mageren Jahre stehen unter dem Gebot von Verzicht und Solidarität. Das ist nur gerecht.«
Fast drei Monate arbeitete ich als Korrektor des »Frohen Boten«. Ich würde es wohl heute noch tun, wenn ich nicht einen kleinen Fehler übersehen hätte. Ich konnte einiges zu meiner Entschuldigung anführen und tat dies auch, aber ich konnte nicht abstreiten, daß der Fehler meine Jagd überlebt hatte. Es ging um die Weihnachtsausgabe 1995, genauer, um den Leitartikel des Bischofs. Ich hatte wenig geschlafen, weil Johannes vorbeigeschaut hatte. Er klagte über Ehestreit, Elvira wollte ein Kind – »die Regierung gewährt doch jetzt Müttern soviel Hilfe« –, Johannes wollte keines: »In solchen Zeiten kriegt man keine Kinder.« Ich war fast ein bißchen froh gewesen, daß ich es einmal nicht war, der jammerte, und schlüpfte gerne in die Rolle des überlegenen Richters. Und dies um so lieber, je mehr Wodka floß. Es war ein bißchen zuviel Wodka geflossen.
Am Morgen danach lagen in meinem Briefkasten die Fahnen der Weihnachtsausgabe des »Frohen Boten«. Dabei eine Notiz: »Bitte beeilen Sie sich, wir sind spät dran.« Es war schwer geworden, Drucktermine zu bekommen. Also kochte ich mir einen starken Kaffee und trug meinen benebelten Kopf zum Schreibtisch. Der Weihnachtsartikel des Bischofs war eine Qual, schlimmster Herz-Jesu-Kitsch über das »Fest der Brüderlichkeit«. Mein Verhängnis wartete in der vorletzten Zeile. Ich war froh, so gut wie fertig zu sein, und nahm quasi nur noch mit dem linken Auge zur Kenntnis, daß der Bischof im »Beschluß des Novemberplenums des ZK durchaus den Willen zur Verständigung aller am Wohle der Menschen interessierten Kräfte in unser aller Deutschland« erkannt haben wollte. Und er lobte die »fruchtbare Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen Kräfte im vergangenen Jahr«.
Ich verzierte auch die letzte Seite noch kunstvoll mit meiner Paraphe, packte die Fahnen in einen Umschlag, stieg auf mein Fahrrad und radelte zum »VEB Vorwärtsdruck« in der Düsseldorfer Innenstadt, wo der »Frohe Bote« hergestellt wurde. Die frische Novemberluft tat mir gut, und meine Laune stieg in dem Maß, wie mein Kater verblich. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, daß ich keinen Grund hatte, gut gelaunt zu sein. Aber das ging mir erst kurz vor Heiligabend auf.
Ich mache mir nicht viel aus Weihnachten. Als »Alleinlebender«, wie »Single« mittlerweile heißt, fehlen einem so ziemlich alle Gründe, einen Weihnachtsbaum zu kaufen oder Kerzen oder Engelfiguren oder das Krippenensemble. Hätte ich letzteres erstanden, wäre mir vielleicht mein tristes Dasein in Zürich erspart geblieben – obwohl es wahrscheinlich weniger trübselig ist, als heute in Deutschland zu leben. Ich hätte die Weisen aus dem Morgenland ja möglicherweise buchstäblich im Blick gehabt, als ich des Bischofs Leitartikel korrigierte. Der schrieb über »die Treue der sogenannten Heiligen Drei Könige im Glauben, was zeigt, daß man dem Herren gehorchen soll und nicht den verderblichen Einflüsterungen von Despoten«.
Was den Bischof dazu verleitet hatte, im fünfzigsten Jahr nach der in Deutschland bombastisch begangenen Niederlage des Naziregimes im Zweiten Weltkrieg die Weisen aus dem Morgenland zu strapazieren, weiß ich nicht. Aber er hatte unzweifelhaft versucht, ein biblisches Gleichnis zu finden für die Pflicht zum christlichen Widerstand gegen Hitler. Und er hatte sich damit eingelassen auf jenen antifaschistischen Impetus, der den Herrschenden als neudeutsche Sinnstiftung so sehr am Herzen lag. Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten mit den Kommunisten hatte der Bischof nicht zum erstenmal das »Erbe des Widerstandes gegen den braunen Ungeist« bemüht.
Man konnte ja über den Bischof sagen, was man wollte, bibelfest war er, und sein Gleichnis paßte gut. Herodes, Tetrarch von Judäa und großer Völkermörder seiner Zeit, hatte die Weisen aus dem Morgenland beauftragt, Jesus auszuspionieren. Aber die Weisen hatten sich angesichts des gerade geborenen Gottessohnes zum Widerstand gegen den Unhold besonnen und »zogen durch einen andern Weg wieder in ihr Land«. Daraufhin hatte Herodes alle Kinder in Bethlehem töten lassen, um auf jeden Fall das eine umzubringen, vor dem er sich schrecklich fürchtete. Glich dieser Wahn nicht jenem vermeintlich wahllosen Abschlachten, dem vor einem halben Jahrhundert zig Millionen Menschen zum Opfer fielen? Es war ein durch und durch antifaschistisches Gleichnis. Es lag ganz auf der Linie, die der Bischof seit einigen Jahren eingeschlagen hatte. Auch in seinem Leitartikel für die Weihnachtsausgabe des »Frohen Boten« bekundete er die Loyalität seiner Kirche, die »fruchtbare Partnerschaft«, wie sich die Annäherung verklausulierte.
Diese und viele andere Argumente brachte der Bischof vor, als ihn zu seiner Überraschung am Mittag vor Heiligabend 1995 Kapluck anrief. So erzählte es mir jedenfalls Jahre später in Zürich Raimund Ohnelang, damals persönlicher Referent des Bischofs, eines der Opfer der »Bethlehem-Krise«, wie der denkwürdige Vorfall bald in Kirchenkreisen genannt wurde. Ohnelang erweckt den Eindruck eines glaubwürdigen Zeugen, und so will ich seine Schilderung der Ereignisse hier wiedergeben.
Kapluck tobte am Telefon. Er schrie von einem »Anschlag auf das Verhältnis Staat – Kirche«, verlangte, daß der Bischof sich öffentlich distanziere vom eigenen Artikel – »Tun Sie Buße, Herr Bischof, tun Sie Buße. Das dürfte Ihnen als wahrem Christenmenschen doch nicht so schwerfallen.« Kapluck war bekannt als Kirchenhasser. Er verstand es, bissige Bemerkungen einzustreuen, sobald er über Kirche, Religion und Glauben sprach. Da waren der SED im Westen Genossen zugewachsen, die eben nicht all die Jahrzehnte das Parteilehrjahr durchlaufen hatten und auch nicht die Parteihochschule »Karl Marx« absolvieren konnten. In der Einheitspartei war immer mal wieder die Rede von den »westlichen Radikalinskis«, denen die »revolutionäre Geduld« fehle.
In der DDR hatte die SED jahrzehntelang gebraucht, um herauszufinden, daß die Kirche im Sozialismus nicht so schnell abstarb wie erwünscht und von Marx, Engels und Lenin vorhergesagt. Die Genossen lernten, daß brachiale Unterdrückung das Absterben nicht beschleunigte. So entschieden sich die Kommunisten, die Kirchen zu bearbeiten, sie durch Zuckerbrot und Peitsche Schritt für Schritt auf die eigene Seite zu ziehen, immer in der Hoffnung, daß die Kirche sich in dem Maß überflüssig machte, wie sie sich auf den Sozialismus einließ. In der DDR war man damit schon recht weit gekommen, und die Zahl der Gläubigen sank. In den neuen Bezirken aber standen die Einheitssozialisten noch ganz am Anfang, auch wenn die Kirchenoberen und manche an der Basis schon Zugeständnisse gemacht hatten. Erfreut nahm die SED zur Kenntnis, daß der auf einen Ausgleich mit Staat und Partei zielende Kurs der beiden großen Kirchen in der DDR allmählich auch im Westen Fuß faßte.
Aber noch gab es in vielen westlichen Landeskirchen, evangelischen wie katholischen, Widerstand gegen den »gottlosen Marxismus«, setzten sich vor allem Pfarrer für demokratische Freiheiten ein und ließen systemkritische Gruppen in Kirchenräumen tagen. Dafür brauchte es einigen Mut, denn seit der Einheit hatte die SED in den alten Bezirken immer wieder übel zugeschlagen. Der Berliner Pfarrer Rainer Eppelmann saß im Zuchthaus Bautzen, seine Bluesmessen und sonstigen »staatsfeindlichen Aktivitäten« hatten die SED schon lange genervt. Seit die SED auf Proteste in Westdeutschland keine Rücksicht mehr nehmen mußte, wurden die konsequentesten Oppositionellen im Osten in Gefängnisse und Zuchthäuser gesteckt.
Im Westen war es oft noch schlimmer. Wellen der Hysterie erfaßten die Staatspartei, wann immer sie Widerspenstiges erahnte. Auch wenn die Genossen nach außen hin pausenlos erklärten, die »übergroße Mehrheit des deutschen Volkes hat sich für Sozialismus und Frieden entschieden«, sie glaubten selbst nicht daran. Hinzu kam, daß die Westgenossen sich in Opposition geübt hatten und es nun lernen mußten, Macht auszuüben. Zwar saßen in Schlüsselpositionen Funktionäre aus dem Osten, aber der Versuch, sich eine gesamtdeutsche Legitimation zu geben, verlangte, daß Genossen aus dem Westen mitregierten. Bei aller Schulung waren viele einstige DKP-Funktionäre hypernervös. Sie wollten den Genossen aus dem Osten beweisen, daß sie den neuen Anforderungen gewachsen waren, sie wollten keine Fehler machen, und sie wollten die Macht nicht gefährden. Letzteres war zwar auf absehbare Zeit unmöglich, auch weil sowjetische Eliteeinheiten in die von Amerikanern, Engländern und Franzosen geräumten Kasernen eingerückt waren, aber die Kommunisten waren derart machtbesessen, daß sie auch Gefahren witterten, wo keine drohten. Und besonders argwöhnisch waren sie natürlich im Westen.
Aber das allein hätte nicht gereicht, um die »Bethlehem-Krise« auszulösen. Ich habe nicht herausfinden können, ob Kaplucks Kirchenhaß spontan ausbrach oder ob er einem Plan aus Berlin folgte. Ohnelang glaubt, daß die obersten Kirchenbearbeiter nur auf eine Gelegenheit gewartet hatten, um einmal kräftig die Peitsche zu schwingen. Wenn das stimmt, hatte ich einfach Pech.
Es half nichts, daß der Bischof beteuerte, erhalte die Regierenden nicht für Despoten und habe nicht zum Widerstand aufgerufen. Sein Gleichnis beziehe sich allein auf das Gebot des Widerstands gegen die braune Diktatur, dem die Kirche nicht in ausreichendem Maß gefolgt sei. Der Bischof äußerte sich verwundert über die Vorstellung, daß die Regierenden es überhaupt für möglich hielten, mit Despoten verwechselt zu werden. Und er beschwor die gute Zusammenarbeit zwischen Kirche und Staat, die »besonders im Rheinland schon erste Früchte« gezeitigt habe.
Es war aber alles umsonst, denn Kapluck konnte seine Thesen beweisen, und das verdankte er mir. Niemand konnte mir vorwerfen, daß ich vermeintlich Anstößiges in einem Artikel des Bischofs übersehen hätte. Wer war ich denn, daß ich es hätte wagen können, in theologische Auslassungen meines obersten Gebieters einzugreifen? Aber ich hatte einen Buchstabendreher nicht erkannt, der veränderte den Sinn eines Satzes, und das reichte. Denn im »Frohen Boten« stand nicht »fruchtbare Zusammenarbeit aller gesellschaftlichen Kräfte im vergangenen Jahr«, sondern »furchtbare Zusammenarbeit«. Meinem katergetrübten Auge war entgangen, daß R und U in unerlaubter Weise ihren Platz getauscht hatten.
Kapluck weigerte sich, dies als einen Satzfehler anzuerkennen, und nahm das Adjektiv »furchtbar« als »eindeutigen Beleg dafür, daß sich das Gleichnis des Bischofs gegen die führende Partei richtet, ja, daß in diesem Artikel die Partei der Antifaschisten auf eine Stufe mit den Nazis gestellt wird. Und wenn Sie, Herr Bischof, das anders sehen, wenn Sie es so nicht gemeint haben, dann muß es Volksfeinde in Ihrem Bistum geben, die hinter Ihrem Rücken Partei und Staat unterminieren wollen. Das liegt in Ihrer Verantwortung. Sorgen Sie für Ordnung.«
Für Kapluck war es der lang gesuchte Grund, die Kirche in seinem Bezirk noch stärker zu schikanieren. »Das ist nicht mehr Widerstand zwischen den Zeilen, sondern eine konterrevolutionäre Plattform«, dröhnte er. Und da er die Existenz einer solchen Plattform behauptet hatte, gingen er und die Sicherheitsorgane nun daran, die Plattform zu finden. Sie brauchten nicht lange.
Zwei Buchstaben am falschen Platz zur falschen Zeit schufen ein staatsfeindliches Zentrum im Bistum Essen. Die Beteiligten wurden als »Glieder einer volksfeindlichen Verschwörung« und als »Agenten der NATO« beschimpft. Namen nannte die Partei aber nicht. Sie wollte es dem Bischof überlassen, sein Reich zu säubern.
Es war ein Lehrstück in marxistisch-leninistischer Taktik. In den Zeitung war häufig die Rede davon gewesen, man müsse »differenzieren zwischen denen, die der Volksmacht feindlich gegenüberstehen, und jenen, die irregeleitet wurden und Volksfeinden auf den Leim gegangen sind«. In der »Bethlehem-Krise« hieß das, daß die Partei es dem Bischof nahelegte, sich als Opfer einer Intrige zu fühlen, die volksfeindliche Kräfte in seinem Bistum ausgeheckt hätten. Die »Agenten des konterrevolutionären Stützpunkts im Bistum Essen«, wie die »Rheinische Post« zu berichten wußte, hätten den Bischof hereingelegt, um die Kirche in ihre verfassungswidrigen Umtriebe gegen den antimonopolistischen Staat zu verwickeln. Und so wurde ich, der kleine Korrektor, zum Staatsfeind wider Willen und war, ohne es zu wissen, Mitglied einer »antidemokratischen Zusammenrottung«.
Das Trommelfeuer in den regionalen Medien dauerte drei Wochen. Dann begriff der Bischof, was von ihm verlangt wurde. Waren denn nicht immer wieder regierungskritische Töne im Bistum zu hören gewesen? Hatten diese Meckerer, die da von »gottloser Zeit« sprachen, nicht wirklich überzogen? Mußten sie denn unbedingt immer wieder den Staat provozieren? Hätten sie ihm statt dessen nicht helfen müssen, wo doch die Staatsmacht noch so verunsichert war, daß sie oft das rechte Maß nicht fand? Der Bischof war überzeugt davon, daß er seine Schäfchen nicht leichtfertig verlassen durfte. So nahm er die schwere Last auf sich, sich von den »Umtrieben, die nicht das Wohl des Ganzen im Sinne haben«, zu distanzieren. Er gab die Konterrevolutionäre zum Abschuß frei. Zwei Pfarrer, über die sich die Partei schon lange geärgert hatte, wurden in die Altenpflege versetzt. Ohnelang, der den Bischof mit seiner schlichten Geradlinigkeit nervte, wurde Helfer in der Armenfürsorge. Der Bischof mochte sich damit beruhigen, daß er diese und andere angebliche Staatsfeinde vor dem Gefängnis rettete, indem er sie aus der Schußlinie zog.
Darunter auch mich. Ende Januar stand Frau Grützel plötzlich wieder vor meiner Tür. Das feine Lächeln war ganz aus ihrem Gesicht verschwunden. Sie schaute mich traurig von der Seite an, als ich sie einließ. Sie müsse mir leider sagen, daß ich nicht mehr als Korrektor für den »Frohen Boten« arbeiten könne. »Wissen Sie«, sagte Frau Grützel, »unser Bischof hat immer das große Ganze im Auge. Sie verstehen?«
Ich verstand.
Offenbar aber hatte es sich der Bischof ausbedungen, daß die Sicherheitsorgane nicht oder wenigstens noch nicht Zugriffen. Und auch in der Presse war der »Stützpunkt des Klassenfeinds« plötzlich kein Thema mehr. Die Staatsmacht hatte mir und den anderen Protagonisten der »Bethlehem-Krise« eine Gnadenfrist eingeräumt. Aber was würde passieren, wenn sie eins und eins zusammenzählte und herausbekam, daß ich genau der Sportredakteurwar, der im Mittelpunkt des BFC-Skandals gestanden hatte? Oder wußten die Sicherheitsorgane das schon?
Ein paar Tage nach meiner zweiten Entlassung war ich abends bei Johannes und Elvira zu Besuch. Sie wohnten in der Kaiserswerther Straße im Düsseldorfer Norden, und ich fragte mich jedesmal, wenn ich bei ihnen war, wie sie den Verkehrslärm dieser Durchgangsstraße nahe eines Autobahnzubringers und das Gerumpel und Gequietsche der Straßenbahnlinie Messegelände – Hauptbahnhof aushielten.
Diesmal war ich wieder der Mann mit den Sorgen. Ich hatte auch nach meinem Rausschmiß bei der »Rheinischen Post« nie wirklich Angst gehabt um mich. So bitter es war, daß ich meinen Job verloren hatte, und so trostlos die Aussichten gewesen waren, einen neuen zu finden – erst jetzt kroch mir die Furcht mit Eiseskälte in die Glieder. Letzte Nacht hatte ich halb wach, halb im Schlaf vom Zuchthaus geträumt und von einer monströsen Gerichtsverhandlung mit mir als Angeklagtem. Im Halbschlaftraum sah ich mich seltsamerweise im Volksgerichtshof der Nazis, vorne hinter dem Richtertisch Roland Freisler, auf der Anklagebank neben mir der bulgarische Kominternfunktionär Georgi Dimitroff. Aber das lag gewiß nur an einem Dokumentarfilm, den ich gerade gesehen hatte, in dem der »heldenhafte Widerstand der Kommunisten und aller anderen Demokraten gegen die Hitler-Barbarei« gezeigt wird.