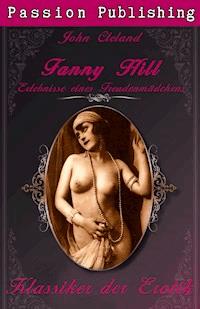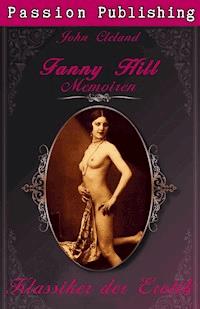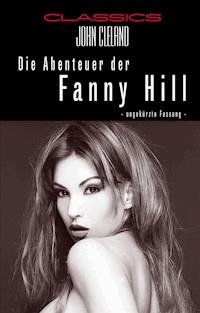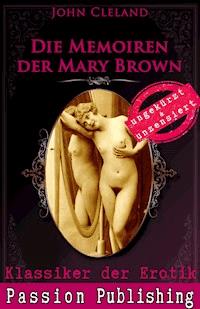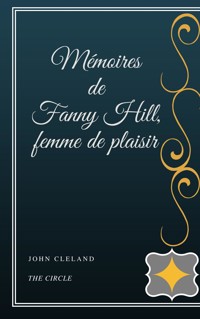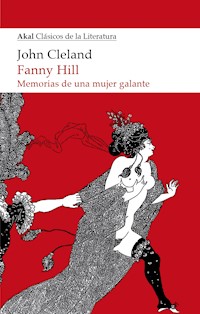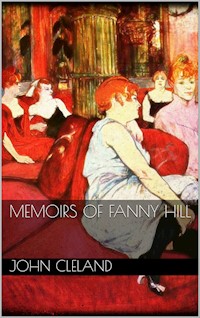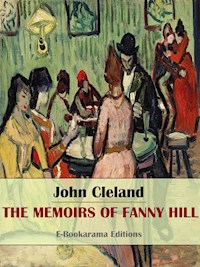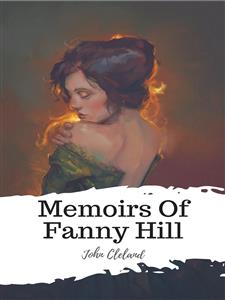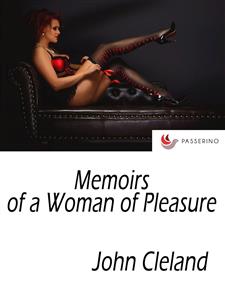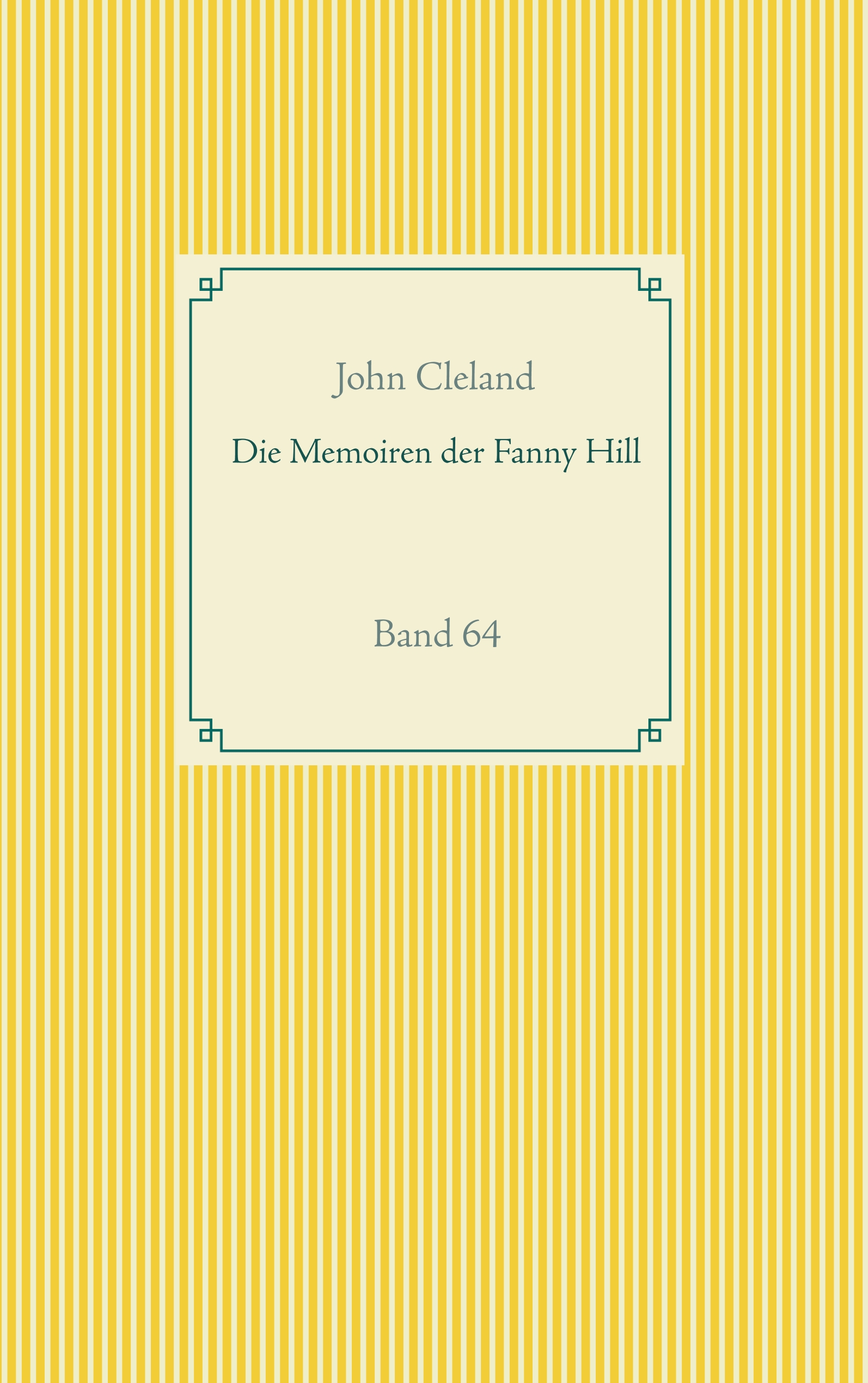
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Taschenbuch-Literatur-Klassiker
- Sprache: Deutsch
John Cleland veröffentlichte die Memoiren der Fanny Hilll unter dem englischen Titel Memoirs of a Woman of Pleasure als einen erotischen Briefroman in London im Jahr 1749. Das Werk löste - sagen wir mal so - Entrüstungsstürme und zahlreiche Irritationen aus. Die Veröffentlichung war lange Zeit verboten, ist es mancherorts bis heute.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
I. Brief
II. Brief
I. Brief
Meine liebe Freundin!
Um Dir einen Beweis zu geben, wie gern ich Dir gefällig bin, schreibe ich auf Deinen Wunsch diese Erinnerungen für Dich nieder. Und so peinlich die Aufgabe auch für mich ist, so betrachte ich es doch als meine Pflicht, Dir mit der grössten Aufrichtigkeit die wüsten Szenen eines ausschweifenden Lebens zu schildern, dem ich mich jetzt endlich glücklich entzogen habe, um das Glück zu gemessen, das Liebe Gesundheit und ein nettes Vermögen mir bieten. Du weisst ja übrigens, dass ich von Natur aus wirklich verdorben gewesen bin und dass ich selbst in den Stunden wildester Ausschweifung nie aufgehört habe, Betrachtungen über Sitten und Charakter der Männer anzustellen, Beobachtungen, die bei Personen meines Standes gewiss nicht eben häufig sind.
Aber da ich jede unnütze Vorrede hasse, will ich Dich nicht lange mit Einleitungen langweilen und Dich nun darauf aufmerksam machen, dass ich alle meine Abenteuer mit derselben Freiheit erzählen werde, mit der sie begangen sind. Nur die Wahrheit soll meine Feder leiten, ohne Furcht vor den Gesetzen einer »Anständigkeit«, die für so intime Freundinnen, wie wir beide sind, nicht existiert. Ausserdem kennst Du ja selbst die Freuden der sinnlichen Liebe zu genau, als dass ihre Schilderungen Dich erschrecken könnten. Und Du weisst ferner, wie viele Leute von Geist und Geschmack, Nuditäten aus ihren Salons verbannen, um sie – mit Vergnügen in ihren Privatgemächern aufzuhängen. – Nun aber zu meiner Geschichte.
Man nannte mich als Kind Francis Hill. Ich bin in einem Dörfchen bei Liverpool von armen Eltern geboren. Mein Vater, den Kränklichkeit an schweren Landarbeiten hinderte, gewann durch Garnmachen einen massigen Verdienst, den meine Mutter durch Halten einer kleinen Kinderschule im Dorfe nur wenig vermehrte. Sie hatten mehrere Kinder gehabt, von denen ich jedoch allein am Leben blieb.
Meine Erziehung war bis zu meinem vierzehnten Lebensjahr die denkbar einfachste. Lesen, stricken, kochen – das war alles was ich lernte. Was meinen Charakter angeht, so war sein Hauptmerkmal eine vollständige Reinheit und jene Furchtsamkeit unseres Geschlechtes, die wir gewöhnlich erst auf Kosten unserer Unschuld verlieren.
Meine gute Mutter war immer mit ihrer Schule und unserem Haushalt so beschäftigt, dass ihr wenig Zeit blieb, mich zu unterrichten. Übrigens kannte sie selbst das Böse auf der Welt zu wenig, um uns darin Lehren erteilen zu können.
Ich war eben in mein fünfzehntes Lebensjahr getreten, als meine teuren Eltern wenige Tage hintereinander an den Pocken starben. Durch ihr Ableben ward ich eine arme Waise ohne Hülfe und ohne Freunde; denn mein Vater, der in der Grafschaft Kent zu Hause war, hatte sich auf gutes Glück in meinem Geburtsort niedergelassen. Übrigens wurde auch ich von der ansteckenden Krankheit ergriffen, aber so leicht, dass nicht die geringste Spur sichtbar blieb. Ich gehe mit Stillschweigen über diesen herben Verlust hinweg. Die rasche Wandlungsfähigkeit der Jugend verwischte die traurigen Eindrücke dieser Zeit nur zu bald aus meinem Gedächtnis.
Eine junge Frau mit Namen Esther Davis, die um diese Zeit nach London, wo sie in Diensten stand, zurückkehren musste, schlug mir vor, mich zu begleiten und versprach mir, mir nach besten Kräften beim Aufsuchen einer Stellung behilflich zu sein.
Da niemand auf der Welt sich um meine Zukunft scherte, so nahm ich das Anerbieten dieses Weibes ohne Zögern an, entschlossen, mein Glück zu versuchen. Ich war entzückt von all den Wundern, die mir Esther Davis von London erzählte und brannte vor Begierde, ebenfalls die königliche Familie, das Mausoleum von Westminster, die Komödie, die Oper, kurz all die schönen Dinge, mit denen sie meine Neugierde reizte, zu sehen.
Aber das Interessanteste an ihren Geschichten war, dass so viele arme Landmädchen, allein durch ihre gute Führung, reich und angesehen geworden waren; dass viele tugendhafte Dienstmädchen ihre Herren heirateten und dann Pferd und Wagen hielten; dass manche sogar Herzoginnen geworden seien – kurz, dass das Glück alles könne und wir eben so gut darauf bauen müssten, wie andere.
Ermutigt durch so schöne Profezeiungen, machte ich eilends meine kleine Erbschaft zu Gelde. Der Erlös belief sich nach Abzug der Schulden und Begräbniskosten auf acht Guineen und siebzehn Shilling.
Dann packte ich meine sehr bescheidene Garderobe in eine Hufschachtel und wir fuhren mit der Postkutsche ab. Meine Führerin diente mir während der Fahrt als Mutter und liess sich dafür ihr Billett von mir bezahlen. Überhaupt verfügte sie über meine Börse, wie über ihr Eigentum.
Sobald wir angekommen waren, hielt mir Esther Davis, auf deren Hilfe ich so fest gerechnet hatte, folgende kurze Rede, die mich fast zu Stein erstarren liess:
»Gott sei Dank, wir haben eine gute Fahrt gehabt. Ich gehe jetzt schnell nach Hause; suche du dir nur so rasch als möglich einen Dienst. Ich rate dir, in ein Mietbureau zu gehen. Wenn ich was höre, werde ichs dir mitteilen. Einstweilen wirst der gut tun, dir irgendwo ein Zimmer zu nehmen. Ich wünsche dir viel Glück und hoffe, dass du immer brav bleiben und deinen Eitern keine Schande machen wirst.«
Nach diesen Ermahnungen grüsste sie kurz und ging einfach weg. Kaum war sie fort, als ich in bitterliche Tränen ausbrach. Das erleichterte mich etwas, konnte mich aber über mein Schicksal nicht beruhigen. Einer der Gasthauskellner machte mich noch verwirrter, indem er mich fragte ob ich etwas wünsche. Naiv antwortete ich »nein« und bat nur um eine Unterkunft für die Nacht. Die Wirtin erschien und sagte mir kühl, dass das Bett einen Shilling koste. Sobald ich Unterkunft hatte, schöpfte ich wieder etwas Mut und beschloss, gleich am nächsten Tage in das Mietbureau zu gehen, dessen Adresse mir Esther aufgeschrieben hatte.
Die Ungeduld brachte mich schon früh aus den Federn. Ich legte eiligst meine schönsten Dorfkleider an, übergab der Wirtin mein kleines Paket und begab mich stracks in das Bureau.
Eine alte Dame führte das Geschäft. Sie sass am Tisch vor einem riesigen Register, dass in alphabetischer Ordnung unzählige Adressen zu enthalten schien. Ich näherte mich der achtbaren Dame mit züchtig gesenkten Augen, wobei ich durch eine Menge Leute mich hindurchwinden musste, und machte ihr ein halbes Dutzend linkische Verbeugungen. Sie erteilte mir Audienz mit der ganzen Würde und dem Ernst eines Staatsministers und entschied nach einem prüfenden Blick und nachdem sie mir als Anzahlung einen Shilling abgenommen hatte, dass die Stellungen für Mädchen jetzt selten seien, dass ich offenbar für schwere Arbeit nicht zu brauchen sei, dass sie aber trotzdem nachsehen wolle, ob sich etwas für mich fände.
Zunächst aber müsse sie erst einige andere Kundinnen abfertigen. Ich verfügte mich traurig nach hinten, fast verzweifelt über die Antwort der Alten. Trotzdem liess ich zur Zerstreuung die Augen umherschweifen und bemerkte eine dicke Dame von ungefähr 50 Jahren in gutbürgerlicher Kleidung, die mich anstierte, als wolle sie mich verschlingen. Ich war zuerst etwas betroffen, aber die liebe Eitelkeit liess mich bald diese Aufmerksamkeit zu meinen Gunsten auslegen und ich richtete mich daher so sehr als möglich auf, um recht vorteilhaft zu erscheinen. Endlich, nach einer nochmaligen genauen Prüfung, näherte sich mir die Dame und fragte mich, ob ich einen Dienst suchte. Ich machte eine tiefe Verbeugung und antwortete »ja«. »Hm ...«, sagte sie, »ich suche ein Mädchen und glaube, dass Sie etwas für mich sind ... Ihr Gesicht bedarf keiner weiteren Empfehlung ... Jedenfalls, liebes Kind, sehen Sie sich vor ... London ist eine sündhafte Stadt ... Folgen Sie meinem Rat und meiden Sie schlechte Gesellschaft ...«
In diesem Tone fuhr sie noch eine gute Weile fort und ich war glücklich, eine anscheinend so ehrenwerte Herrin gefunden zu haben. Währenddessen lächelte mir die alte Vermittlerin so bedeutsam zu, dass ich törichterweise überzeugt war, sie gratuliere mir zu meinem Glück, während ich später erfuhr, dass die beiden Hexen alte Vertraute waren und Madame Brown, meine neue Herrin, ihren »Vorrat« oft aus diesem »Magazin« ergänzte. Die letztere war so zufrieden mit mir, dass sie aus Angst, ich könnte ihr entwischen, mich sofort in einen Wagen packte, mein Gepäck aus dem Gasthaus abholte und dann gradeswegs mit mir in ihr Haus fuhr. Das Äussere der neuen Heimat, der Geschmack und die Sauberkeit der Möbel bestätigten noch die gute Meinung, die ich von meiner Stellung hatte. Ich zweifelte nicht, dass ich in einem ausserordentlich anständigen Hause sei.
Sobald ich installiert war, sagte mir meine Herrin, dass es ihre Absicht sei, in familiäre Beziehungen zu mir zu treten. Sie habe mich weniger als Dienerin, denn als Gesellschafterin aufgenommen und werde mir eine wahre Mutter sein, wenn ich mich gut führe. Auf all das antwortete ich kindisch, mit vielen lächerlichen Verbeugungen:
»Ja – oh ja – gewiss – Ihre Dienerin, Madame.«
Darauf klingelte Madame und ein grosses ältliches Stubenmädchen erschien.
»Martha«, sagte Madame Brown, »ich habe dieses junge Mädchen aufgenommen, um für meine Wäsche zu sorgen; zeigen Sie ihr ihr Zimmer. Ich empfehle sie Ihn er ganz besonderen Sorgfalt, denn ihr Gesicht gefällt mir ganz ausnehmend.«
Martha, die eine schlaue und im Métier ungemein erfahrene Person war, begrüsste mich respektvoll und führte mich in den zweiten Stock, in ein Zimmer nach hinten hinaus. Dort stand ein sehr schönes Bett, das ich, wie sie mitteilte, mit einer Verwandten der Madame Brown teilen sollte. Darauf stimmte sie einen Lobgesang auf ihre teure Herrin an, der mir die Augen geöffnet haben würde, wenn ich auch nur die geringste Lebenserfahrung besessen hätte.
Man klingelte zum zweitenmal. Wir steigen wieder hinab und ich werde in ein Esszimmer geführt, wo die Tafel für drei gedeckt stand. Neben meiner Herrin sass jetzt die angebliche Verwandte, die das Hauswesen leitete.
Ihrer Sorgfalt war auch meine Erziehung anvertraut und zu diesem Zwecke sollte ich mit ihr schlafen. Von Seiten des Fräuleins Phoebe Ayres – so hiess meine Lehrerin – hatte ich eine neue genaue Prüfung zu bestehen und das Glück, auch ihr zu gefallen. Dann speiste ich zwischen den beiden Damen, deren Aufmerksamkeit und Liebenswürdigkeit mich entzückten.
Es wurde beschlossen, dass ich auf meinem Zimmer bleiben sollte, bis die meinem neuen Stande angemessenen Kleider fertig seien; aber dies war natürlich nur ein Vorwand. Madame Brown wollte, dass niemand mich sähe, bis sie einen Käufer für meine Jungfernschaft, von der sie überzeugt war, gefunden hätte.
Bis zum Abend ereignete sich nichts Bemerkenswertes. Als wir dann in unser gemeinsames Schlafzimmer gingen und Phoebe merkte, dass ich mich sehr genierte, mich in ihrer Gegenwart zu entkleiden, zog sie mir selbst in einem Augenblicke Brusttuch, Rock und Hosen aus. Dann schmiegte ich mich errötend und sehr geniert tief in die Kissen, wohin mir Phoebe sogleich folgte. Sie war ungefähr 25 Jahre alt, sah aber 10 Jahre älter aus. Ihr langer und angestrengter Dienst im Métier hatte sie vor der Zeit so gealtert.
Sie befand sich kaum an meiner Seite, als sie mich schon mit unglaublicher Glut in ihre Arme schloss. Ich fand dieses Benehmen ebenso neu wie komisch, schob es aber auf reine Freundschaftsregungen und gab ihr treuherzig Kuss um Kuss zurück.
Ermutigt durch diesen kleinen Erfolg, liess sie ihre Hände über die geheimsten Teile meines Körpers gleiten und ihre lüsternen Berührungen erregten und überraschten mich mehr, als dass sie mich ärgerten.
Die Schmeicheleien, mit denen sie sie begleitete, gewannen mich vollends. Da ich nichts Böses kannte, fürchtete ich auch nichts, noch dazu, da sie mir bewiesen hatte, dass sie Weib sei. Sie hatte mich nämlich zwei schlappe Brüste betasten lassen, die ihr bis auf den Bauch hingen und deren enorme Grösse vollkommen ausreichten, das Geschlecht zu kennzeichnen, namentlich für mich, die kein anderes kannte.
Ich hielt also geduldig still bei ihren Liebkosungen, die mich mehr und mehr aufzuregen begannen. Ein ganz neues Feuer brannte in meinen Adern. Mein Busen oder vielmehr die kleinen festen und glatten Hügel, die eben erst ihre Reife erlangten, zitterten heftig vor Erregung, als Phoebe ihre Hand der zarten Stelle näherte, die erst seit wenigen Monden ein seidiger Flaum zierte. Ihre Finger spielten mit den feinen Härchen und zogen sie liebkosend lang aus. Aber nicht zufrieden mit diesem Vorspiel, griff Phoebe bald den Hauptpunkt an, indem sie den Zeigefinger so tief wie möglich einführte, ein Verfahren, das mich ohne Zweifel hätte laut aufschreien lassen, wenn sie nicht mit so ausserordentlicher Vorsicht zu Werke gegangen wäre.
Die wollüstige Berührung hatte mich ungemein entflammt, und das Leben meines ganzen Körpers schien an dem einen Punkt zusammenzufliessen, dessen zarte Lippen sie bald zusammendrückte, bald auseinanderschob, immer mit einem Finger dazwischen, bis endlich ein tiefer Seufzer ihr anzeigte, dass der Höhepunkt erreicht war. Ich blieb regungslos in den Armen der Messaline liegen – in einer wundervollen Art von Erschöpfung, die ich gern auf ewig verlängert hätte.
»Ah«, rief sie mit einer glühenden Umarmung, »wie reizend du bist! Wie glücklich wird der Sterbliche sein, der dich zum Weib machen darf! Wie schade, dass ich nicht Mann bin!«
Ich war so verwirrt und aufgeregt, dass ich wahrscheinlich ohnmächtig geworden wäre, wenn nicht ein Tränenstrom meine Nerven ein wenig beruhigt hätte.
Die erfahrene Phoebe hatte allem Anscheine nach Geschmack an dieser Erziehung junger Mädchen gefunden.
Nicht gerade, dass sie Abscheu vor den Männern empfand, – aber sie hatte ein geradezu unersättliches Temperament und nahm daher alles, was ihr der Augenblick bot.
Jetzt schob sie plötzlich mit einem Ruck die Decke an das Fassende des Bettes und ich befand mich ganz nackt ihren gierigen Blicken ausgesetzt, da sie die Kerze brennen gelassen hatte. Ich wurde sehr rot, – aber ich gestehe, weniger aus Scham als aus Begierde.
»Nein, nein, mein Täubchen«, sagte sie, »du kannst mir soviel Schönheiten nicht entziehen! Ich muss meine Augen ebenso sättigen wie meine Begierden ... Lass mich diesen entzückenden, knospenden Busen mit den Augen verschlingen. – Lass mich ihn küssen – Himmel, welche wundervolle, weisse Haut! Welche Hüften ... Und dieser köstliche Haarflaum! Lass mich auch die reizende kleine Öffnung betrachten! Ah – ah, – das ist zu viel – du musst nun selbst – –«
Hier packte sie meine Hand und führte sie an einen Ort, den man sich denken kann! Aber ach, wie verschieden doch dieselbe Sache manchmal beschaffen ist! Ein harter dicker Bart bedeckte hier die weite Öffnung der gewaltigen Höhlung.