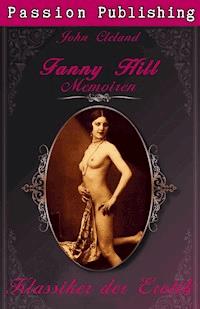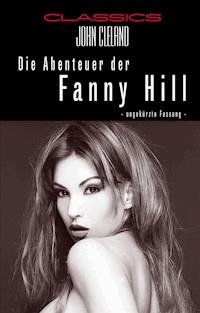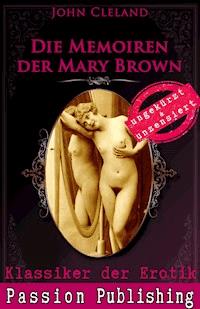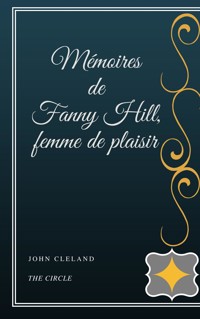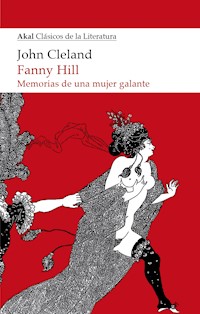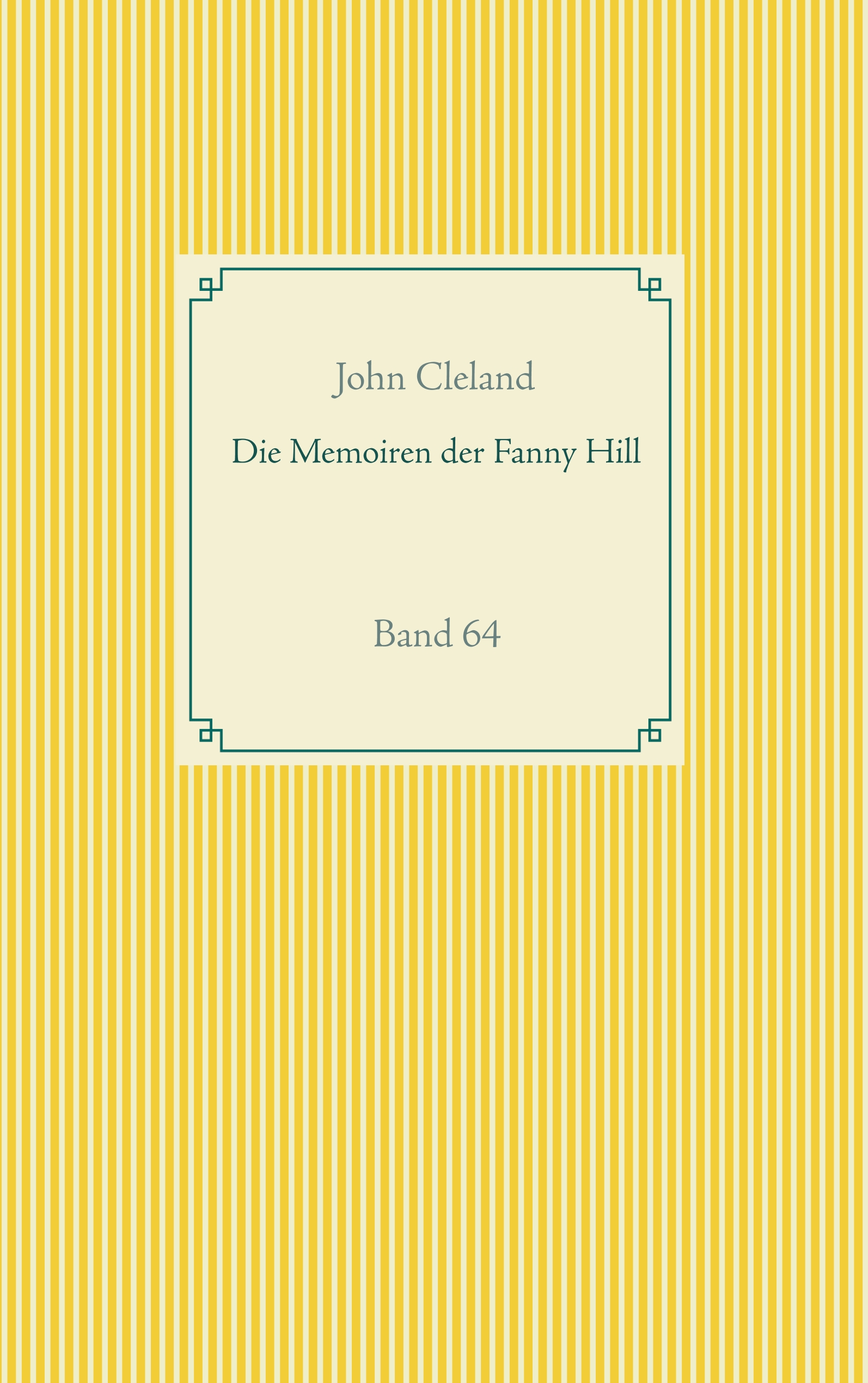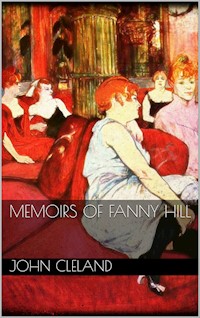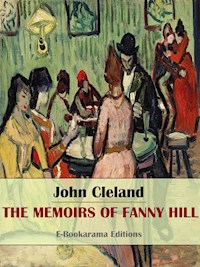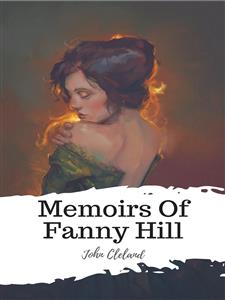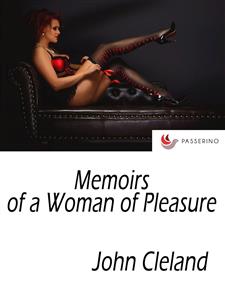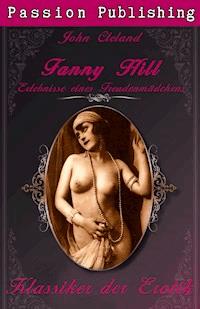
Klassiker der Erotik 32: Fanny Hill - Erlebnisse eines Freudenmädchens - Teil 1 E-Book
John Cleland
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Passion Publishing
- Kategorie: Erotik
- Serie: Klassiker der Erotik
- Sprache: Deutsch
Der skandalöseste Erotikroman des 18. Jahrhundert mit der beliebtesten Erotikprotagonistin der Weltliteratur! Fanny Hill kommt als 15-jähriges Waisenkind nach London und wird dort in einem Bordell aufgenommen. Sie schafft es ihrem Schicksal als Prostituierte zu entfliehen und wird von einem jungen Gentleman aus dem Bordell gerettet. Mit ihm lernt sie die wahre Liebe kennen. Als der junge Gentleman nach Übersee geschickt wird bleibt Fanny nichts anderes übrig, als Prostituierte zu werden, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Dabei lernt sie die Geheimnisse der Erotik kenne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
John Cleland
Fanny Hill
Erlebnisse eines Freudenmädchens Teil 1
Inhalt
Weitere e-books bei Passion Publishing
Madame,
ich möchte Ihren Wunsch als Befehl nehmen und Ihnen aus der Zeit meines Lebens berichten, die inzwischen vorbei ist, und an die ich mich naturgemäß nur ungern erinnere. Es war ein Leben, das vor der jetzigen Zeit lag, in der ich nun in Glück, Wohlstand, Zufriedenheit und Gesundheit lebe. Sie erwarten, daß ich Ihnen das berichte, wie ich als „Freudenmädchen“ mein Brot verdiente, auch wenn man mit Recht meinen darf, daß diese Bezeichnung für mich nicht unbedingt gelten mag. Dennoch habe ich, wie es eben bei Freudenmädchen üblich ist, mehr von der Welt und deren Wesen und Sitten erfahren, als dies sonst normalerweise zutrifft. Ich habe augenblicklich Muße genug, auf Grund meines durchaus respektablen Verstandes die Dinge so zu sehen, wie sie sind, während diese Mädchen stets meinen, daß jeder ernsthafte Gedanke ein furchtbarer Feind sei, der soweit wie möglich ferngehalten werden müsse, ja weitgehend auszumerzen sei. Jedoch konnten mich auch die zügellosesten Vergnügungen und ausgelassensten Freuden nicht davon abhalten, das Wesen eines Lebens dieser Art genau zu studieren.
Ich muß sagen, daß ich lange Vorreden verabscheue. Deswegen will ich mich auch nicht umständlichst entschuldigen sondern nur feststellen, daß ich im Nachfolgenden mein Leben, das heißt das Leben, von dem Sie wissen wollen, genau so nacherzählen werde, wie ich es nun mal geführt habe.
Ich werde mich bemühen, mich streng an die reine Wahrheit zu halten und ihr keinerlei beschönigendes Mäntelchen umzutun. Ich will alles, die Situationen und die Umstände, die zu diesen führten, so schildern, wie sie tatsächlich waren, und es soll mir gleichgültig sein, ob ich damit die Anstandsgesetze übertrete, die zwischen uns beiden auf Grund unserer Beziehungen zueinander ja sowieso keine Gültigkeit haben dürften. Im übrigen kennen Sie selbst die Tatsachen viel zu genau, als daß Sie aus Prüderie oder gar aus charakterlichen Gründen über derartige Schilderungen die Nase rümpfen würden. Selbst Personen aus der höchsten Gesellschaft, denen man doch guten Geschmack zuspricht, finden nichts dabei, Nacktbilder in ihren Wohnräumen aufzuhängen. Und wenn sie das nicht auch schon in der Eingangshalle tun, dann nur deswegen, weil sie die allgemeinen Vorurteile gegen Nuditäten dabei in Betracht ziehen.
Genug der Vorreden - lassen Sie mich zu meiner persönlichen Geschichte kommen. Als Mädchen hieß ich Frances Hill und wurde in einem kleinen Dorf in der Nähe von Liverpool in Lancashire geboren. Meine Eltern waren ausgesprochen arm, aber, wie ich ganz bestimmt glaube, grundehrlich.
Mein Vater war durch einen Unfall gelähmt und konnte schwere Bauernarbeit nicht mehr verrichten. So ernährte er sich und seine Familie mehr schlecht als recht durch Netzemachen. Meine Mutter unterstützte ihn dabei so gut sie eben konnte, indem sie Mädchen aus der Nachbarschaft unterrichtete. Ich hatte viele Geschwister, die alle früh starben, wohingegen ich selbst als einziges der Kinder eine ausgezeichnete Gesundheit mitbekommen habe.
Meine ganze Erziehung bestand bis zum meinem vierzehnten Lebensjahr aus einem bißchen Lesen, besser gesagt Buchstabieren, einem unleserlichen Gekritzel und etwas Nähen. Von meiner Tugend wäre zu sagen, daß ihre Grundlage lediglich aus der völligen Unkenntnis des Lasters und jener Furcht und Scheu bestand, die junge Mädchen vor allem Neuen haben, mehr als vor etwas anderem. Dabei verlieren wir diese Furcht meistens auf Kosten unserer Unschuld, und zwar dann, wenn wir die Männer nicht mehr als Raubtiere ansehen, die uns fressen wollen.
Unterricht und Hausarbeiten nahmen die ganze Zeit meiner Mutter in Anspruch, so daß für meinen eigenen Unterricht so gut wie nichts mehr übrig blieb. Da meine Mutter zudem viel zu naiv war, um irgendetwas Böses zu kennen, kam sie auch gar nicht auf die Idee, mich über das Böse in der Welt aufzuklären.
Ich war gerade fünfzehn Jahre alt geworden, als zu meinem großen Unglück meine lieben Eltern kurz nacheinander an den Pocken starben. Ich blieb als Waise ohne irgendwelche Freunde zurück, da mein Vater seiner Zeit aus Kent zugewandert war. Die schreckliche, für meine Eltern tödliche Krankheit hatte damals auch mich befallen, jedoch nur so schwach, daß ich bald wieder ganz gesund war und auch keinerlei Narben zurückbehielt. Das wußte ich damals allerdings noch nicht zu schätzen. Die Zeit wie auch meine jugendliche Unbekümmertheit ließen mich aber ziemlich bald meinen Schmerz über den unersetzlichen Verlust vergessen. Ja, es gab etwas, was mich völlig gleichgültig dagegen machte: die Aussicht, eine Stellung in London anzutreten, wozu mir Esther Davis, ein junges Frauenzimmer, riet. Sie war aus London zu Besuch von Bekannten gekommen und wollte nach einigen Tagen wieder in die Stadt zurück. Sie versprach, mich mit Rat und Tat zu unterstützen.
Im übrigen gab es im Dorfe keinen, der mir hätte irgendwie raten können oder sich überhaupt meiner angenommen hätte. Nach dem Tod meiner Eltern kümmerte sich eine Frau um mich, die aber ebenfalls für diesen Plan sprach, und so stand mein Entschluß fest, das Abenteuer auf mich zu nehmen und nach London zu gehen. Ich wollte dort „mein Glück machen“, wie man so sagt - dabei hat ein solcher Vorsatz schon mehr Menschen verdorben als glücklich gemacht.
Außerdem verstand es Esther David, mir mit ihren ausführlichen Schilderungen von den Herrlichkeiten, die es in London gäbe, ganz und gar den Kopf zu verdrehen. Ob sie nun von großartigen Denkmälern und Bauwerken, vom König oder vom Theater, der Oper oder anderen wunderbaren Dingen erzählte - es schien mir mehr als begehrenswert, all das zu sehen.
Ich muß heute noch lachen, wenn ich an die staunende Bewunderung denke, mit der wir Dorfmädchen, deren ganzer Sonntagsstaat in einem groben Hemd und wollenen Röcken bestand, Esthers Putz begafften: ihr Kleid aus billiger Atlasseide, ihre Hauben, die mit dünnen Bändern besetzt waren, ihre bestickten Schuhe. Für uns schien dies alles in London zu wachsen - und ich wollte unbedingt, daß es das auch für mich tue.
Für Esther war der einzige Beweggrund, auf der Reise in die Stadt die Sorge für mich zu übernehmen, der, in mir als künftige Städterin eine für sie vorteilhafte Gesellschafterin zu haben. Sie erzählte, daß es schon viele Mädchen vom Lande in der Stadt erreicht hätten, sich und ihre Verwandtschaft für das ganze Leben glücklich zu machen. Ja manche, die sich anständig gehalten hätten, wären sogar von ihren Herren geheiratet worden, hätten Kutschen bekommen, und einige wären sogar zur Herzogin avanciert. Das sei eben alles eine Sache des Glücks, und sie wüßte nicht, warum es gerade mir nicht ebenso ergehen sollte wie einer anderen.
All das, was Esther so erzählte, verstärkte in mir nur den Entschluß, die Reise zu unternehmen, und ich konnte kaum erwarten, bis es so weit sein sollte. Dazu kam, daß ich keine Menschenseele im Dorf hatte, für die ich dageblieben wäre. Auch die Frau, die mich betreute, tat dies lediglich aus Mitleid und ohne jede Zärtlichkeit. Jedoch war sie so gefällig, meine wenigen Habseligkeiten, die mir nach Abzug der Unkosten verblieben waren, zu Geld zu machen und mir dies bei der Abreise auszuhändigen. Mein ganzes Vermögen bestand nun aus recht kümmerlichen Garderobestücken, die sich bequem in eine Schachtel packen und tragen ließen, sowie aus Bargeld in Höhe von acht Pfund und siebzehn Schillingen. Diese tat ich in einen verschließbaren Beutel. Soviel Geld auf einem Haufen hatte ich bisher weder gesehen noch besessen, und ich zweifelte daran, daß man einen solchen Schatz je durchbringen könne. Vergnügt ließ ich die vielen guten Ratschläge über mich ergehen, die ich mit auf den Weg bekam.
Dann saßen wir endlich in der Kutsche. Teils aus Betrübnis, teils aus Freude vergoß ich einige Abschiedstränen, doch fiel mir das Fortgehen, wie gesagt, nicht schwer. Ich kann daher auch ohne weiteres diese Szenen übergehen, wie auch die Tatsache, daß mir der Kutscher lüsterne Blicke zuwarf, und einige Passagiere sogar Pläne in Bezug auf mich machten. Esther verstand es jedoch, in mütterlicher Weise auf mich aufzupassen und für mich zu sorgen. Allerdings berechnete sie mir ihren Schutz ziemlich hoch: ich mußte nämlich alle Reisekosten für sie bezahlen. Das tat ich aber gerne, denn für ihre Hilfe war ich ihr sehr zu Dank verbunden. Außerdem war sie wirklich sparsam und sorgte dafür, daß wir nicht übervorteilt wurden.
Spät an einem Sonnabend kamen wir mit unserer nur langsamen Kutsche, auch wenn diese zuletzt sogar mit sechs Pferden bespannt war, in London an. Die breiten Straßen, die wir auf dem Weg zu unserem Gasthaus entlangfuhren, waren vom Lärm vieler Wagen und hastender Fußgänger erfüllt. Das Gedränge und die Menge großer Häuser versetzten mich in Angst und Staunen.
Als wir an dem Gasthof angekommen waren, wurde das Gepäck entladen und uns übergeben. Doch stellen Sie sich meine Bestürzung vor: Esther, die auf der ganzen Reise so lieb und besorgt zu mir gewesen war, zeigte sich plötzlich kalt und fremd mir gegenüber, als wenn sie auf einmal befürchtete, ich könnte ihr eine Last werden.
Auf diesen Schlag war ich nicht vorbereitet. Ich hatte erwartet, daß sie mir auch fernerhin in der fremden, großen Stadt ihren Beistand gewähren würde, den ich sicher notwendig brauchen würde. Aber sie schien es als genug anzusehen, daß sie mich sicher an das Ziel meiner Reise gebracht hatte, und begann, sich mit einigen Küssen von mir zu verabschieden.
Ich war so überrascht, ja bestürzt, daß ich nichts zu sagen wußte. Esther nahm meine Verwirrung als Zeichen dafür, daß mir der Abschied von ihr naheging, und versuchte, mich mit guten Ratschlägen zu trösten. Sie wies mich an, möglichst bald eine Stellung zu suchen. Sie selbst müsse in die ihre zurück, aber im übrigen gäbe es solche mehr als genug, ich sollte nur in ein Vermittlungsbüro gehen. Außerdem wäre es zweckmäßig, wenn ich mir schleunigst ein passendes Logis nehmen würde. Ich könnte ihr die Adresse ja dann bekannt geben. Ansonsten wünschte sie mir viel Glück und sagte noch, daß ich ja anständig bleiben und meinen Verwandten keine Schande machen solle. Damit ging sie und überließ mich meinen verzweifelten Gedanken. Ich stand in dem kleinen Zimmer des Gasthofs und begann zuerst einmal, im Gefühl der Einsamkeit und der unvermuteten Trennung, furchtbar zu weinen. Dadurch wurde mir leichter ums Herz, auch wenn ich damit durchaus noch nicht wußte, wie es weitergehen sollte und würde.
Meine Verwirrung wurde nicht geringer, als ein Kellner das Zimmer betrat und mich in knappster Form nach meinen Wünschen fragte. Ohne groß nachzudenken sagte ich: „Nichts!“ Ich wünschte lediglich zu erfahren, wo ich diese Nacht schlafen könnte. Die Antwort des Burschen war, daß er mit der Frau des Hauses sprechen wolle. Diese kam auch kurz darauf und bot mir ohne Federlesen und ohne auf meine Lage irgendwie einzugehen an, für einen Schilling die Nacht dort zu bleiben. Am nächsten Tag solle ich dann zu meinen Bekannten gehen und selbst weiter für mich sorgen.
Ich wundere mich, mit welch albernen Trostgründen doch das menschliche Gemüt zu beruhigen ist. Es genügte, daß mir ein Nachtlager angeboten wurde, und schon war meine Verzweiflung verschwunden. Ich schämte mich allerdings, der Wirtin zu gestehen, daß ich überhaupt keine Bekannten in London hatte. Deswegen nahm ich mir vor, am nächsten Tag sofort ein Vermittlungsbüro aufzusuchen, dessen Adresse mir Esther noch auf die Rückseite eines Gassenhauers geschrieben hatte. Sicher würde ich dort etwas finden, was mir weiterhalf, ehe mein Geld aufgebraucht war, wie ich meinte. Im übrigen hatte mir Esther oft gesagt, daß ich mich ruhig auf sie verlassen solle, wenn ich nach meiner Herkunft gefragt würde oder man sich über mein Betragen moquieren sollte. Sie würde schon eine passende Antwort wissen. Bei diesen Gedanken kam auch mein Vertrauen zu ihr wieder, und ich war zum Schluß soweit, nur meine Unerfahrenheit dafür haftbar zu machen, daß ich Esthers Verhalten anfangs zumindest als sonderbar empfunden hatte.
Am nächsten Morgen machte ich mich so hübsch, wie es mir meine Bauernkleider nur irgend erlaubten, gab der Wirtin die Schachtel mit meinem Besitz zum Aufbewahren und ging los. Unterwegs hielt ich mich nicht länger auf, als verständlich ist, wenn man bedenkt, was es für ein gerade 15-jähriges Mädchen vom Lande an Neuem wie z. B. Läden und Schilder, zu sehen gab. Endlich fand ich auch das Vermittlungsbüro. Die Vorsteherin war eine ältere Frau, die an einem Tisch mit einem großen Buch und etlichen Papieren saß und die Kundschaft empfing. Ich ging auf sie zu, ohne die Anwesenden zu beachten, machte einen tiefen Knicks und brachte, ein wenig umständlich, mein Anliegen vor.
Nachdem mich die Frau mit der Strenge und Wichtigkeit eines Staatsministers ausgefragt hatte, prüfte sie mich mit einem langen Blick von oben bis unten, gab aber dann doch keine eigentliche Antwort sondern verlangte zunächst den üblichen Handschilling. Dann sagte sie, daß freie Stellungen für junge Mädchen zur Zeit sehr selten seien; außerdem käme ich ihr für schwerere Arbeiten reichlich zart gebaut vor. Jedenfalls würde sie aber doch in ihrem Buch nachsehen, ob sie etwas passendes für mich fände. Inzwischen solle ich etwas warten, bis sie andere Kunden abgefertigt hätte.
Diese Auskunft jagte mir einen kleinen Schrecken ein, doch fing ich mich schnell wieder und trat vom Tisch zurück. Um mir die Wartezeit zu vertreiben, sah ich mich in dem Zimmer ein wenig um. Dabei begegnete ich den Blicken einer Dame - wenigstens hielt ich sie in meiner Unerfahrenheit für eine solche - die in einer Ecke saß und trotz der sommerlichen Hitze einen Samtumhang trug. Sie war unappetitlich fett mit einem kupferfarbigen, aufgedunsenen Gesicht, ohne Haube und gute 50 Jahre alt.
Sie verschlang mich förmlich mit den Augen, während sie mich von Kopf bis Fuß musterte, und dachte gar nicht daran, sich um die Verlegenheit zu kümmern, in die mich ihr Anstarren versetzte. Zweifellos nahm sie mein Erröten als Empfehlung und Zeichen dafür, daß ich mich für ihre Zwecke sicher eignen würde.
Ich bemühte mich, einen guten Eindruck zu machen, indem ich mich möglichst gerade hielt und meinem Gesicht einen einigermaßen passenden und guten Ausdruck verlieh. Nach einiger Zeit, in der sie mein Gesicht und meine Figur genauestens geprüft hatte, stand sie auf, kam auf mich zu und fragte mich im Tone größter Ehrbarkeit: „Mein süßes Kind, suchst Du vielleicht eine Stellung?“ Ich machte einen tiefen Knicks und antwortete: „Ja, wenn’s recht ist.“ Oh, das träfe sich gut, sagte sie darauf, denn der Grund ihres Hierseins sei der, sich nach einem Dienstmädchen umzusehen. Sie könne sich denken, daß ich unter ihrer Anleitung recht brauchbar wäre. Im übrigen spräche auch mein Gesicht für mich. London sei eine böse, ja gottlose Stadt, doch wolle sie schon dafür sorgen, daß ich unter ihrer Aufsicht vor schlechter Gesellschaft bewahrt bliebe. Kurz, sie redete und redete, wie so eine richtige G’schaftlhuberin. Es war mehr, als nötig gewesen wäre, um ein unerfahrenes Landmädchen zu überreden, das sich davor fürchtet, auf die Straße zu gehen oder gar betteln zu müssen, und welches auf das erstbeste Angebot hin, ein Obdach zu bekommen, sofort mit beiden Händen zugreift. Zumal, wenn ein solches Angebot auch noch von einer so vornehmen Dame kam, wie mir ja schien. Ich wurde also engagiert. Zwar fiel mir ein hintergründiges Lächeln und ein Achselzucken der Vermittlerin am Tisch auf, doch hielt ich das für ein Zeichen dafür, daß sie über meine schnelle Unterbringung befriedigt sei. Ich hatte ja noch keine Ahnung, daß die beiden alten Weiber sich bestens kannten, und daß dieses Vermittlungsbüro eine Zentrale für den Nachschub „frischer Ware“ war, wo Madame Brown, meine neue Herrin, sich sehr oft eindeckte.
Madame, so will ich sie der Einfachheit halber nennen, war über den Handel derart gut gelaunt, daß sie mich, wahrscheinlich aber aus Angst, ich könnte ihr infolge einer Warnung oder sonst einem Zufall doch noch entwischen, in einer Kutsche verstaute und mich zu meinem Gasthof brachte. Sie verlangte dort höchst persönlich meine Schachtel, die ihr auch, weil ich ja dabei war, ohne weiteres gegeben wurde.
Anschließend fuhren wir mit der Kutsche zu einem Geschäft in der Nähe der St. Paulskirche, wo sie mir ein Paar Handschuhe kaufte. Dann befahl sie dem Kutscher, in die * * * Straße zu ihrem Hause zu fahren. Unterwegs erzählte sie in launiger Weise von allem möglichen, so daß ich viel Spaß hatte und großes Zutrauen zu ihr faßte. Sie verstand so zu plaudern, daß ich nicht im geringsten zweifelte, bei ihr durch einen besonders glücklichen Zufall an die gütigste, reizendste und beste Frau geraten zu sein, die überhaupt existierte. Frohgemut und voll seliger Erwartungen betrat ich also ihr Haus und nahm mir vor, Esther von meinem großen Glück zu berichten, sobald ich mich eingerichtet hätte.
Meine hohe Auffassung von diesem Glücksfall wurde keineswegs geringer, als ich in ein wunderschönes Wohnzimmer kam, das meiner Meinung nach ganz prächtig möbliert war. Immerhin hatte ich ja bisher nichts anderes als ordinäre Bauernstuben gesehen. Besonders kostbar schienen mir zwei goldgerahmte Spiegel und ein Vitrinenschrank mit Silbersachen zu sein, die mich davon überzeugten, daß ich in eine ausgesprochen wohlhabende Familie gekommen sei.
Madame rieb sich die Hände und sagte zu mir: „Nun, mein liebes Kind, sei vergnügt und lerne erst mal, Dich frei und ungezwungen zu bewegen!“ Sie deutete an, daß sie mich keineswegs als gemeine Hausmagd eingestellt hätte, sondern sozusagen als Gesellschafterin für sie. Sollte ich mich als angenehm und tüchtig erweisen, wäre sie bereit, mehr als zwanzig Mütter auf einmal für mich zu tun. Außer, daß ich dauernd und läppisch knickste und nichtssagende Worte wie „Ja“, „Nein“, „Sicherlich“ und so weiter stammelte, wußte ich nicht, was ich sonst antworten sollte.
Als Madame klingelte, erschien eine dicke, kräftige Dienerin, die uns auch bereits die Tür geöffnet hatte. „Hier, Martha“, sagte Madame Brown, „dieses junge Mädchen habe ich gerade eingestellt. Sie soll sich um meine Wäsche kümmern. Zunächst zeige ihr oben ihr Zimmer. Außerdem verlange ich, daß Du ihr mit derselben Achtung begegnest wie mir selbst auch, denn ich habe sie besonders ins Herz geschlossen!“
Martha grinste verschmitzt. Sie war gut abgerichtet und wußte sofort, was sie zu tun hatte. Sie machte einen kleinen Knicks und bat mich, mit ihr zu kommen. Wir stiegen zwei Treppen hoch, wo sie mir dann ein reizendes Zimmer zeigte, das nach hinten hinaus lag, und in dem ein breites, schönes Bett stand. Hierin sollte ich, wie sie mir sagte, mit einer Cousine von Madame schlafen, die bestimmt sehr nett zu mir sein würde. Danach ließ sie eine beachtliche Reihe von Lobeshymnen über unsere gute Herrin vom Stapel, versicherte mir, was ich für ein eminentes Glück gehabt hätte, daß ich gerade hier angestellt worden wäre, und daß ich keine bessere und liebere Herrin hätte finden können. Sie erging sich in noch viel mehr Lobsprüchen, die in jedem anderen den Verdacht hätten aufkommen lassen, daß das maßlos aufgeschnitten sein müsse. Bloß in mir blöder Gans kam ein solcher Verdacht nicht auf, nahm ich doch jedes ihrer Worte genau wörtlich, so daß Martha, die sehr schnell merkte, wie weit mein Geist reichte, sich danach richtete und ziemlich auftischte.
Während sie noch schwadronierte und mir meine zukünftige Arbeit in den rosigsten Farben schilderte, klingelte es, daß wir hinunterkommen sollten. Im Zimmer mit dem Vitrinenschrank war ein Tisch für drei Personen gedeckt - Madame, ihre Cousine und mich. Mrs. Phöbe Ayres, die besagte Cousine, war eine Art Directrice im Hause. Ihre Aufgabe bestand darin, junge Füllen wie mich abzurichten und ihnen das Traben beizubringen. Aus diesem Grunde wurde sie mir auch zur Bettgenossin gegeben. Damit ihrer Person mehr Ansehen und Respekt verliehen wurde, hatte die ehrwürdige Präsidentin des Kollegiums ihr den Titel einer Cousine zuerkannt.
Zunächst einmal wurde ich einer neuerlichen Prüfung unterzogen. Diesmal von Cousine Phöbe. Diese Besichtigung fiel zu ihrer vollsten Zufriedenheit aus. Dann wurde das Mittagessen aufgetragen und Madame Brown nötigte mich, nachdem sie mich nunmal als ihre Gesellschafterin bezeichnet hatte, mit am Tisch Platz zu nehmen. Ich protestierte heftig dagegen, weil ich mir als „Untertan“ und nicht als „Gnädiges Fräulein“ vorkam. Mein bißchen Erziehung genügte gerade, um zu wissen, daß es sich keineswegs schicken könne, sich so ohne weiteres zu setzen.
Die Gespräche bei Tisch wurden in der Hauptsache von den beiden Damen geführt. Es war eine gewisse Doppeldeutigkeit in ihren Worten, die ich aber entweder nicht mitbekam oder nicht verstand. Manchmal wandten sie sich auch an mich direkt und versicherten mich ihres Wohlwollens, damit ich mit meinem jetzigen Los zufrieden wäre. Dabei war das gar nicht nötig, denn ich war ja durchaus zufrieden. Wir verabredeten, daß ich für ein paar Tage für die Umwelt „unsichtbar“ bleiben sollte, bis die Garderobe angefertigt wäre, die einer Gesellschafterin würdig sei. Die Damen fanden, daß sehr viel auf den ersten Eindruck ankäme, den jemand mache. Unter dem Aspekt, meine bäuerliche Kleidung gegen echten Londoner Staat vertauschen zu können, ließ ich mich durchaus gern für einige Tage einsperren, damit ich von niemandem gesehen würde. Der einzige Grund, mich von der Umwelt fernzuhalten, war für Madame Brown in Wirklichkeit der, daß mich weder einer ihrer Kunden noch eines ihrer Mädchen sehen oder sprechen sollte, bevor sie nicht einen besonders guten Interessenten für meine Jungfernschaft gefunden hatte, die ich offensichtlich in dieses Arbeitsverhältnis mitgebracht hatte.
Es wäre müßig, sich mit den Kleinigkeiten aufzuhalten, die der Tag noch bis zur Zeit des Schlafengehens mit sich brachte. Nur soviel sei gesagt, daß ich froh über meine so angenehme Tätigkeit in diesem Hause war und die Menschen pries, die sich so nett um mich kümmerten. Nach dem Abendessen brachte Martha uns mit einem Leuchter die Treppen hoch ins Schlafzimmer und ließ uns dann allein.
Ich zögerte schamhaft, mich auszuziehen und vor Phöbe im Hemd zu Bett zu gehen, was diese natürlich merkte. Sie kam einfach auf mich zu, zog mir das Brusttuch weg und begann, meine Kleider zu öffnen. Damit überbrückte sie die für mich im ersten Augenblick peinliche Situation, und ich zog mich nun selbst aus. Ich schämte mich aber doch, nackt bis aufs Hemd vor ihr zu stehen, und kroch so schnell wie möglich unter die Bettdecke. Phöbe lachte, und es dauerte nicht lange, da lag sie neben mir. Während sie die Decke geradezog, erzählte sie, daß sie fünfundzwanzig Jahre alt sei. Aber dabei unterschlug sie mindestens zehn volle Jahre, die Verwüstungen nicht mitgerechnet, die an ihrem Körper durch einen allzu lasterhaften Lebenswandel und das häufige warme Baden ihre Spuren hinterlassen hatten. So wurde es für sie schon frühzeitig notwendig, andere die Wollust zu lehren, statt sie selbst zu erleben.
Kaum hatte sich also dieses getreue Werkzeug ihrer Herrin hingelegt, schob sie sich dicht an mich heran, was ihr wohl zur Gewohnheit geworden war, um keine Zeit und keine Gelegenheit zu Intimitäten zu verlieren. Und schon umarmte und küßte sie mich glühend. Zwar kam mir das erst reichlich seltsam vor, aber dann dachte ich, daß diese Art Freundschaftsbezeugungen in London wohl üblich wären, und erwiderte die Küsse und Umarmungen mit all der Heftigkeit, die ich in meiner Unschuld aufbringen konnte. Meine Reaktion ließ sie kühner werden, und sie begann, mich mit ihren Händen freizügigst zu betasten; sie ließ sie auf meinem Körper herumwandern, drückte und koste mich hier und dort, was mich mehr und mehr erregte. Ich war überrascht, daß ich dieses Verhalten nicht als Beunruhigung oder Beleidigung auffaßte sondern eher über die Wirkung erstaunt war.
Phöbe sparte keineswegs mit entzückten Ausrufen über meine Schönheit, was dazu beitrug, ihre Liebkosungen gerne zu dulden. Naiv, wie ich nun mal war, sah ich in ihrem Tun auch nichts Schlimmes. Außerdem war sie immerhin jemand, von dem ich durch einen fühlbaren Beweis wußte, daß es sich um ein weibliches Wesen handelte. Denn sie ließ mich ein Paar schwere Brüste fassen, die zwar reichlich wenig fest waren, aber die eben diesen Beweis doch eindeutig erbrachten.
Ich lag also gerade so da, wie Phöbe es sich wünschte, willig und zahm, während sie ihre Hände mit ziemlicher Kühnheit auf mir herumspazieren ließ. Ich muß gestehen, daß ich dabei ein völlig fremdes, nie erahntes Vergnügen in mir aufsteigen fühlte. Dabei brannte jede Stelle, die Phöbe berührte, wie Feuer.
Eine Zeit lang beschäftigte sie sich mit meinen Brüsten, sofern man zwei harte, ganz kleine und sehr zarte Hügelchen überhaupt so nennen kann, die eben begannen, Form und Gefühl zu bekommen. Langsam glitten ihre Hände daraufhin weiter nach unten, um schließlich da zu landen, wo sich erst vor wenigen Monaten ein weicher Flaum gezeigt hatte: auf dem zarten Hügel, wo auch der Sitz des ausgeprägten Gefühls und zugleich der Unschuld ist. Sie ließ ihre Finger dort spielen, und es war offensichtlich, daß sie sich daran freute.
Dann aber war sie nicht damit zufrieden, sich nur mit den äußeren Schönheiten zu befassen - sie wandte sich auch noch dem Hauptplatz zu. Sie spielte, drehte und bohrte so lange, bis sie endlich einen Finger hineinbrachte. Ich muß sagen, daß ich aus dem Bett gesprungen wäre und laut um Hilfe geschrien hätte, wenn sie nicht so unmerklich und allmählich vorgegangen wäre, daß in mir gar kein Gefühl der Schamhaftigkeit aufkam.
Statt dessen aber erregten mich ihre lüsternen Hände und ließen ein Feuer in meinen Adern pulsen, das sich speziell in der von der Natur dazu erkorenen Stelle festsetzte. Zum ersten Mal waren fremde Hände damit beschäftigt, sich mit dieser Stelle meines Körpers näher zu befassen. Ein kleiner Aufschrei machte Phöbe darauf aufmerksam, daß sie mir weh tat und daß sie nicht weiter gehen dürfe.
Mein erregtes Dehnen und Strecken, mein wildes Herzklopfen und heftiges Atmen zeigten der erfahrenen Hexe, daß mir ihr Vorgehen eher Vergnügen als das Gegenteil bereitete und ich durchaus nicht beleidigt über ihr Tun war. Dabei küßte und liebkoste sie mich immer weiter und flüsterte zärtliche Sätze wie: „Oh, was bist Du doch für ein bezauberndes Geschöpf!“ oder „Welch Glück für den Mann, der Dich zur Frau macht!“ oder „Warum bin ich bloß kein Mann!“ Und immer wieder zärtliche und aufregende Küsse, die ihre Worte unterbrachen. Solche Küsse hatte ich noch nie erhalten.
Ich war verwirrt, wie betäubt und völlig außer mir. Eine derartig starke, für mich so neue Empfindung war zu viel für mich. Ich befand mich in einem Zustand des Aufruhrs der Sinne, wodurch ich nicht mehr fähig war, überhaupt noch zu denken. Die Tränen rannen mir ungewollt aus den Augen, und ich glaube, es waren reine Tränen der Lust. Phöbe selbst, die in allen Künsten der Wollust erfahren war, fand offensichtlich in der Tätigkeit, junge Mädchen abzurichten, um nicht zu sagen: auf den Geschmack zu bringen, die Befriedigung einer persönlichen Einstellung, die man nicht mit Worten erklären kann. Dabei haßte sie die Männer durchaus nicht und zog diesen auch nicht Vertreterinnen ihres eigenen Geschlechts vor, doch schien es, daß sie irgendetwas trieb, jede Art von Genuß, auch den gleichgeschlechtlichen, „mitzunehmen“, wo er sich ihr bot. Es war wohl eine gewisse Art der Übersättigung, die sie dazu antrieb. Als Phöbe nun gewiß war, meiner sicher zu sein, zog sie die Bettdecke langsam von mir weg, und ich sah mich, das Hemd bis zum Hals hochgeschlagen, nackt daliegen. Ich war unfähig, mich dagegen zu wehren, und sicher war die Ursache meines Errötens eher Verlangen als Schamgefühl. Phöbe hatte das Licht die ganze Zeit, und sicher nicht ohne Absicht, brennen lassen, so daß mein jetzt entblößter Körper voll beleuchtet war.
„Unmöglich, mein süßes Mädchen“, sagte Phöbe, „daß Du diese Schätze vor mir verbergen darfst! Nicht nur meine Hände, auch meine Augen wollen genießen! Ich kann mich an Deinem jungen Busen gar nicht satt sehen, ich muß ihn küssen - oh wie ist er zart und fest - ich muß ihn nochmal küssen - wie schön er ist! Und wie zart ist das süße Fellchen da unten - laß es mich betrachten - oh, ich halte das nicht aus - ich muß . . .” Und Phöbe führte meine Hand zu sich selbst. Doch was war das für ein gewaltiger Unterschied zwischen mir und diesem fertigen Weib! All meine Finger, ja die ganze Hand fanden leicht dort Platz, und als sie mich in sich fühlte, geriet sie derart in Ekstase, daß ich meine Hand bald darauf ganz feucht zurückzog. Gleich danach beruhigte sich Phöbe wieder, seufzte noch ein paarmal und gab mir dann einen Kuß, der das Geschehene deutlich auszudrücken schien. Dann zog sie die Bettdecke wieder über uns.
Ich weiß nicht, welche Gefühle Phöbe empfunden hatte, aber eines weiß ich, nämlich daß ich in dieser Nacht das erstemal einen Begriff von entbrennender Natur bekam und erfahren mußte, daß der Umgang mit dem eigenen Geschlecht ebenso gefährlich sein kann, wie der mit dem anderen.
Als Phöbe sich wieder beruhigt hatte, wovon ich allerdings weit entfernt war, begann sie, mich nach allen Richtungen auszufragen, um Madame Brown entsprechend berichten zu können. Meine naiven und offenherzigen Antworten gaben ihr die Gewißheit, entsprechenden Erfolg zu haben, war ich doch unwissend, willfährig und gleichzeitig temperamentvoll genug.
Als unser Gespräch lange genug gedauert hatte, schlief ich vor Ermüdung ein. Die Natur, die sich ein Ventil suchte, um die Aufregung, in die ich versetzt worden war, auszugleichen, schenkte mir dann einen jener Träume, die fast ebenso reizvoll und angenehm sind, wie die Wirklichkeit. Am nächsten Morgen wachte ich gegen zehn Uhr auf und fühlte mich frisch und munter. Phöbe, die bereits vor mir aufgestanden war, wollte wissen, wie es mir ginge und ob ich jetzt frühstücken wolle. Sie vermied es peinlichst, mich noch mehr zu verwirren, als das schon dadurch geschah, daß ich sie nur ansah und dabei an die vergangene Nacht dachte. Sie hütete sich, eine Anspielung darauf zu machen. Ich erbot mich aufzustehen und an die Arbeit zu gehen, die sie mir zuweise. Phöbe aber lächelte nur. Wenig später brachte Martha den Tee, und kaum war ich angezogen, als auch schon Madame Brown angewatschelt kam. Ich erwartete, daß sie mich wegen meines späten Aufstehens schelten würde, statt dessen bekam ich von ihr Komplimente über mein blendendes Aussehen zu hören. Sie sagte, daß ich eine ausgesprochene Schönheit wäre und daß mich die vornehmen Herren zweifellos sehr bewundern würden. Meine Antworten auf derart ungewohnte Zugeständnisse waren einfältig und dämlich. Aber das gefiel den beiden erheblich mehr, als wenn ich mit wohlgesetzten und gewandten Worten einen Beweis von weltmännischer, erfahrener Erziehung gegeben hätte.
Wir frühstückten sodann gemeinsam, und als das Geschirr abgeräumt war, brachte Martha zwei Bündel Wäsche und Kleider, mit denen ich mich ausstaffieren sollte, wie die beiden Damen es bezeichneten.
Sie können sich vorstellen, Madame, wie groß mein Entzücken war, als ich den weißen Atlas sah, der mit silbernen Blumen bestickt war. Zwar war er schon gereinigt, aber für mich war er nagelneu. Dazu kamen eine Haube mit Brüsseler Spitzen, gestickte Schuhe und vieles andere, was nunmal einen Londoner Staat ausmacht. Natürlich handelte es sich dabei um Garderobe aus zweiter Hand, die Madame Brown so schnell wie möglich beigeschafft hatte. Das war mir aber egal. Ich ahnte ja nicht, daß Madame bereits einen Kunden im Hause hatte, der meine Reize besichtigen sollte. Dieser Kunde hatte sich ausbedungen, mich nicht nur sozusagen vorläufig zu besehen, sondern er wollte mich auch gleich an sich übergeben wissen, falls ich ihm gefiele. Dabei hatte er die Bemerkung fallen lassen, daß wirklich jungfräuliche Mädchen hierorts mehr als selten seien.
Es wurde nunmehr Phöbe überlassen, mich anzuziehen. Allerdings ging es mir bei weitem nicht schnell genug, konnte ich doch nicht erwarten, mich bald in dem neuen Staat zu sehen. Als ich endlich angezogen vor dem Spiegel stand, freute ich mich wie ein Kind über die Verwandlung, die mit mir vorgegangen war. Ich war wirklich zu naiv, um festzustellen, daß ich in meinen einfachen, bäuerlichen Kleidern viel besser ausgesehen hatte als in dem Flitterkram, in dem ich mich ja nicht mal zu bewegen wußte. Phöbes Schmeicheleien aber bestärkten mich nur noch in meiner plötzlichen Eitelkeit, die jetzt in mir aufstieg. Daß Phöbe dabei immer wieder darauf hinwies, daß ich mein gutes Aussehen ihren Ankleide-Praktiken mitzuverdanken habe, fiel mir gar nicht auf. Es war kein Eigenlob, daß ich vor dem Spiegel für mich selbst schwärmte. Das gibt mir Gelegenheit, Ihnen etwas über mein damaliges Äußeres zu erzählen.
Ich war für mein Alter von knapp 15 Jahren ziemlich, wenn auch nicht allzu groß. Meine Figur war gerade, schlank und eigentlich unbäuerlich grazil, ohne daß ich durch Schnürleibchen oder ähnliches verbildet war. Mein Haar floß in glänzenden, dunkelbraunen Locken bis auf meine Schultern herunter und betonte die helle Farbe meiner Haut. Mein Gesicht bildete ein rundliches Oval mit feinen Zügen, war vielleicht ein klein wenig rötlich und zeigte ein Grübchen am Kinn. Meine tiefschwarzen Augen waren damals ein wenig verschwommen, doch konnten sie bei manchen Gelegenheiten ganz schön Blitze schießen. Ich hatte kleine, ebenmäßige, sehr weiße Zähne, die ich gewissenhaft pflegte. Im übrigen verfügte ich noch über zwei süße, sehr feste Brüstchen, die im Laufe der Zeit das hielten, was ihre Form anfangs versprach. Kurz und gut, ich besaß alle Attribute der Schönheit und brauchte durchaus nicht erst die entsprechenden Urteile irgendwelcher Männer einzuholen, um mich bestätigt zu finden. Daß die Männer stets nur ein positives Urteil über meine Schönheit fanden, schmeichelt höchstens meiner Eitelkeit. Ja, sogar Frauen und Mädchen gaben oft zu, daß ich allen Anforderungen genüge, die an eine schöne Figur und ein angenehmes Äußeres zu stellen seien. Sicher, was ich hier sagte, klingt arg nach übertriebenem Eigenlob. Aber ich bin der Meinung, daß ich Ihnen derartige Dinge über mich ruhig sagen kann, nachdem die Natur mich mit derartigen Vorzügen ausgestattet hatte. Nun, ich war also jetzt geputzt und gestriegelt, doch kam es mir nicht im geringsten in den Sinn, daß es sich bei dieser Aufzäumung lediglich um ein Mäntelchen für mich als Schlachtopfer handelte. Ich schrieb alles der Güte und Freundschaft von Madame Brown zu. Übrigens hatte diese meinen ganzen Plunder, wie ich mein altes Zeug mal nennen will, und mein restliches Geld unter dem Vorwand, es gut aufzuheben, einfach an sich genommen.
Nachdem ich nun eine Zeitlang vor dem Spiegel in Selbstbewunderung zugebracht hatte, mußte ich in’s Wohnzimmer hinunter kommen, wo mir Madame zu den neuen Kleidern gratulierte. Sie sagte, daß mir diese so gut ständen, als ob ich nie etwas anderes getragen hätte als solch vornehme Sachen. Na ja, mir konnte sie ja sowas damals aufbinden. Gleichzeitig stellte sie mich einem Verwandten vor, einem älteren Herrn, der schon bei meinem Eintritt in das Zimmer auf mich zukam. Er grüßte, nachdem ich höflich geknickst hatte, war aber ein wenig beleidigt, weil ich ihm nur die Wange zum Kuß geboten hatte. Dieses Versehen glaubte er sofort gutmachen zu müssen, indem er meinen Kopf zwischen seine Hände nahm und seine Lippen heftig auf meinen Mund preßte. Nach dem Eindruck, den er rein äußerlich auf mich machte, paßte mir das ganz und gar nicht. Er war maßlos häßlich, von kleiner, widerlicher Gestalt, reichlich kurz geraten, krumm und eher über als unter sechzig Jahre alt. Seine Haut hatte die Farbe eines vertrockneten Leichnams, wobei seine Kalbsaugen stierten, als wenn er gerade erdrosselt würde. Zwischen seinen aufgeworfenen Lippen sah man ein paar lange Eberzähne und außerdem roch er furchtbar aus dem Mund. Er machte einen so abschreckenden Eindruck, daß er Schwangeren hätte gefährlich werden können. Gleichzeitig aber war er so von sich eingenommen, daß er überzeugt war, jede Frau müsse sofort in ihn verliebt sein. Dafür, daß solche Geschöpfe so taten, als ob sie es wären, gab er Unsummen her. Wer das nicht fertigbekam, wurde von ihm ausgesprochen brutal behandelt. Dabei suchte er ständig Abwechslung bei anderen Frauenzimmern, jedoch nicht aus einem Bedürfnis daran, sondern weil er diese Abwechslung zum Anreiz brauchte, wenn er überhaupt einen Genuß verspüren wollte. Trotzdem verließ ihn meist die Manneskraft und er wurde dann gegenüber der jeweiligen Partnerin maßlos wütend und ausfallend.
Mit diesem gräßlichen Monstrum wollte mich also meine liebenswürdige Wohltäterin verkuppeln. Nur seinetwegen hatte sie mich ins Wohnzimmer kommen lassen. Und damit er mich recht in Augenschein nehmen könnte, drehte sie mich nach allen Seiten herum, ließ mich vor ihm posieren und zog sogar mein Brusttuch heraus, um ihm die Frische meines jungen Busens zu präsentieren. Ja, sie ließ mich auf und ab gehen und fand dabei noch Gelegenheit, meinen bäuerlichen Gang als besonderen Reiz zu preisen. Sie vergaß aber auch gar nichts, um mich begehrenswert erscheinen zu lassen. Für all das hatte er nur ein gnädiges, huldvolles Nicken, wobei er mich mit seinen Kalbsaugen anstierte. Ab und zu mußte ich ihn ansehen, doch sah ich vor Abscheu immer gleich wieder weg, wenn ich seinen starren Blicken begegnete. Zweifellos sah er das als Schamhaftigkeit oder jungfräuliche Ziererei an, aber was anderes war seinem Charakter ja nicht zuzumuten.
Endlich durfte ich wieder gehen. Phöbe begleitete mich auf mein Zimmer und blieb bei mir. Ich sollte mich beruhigen und Zeit haben, darüber nachzudenken, was da gespielt würde. Ich muß aber zugeben, daß meine Dummheit und meine Naivität so groß waren, daß ich immer noch nicht merkte, wer Madame Brown wirklich war. Ich sah in diesem sogenannten Vetter effektiv niemand anderes als einen Verwandten meiner Wohltäterin, der zwar ungewöhnlich häßlich war, mich jedoch nicht mehr anging, als daß ich meine Dankbarkeit und Ehrfurcht für Madame auch auf ihn auszudehnen habe.
Phöbe also bemühte sich, mir Sympathien für diesen gräßlichen Kerl einzuflößen und fragte mich, ob ich nicht begeistert wäre, wenn ein derart schöner und feiner Herr mein Mann werden wollte. Diese Attribute nahm sie wahrscheinlich in Bezug darauf, daß seine Kleider goldbestickt waren. Ich aber meinte, daß ich wirklich noch nicht ans Heiraten dächte, und wenn, dann sicher jemanden aus meinem eigenen Milieu. Die Widerlichkeit dieses „schönen, feinen Herrn“ hatte in mir die Assoziation entstehen lassen, daß alle vornehmen Leute so wären, wieder Vetter von Madame. Phöbe ließ sich aber damit durchaus nicht abspeisen und redete immer wieder auf mich ein, um mir Zweck und Absichten des so gastfreien Hauses zu erklären, in dem ich mich befände. Soweit sie vom männlichen Geschlecht im allgemeinen sprach, konnte sie durchaus annehmen, daß ich ergeben sei, und sie nur das Beste erwarten könne. Doch war sie viel zu erfahren, um nicht Klarheit darüber zu haben, daß mein Abscheu vor besagtem Vetter ein Hindernis bedeuten könnte, das sie sich in Anbetracht des Handels, den sie mit mir vor hatten, nicht wünschten. Und dieses Hindernis war durchaus nicht leicht wegzuräumen. Zwischenzeitlich hatte Madame Brown eine Art Vertrag mit dem alten Kerl gemacht, wonach er, wie ich später erfuhr, im voraus fünfzig Pfund Sterling dafür zu bezahlen hatte, daß er einen Versuch mit mir machen konnte. Sollte dieser Versuch dazu geführt haben, seine Gelüste bei mir voll zu befriedigen, mußte er weitere hundert Pfund bezahlen. Ich selbst wurde dabei völlig seiner Wollust einerseits und seiner Großmut andererseits überlassen. Er wollte, nachdem dieser höchst einseitige Vertrag geschlossen war, sofort mit mir zusammen sein und den Tee mit mir nehmen, falls man uns allein ließe. Madame versuchte ihm das auszureden, weil ich noch zu neu in diesem Genre sei, ich wäre ja erst vierundzwanzig Stunden im Hause. Außerdem müsse ich erst noch etwas „abgerichtet“ werden. Das Ekel ließ sich aber nicht abweisen. Die Ungeduld ist immer ein Zeichen von starken Gelüsten. Er war so von sich eingenommen, daß er jeden Aufschub ablehnte, weil er immer nur den üblichen Widerstand bei einem Mädchen voraussetzte und daher meinte, es müsse auch bei mir sofort klappen. Infolgedessen wurde die Stunde meiner Prüfung auf den kommenden Abend festgelegt.
Beim Mittagessen ließen Madame und Phöbe wahre Lobhudeleien auf den ominösen Vetter los. Es hörte überhaupt nicht auf: Wie glücklich ein Mädchen doch wäre, das er mit seiner Neigung bedenke - wie sehr der Herr sich schon beim ersten Blick in mich verliebt hätte - was ich für ein Glück machen würde, wenn ich folgsam wäre und mir nicht selbst im Lichte stände - wie hoch doch seine Ehre einzuschätzen sei - wie geborgen ich für mein ganzes Leben wäre - daß ich eine feine Kutsche fahren könnte - und ich solle unbedingt seinem Verlangen Gehör schenken. Die beiden Damen erschöpften ihre ganze Redegewandtheit, um mich zu überzeugen. Aber meine Abneigung gegen dieses Ungeheuer war bereits so stark, daß ich dafür keinerlei Ohr hatte. Ich verstand es auch noch nicht, meine Gefühle zu vertuschen und diplomatisch zu antworten, so daß ich rundheraus sagte, daß sie diesem Herrn nicht die allergeringste Hoffnung machen könnten, mich zu bekommen. Währenddessen wurde immer wieder neuer Wein eingeschenkt. Bestimmt sollte ich durch den Alkohol willfähriger für die schmutzigen Absichten und den kommenden Abend gemacht werden.
Wir saßen unter diesen Umständen lange bei Tisch. Etwa gegen sechs Uhr abends, ich hatte mich gerade auf mein Zimmer begeben, wo mir der Tee serviert wurde, kam meine ehrwürdige Herrin in Begleitung dieses Fauns herein. Dieser grinste auf eine Art, die mir Übelkeit erregte, und was mich nur in meinem Gefühl des Abscheus gegen ihn bestärkte.
Er setzte sich so, daß er mich immer im Auge behielt, wobei er während der Zeit, wo wir Tee tranken, schmachtend die Augen verdrehte. Daß ich dabei verlegen wurde, hielt er für gesellschaftliche Unerfahrenheit.
Nach dem Tee schützte Madame, die sonst immer sehr viel Zeit hatte, dringende Geschäfte vor, um uns allein lassen zu können. Sie legte mir nahe, ihren Vetter um ihret- und meinetwillen gut zu unterhalten, bis sie wieder da wäre. An ihn wandte sie sich mit den Worten: „Seien Sie hübsch artig, mein Lieber, und gehen Sie sanft mit dem süßen Kind um!“ Damit eilte sie aus der Tür, und ich hatte nur noch die Möglichkeit, mit offenem Mund und voller Staunen hinter ihr her zu schauen.
Jetzt waren wir allein. Der Herr Vetter und ich. Nur bei dem Gedanken daran befiel mich schon ein Zittern in allen Gliedern, und eine furchtbare Angst stieg in mir auf, ohne daß ich wußte, warum. Mit wankenden Knien ging ich zu dem Kanapee am Kamin, wo ich mich hinsetzte und bewegungslos sitzen blieb. Ich war wie versteinert, ohne Atem, ohne Leben, ohne zu sehen, ohne zu hören.
Es war mir allerdings nicht lange vergönnt, wie betäubt dazusitzen. Der schauderhafte Kerl setzte sich neben mich, umarmte mich, so sehr ich mich auch wehrte, und begann, mir widerlich schmatzende Küsse aufzudrängen. Vor Ekel konnte ich mich nicht mehr rühren, und so nutzte er die Gelegenheit, wo ich keinen Widerstand leistete, mir das Brusttuch fortzureißen und lechzend mein Decolleté zu prüfen. Ich war wie in Agonie und weder imstande zu schreien noch mich zu wehren, was das Untier ausnutzte und versuchte, mich auf das Kanapee zu legen. Mit der Hand wollte er meine Beine, die ich ganz fest gekreuzt hatte, auseinander bringen. Dieses Tun brachte mich zur Besinnung. Wie von der Tarantel gestochen sprang ich hoch, so daß er, weil er nicht darauf gefaßt war, zur Seite flog, warf mich ihm zu Füßen und flehte ihn an, nicht so hart gegen mich zu sein und mir doch keinen Schaden zuzufügen.
„Dir Schaden zufügen, mein Liebling?“ grinste das Vieh, „an sowas denke ich überhaupt nicht! Hat Dir denn die alte Dame nicht gesagt, daß ich Dich liebe? Und daß ich sehr artig mit Dir umgehen wolle?“ - „Ja, mein Herr, das hat sie schon gesagt. Aber ich kann Sie trotzdem nicht lieben, mit dem besten Willen nicht! Bitte, bitte, lassen Sie mich! Und wenn Sie mich in Ruhe lassen und fortgehen, will ich Sie sogar von Herzen gern haben!“
Aber es war, als ob ich gegen eine Gummiwand redete. Meine Tränen, meine demütige Stellung und meine durcheinandergebrachte Kleidung schienen ihn nur noch mehr zu entflammen. Vielleicht konnte er auch seine Gier nicht mehr im Zaum halten - jedenfalls begann er erneut, mich schnaufend vor Erregung zu attackieren, griff nach mir und versuchte wiederum, mich auf das Kanapee zu legen. Und diesmal glückte es ihm auch. Obwohl ich mich mit aller Kraft wehrte, legte er mich lang hin und zog meine Röcke bis über meinen Kopf hoch. Dann versuchte er, meine entblößten Schenkel, die ich fest übereinandergelegt hielt, mit dem Knie auseinanderzudrücken, was ihm jedoch trotz aller Mühe nicht gelang. Er hatte seine Weste und die Hose aufgeknöpft und lag mit seinem ganzen Gewicht auf mir. Während ich mich noch verzweifelt sträubte und wehrte, ließ er plötzlich von mir ab, erhob sich keuchend und schnaufend und stieß die Worte „alt“ und „häßlich“ zwischen den Zähnen hervor. Das hatte ich zu ihm bei meinem hitzigen Zurwehrsetzen gesagt.
Ich merkte erst später, daß die Rauferei und das wilde Zappeln die Erregung dieses Tiers so angestachelt hatten, daß seine Kraft ihn verließ, bevor er überhaupt zu mir kommen konnte. Den Beweis fand ich auf meinen Beinen und meinem Hemd.
Darauf befahl er mir in bissigem Tone, aufzustehen, da er nicht gedächte, mir die Ehre anzutun, sich noch weiter mit mir zu beschäftigen. Im übrigen solle sich die alte Hure nach einem anderen Idioten umsehen, der sich statt seiner mit der angeblichen Keuschheit und bäuerlichen Sittsamkeit meiner Person betrügen ließe. Er wäre überzeugt, daß ich meine Jungfernschaft längst einem Bauernlümmel auf dem Dorfe überlassen hätte und jetzt in der Stadt den Rahm abschöpfen wolle. In diesem Ton ging das eine ganze Weile weiter, und ich hörte ihm mit dem größten Vergnügen zu. Sicher mit mehr, als ein verliebtes Mädchen die Liebesschwüre ihres Freundes anhört. Denn seine höhnischen Bemerkungen waren eine Art Garantie, daß er mich wenigstens mit seinen widerlichen Liebkosungen in Ruhe ließ.
Jedenfalls hatte ich auf diese Weise die wahren Absichten von Madame Brown erfahren, doch wurde mir das gar nicht richtig bewußt - dazu fehlte es mir an Herz und Verstand. Ich kam gar nicht auf die Idee, mich von dieser Kupplerin zu trennen, war ich doch der Meinung, mit Leib und Seele ihr Eigentum zu sein. Unbewußt versuchte ich dadurch, daß ich eine gute Meinung von ihr behielt, mich selbst zu betrügen. Es schien mir immer noch besser, bei ihr mit dem Schlimmsten rechnen zu müssen, als ohne sie betteln zu gehen, da ich weder Geld noch einen Freund hatte, der mir weiterhelfen konnte. Diese Angst war mein Verderben.
Den Kopf voll von krausen Gedanken saß ich am Kamin, das Haar von der Rauferei aufgelöst, das Kleid am Hals weit geöffnet, und heulte. Plötzlich aber fing der alte Lüstling wieder an, feurig zu werden. Der Anblick meiner blühenden Jugend, der Gedanke, daß ich möglicherweise doch noch unschuldig sein könnte, ließ ihn nicht ruhig bleiben.
Er wartete noch eine Zeit und fragte mich dann ganz ruhig und sogar zärtlich, ob ich es nicht doch nochmal mit ihm versuchen wolle, ehe die alte Dame wieder zurückkäme. Dann wäre auch alles wieder gut, und er sei bereit, mir seine Liebe erneut zu schenken. Dabei versuchte er, mich zu küssen und meine Brüste anzufassen. Ekel, Furcht und Widerwille jedoch waren so stark in mir, daß ich mich geistesgegenwärtig von ihm losriß, zur Glocke lief und, ehe er mich daran hindern konnte, derart an der Schnur zog, daß das Dienstmädchen sofort gelaufen kam, um zu hören, was der Herr haben wolle. Ohne erst zu klopfen trat Martha ein und sah mich mit aufgelöstem Haar und blutender Nase, was das Ganze fast tragisch machte, auf dem Boden liegen. Dazu der Quälgeist, der ohne Rücksicht auf mein Jammern immer noch versuchte, das zu erreichen, was er wollte. In ihrer Verwirrung über das Durcheinander wußte sie nicht, was sie tun sollte.