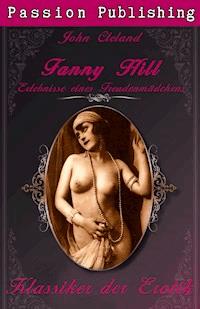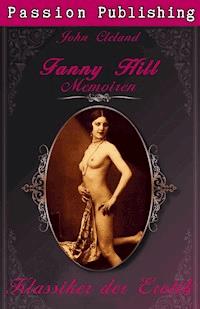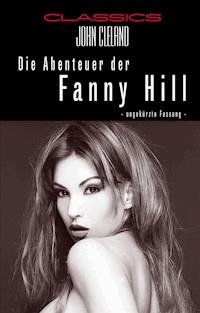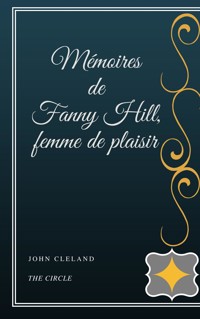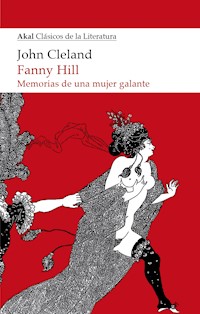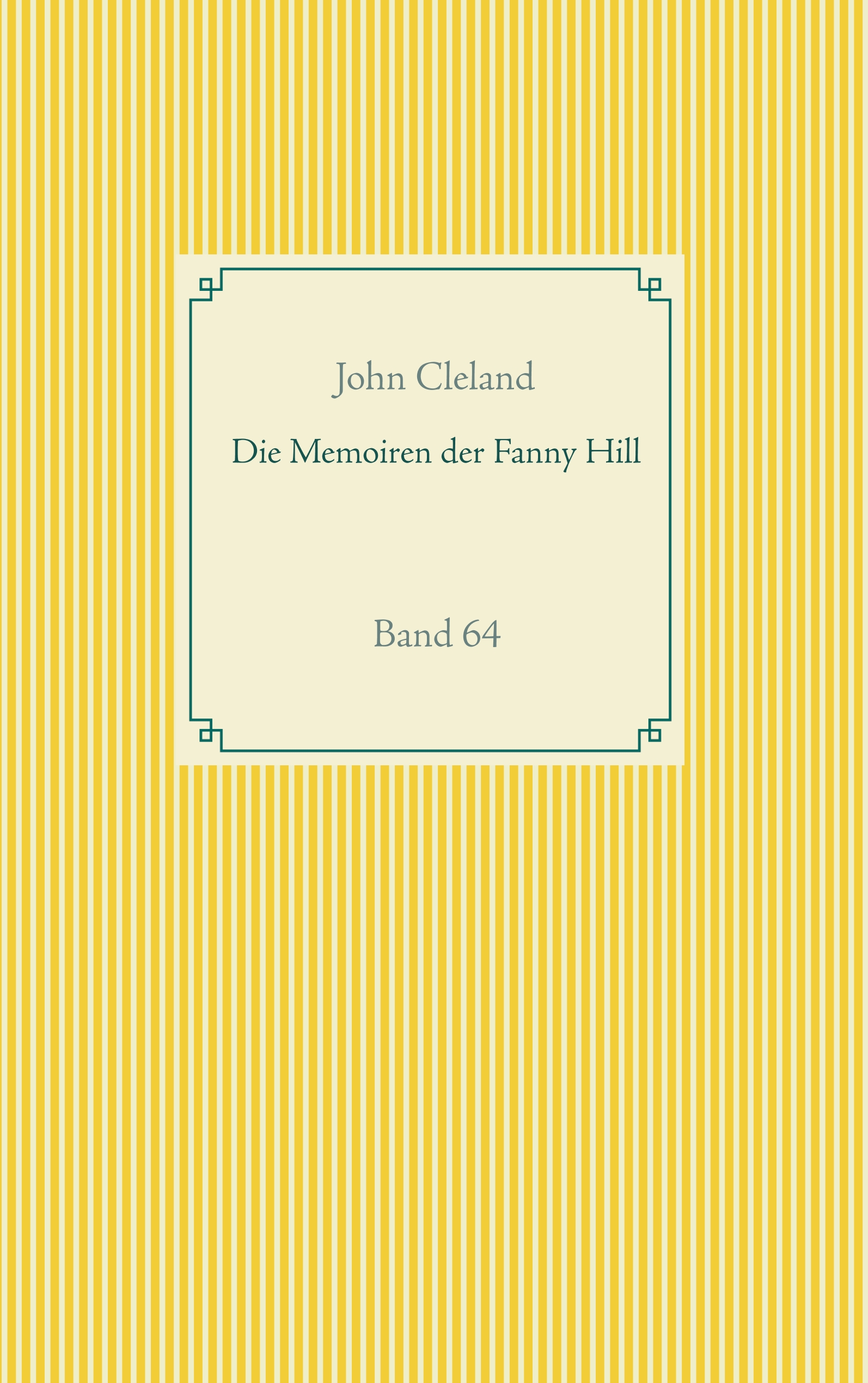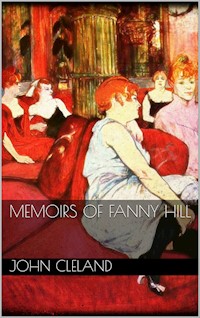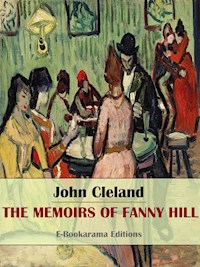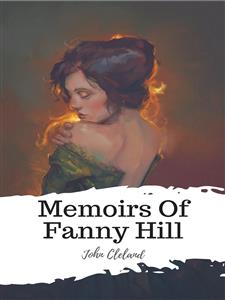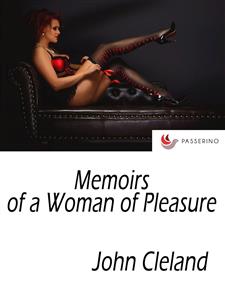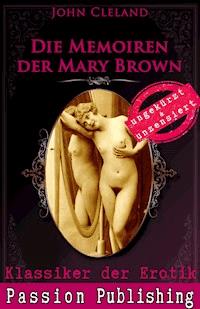
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Passion Publishing
- Kategorie: Erotik
- Serie: Klassik der Erotik
- Sprache: Deutsch
Mary Brown begleitet als Kammerzofe eine vornehme Lady nach Paris, wo sie durch missliche Umstände an eine Kupplerin gerät. Schnell macht sie Karriere, denn die berühmtesten Kurtisanen weihen sie in die Feinheiten des Gewerbes ein. Ein englischer Lord bringt sie zwar nach London zurück, doch dort weiß man ihre Fähigkeiten ebenfalls zu schätzen, so das sie erst nach vielen Abenteuern im sicheren Hafen der Ehe landet. Nur wenige erotische Bücher des 18. Jahrhunderts vermitteln einen so genauen Einblick in die amourösen Sitten der Demimonde von Paris und London. Der Autor ist denn auch kein geringerer als John Cleland, der Verfasser der berühmten "Fanny Hill". Sein vorliegendes Werk, das er anonym schrieb, blieb lange unentdeckt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JOHN CLELAND
Die Memoiren der Mary Brown
Deutsche Erstübersetzung von Helmut Werner
Inhalt
Vorwort
Band 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Band 2
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Weitere e-books bei Passion Publishing
Vorwort
Das englische Original dieser Memoiren erschien 1766 und dürfte mit Sicherheit aus der Feder von John Cleland stammen, wenngleich auf dem Titelblatt als Verfasser nur ganz allgemein der „Autor der Memoiren der Fanny Hill“ angegeben wird. Aber überlieferungsgeschichtliche, inhaltliche und nicht zuletzt stilistische Gründe sprechen eindeutig für die Verfasserschaft Clelands.
John Cleland (1709-1789) hat also neben seinem berühmten Erstlingswerk: The Memoirs of a Woman of Pleasure (Die Memoiren der Fanny Hill) aus dem Jahre 1749 und The Memoirs of a Coxcomb (Die Memoiren eines Dandy) aus dem Jahre 1751 mit Sicherheit noch ein drittes erotisches Buch mit dem Titel „Die Memoiren der Mary Brown“ verfaßt, die hier zum erstenmal in deutscher Übersetzung erscheinen. Gewichtige Gründe sprechen dafür, daß noch weitere Werke auf diesem Gebiet von ihm stammen, dies bedarf aber noch weiterer Untersuchungen.
Man kann sehr häufig lesen, daß der Richter dem wegen der Veröffentlichung der Memoiren der Fanny Hill angeklagten John Cleland jährlich eine Pension von 100 Pfund aussetzte, damit er sein Talent nicht mehr auf einem so anrüchigen Gebiet verschwende. Dafür gibt es jedoch keine Beweise, und diese Behauptung dürfte auf Berichte und Erfindungen des 19. Jahrhunderts zurückgehen. Im Gegenteil, John Cleland hat munter weitergeschrieben! Nur der pornographische Gehalt seiner Werke tritt stark in den Hintergrund, so daß man diese Bücher nur als dezente und pikante Erotika bezeichnen könnte.
Die „Memoiren der Fanny Hill“ und die „Memoiren eines Dandy“ sind unzweifelhaft Romane, die von einer beliebten Kupferstichfolge des bekannten englischen Malers William Hogarth angeregt wurden. Was nun die Memoiren der Mary Brown anbelangt, so galten sie als ebenso fiktiv wie die der Fanny Hill, und Mary Brown war eben nur eine andere Fanny Hill. Sie mußten im Gegensatz zu dem Erstlingswerk Clelands dezent sein, weil er sonst weitere Schwierigkeiten mit der englischen Justiz bekommen hätte.
Aufgrund meiner Untersuchungen kann als sicher gelten, daß Mary Brown tatsächlich gelebt hat und daß diese Memoiren ein hohes Maß an Authentizität besitzen. In einem wichtigen Quellenwerk der englischen Sittengeschichte: Nocturnal Revels or the history of King's Place and other modern nunneries (1779), das auch auf deutch mit dem Titel: „Nachtschwärmereien oder die Geschichte der neuen Nonnenklöster“ 1780 erschienen ist, wird eine Kurtisane namens Mary Brown erwähnt. Diese wichtige Stelle will ich hier in deutscher Übersetzung anfügen.
Kapitel 19. Geschichte der Mary Brown, einer bekannten Kurtisane.
… Frau Brown ist allgemein unter dem Namen „der Constabel“ bekannt, und sie ist ein schönes Stück Fleisch für die Grenadiere. Sie sollte auch von der Regierung Pension erhalten, weil sie die Truppen seiner Majestät betreut…
Mary Brown ist später in das Kloster (Curzonstreet, Mayfair) eingetreten. Weil in ihrer Geschichte manches merkwürdig ist, wird der Leser es nicht übel finden, sie zu hören.
Sie war die Tochter eines Baumeisters in der Gegend von Marylebone, und man hielt sie für die Eigentümerin von 10000 Pfund. Mary war ein schlankes und artiges Mädchen und hatte eine ziemlich gute Erziehung erhalten, die bei ihr nicht vergebens gewesen war. Kaum hatte sie das Alter erreicht, wo das weibliche Geschlecht anfängt, an das männliche zu denken, als sie bei allen öffentlichen Gelegenheiten erschien. Da sie ein für Liebe und verliebte Dinge empfindsames Herz hatte, machte es ihr große Schwierigkeiten, den mannigfachen Angriffen der jungen, artigen und schlauen Herren auszuweichen. Hinzu kam eine Bekanntschaft, die sie mit einer gefährlichen Frau gemacht hatte, die unter dem Schein der Keuschheit sich Zutritt zur ehrbaren Gesellschaft verschafft hatte, obgleich das forschende Auge der Neugierde sie schon stark in Verdacht hatte.
Einst wurde eine Landpartie nach Windsor veranstaltet, bei der auch ein Herr dabei war, der, wie sie glaubte, ihr in ehrlicher Absicht den Hof machte. Weil er aber von ihrer Freundin erfahren hatte, daß der alte Brown sich vor seinem Tod nicht von einem Groschen trennen wollte, so faßte er bald einen anderen Plan und wollte sich nicht ihres Herzens, sondern ihrer Tugend bemächtigen.
Doch ihre Freundin machte sich über ihre Furcht lustig, mit diesem Mann allein zu sein, den sie bald ihren Ehemann nennen würde. Getäuscht durch diese Meinung vertraute sie seinen Versprechungen und gab seinen Zudringlichkeiten nach, weil sie glaubte, daß dies nur das Vorspiel der Ehe sein würde. Aber leider mußte sie bald feststellen, daß sie betrogen wurde.
Mit welcher Bewegung der Seele, welchem Kummer, welchen Gewissensbissen las sie in den öffentlichen Blättern, daß er sich mit einer anderen verheiratet hatte! O Leser, wenn du ein Weib bist, so überlaß dich nun deinen Empfindungen! Es dauerte lange, bis sie ihren Kummer überwinden konnte. Weil sie sah, daß diese Liebe keine Früchte trug, so tröstete sie sich damit, die Treulosigkeit ihrer Freundin entdeckt zu haben.
H e r r W …ms, ein Mann mit großem Vermögen, stellte ihr seit einiger Zeit nach und würde ihr sicher seine Hand gegeben haben, wenn der Vater eine Mitgift herausgerückt hätte. Als man deswegen verhandelte, zeigte sich, daß der Herr Brown nicht mehr so streng war. Aber er machte Bankrott, so daß seine Tochter das ihr von ihm versprochene Geld nicht bekam. Herr W…ms, der so lange um Mary geworben hatte, wollte seine Liebe zu ihr nicht aufgeben, obgleich ihm die Klugheit verbot, dieses Ziel weiter auf anständige Weise zu verfolgen. Die Versuchung nämlich war zu stark, ihr Anträge von weniger zärtlicher Art zu machen, die sie hoffentlich annehmen würde. Bei den ersten Worten dieser Art reagierte sie mit äußerster Empfindlichkeit und machte ihm sehr heftige Vorwürfe wegen seiner Untreue. Darauf war er jedoch gefaßt, kümmerte sich nicht weiter darum und hielt an seinem Vorhaben fest. Endlich konnte Mary nicht umhin, sich ihm hinzugeben. Kurze Zeit darauf war sie schwanger und schenkte nach neun Monaten einem Sohn das Leben.
Die zärtliche Liebe des Herrn W…ms wurde hierdurch in keiner Weise vermindert, sondern im Gegenteil noch vermehrt. Nachdem sie wiederhergestellt war, erschien sie in der Öffentlichkeit mit demselben Glanz wie vorher. Da sie ihre Niederkunft geheim gehalten hatte, so war sie auch ein Geheimnis geblieben. Sir Carl B. .y machte sich eines Abends in Ranelagh an sie heran, als er von der Untreue seiner Gemahlin erfahren hatte. Weil er glaubte, daß Madame Brown, wie wir sie jetzt nennen wollen, eine sehr angenehme und sehr schöne Frau war, so fing er an, für sie ein starkes Interesse zu zeigen und hoffte, bei ihr Trost für die Untreue seiner Frau zu finden. Eine solche Eroberung schmeichelte Mary sehr, und sie hielt sie für eine gerechte Rache an Herrn W… ms, weil er sich ihr Unglück zunutze gemacht hatte. Kurzum, sie gab sich Sir Carl hin, der ihr seine Freigebigkeit und Liebe bewies. Herr W…ms entdeckte ihre Untreue und verließ sie. Sir Carls Zuneigung dauerte auch nicht viel länger. In dieser Lage mußte sie an ein anderes Unterkommen denken. Sie begegnete in dieser kritischen Zeit Frau B.. nks. die sie überredete, in ihr Haus zu ziehen.
Den vorliegenden Memoiren der Mary Brown kann man folgende Lebensbeschreibung entnehmen: Sie muß um 1739 in Lancashire geboren sein. Mit elfeinhalb Jahren kommt sie nach Douai in Flandern. 1752 geht sie mit dreizehn Jahren nach England zurück, weil ihr Vater gestorben ist. Mit siebzehn Jahren wird sie verführt und bekommt ein Kind, als sie auf die Versprechungen eines Mannes hereinfällt. Um 1757 begleitet sie eine Lady als Kammerzofe nach Frankreich, bei der sie zweieinhalb Jahre bleibt. Mit zwanzig gerät sie in Paris auf die schiefe Bahn und verdient sich ihren Lebensunterhalt als Dirne im Haus der Madame Laborde und Maillot. Vier Jahre später geht sie um 1764 im Alter von vierundzwanzig Jahren nach England zurück. Mit achtundzwanzig Jahren verfaßt sie ihre Memoiren, so daß sie vier Jahre in London das Leben einer Kurtisane führte.
Obwohl es zwischen beiden Berichten viele Widersprüche gibt, stimmen sie doch darin überein, daß Mary Brown auf das Heiratsversprechen eines Mannes hereinfiel, schwanger wurde und dann ihren Lebensunterhalt als Dirne verdiente.
Was die sonstigen Angaben in ihren Memoiren anbelangt, so sind sie zum größten Teil authentisch. So auch die Vorgänge in dem Kloster von Douai, die uns von der oben erwähnten Quelle so geschildert werden:
… er sagte, daß er in einem Kloster in Douai Beichtvater gewesen sei. Am Anfang habe er sich sehr sorgsam seine ersten Schritte überlegt. Als eines Tages eine junge Nonne, die eben erst den Schleier genommen hatte, bei ihm gebeichtet habe, sei er von ihren Reizen bezaubert gewesen. Er habe sich deshalb nicht zurückhalten können, einen Angriff auf sie zu wagen, der auch gelungen sei. Die artige Nonne gestand, daß sie vielleicht noch schlimmer dran sei als er selbst und daß sie sich nichts lieber gewünscht habe, als daß er den Anfang mache. Diese Vertraulichkeit dauerte einige Zeit an. Als sie aber schließlich von einer anderen Schwester entdeckt wurde, habe er sich genötigt gesehen, auch ihr seine Dienste anzubieten, um sich nicht ihren Zorn zuzuziehen. Aber diese zweite Liebe war nicht lange verborgen geblieben, sondern sie wurde von der Äbtissin entdeckt, der er ebenfalls seine Ehrerbietung habe bezeugen müssen. Nach einigen Monaten seien diese beiden Schwestern schwanger geworden. Die Äbtissin habe an seinen Geschicklichkeiten so sehr Gefallen gefunden, daß er bald entkräftet gewesen wäre. Deswegen habe er es für das beste gehalten, sich heimlich davonzumachen.
Der Name dieses Paters wird mit O'FL.. ty angegeben, während er in den Memoiren der Mary Brown Martin heißt.
Um 1760 war Mary Brown ihren Memoiren zufolge in Paris bei Madame Laborde. In den Akten der Pariser Sittenpolizei wird eine Kupplerin gleichen Namens erwähnt. Nach dem Sturm auf die Bastille wurden die Akten der Pariser Sittenpolizei gefunden, und der Teil der Akten, der sich mit den Ausschweifungen der Geistlichen beschäftigt, wurde 1790 veröffentlicht. Darin findet sich folgendes Schreiben:
Oktober 1757
Brief des Leutnants der Polizei an den Inspektor Monsieur!
Ich habe mich heute gegen 20 Uhr 30 mit dem Kommissar Sirebeau zu der Laborde begeben, die Mereau genannt wird, eine Dirne, die in der Rue Saint Honore nahe der Oper bei einem Apotheker wohnt. Dort trafen wir den Sieur Bernard Delaunay an. Er ist achtundzwanzig Jahre, in Bordeaux geboren, Priester in der obigen Gemeinde und Lehrer des Dom Emmanuel, Infant von Portugal. Er hat seine Wohnung in Paris in der Rue Dauphin bei Sieur Adelin, einem Weinhändler. Er gestand, daß er den Geschlechtsverkehr bis zum Höhepunkt mit Leonore vollzogen hatte, die als Dirne bei der Mereau wohnt. Der oben erwähnte Kommissar Sirebeau hat darüber das beigefügte Protokoll auf genommen. Nachdem er den Namen, Beruf und Wohnort des obigen Delaunay verifiziert hat, ließ er ihn frei.
Marais
Wir erinnern uns, daß Madame Laborde im Gespräch mit Mary Brown bemerkt, sie habe häufig Besuch von Geistlichen. Ich könnte noch weitere Quellen, veröffentlichte und unveröffentlichte anführen, um die Authentizität der Memoiren der Mary Brown zu beweisen. Wenn man diese Quellen mit den Memoiren vergleicht, so muß man feststellen, daß die wesentlichsten Fakten übereinstimmen, daß aber bei deren Ausgestaltung oft große Unterschiede zu finden sind.
Die Veröffentlichung der Memoiren der Mary Brown fiel in eine Zeit, während der in England zahlreiche Memoiren von Kurtisanen und Biographien von Dirnen erschienen sind. So wurden 1759 die Memoiren der berühmten Miß Kitty Fisher und 1758 die von Fanny Murray publiziert. Das Leben und die Erfahrung eines Londoner Freudenmädchens werden auch in dem Buch „Adventures of a Speculist“ (Die Abenteuer eines Beobachters) von Georg Alexander Stevens geschildert, das 1762 erschienen ist. Eine solche Fülle von Kurtisanenmemoiren veranlaßten erst wieder die französischen Kurtisanen des Second Empire gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Neben dieser reichhaltigen Kurtisanenliteratur benutzte Cleland auch die zeitgenössischen Romane als Quellen. Ohne Zweifel repräsentiert Mary Brown den Typus der verführten Unschuld, wie ihn Richardson in der Gestalt der „Clarissa“ seines gleichnamigen Romans, der 1748 erschienen ist, vorgeführt hatte. Wie Clarissa wird Mary Brown durch eine Opiumtinktur betäubt und dann entjungfert. Auch der Roman „Candide“ von Voltaire ist mit Sicherheit benutzt worden. Der Doktor T.. o, der von dem Liebhaber der Mary Brown wegen seiner galanten Krankheit konsultiert wird und dann später sie selber beim Spielen ausnimmt, hat große Ähnlichkeit mit der Romanfigur Pangloß bei Voltaire, insbesondere weil beide auch die gleiche Auffassung über die Entstehung der venerischen Krankheiten vortragen.
Natürlich finden sich auch viele Übereinstimmungen mit dem Erstlingswerk von John Cleland, den „Memoiren der Fanny Hill“. So dürfte es nicht zufällig sein, daß beide sich zum ersten Mal wirklich verlieben, nachdem sie an lesbischen Orgien teilgenommen hatten. Fanny Hill findet ihren Charles und Maria Brown Williams. Beide Bücher sind im Grunde sehr moralisch, weil sie letztlich das Laster verdammen und die Ehe als erstrebenswertes Ziel einer Frau ansehen. Aber in den Memoiren der Mary Brown wird noch überzeugender die Stimmung und innere Haltung einer Frau gezeigt, die ihren Körper verkauft - oder besser, verkaufen muß -, weil ihr das Nötigste zum Leben fehlt. Das psychologische Moment spielt bei Mary Brown eine große Rolle. Wir erfahren von dem seelischen Konflikt einer Frau, die anders als Fanny Hill genügend Bildung besitzt, um über ihr Leben nachzudenken und die Rolle einer Prostituierten bewußt zu reflektieren.
In seiner blumenreichen Sprache schildert uns Cleland viele sittengeschichtlich bedeutsame Einzelheiten aus der goldenen Zeit der Londoner Bordelle und vermittelt uns einen Eindruck von dem Treiben der Lebewelt an ihren wichtigsten Treffpunkten, wie den Lustgärten Vauxhall und Ranelagh. Wenn eine Dirne bestehen wollte, durfte sie keine Gefühle zeigen und mußte wie ein Geschäftsmann Vorgehen. In der Person der berühmten Mrs. Goodby finden sich all diese Eigenschaften vereint. Sie betreibt das Geschäft mit der Prostitution wie ein professioneller Kaufmann, und hat z. B. in London Anwerbebüros eingerichtet, die sie mit immer neuem Nachschub versorgen. Junge Mädchen, die man als geeignet für dieses Gewerbe ansieht, werden zum Schein als Dienstmädchen angestellt und dann durch besonders ausgewählte junge Männer zu Dirnen gemacht. Auch Fanny Hill wird auf diese Weise verführt und auf „die Bahn des Lasters gebracht“.
Kein Zweifel also, daß die vorliegenden Memoiren, die jetzt zum ersten Mal in deutscher Übersetzung zugänglich sind, für die Kenntnis der Kultur- und Sittengeschichte Englands um die Mitte des 18. Jahrhunderts eine sehr wichtige Quelle sind.
Helmut Werner
Band 1
Kapitel 1
Da der Leser dieses Buch nicht als eine Novelle oder einen Roman ansehen soll, sondern als eine Schilderung der Abenteuer einer Frau, die einiges Aufsehen in der Lebewelt erregt hat, darf er nicht überrascht sein, wenn er auf den folgenden Seiten nichts findet, was ans Wunderbare und Außergewöhnliche grenzt. Die Ereignisse meines Lebens liegen gar nicht so weit entfernt von dem üblichen Weg einer Frau, deren Verführung durch die Fehler einer Erziehung begünstigt wurde, die man fälschlich als vornehm ansieht. Ich werde mich eines dem Thema angemessenen Stiles befleißigen, der sich nur durch Wahrhaftigkeit und Schlichtheit auszeichnet.
Obgleich der Name Brown, der weit verbreitet ist, den Anschein hervorruft, erfunden zu sein, ist er dennoch mein richtiger Familienname; er ist seit alters her in Lancashire verbreitet, wo ich geboren bin. Mein Vater hatte in dieser Grafschaft ein kleines ererbtes Besitztum, wo er gewöhnlich wohnte. Sein Bekenntnis war römisch-katholisch, und er war ein fanatischer Anhänger seiner Religion. Dies war der Grund, daß sein Onkel sich von ihm fernhielt, der in der Verwaltung tätig war und gute Beziehungen zum Hofe hatte. Aber durch seine Protektion, die für meinen Vater von sehr großer Wichtigkeit gewesen sein dürfte, unterstützte er ihn.
Ich hatte noch zwei ältere Brüder. Da ich die einzige Tochter war, wurde ich von meinem Vater und meiner Mutter verhätschelt, besonders aber von ihr, die eine dieser gutmütigen Frauen war, die alles um der lieben Ruhe und des Friedens willen machen. Deshalb setzte ich bei jeder Gelegenheit meine Wünsche durch. Meine Brüder machten ihr wegen ihrer Nachsicht das Leben schwer. Weil sie ihre Jugendsünden vor ihrem Vater verbarg, hatten wir alle drei gute Aussichten, auf die schiefe Bahn zu geraten.
Obgleich mein Vater durch sein religiöses Bekenntnis, das auch seine zwei Söhne annehmen mußten, ihnen jede Hoffnung nahm, einmal später eine Stelle in der Verwaltung oder Armee zu finden und sein Vermögen, wenn es geteilt würde, niemals ausgereicht hätte, uns ein standesgemäßes Leben zu ermöglichen, besaß er dennoch so viel Familienstolz, daß er es nicht übers Herz brachte, sie zu Kaufleuten auszubilden. Nachdem sie so viel Wissen erworben hatten, wie ihnen die Lateinschule vermitteln konnte, wurden sie ins Ausland geschickt, um an dortigen Seminaren ihre Studien zu vollenden.
Mir stand fast derselbe Weg bevor. Als ich nämlich das elfte Lebensjahr erreicht und mir so viel Wissen erworben hatte, wie unser hiesiges Pensionat vermitteln konnte, wurde ich nach Douai geschickt, damit meine Erziehung vervollständigt, meine Moral verbessert und die Grundsätze meiner Religion in mir noch fester verankert würden.
Ein Priester, der in unserer Familie lebte und bei uns die Rolle eines Hausseelsorgers und Beichtvaters innehatte, war sehr bemüht, den Aberglauben wachzuhalten, den ich und meine Brüder von Natur aus besaßen. Er schärfte uns ein, es sei eine größere Sünde, freitags Fisch zu essen, als sich eines Diebstahles, ja sogar eines Mordes schuldig zu machen. Ich muß eingestehen, er beeinflußte so tief meinen unkritischen Verstand, daß ich mit einer Art von Schrecken auf das Fleisch an diesem Tag sah. Nur mit Schwierigkeiten konnte ich mich am nächsten Tag daran gewöhnen. Schließlich glaubte ich, daß mein Seelenheil wesentlich davon abhinge, ob ich ein Stück Holz in Form eines Kreuzes küßte. Diese und andere ähnliche Merkwürdigkeiten schienen mir von großer religiöser Bedeutsamkeit zu sein, und ich beachtete sie sehr streng. Ob unser Beichtvater wirklich das glaubte, was er lehrte, oder nur so viel Frömmelei vortäuschte, um uns zu imponieren, das wage ich nicht zu entscheiden. Aber man muß erwähnen, daß seine ganze Lebensführung von Mäßigung bestimmt war. Er aß wenig, trank fast überhaupt nichts, war in keinen Skandal verwickelt und erfreute sich des Rufes, mildtätig zu sein. Sein ganzer Charakter nämlich war noch viel stärker durch seine Grundsätze als durch seine Weltanschauung geprägt. In unserer Nachbarschaft genoß er so viel Verehrung, daß sich jeder geschmeichelt fühlte, in der Gesellschaft von Herrn Fisher zu sein. Das war in großen Umrissen der Charakter unseres Seelenhirten, der mich sehr gründlich auf mein zukünftiges Leben fern von der Welt vorbereitete.
Niemals war ich eine Nacht von meiner Mutter getrennt. Obgleich ich schreiben, rechnen, tanzen und ein wenig Französisch in dem Pensionat in unserer Stadt gelernt hatte, war ich doch nur das, was man eine Tagesschülerin nennt. Als sich endlich der Tag meiner Abreise nach Liverpool näherte, von wo ich nach Calais eingeschifft wurde, quälte mich der Gedanke, daß ich meine Mutter verlassen mußte. Aber ihre Unruhe war augenscheinlich ebenso groß. Als die Stunde des Abschiedes kam, dachte ich, es drehe sich mir das Herz im Leibe herum. Ich brachte kein Wort über die Lippen, fiel ihr um den Hals, und unsere Tränen vermischten sich. Schließlich jedoch hatte sie sich einigermaßen wieder gefaßt und sagte zu mir: »Meine liebe kleine Mary, wir müssen uns trennen, aber ich hoffe, nicht für immer. Es ist das Beste für deine Seele und deinen Körper. Und wenngleich es auch schlimmer als der Tod für mich ist, dich gehen zu lassen, darf ich mich doch dem nicht in den Weg stellen, was zu deinem Nutzen und Frommen ist. Vergiß niemals die Gebote des ehrwürdigen Herrn Fisher und bete bei jeder Gelegenheit für deinen Vater und deine Mutter, für Tommy und Charles…!«
Da unterbrach sie ein Strom von Tränen. Gerade rechtzeitig kam mein Vater uns zu Hilfe, der mich aufforderte, mich zu der Kutsche zu begeben, die, wie er sagte, schon beinahe eine halbe Stunde auf mich warten würde. Er nahm mich an die Hand, und ohne nach dem Grund unseres Kummers zu fragen, den er ja sehr gut kannte, führte er mich zur Kutsche. Alles um mich herum war mir gleichgültig geworden, und ich hatte für meine Umwelt keine Augen mehr.
Kapitel 2
Ich war schon einige Meilen gefahren, ehe ich daran dachte, mir meine Mitreisenden anzusehen. Mein Vater, der neben mir saß, bat mich, meine Tränen abzutrocknen und meinen Kummer nicht weiter zu zeigen. Aber ich sah darin den einzigen Trost, der mir geblieben war, und es wäre grausam gewesen, mir diese kleine Linderung zu versagen, der mein Kummer bedurfte. Schließlich hatte dieser Bach des Jammers seine Quellen ausgetrocknet, und wie sie vorher von selbst geflossen kamen, so hörten sie jetzt auf zu fließen. Ich konnte meine Augen für ihren eigentlichen Zweck benutzen.
Unsere Reisegesellschaft bestand aus zwei vormals gefangenen Franzosen, welche die Freiheit durch den Vertrag von Aix-la-Chapelle erlangt hatten, einem Schmuggler von der Insel Man und einem Schauspieler, der zu einer umherziehenden Schauspielertruppe in Liverpool gehörte. Denn in der Unterhaltung hatten sie bald ihre Berufe offenbart. Die französischen Offiziere anerkannten sehr freimütig die höfliche und gute Behandlung, die ihnen in England widerfahren war, wo sie, wie sie selbst eingestanden, ein besseres Leben gehabt hatten, als wenn sie in ihrem eigenen Land ihren Dienst getan hätten. Der Schmuggler stimmte mit den Franzosen überein, daß England eines der gastfreundlichsten Länder auf Erden wäre und daß es in jeder Hinsicht das beste wäre, wenn es nicht die Zollbeamten und Steuereinnehmer gäbe, die ein Unglück für die Gesellschaft und der Ruin des Handels seien. Was den Schauspieler anbelangt, so beklagte er laut die Tyrannei der Direktoren und den Mangel an Urteilskraft beim Publikum, das guten Leistungen keinen Beifall zolle, aber sein Geld verschwende, um ausländische Sänger, Tänzer und Harlekine zu sehen.
Meine Augen und Ohren waren die einzigen Organe, die ihre Aufgaben verrichten konnten. Was meine Zunge anbelangt, war meine Stimmung zu sehr gedrückt, um mich ihrer zu bedienen, und die einzigen Laute, die ich hervorbringen konnte, waren: »Ach Gott! Ach…!« Sie drangen sehr häufig über meine Lippen. Wegen meines jetzigen Zustandes und vor allem wegen der Tränen versank mein Vater in die gleiche Melancholie wie ich. Da das Gesprächsthema keinen Bezug zur Religion hatte, waren weder er noch ich daran interessiert, an dem Gespräch teilzunehmen. All seine Reden und sein ganzes Denken kreisten nur um dieses Thema. Es war unmöglich, über Religion zu reden, ohne bei ihm Widerspruch hervorzurufen. Kaum hatte der Schmuggler seine Meinung über die Bedeutung der eidesstattlichen Versicherungen beim Zoll vorgebracht, als Mr. Brown sofort auf dieses Thema einging und durch wissenschaftliche und theologische Argumente bewies, daß man unweigerlich der Verdammung anheimfällt, wenn man sich des Verbrechens des Meineides schuldig macht. Niemand von den Mitreisenden war so kühn, unverblümt eine andere Meinung zu vertreten. Aber der Schmuggler richtete eine Frage an Mr. Brown, die ihn etwas außer Fassung brachte, da er nicht sogleich eine Antwort parat hatte:
»Gibt es so viele Höllen, wie es Verbrechen gibt? Wenn nicht«, fuhr der Fragesteller fort, »sind alle Strafen gleich, dann ist aber auch ein Urteil ungerecht.«
Dies war eine kühne Behauptung in Gegenwart meines Vaters. Er bot all seinen Eifer auf und bediente sich sogar des Aberglaubens, um zu beweisen, daß es nur zwei Höllen gäbe oder besser eine und eine halbe, da das Fegefeuer nicht als vollständige Strafe angesehen werden könne. Die Kirchenväter und die modernen theologischen Schriftsteller wurden zitiert, um seine Theorie zu stützen, die ebenso einschläfernd wie rechtgläubig war. Dadurch versank ich in einen sanften und heilsamen Schlaf, wie ich ihn seit einigen Tagen nicht mehr erlebt hatte.
Kapitel 3
Mein Schlaf wurde nicht im geringsten gestört, bis wir nach Liverpool gekommen waren. Wie hielten bei einem Gasthaus an, wo ich mit meinem Vater das Abschiedsessen einnahm. Das Schiff lag vor Anker, um am nächsten Morgen auszulaufen. Nach einer leidenschaftlichen Szene zwischen mir und Mr. Brown ging ich an Bord.
Eine frische Brise kam auf, und nach drei Stunden sahen wir das Land nicht mehr. Bis zum Schluß warfen meine hübschen Augen den Albionsklippen verstohlene Blicke zu.
„Lebt wohl, heimatliche Gestade, Verwandte, Freunde und alles, was mir lieb und teuer ist, vielleicht für immer! „
Am Schluß dieses Selbstgespräches brach ich in einen wahren Strom von Tränen aus, so daß um mich herum wirklich nichts mehr außer Wasser war. Bald folgte eine solche Übelkeit, daß ich nur noch an Ruhe dachte, die mir auch in einem gewissen Umfang durch den üblichen Verlauf der Seekrankheit zuteil wurde. Nach einigen Stunden hatte ich aber einen solchen gesunden Appetit, daß ich, als ich in der Kabine Pökelfleisch fand, das kräftigste und köstlichste Mahl meines Lebens zu mir nahm.
Als sich auf diese Weise meine Stimmung etwas verbessert hatte, betrachtete ich meine Lage in einem günstigeren Licht als vorher. Mein Kummer wurde sehr gemildert, als ich an Bord einer jungen Frau begegnete, die an denselben Ort und in dasselbe Kloster geschickt wurde. So bewahrheitete sich das Sprichwort: „Ein Freund in der Not vermindert Kummer und Leid.“ Bald schon führten wir ein vertrauliches Gespräch, bei dem sie mir von ihrer Familie und Verwandten erzählte und mir den Grund nannte, weshalb sie ins Ausland geschickt wurde.
»Meine Liebe, sehr wahrscheinlich hast du schon von meiner Familie und meinen Freunden gehört. Mein Name ist Juliane Fleetwood. Mein Vater lebt einige Meilen von Lancaster entfernt. Dort hat er ein Erbgut, das im Jahr ungefähr 2000 Pfund Gewinn abwirft. Ich bin seine einzige Tochter. Meine Mutter starb vor ungefähr vier Jahren. Seit dieser Zeit kümmerte sich eine entfernte Verwandte um mich. Diese Cousine hatte ihre Fehler und der hervorstechendste war, daß sie trank. Als ich die Möglichkeit besaß, ihre Neigung in dieser Hinsicht zu fördern, gab sie mir als Gegenleistung die Freiheit, tun und lassen zu dürfen, was ich wollte. Ich lebte ohne jeden Zwang, als ich das Alter erreichte, das mich zur Frau machte. Meine Lektüren waren Liebesgeschichten und kleine Romane, die mir unsere Dienstmägde beschafften. Als ich „Pamela“ las, war ich sehr froh zu erfahren, daß sie am Ende doch noch glücklich wurde. Diese Lektüre hatte einen so nachhaltigen Einfluß auf mein Denken und Fühlen, daß ich von nun an alle Unterschiede der Geburt und des Vermögens als ein Hindernis für das Zusammenleben zweier Personen ansah, die sich wirklich lieben. Wenngleich mein Denken auch durch solche Romane beeinflußt wurde und in meinem Herzen günstige Voraussetzungen vorhanden waren, glich unser Haus doch mehr einem Nonnenkloster als dem Landsitz eines Gentlemans. Auch habe ich ein männliches Wesen, das man als Gentleman bezeichnen könnte, in unserer Nachbarschaft keines Blickes gewürdigt, außer einen Landedelmann, der ein großer Jäger war und der mehr Ähnlichkeit mit seinen Hunden und Pferden hatte, als mit einem vernunftbegabten Wesen. Seine einzigen Gesprächsthemen waren das Überspringen von Toren, die fünf Riegel haben, die Nähe des Todes, das Bieten von ungünstigen Wetten und der Gewinn von Pokalen. Eine solche Konversation war nicht nach meinem Geschmack, und ich mußte die Schlußfolgerung ziehen, daß Gentlemen, wenn sie sich auf diese Weise und über diese Gegenstände unterhielten, wenig Grund hätten, sich auf ihre Geburt und Erziehung etwas einzubilden. Als ich damals diese wenig schmeichelhaften Überlegungen bezüglich des Adels anstellte, mußte ich einen Vergleich zwischen dem Landedelmann und William, einem jungen Lakaien, ziehen, der schon seit zwei Jahren in unserer Familie war. Sein Benehmen schien mir höflicher und seine Gespräche mit den Dienstmägden, die ich belauschte, geistvoller als die des Landedelmannes zu sein. Was seine Person anbelangt, war jeder Vergleich überflüssig. Der Landedelmann war plump, unhöflich, kurzsichtig und pockennarbig. Wohingegen Williams Gesicht hübsch, sein Körper schlank und gut gebaut und sein Benehmen zuvorkommend war. Alles in allem schien es mir, daß die Natur keine so großen Unterschiede beabsichtigt hatte, wie sie mein Vater ständig zwischen den vornehmen Leuten und den Menschen machte, die von ihrer Hände Arbeit lebten.
Seit einiger Zeit hatte ich beobachtet, da William sich ganz besonders Mühe gab, mir die Wünsche von den Augen abzulesen. Meine Bewegungen verrieten ihm schon, was ich wünschte, und er gab mir erst gar keine Gelegenheit, nach etwas zu fragen. Durch diese zuvorkommende Behandlung zog er, wie ich eingestehen muß, all meine Aufmerksamkeit auf sich, und ich mußte ihm häufig einen Blick zu werfen, um zu sehen, ob er ihn günstig auf nahm.
Wenngleich sich unsere Blicke auch nur ganz selten trafen, so konnte ich dennoch in seinem Gesicht so etwas wie Verwirrung bemerken.
Er bediente mich eines Nachmittags, als ich ganz alleine in unserem Sommerhaus am Ende des Gartens Tee trank. Als ich ihm durch Kopfnicken andeutete, meine Tasse zu füllen, stieß er dabei einen solchen Seufzer aus, daß ich ihn im Scherz fragte: „Oh, Will, du bist doch nicht verliebt? „
Ich hatte noch nicht diesen Satz zu Ende gesprochen, da zitterten seine Hände so sehr, daß er auf meine Hand Wasser verschüttete, das sie verbrühte. Diesen peinlichen Vorfall nahm er sich so sehr zu Herzen, daß er in Tränen ausbrach. Darüber war ich wiederum so gerührt, daß ich im Augenblick den brennenden Schmerz vergaß, den mir das kochende Wasser verursacht hatte. Ich richtete meine Aufmerksamkeit darauf, ihn zu trösten, indem ich ihm versicherte, daß die Verbrennung nicht so groß sei und daß er über diesen Vorfall nicht so sehr bekümmert sein sollte.
Sobald ich ihn etwas getröstet hatte, trocknete er seine Tränen ab. Aber er warf mir einen Blick zu, von dem ich unmöglich eine Beschreibung geben kann. Da ich noch zu jung und unerfahren war, um die Sprache der Augen zu verstehen, glaubte ich alles darin zu lesen, was die zärtlichsten und empfindsamsten Gefühle ausdrücken können.
Seit diesem Augenblick war ich erst dann zufrieden, wenn Will mich bediente und mich begleitete. Es machte mir die größte Freude, ihn zu betrachten, wenn mich niemand dabei beobachtete. Ich entdeckte bei ihm Vorzüge, die mir vorher einfach entgangen waren. Sein Gesicht war so vollkommen wie das von Adonis. Liebesgötter lagen hinter jeder Locke seines herabwallenden, kastanienbraunen Haares auf der Lauer. Sein ganzer Körper schien als Modell für Bildhauer und Maler geeignet zu sein! Ich sehnte mich nach einer Gelegenheit, um mit ihm über die Liebe zu reden, und ich hätte mir gern noch einmal die Finger verbrüht, um über dieses Thema mit ihm ein Gespräch zu führen.
Einige Tage später konnte ich es so einrichten, am selben Platz wieder allein Tee zu trinken. Ich war aber nicht fähig, ihm auf Kommando solche Blicke zuzuwerfen, deren Sinn er für gewöhnlich so schnell begriff. Als ich ihm einen Auftrag erteilen wollte, brachte ich nur einen Seufzer über die Lippen. Kurzum, bei dieser Gelegenheit wurde kein Wort gesprochen, sondern auf beiden Seiten herrschte vollständige Verwirrung, ohne daß einer von uns es wagte, einen Blick auf den anderen zu werfen.
Am nächsten Morgen fand ich auf meinem Toilettentisch einen Brief, den ich schnell öffnete. Ich glaube, ich habe ihn in meiner Tasche, und ich werde ihn dir vorlesen:
„0 Göttin! Was ist wohl der Grund, daß ich mich so unglücklich und verwirrt fühle? Sicherlich kann es in Herzen keine Zuneigung geben, die von dem Schicksal durch einen so großen Abstand getrennt sind. Ich wage nicht daran zu denken, daß Sie auch nur einen einzigen Gedanken um einen armen Burschen wie mich verschwenden. Nein, das ist unmöglich. Ich muß in den entferntesten Winkel der Erde entfliehen, damit ich dort vergesse, daß es ein solches göttliches Wesen wie die unvergleichliche Juliana gibt. Weshalb erdreiste ich mich denn durch meine Ungezogenheit und Torheit, eine solche vortreffliche Persönlichkeit zu belästigen, wenn es doch schon die größte Anmaßung wäre, zu sagen, ich sei Ihr unterwürfigster Sklave? William Franklin. „