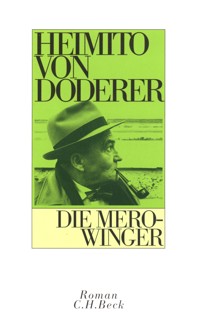
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Im Mittelpunkt des Buches steht Childerich III. von Bartenbruch, ein grotesker Zeitgenosse. Nachfahre aus merowingischem Geschlecht. Er ist bestrebt, durch ein kompliziertes System von Heiraten und Adoptionen sämtliche Verwandtschaftsgrade in seiner Person zu vereinigen. Es gelingt ihm, durch vier nach einem bizarren Plan ausgeklügelten Ehen sein eigener Vater, Großvater, Neffe und Onkel zugleich zu werden. Childerich, der letzte Merowinger im 20. Jahrhundert, verfiel auf die Vorstellung von der "Totalität der Familie" und ihrer vollen Repräsentanz im Ein-Mann-Prinzip. "La famille c'est moi." Schließlich aber gerät der Merowinger in Konflikt mit anderen Sippen, wird überwältigt, seiner weit über die Grenzen des Gewöhnlichen hinausgehenden Manneskraft beraubt und zu einem Schattendasein verurteilt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
HEIMITO VON DODERER
Die Merowinger
oder Die totale Familie
Roman
VERLAG C. H. BECK
Wappen der Freiherrn von Bartenbruch
Zum Buch
Im Mittelpunkt des Buches steht Childerich III. von Bartenbruch, ein grotesker Zeitgenosse, Nachfahre aus merowingischem Geschlecht. Er ist bestrebt, durch ein kompliziertes System von Heiraten und Adoptionen sämtliche Verwandschaftsgrade in seiner Person zu vereinen. Es gelingt ihm, durch vier nach einem bizarren Plan ausgeklügelten Ehen, sein eigener Vater, Großvater, Neffe und Onkel zugleich zu werden. Childerich, der letzte Merowinger im 20. Jahrhundert, verfiel auf die Vorstellung von der „Totalität der Familie“ und ihrer vollen Repräsentation im Ein-Mann-Prinzip: „La famille c`est moi.“ Schließlich aber gerät der Merowinger in Konflikt mit anderen Sippen, wird überwältigt, seiner weit über die Grenzen des Gewöhnlichen hinausgehenden Manneskraft beraubt und zu einem Schattendasein verurteilt.
INHALT
1: DIE HEILUNGEN
2: DIE EXISTENZGRUNDLAGEN
3: DIE RÄUMLICHEN VERHÄLTNISSE
4: DIE TOTALE FAMILIE UND DIE ENTSTEHUNGEINER BART-TRACHT
5: DER PAUST’SCHE SACK – DIE SUBKONTISTEN
6: DER MAJORDOMUS – DIE SKANDALE
7: DIE BAUSCHUNG – DIE ORGEL DES GRIMMES
8: EIN FURCHTBARER VERDACHT PROFESSOR HORNS.HORN VERFÄLLT DER GELDGIER
9: HULESCH & QUENZEL
10: DAS FRAGWÜRDIGE KAPITEL
11: DIE BEUTELSTECHER
12: DAS SMOKINGERL
13: PÉPIN
14: ELEMENTE UND SUBELEMENTE
15: DER GROSSE BEUTELSTICH
16: EINLEGEN VON PEINFLASCHEN BEI CHILDERICH III. –GRIMM CHILDERICHS – DIE WINTERMANDLN
17: FISTULIERUNG BACHMEYERS
18: UNTERGANG PROFESSOR HORNSIM TOBEN DER ELEMENTE
19: HUMANE ANWENDUNG VERLÄNGERTER BLATT-ZANGEN
20: EINZELBEHANDLUNG CHILDERICHS III. – TRIUMPH DER WUTHÄUSLEIN –WIEDERGEBURT PROFESSOR HORNS DURCH DIEWISSENSCHAFT
21: TIMURISATION DER FAMILIE KRONZUCKER
22: KRIEGSVORBEREITUNGEN –SCHNIPPEDILDERICHS WIEDERKEHR
23: VERPRÜGELUNG DES DOCTORS DÖBLINGER
24: DIE SCHLACHT AM WINDBÜHEL
25: ÜBERGANG ZUM STELLUNGSKRIEGE –SCHNIPPEDILDERICHS ABSCHIED –CHILDERICHS III. AUSZUG
26: STURM AUF THEUDEROVILLE – SCHEERUNG UNDENTMANNUNG CHILDERICHS III.
27: DIE EYGENER
28: EPILOG
STAMMTAFEL
Fußnoten
Dem hochverehrten Freunde
BAURAT HANS STUMMER
herzlich zugeeignet
vieler glücklicher Stunden
dankbar eingedenk!
H. D.
Verily even, I think, no ‘story’ is possible without its fools –
Henry James, Preface to The Princess Casamassima
*
Verprügelt mir nicht Jeden! Dafür aber die Richtigen saftig.
Ein Wort Childerichs III. an seine Knechte
*
Die Wut des Zeitalters ist tief.
Ausspruch des Majordomus Pépin von Landes-Landen
*
Doch ein Geschlecht ist schwerer als der Mensch.
Ausspruch Childerichs III.
1
DIE HEILUNGEN
Bachmeyer, ein kleiner, lebhafter, sehr gut gekleideter Mann mit schwarzem Spitzbarte, stieg die Treppen zur Privat-Ordination des Direktors der neurologischen und psychiatrischen Klinik, Professor Dr. Horn, hinauf und ließ dabei einen spürbaren Duft-Streifen von Lavendelwasser hinter sich: bitter und rundlich zugleich, ein sozusagen comfortabler Geruch. Als ihm geöffnet war, betrat er die weiten Vor-Räume und, auf die Minute bestellt, auf die Minute gekommen, hatte er nicht lange Zeit, sich in dieser neuen Umgebung umzusehen: schon erschien eine weißgekleidete, blond überschopfte, hübsche, große Krankenschwester – ihre Augen konnte Bachmeyer nicht recht sehen, wegen ihrer Brillen, zu seinem Glücke! – und sagte, der Herr Professor lasse Herrn Bachmeyer bitten. Im Ordinationsraume selbst ward der Patient alsbald vom Arzte sozusagen überwölbt, wie von einem vorhängenden Felsen: der Professor trug ebenfalls reinstes Weiß, einen Ärztekittel, wovon aber ungeheuer viel vorhanden war, ganz oben erst gekrönt vom Antlitze, vom runden, breiten Barte, von den blinkenden goldnen Brillen. Es gehörte Horn zu jenen Leuten, die ständig vor Wohlwollen schnaufen und, auch wenn sie nichts reden, immer irgendwelche kleine Töne von sich geben, eine Art asthmatisches leises Piepsen, das in seltsamer Weise an jenes feine Getön erinnern kann, wie es eine gewisse Art von Schmetterlingen zu erzeugen vermag, die zwar in Europa einheimisch, aber doch selten ist: wir meinen den dicken, samtigen ‚Totenkopf‘. So piepste denn Horn, wenn er nicht gerade schnaufte oder sprach. Bachmeyer hatte Platz genommen und Horn ließ seine gletscherweißen Massen ihm gegenüber nieder, rückte die Brillen, sah auf Bachmeyers elegante Schuhe hinab und sagte: „Nun, Herr Bachmeyer, wo fehlt’s denn, was haben Sie denn für Beschwerden?“
Bachmeyers intelligente Augen, glänzend wie facettierte schwarze Jettknöpfe, bewegten sich lebhaft, während er antwortete, korrekt sprechend, urban und wohlerzogen:
„Die Wut, Herr Professor. Ich leide unter schweren Wutanfällen, die mich entsetzlich anstrengen und sehr mitnehmen.“
„Hm“, sagte Horn mit leichtem Schnauben und Schnaufen, den Blick immer auf Bachmeyers Schuhspitzen geheftet, „können Sie mir, Herr Bachmeyer, vielleicht sagen, welchen Grund diese Wutanfälle haben?“
Bachmeyers Augen blitzten auf wie das Mündungsfeuer bei einer Schusswaffe; zugleich beobachtete der Professor, wie die Spitzen seiner Schuhe sich immer weiter voneinander entfernten, so daß die auseinander gedrehten Füße jetzt schon einen stumpfen Winkel bildeten. Zugleich begannen beide Füße eine Art verhaltenen Tretens und Stampfens, ohne daß freilich die Sohlen sich eigentlich vom Boden lösten. Wenngleich Bachmeyer die folgenden Worte urban und höflich wie das Frühere sprach, schien doch sein Grimm jäh zu schwellen, und er zerrieb geradezu, was er sagte, zwischen den Zähnen. Zugleich wurde seine Stimmlage jetzt hoch, fast fistelnd:
„Wenn ich den Grund wüßte, Herr Professor, wäre ich vielleicht gar nicht zu Ihnen gekommen.“
Horn hielt sich dabei nicht auf; er hätte wohl sagen können, daß er nicht eigentlich nach dem Grunde, sondern nur nach den Anlässen der Wutanfälle habe fragen wollen und daß der Ausdruck ‚Grund‘ von ihm versehentlich gewählt worden sei. Inzwischen aber hatten sich Bachmeyers Fußspitzen noch erheblich weiter auseinander gedreht und der Professor sagte beiseite und halblaut zu der Ordinationsschwester Helga, die herangetreten war:
„Hundertunddreißig Grad. Nasenzange.“
Schon saß das Instrument, etwa von der Größe eines kleinen Schmetterlings – es sah auch ähnlich aus – auf Bachmeyers Nase (dem Horn durch einen Augenblick sanft die Hände festhielt), in der Art eines Kneifers, nur erheblich weiter unten. Es war eine feine und lange Schnur daran befestigt, deren Ende Schwester Helga in der Hand hatte; jedoch war die Schnur nicht etwa gespannt, sondern locker und durchhängend.[1] Die Schwester blickte auf den Patienten; ihre schmalgeschlitzten Äuglein hinter den Brillengläsern aber zeigten eigentlich keinen richtigen Blick, sondern nur die dünne und wäßrige Substanz einer fast unbegreiflichen, alleräußersten Frechheit, und einer sanften Befriedigung eben darüber.
„Wir beginnen nun gleich mit der Behandlung“, sagte Horn zu dem perplexen Bachmeyer und schnaufte begütigend. „Bitte jetzt keinerlei heftigere oder plötzliche Bewegung zu machen, es könnten sonst leicht Beschwerden eintreten. Und langsam aufstehen, ja, so, Herr Bachmeyer.“ Er drehte ihn sanft herum, so daß Bachmeyer mit dem Rücken gegen den Arzt stand. Die Schwester betätigte einen elektrischen Kontakt: im nächsten Augenblicke schmetterte der Krönungsmarsch aus Giacomo Meyerbeers Oper ‚Der Prophet‘, von einem Lautsprecher machtvoll verstärkt, in den Raum. Dieser gewaltige Rhythmus löste endlich Bachmeyers Sohlen ganz vom Boden. Die Fußspitzen weit auseinandergestellt – der Fußwinkel mochte jetzt bald 140 Grad betragen – begann er zu treten, ja, bald zu stampfen, und bewegte sich so, immer die Fußspitzen seitwärts, mit kleinen Schritten fort, bald in ein noch kraftvolleres Stampfen übergehend: rhythmisierter, geordneter Grimm. Helga schwebte voran. Sie glich einem Botticelli-Engel, aus dessen Augen jedoch äußerster Hohn blinzte.
So leitete sie Bachmeyern, das Ende der Schnur, die zur Nasenzange lief, leicht emporhaltend, den anderen Arm tänzerisch in die Hüfte gestützt. So leitete sie Bachmeyern wie einen Bären. Die Schnur hing durch. Eine geringste Anspannung nur hätte, vermöge des sinnreichen, kleinen Hebelwerkes der Nasenzange, dem Wütenden einen äußersten, ja, fast betäubenden Schmerz zugefügt und ihn unverzüglich gebändigt, wenn er etwa versuchen wollte, aus dem rhythmisch geordneten Wutmarsch seitwärts auszubrechen. Der Professor hatte indessen aus zahlreichen Pauken- und Trommelschlögeln, Klöppeln, Klöpfeln und hölzernen Hämmern, die in Taschen an der Wand gereiht waren, zwei Instrumente gewählt – lange Paukenschlögel, vorne gut umwickelt – und schritt hinter Bachmeyern drein, den Rhythmus mäßig auf dessen Schädel paukend, wobei er die Schlögel elegant und routiniert aus dem Handgelenke fallen ließ. So bewegte sich dieses dreigliedrige therapeutische Wut-Element unter Trompetenschall durch das weite Ordinations-Zimmer, sodann durch eine im Hintergrunde offen stehende Flügeltüre und den benachbarten Raum, um schließlich in ein sehr ausgedehntes Gemach einzutreten, welches völlig leer war, bis auf den lang ausgezogenen Tisch in der Mitte – es war ein solcher, wie man ihn oft in sehr groß dimensionierten Eßzimmern sehen kann – welcher, ganz nach Art der Schaukasten oder Schaugestelle in den Museen, mehrere Stufen von rotem Samt zeigte. Sie waren in Abständen mit billigen Porzellan- oder Steingutfiguren besetzt: Mädchen mit Harfen, Tänzerinnen mit Tamburins, Knaben mit Hirtenflöten, weiblichen Figuren, die Krüge auf der Schulter hielten, und ähnlichem Unfug mehr. Bachmeyers Stampfen hatte sich während des Wutmarsches erheblich gesteigert, zur Befriedigung des Professors, der ja nur bei kräftigem Durchkochen und Durchtreiben des Grimms etwas für seine therapeutischen Ziele hoffen durfte; als man in den letzten, großen Raum kam, trat Bachmeyer bereits derart machtvoll auf, daß der Boden zitterte und mit ihm alle Figuren auf dem Tische. Der Professor, nachdem er sich durch einen kurzen Blick davon überzeugt hatte, daß Bachmeyers Fußwinkel noch keineswegs abnahm, sondern eher größer zu werden im Begriffe war, vertauschte blitzschnell die Paukenschlögel gegen zwei hölzerne Hämmer, welche in den Taschen seines weißen Kittels staken: die rhythmische Applikation wurde zudem jetzt noch bedeutend kräftiger als vorher erteilt, was angesichts der dicken, schwarzen Haarwirbel Bachmeyers dem Arzte als angängig erschien; allerdings waren die Hämmer an der Schlagfläche mit Leder gepolstert. Man war noch keine zwei Schritte an dem Tische mit den roten Samtstufen entlang gegangen, als Bachmeyer blitzschnell, ja, geradezu mit Gier, eine der Figuren ergriff und sie zu Boden schmetterte, so daß die Scherben weithin über das glatte Parkett sprangen. „Eins“, sagte der Professor laut, und Schwester Helga wiederholte: „Eins!“ Während des weiteren Umganges consumierte Bachmeyer noch zwei Figuren, darunter einen Faun mit Spitzbart und Bocksbeinen. Jedesmal wurde laut mitgezählt. Schon nach der zweiten Figur begann der Fußwinkel rapid zu sinken und das Stampfen Bachmeyers schwächte sich mehr und mehr ab. Nach der dritten Figur sagte der Professor laut „neunzig“, die Schwester wiederholte, die Applikation ward neuerlich modifiziert, von den Hämmern wieder zurück auf die Schlögel, welche Horn jetzt nur leicht auf Bachmeyers Haupt tanzen ließ; dieser langte schließlich vorne im Ordinationszimmer mit dem Fußwinkel eines normalen und menschlichen Ganges an. Noch blieb die Nasenzange am Ort. Erst nachdem der Arzt durch einen kurzen, mäßig starken Riss an Bachmeyers Bart – es erfolgte darauf keinerlei Reaktion – sich von der nunmehr eingetretenen Harmlosigkeit dieses Patienten überzeugt hatte, ward sie entfernt.
„Ich danke vielmals, Herr Bachmeyer“, sagte Professor Horn, sich mit seiner ganzen Masse langsam verbeugend (während im Blick der Schwester Helga die Frechheit gallertig wie Eierklar stand), „Sie werden jetzt zweifellos ein Nachlassen der Beschwerden während der nächsten Tage beobachten können; die Reaktionen waren ja sehr günstig, durchaus erfolgversprechend. Doch möchte ich empfehlen, in zehn Tagen wieder vorzusprechen; wie Sie wissen, ordiniere ich für solche speziale Fälle jeden 1., 10. und 20. des Monates; das wäre also das nächste Mal am 20.“
Schon hatte Schwester Helga in einem Buche nachgeschlagen und rief Bachmeyern, freundlich lächelnd, die genaue Uhrzeit seines Erscheinens zu. Horn verbeugte sich nochmals, vor Wohlwollen schnaufend. Und damit ging Bachmeyer ab: in tiefstem Staunen, leicht schwitzend – dies trieb den Lavendelduft noch mehr heraus – und in glücklicher Benommenheit. In tiefstem Staunen: nicht so sehr über alles, was ihm jetzt widerfahren war, sondern über das Fehlen der Wut, ja, mehr als das, über das augenblickliche Fehlen jedes Verhältnisses, jeder Beziehung, jeder Möglichkeit zur Wut oder zum Grimme. In Bachmeyer war die unschuldige Freundlichkeit und Sanftmut eines gutgearteten Jünglings, während er leichten Schrittes über den Treppenabsatz vor der Ordination des Professors Horn ging. Eben als er dann die ersten Stufen betrat, kam von unten ein kleiner, sehr bärtiger Herr, den er im Vorbeipassieren versehentlich leicht streifte; Bachmeyer lüftete den Hut, entschuldigte sich rasch und lief leichtfüßig die Treppen hinab, voll tiefer Bewunderung für den Arzt, von dem er eben kam, und beflügelt von der Aussicht, daß ihm wirklich könnte geholfen werden.
Hätte Bachmeyer sich umgewandt – zu seinem Glücke tat er’s nicht – dann wäre ihm vielleicht das Mark gefroren vor Entsetzen über den Blick, welchen das vielfach bärtige Wesen, das er auf der obersten Stufe leicht gestreift hatte, ihm nun nachsandte: beispiellose Wut, gräßlicher Grimm brachen als gelblich-grün aufleuchtender Strahl aus den Augen des Kleinen: ja, die Wut stand wie in bebenden Türmen ob seinem Haupte. Er schritt über den Treppenabsatz auf Horns Türe zu, indem er die Knie weit höher hob, als zum Gehen erforderlich gewesen wäre, er ging im Hahnentritt; und einem kundigen Auge hätte sein Fußwinkel allein schon gesagt, daß hier eine bedenkliche Lage herrschte. Der Professor, als er des Kleinen ansichtig wurde – welcher den Namen eines Freiherrn Childerich von Bartenbruch trug und Childerich III. genannt wurde, zum Unterschiede von seinem Vater und Großvater, die ebenso geheißen – der Professor also erkannte sogleich die Gefährlichkeit des Zustandes, in welchem sich dieser ihm schon lange bekannte Patient heute befand; und Horn wußte auch sehr wohl um die bestehende Möglichkeit, daß zwei oder drei Sekunden später das kleine, bärtige Wesen tief in seine Schulter verbissen sein konnte, mit einem ungeheuren Satze ihn anspringend. Jedoch der Professor dosierte meist richtig und rechtzeitig. Seine flachen Hände gebrauchend, die ungefähr die Größe von Suppentellern haben mochten, begann er sofort, dem Herrn von Bartenbruch derart kräftige Ohrfeigenpaare zu applizieren, daß der Kleine bald mit rotem Gesicht im Ordinationszimmer nur so herumtaumelte: nach dem sechsten Ohrfeigenpaar konnte schon die Nasenzange gesetzt und der Baron auf den Trab, das heißt auf den Wutmarsch, gebracht werden. Helga schwebte voran. Immerhin erst nach der fünften Figur – im ganzen consumierte Herr von Bartenbruch heute deren neun – begann der Fußwinkel zu sinken, so daß Professor Horn einen zweiten Umgang vornahm, an dessen Beginn man noch auf 100–110 Grad stand; und erst ganz am Ende trat die Normalisierung ein und wurde das Maß eines menschlichen Ganges erreicht. Bartenbruch mußte sofort gebadet und in einem für solche Zwecke neben der Ordination befindlichen Ruhe-Raume gebettet werden.
2
DIE EXISTENZGRUNDLAGEN
Der Doctor Döblinger, ein nicht eben unbekannter Schriftsteller, befand sich zu jener Zeit, als Herr von Bartenbruch Patient des Professors Horn wurde – also etwa ein halbes Jahr vor dem Erscheinen Bachmeyers am gleichen Schauplatz – in einer äußerst bedenklichen Lage. Er war zwischen zwei Verträgen, einen abgelaufenen und einen noch nicht wirksamen, zu sitzen gekommen, wie zwischen zweien Stühlen, auf dem Boden also, auf dem Boden des Dalles, um’s ganz gradaus zu sagen. Die Lage wurde daumschräublich: und damit ließen denn die Fähigkeiten, bei aller Zähigkeit, doch allmählich gar sehr nach. Zudem bestand Gefahr der Melancholie. Wenn es jemand durch längere Zeit schlecht geht, wird das Benehmen der Menschen gegen ihn auch gerade kein besseres, ja, es beginnen deren Manieren einen Schwund zu zeigen, welcher in unangenehmer Weise dem des Geldes parallel läuft. Dies kann zu tief verstimmenden Betrachtungen führen, und solchen pflegte sich der Doctor Döblinger sehr zur Unzeit hinzugeben, nämlich am Morgen. Als er nun einmal um acht, zwar schon glatt rasiert, aber ebenso glatt arbeitsunfähig, beim Frühstück saß, klingelte es schwach, gewissermaßen schüchtern und höflich, nicht aber so wie der Briefträger das zu machen pflegte, der immer zweimal kurz den Knopf drückte. Döblinger, nachdem er durch’s Vorzimmer gegangen war und geöffnet hatte, erblickte vor der Türe die ungeheuren, gletscherweißen, leicht überhängenden Massen Professor Horns im Ärztemantel, ohne allerdings zu wissen, wer das sei und was solcher Aufzug vorstelle; denn der Professor hatte die Ordination hier eben erst eingerichtet; und Döblinger, in seinen Sorgen, war weit weniger aufmerksam und sehscharf als ehedem. „Meine Verehrung, Herr Doctor“, sagte Horn, stark vor Wohlwollen schnaufend, „gestatten Sie, daß ich mich Ihnen bekannt mache. Mein Name ist Horn. Professor Horn.“ Sodann piepte er leise: „Würden Sie mir, lieber Doctor, eine Unterredung von zehn Minuten in einer geschäftlichen Angelegenheit gewähren? Und wollen Sie, bitte, gütigst entschuldigen, daß ich im Arbeitskleid bei Ihnen erscheine! Aber, wie’s nun einmal ist – die Pflichten drängen.“ Döblinger beneidete in diesen Augenblicken den consolidierten Koloß; ihn drängten zur Zeit die Gläubiger mehr als andere Pflichten. Er bat den Professor, einzutreten und Platz nehmen zu wollen. Horn, der sein Cigarren-Etui hervorgezogen hatte und die Erlaubnis zum Rauchen erbat – Döblinger konnte nur mit Cigaretten dienen – gab während des Entzündens der Cigarre eine solche Fülle der Schnauf- und Pieplaute von sich, daß sie gleichsam nach allen Seiten aus ihm hervordrangen, wie die Blumen aus einer Vase. Inmitten dieses Straußes oder Kranzes von unarticulierten Äußerungen saß er nun bergesgleich und schmauchend. Sodann begann er nicht ohne eine Art von beschwerlichem Behagen – wobei die Pieplaute sich dazwischen wieder hören ließen – seine Sache darzulegen, während es Döblingern eben einfiel, daß er ja diesen Gelehrten dem Namen nach längst kannte. „Nun, verehrter Herr Doctor, ich habe also jetzt grad über Ihnen meine Praxis für die Privatpatienten. Hm. Da mußte ich mit dem Hausherrn ein besonderes Abkommen treffen, ja, sozusagen wegen des dabei habituellen Lärms. Das berührt nun auch Sie, ja, Sie vor allem. Ich möchte mit Ihnen, hm, sozusagen ein gentleman agreement treffen. Ja. Hm. Es sind besonders drei Tage im Monate – immer der 1., 10. und 20. – wo Ihnen, Herr Doctor, der Aufenthalt hier in Ihren Zimmern schwerfallen wird, ja, hm, ich möchte sagen, für Ihre literarische Arbeit kommt die Wohnung während dieser drei Tage des Monates kaum in Frage. Kaum. Das bedeutet nun eine empfindliche Unterbrechung, Störung, Schädigung für Sie, Herr Doctor. Es war die Loyalität immer mein Lebensprinzip, im Praktischen wie im Theoretischen, sozusagen, hm (piep!). Ich möchte Ihnen daher auf Grund eines, hm, sozusagen Still-Halte-Abkommens zwischen uns – paradox genug, wo es sich doch um den Lärm handelt! – eine angemessene monatliche Entschädigung anbieten und gleich für’s nächste Vierteljahr im voraus übergeben. Und da habe ich mir nun überlegt....“
Die Gedanken des Herrn Doctor Döblinger kamen nicht nur sehr schnell auf den Trab, sondern sie gingen alsbald in einen munteren Schweinsgalopp über. Was nun den Professor bewog, eine verhältnismäßig sehr hohe Summe anzubieten – Lärm-Miete möchte man sagen! – das ließ der Doctor Döblinger gerne dahingestellt. Vielleicht hatte Horn in seinem früheren Ordinations-Lokal unangenehme Erfahrungen gemacht, vielleicht eine gerichtliche Klage, vielleicht ein unliebsames Aufsehen erregt: genug, er brachte hier ein offenbares Opfer, um die in Frage kommenden Faktoren von vornherein zu neutralisieren, ja, an seinen Unternehmungen eigentlich zu interessieren. Zudem, er mußte sich wohl darüber im Klaren sein, daß jeglicher andauernde, außergewöhnliche Lärm für einen Literaten ein ganz besonderes Übel bedeutet: so zog er denn gleich den Doctor Döblinger großzügig in den Kreis seiner eigenen Interessen. Zahlen macht Frieden. Zudem zahlte ja nicht der Professor Horn; sondern es bezahlten seine Patienten.
Man wurde einig, wie sich leicht denken läßt. Der empfangene Betrag schloß für den Doctor Döblinger die klaffende Lücke im Existenzplan. Und, Horn hatte ihn noch nicht verlassen, da wußte er schon, wohin zu flüchten während der kritischen Zeiten. Er hatte sich einst verschiedener Wissenschaften beflissen und zahlreiche Prüfungen abgelegt; das berechtigte ihn auch heute noch, in einem staatlichen Forschungs-Institute, das sich hier in der Stadt befand, einen Arbeitsplatz zu belegen. Davon gedachte er nun, wenigstens für drei Tage im Monat, Gebrauch zu machen.
Freilich bedeutete die Sicherung einer ungestörten Privatordination vor allem für den Professor eine die Existenzgrundlagen berührende Angelegenheit; denn jene Grundlagen waren für ihn, angesichts seiner mehrköpfigen Familie und eines fast herrschaftlich zu nennenden Haushaltes, durch die Professur allein keineswegs noch gegeben. Horn bewohnte draußen vor der Stadt eine der schönsten Villen im Rebengelände.
Er plagte sich redlich, hatte es weit gebracht und bezog ungeheure Honorare. Die gewöhnliche Kunst mancher Psychiater besteht bekanntlich darin, irgendwelche Gesunde, deren sie habhaft werden können, ad hoc verrückt zu machen, so daß am Ende die Diagnose stimmt und die Behandlung fortgesetzt werden muß; um das Letztere war’s dem Professor freilich auch zu tun; und für’s Verrücktmachen ad hoc hatte er seine eigene Methode, eine eigentlich außermedizinische Methode, die er durch Laien üben ließ, wovon später. Aber immerhin, er leistete doch was, er ging über die gewöhnliche Psychiatrie weit hinaus, er half den Leuten wirklich, besonders am 1., 10. und 20. des Monates. Bachmeyer etwa hatte gleich nach dem ersten Besuch eine entschiedene Besserung verspürt. Horn plagte sich redlich. Eine ambulante Behandlung, wie etwa jene Childerichs III., war auch körperlich in hohem Maße anstrengend. Er tat was. Er paukte die Kerle, ließ sie unter Umständen auch baden, frottieren und betten. Er führte über jeden genaue Aufzeichnungen und wußte von ihnen weit mehr, als gemeiniglich ein Arzt von einem Patienten weiß.
Das war auch in seinem Falle unumgänglich notwendig, der außermedizinischen Methoden wegen. Die meisten der Wutkranken lieferten ihm die öffentlichen Ämter, Behörden, Stellen, mit denen die Patienten als größere Geschäftsleute – wie etwa Bachmeyer und viele andere – laufend zu tun hatten (nur bei Childerich waren die Anlässe anderer Art). Der Professor wußte fast immer genau im voraus, wann einer seiner Patienten auf einem Amte vorzusprechen hatte und auch bei wem: er hatte sich ganz bewußt mit der Zeit eine gewisse Kenntnis der Behörden und der dort in Frage kommenden Personen angeeignet. Der Ursprung seiner Methode erscheint noch als ein durchaus humaner, nämlich als ein sehr weitgehender Pflichtbegriff von ärztlicher Obsorge: dieser veranlaßte Horn bei schwierigen Fällen, also insbesondere bei Wut, sich vor dem Erscheinen des betreffenden Patienten auf einem Amte mit der jeweils dort maßgebenden Persönlichkeit in Verbindung zu setzen und eine Berücksichtigung der schwankenden Gemütslage, erhöhten Erregbarkeit und Reizbarkeit seines Schützlings zu erbitten. Weil nun Horn solches unter dem ganzen Gewichte seiner Stellung und seines Namens vorzubringen wußte – welches Gewicht auch auf dem rein akustischen Wege wie ein Überhang aus dem Telephon sich wölbte, durch Horns schnaufende Vaterstimme beinah anschaulich vermittelt – weil er also am Telephon unerschütterlich mit seiner ganzen Kompetenz auftrat, so geschah es selten, daß man seine Einmischung oder Intervention geradezu barsch zurückwies (bis auf einen Sektionsrat etwa, der ihm einmal sagte: „Dann lassen Sie eben Ihre hochempfindlichen Herren Narren nicht frei herumlaufen!“). Was freilich nicht ausschloß, daß man sich über solche Anrufe des Direktors der neurologischen und psychiatrischen Klinik auf den Ämtern gewaltig ärgerte und sie als durchaus unangemessen empfand. Horn mußte das bald merken. Oft kamen die Patienten nach ihren Amtsgängen fürchterlich zugerichtet in die nächste Sprechstunde, mit erheblich erhöhtem Fußwinkel und einem dann folgenden verstärkten Figurenverbrauch, der jenen der letzten Ordination weit hinter sich ließ. So gingen die Früchte wochen- und monatelanger Behandlung verloren, und manch einer, der auf Ämtern gewesen, bedurfte jetzt einer Vor-Behandlung, wie wir sie bei dem Freiherrn von Bartenbruch kennen gelernt haben, der zwar für seine Person einen sozusagen außerämtlichen Fall darstellte, dafür aber den schwierigsten in des Professors Privatpraxis überhaupt.
Diese schwoll. Bebend vor Wut kamen die Leute von den Ämtern. Des Professors telephonische Anrufe besserten nichts, ja, sie verschlimmerten alles: und Horn mußte dessen bald inne werden. Personen, die über einen Fußwinkel von 110 Grad und drei Figuren kaum mehr hinausgelangt waren und höchstens einmal im Monate noch zwecks Bepaukung vorzusprechen hatten, füllten nun wieder am 1., 10. und 20. das Wartezimmer. Jetzt aber geschah das Entscheidende: der Professor blieb trotzdem bei seiner Gepflogenheit der telephonischen Anrufe vor den Amtsgängen, er gab diese untaugliche Methode nicht auf. Damit aber tat er einen entscheidenden Schritt, einen Schritt hinüber zu einer sehr tauglichen Methode – ad hoc.
Es ist schwer zu sagen, wann diese Wendung sich bei ihm vollzogen haben mag, und wie dies im einzelnen und auch im Seelischen geschah. Das Resultat bestand jedenfalls darin, daß eine in ihren Ursprüngen humane Absicht auf den Kopf gestellt ward. Am allermerkwürdigsten aber erscheint es, daß man Horns gleichbleibende telephonische Anrufe bei den Amts-Stellen nicht etwa mit steigender und schließlich irgendwo hervorplatzender Ungeduld hinnahm. Vielmehr wurde man zusehends entgegenkommender, ohne daß jedoch die erwähnten Auswirkungen sich irgendwie änderten oder gar abschwächten: ja, sie schienen sich eher zu verstärken; fast sah es so aus, als hätte man den Professor in einer wahrhaft sublim zu nennenden Weise noch früher richtig verstanden, als er sich selbst. Bei alledem ist es nur als ein hinzutretender, keineswegs als entscheidender Umstand anzusehen, daß Horn um diese Zeit begann, auch persönlich in Beamtenkreisen zu verkehren, wobei sich Gastfreundschaft und Entgegenkommen des Professors in jeder Hinsicht glänzend erwiesen. Es muß abgelehnt werden, daraus irgendwelche konkreten, und also schon zu weitgehenden, Folgerungen zu ziehen.
Dieses ganze System – man kann es doch wohl so nennen – aber hatte, wie eben jedes System, ein Loch. Nichts Menschliches ist vollkommen. Das Loch hieß Regierungsdirector Dr. Schajo; wovon später.
3
DIE RÄUMLICHEN VERHÄLTNISSE
Zilek war ein vorzeitig pensionierter Oberlehrer und hatte die unter Doctor Döblingers Zimmern gelegene Wohnung inne. Zilek war so dünn, daß man, wenn er nur einen Türspalt öffnete, ihn schon zur Gänze erblicken konnte. Sein Wesen entsprach auch sonst seinem Namen, der ja an den Angriff einer Stechmücke denken läßt. Sehr zum Unterschiede von dem über ihm wohnenden Schriftsteller war er stets aufmerksam und bei voller Sehschärfe, eine vigilante Natur und ein Adnotam-Nehmer von Profession. Der Einzug Horn’scher Anstalten in’s Haus war ihm also keineswegs entgangen, noch weniger die umfängliche Person des Professors, den er wiederholt schon senkrecht empor hatte steigen sehen, im Glashause des Aufzuges nämlich. Diesen benutzte der Professor stets, und auch die meisten seiner Patienten taten das; es war ein Punkt im Mietvertrage, daß jenen der Lift zur Verfügung stehen müsse, denn Horns Pauklokal lag im vierten Stock. Gerade aber die Paukanden (nicht Paukanten!), welche am 1., 10. und 20. jedweden Monates in Erscheinung zu treten pflegten, gingen dann allermeist zu Fuße die Treppen hinauf, sie zeigten wenig Lust, im Aufzug zu fahren, mochte gleich die Portiersfrau oder Hausmeisterin jeden jedesmal in der höflichsten Weise dazu einladen, sich doch hinauf fahren zu lassen – um so einladender, als Frau Soflitsch eine hübsche, ungewöhnlich dralle Weibsperson von kaum fünfundzwanzig Jahren vorstellte. Sie bezog von Professor Horn geradezu ein festes Gehalt und daneben einen stets fein rieselnden Regen von Trinkgeldern; auch ihr langer, dünner Mann, Herr Soflitsch, von Beruf Tischler, ward beschenkt, obgleich man diesen Tischler Soflitsch fast niemals zu Gesicht bekam, denn er arbeitete auswärts. Es läßt sich also leicht denken, daß die Hausbesorgerin sich der Horn’schen Sachen befliß und stets zur Hand war, wenn jemand zum Paukboden hinaufgelangen wollte. Aber eben die Paukanden, wie schon gesagt, waren es, die allermeist mit leichtem Knurren – bei Childerich klang es manchmal fast bedrohlich – an ihr vorbeiwischten, um dann auf der Treppe in ein sozusagen gravitätisches Zeitmaß zu fallen; man möchte eher sagen, daß sie stapften, als daß sie stiegen, und manche traten dabei sehr fest auf (es klang nach Selbstbewußtsein), so daß man sie noch lange stapfen und stampfen hörte, bis herunter in die Portiersloge, mochten sie gleich schon im zweiten oder dritten Stockwerke sich aufwärts bewegen. Besonders bei Childerich war es meist so; jedoch nicht immer. Allmählich fiel dieser Umstand der Portiersfrau auf. Mitunter, wenn auch selten, pflegte dieser Wüterich ohneweiteres den Lift zu benutzen; das war nun freilich noch auffallender: am allermeisten aber die durchaus liebenswürdige Natur des kleinen, sozusagen vielfach und auf eine schwer zu überblickende Weise bärtigen Herrn, der es an andeutungsweisen Hofierungen der hübschen Soflitsch während des Aufwärts-Schwebens nicht fehlen ließ, und beim Aussteigen auch nie an einer stattlichen Belohnung. Ein nächstes Mal wieder schoss er jedoch im Hausgang unten knurrend an ihr vorbei, und dann hörte man ihn gewaltigen Schritts die bebenden Treppen hinaufsteigen, als begäbe sich der steinerne Gast aus dem Don Giovanni in voller Person zu Professor Horn, nicht aber der kaum mehr als einen Meter und sechzig messende Freiherr von Bartenbruch.
So spiegelte sich die überaus schwankende Verfassung dieses Patienten innerhalb der Frosch-Perspektive einer Portiersloge ab. Für Professor Horn, also vom Standpunkt der Wissenschaft und einer sowohl medizinischen wie außermedizinischen Praxis, sah der Fall allerdings wesentlich ernster und komplizierter aus.
Es gehörte der Professor nicht zu jener psychiatrischen Schule, die ihre Macht vorzüglich darauf gründet, daß ein ‚ad hoc‘ Vorbehandelter vom Facharzte jederzeit in eine Anstalt eingewiesen werden kann: damit hat man freilich den Hebel vieler Dinge des Lebens in der Hand und auch solcher, die mit der Wissenschaft nichts zu tun haben. Derartige Eventualitäten erwog der Professor bei Paukanden nie. Einerseits waren die Honorare, welche diese Art von Patienten zahlen mußte, die höchsten überhaupt, andererseits aber, und damit im Zusammenhange, wollte der Professor die Leute im wissenschaftlichen Sinne überhaupt nicht für Kranke halten; und das waren sie ja wohl auch nicht. Sie befanden sich nur sozusagen in permanenter Ad-hoc-Vorbehandlung. Diesen Zustand in der Schwebe zu halten wurde durch Dosierung der außermedizinischen Mittel möglich. Wir haben schon gesehen, daß Horn im richtigen und rechtzeitigen Dosieren Meister war. Bald verfiel er darauf, wenn die Ad-hoc-Wirkung der außermedizinischen Methoden zu nachdrücklich ward, den telephonischen Anruf vor dem Amtsgang eines Patienten einfach zu unterlassen – und jedesmal erschien dann der betreffende Fall ohne erhebliche Steigerung des Fußwinkels in der Ordination, und auch der Figurenverbrauch stieg nicht nennenswert an. Schon diese Umstände allein zeigen uns, wie sublim und richtig man den Professor in einer seinem Kompetenzbereich entrückten Sphäre verstand. Späterhin, als er mit solchen Kreisen die persönliche Fühlung schon in zunehmendem Maße und vielfältig aufgenommen hatte, blieb in ganz vereinzelten Ausnahmefällen, wenn innerhalb des ‚ad hoc‘ der Überdruck allzu steil und etwa bis an die Internierungsgrenze anstieg, immer noch die sich jetzt eröffnende Möglichkeit einer direkten Fühlungnahme: und das nun wirklich im ursprünglichen durchaus humanen Sinne der Obsorge. Ausnahmslos sanken dann Fußwinkel und Figurenverbrauch rapid ab; so daß der Professor sich entschloß, diese außermedizinische Therapie höchst selten und immer nur einmalig zu applizieren.
Childerich jedoch befand sich außerhalb solcher Einwirkungsmöglichkeiten und Regulative. Seine geradezu beispiellosen Wut-Anfälle standen mit Amtsgängen in keinem Zusammenhange, sie waren also keine amtswegigen. Die schwersten Wut-Anfälle Childerichs hatten ihre Anlässe bisnun innerhalb des freiherrlichen Familienkreises gehabt, dessen ganz ungewöhnlich complizierte Verhältnisse freilich auch durch schärfste finanzielle Interessen tief und finster grundiert waren.
Zurück zu Zilek. Er versuchte, aus der Portiersfrau etwas über Horn herauszukriegen, ganz vergebens freilich, wie man sich leicht denken kann, denn die Hausmeistersleute standen fest zu ihrem hochverehrten Herrn Professor. Nicht lange danach zilkte einmal morgens schüchtern die Türklingel bei Doctor Döblinger. Dieser saß glatt rasiert, und ebenso glatt bereit, die Morgenarbeit aufzunehmen, bei Tee und Eiern. Es war ein Viertel vor acht. Doctor Döblinger öffnete die Wohnungstür zum Spalt und erblickte durch ihn Herrn Zilek zur Gänze. Dieses Geschöpf nun war ihm freilich bekannt. Zilek wohnte eben so lange im Hause wie er selbst. Man stand auf Gruß-Fuß. „Entschuldigen Sie die Störung, Herr Doctor“, zilkte es zart, „ich hätte Sie so gerne einmal etwas gefragt.“ Man ging hinein. Es war, als poche Zilek mit einem kleinen Probier-Hämmerchen an Doctor Döblinger und der ganzen Lage hier sachte herum. „Da hat doch jetzt über Ihnen dieser Professor seine Ordination.“ „Ja“, sagte Döblinger. „Haben Sie da nicht Besorgnisse wegen seiner Patienten, denen man im Lift und auf der Treppe täglich begegnet? Es sind doch Geisteskranke darunter, wahrscheinlich; oder daß oben Lärm entstünde – würde Sie das nicht sehr stören, bei Ihrer Arbeit?“ „Habe bisher nichts bemerkt“, entgegnete der Autor, während seine private Person bereits argwöhnisch die Zugbrücke hochgehen ließ: er witterte Schädliches, mindestens Abträgliches. „Allerdings“, fügte er beiläufig hinzu, „arbeite ich jetzt oft außer Hause.“ In Wahrheit aber war er noch kein einziges Mal seit dem Erscheinen Professor Horns auf jenem gelehrten Institute gewesen – Horn hatte seinen Besuch bei Doctor Döblinger am Monatsersten gemacht (dem letzten ruhigen und häuslichen Monats-Ersten für lange Zeit! – damals daumschräublich-sorgenvoll begonnen und garnicht recht geschätzt, oh, sehr im Gegenteile, von wegen der Wohnungsmiete!). Nun, seitdem waren nur fünf Tage vergangen; der erste Warntag sozusagen, von dem ab es alle zehn Tage da oben losgehen würde, aber sollte ja der zehnte dieses Monates sein. „Hm, nun ja, mir wurde die Sache doch ein wenig ungemütlich“, sagte Zilek, indem er gleichsam das Probierhämmerchen weg tat und bereits beidrehte, „als dieser Narrendoctor da ins Haus zog. Sie meinen also, daß für uns keinerlei Gefahr einer Störung besteht, durch Lärm oder unliebsame Zwischenfälle?“ „Wo denken Sie hin!“ rief jetzt Doctor Döblinger und schwang sich auf das hohe Roß des Wohlunterrichteten und Wissenden, um Zilek rasch nieder zu reiten. „Sie dürfen sich doch nicht vorstellen, daß der Professor hier schwere Fälle behandeln wird, Leute etwa, die in eine Anstalt gehören, und so weiter. Dafür hat er ja seine Klinik. Dies hier ist offenbar nur seine Privat-Ordination für neurologische Zwecke oder etwa für Personen, die an Gemüts-Depressionen oder an nervösen Störungen leiden.“ Wirklich ward Zilek solchermaßen überritten. Er drang nicht durch; und ging also. Bemerkenswert ist doch, daß Döblingers Verhalten eine gewisse Analogie zu dem der Portiers-Leute zeigte. Hier war sogleich nach dem Einzug des Professors eine Interessengemeinschaft entstanden. Vielleicht fühlte Zilek das in irgendeiner Weise – und trachtete nun den Anschluß zu finden: jetzt noch vergebens; aber sehr bald sollte das Gewünschte ganz von selbst sich ihm anbieten.
Er hatt’ es nötig. Er kam mit seiner Pension niemals aus[2]; während ihm zu Häupten beim Doctor Döblinger zwar keine festen Bezüge vorhanden waren, jedoch die Pressionen stets vorübergehend blieben. Diesmal hatten sie gar ein plötzliches Ende gefunden.
Man fragt sich, wie die beiden Leute, Zilek mit seiner Frau, jedoch ohne Kinder, der Doctor Döblinger gar allein, so geräumig zu wohnen vermochten. Beide hatten den Weg zu solchem schönen Zustande, der ihnen die Mitmenschen vom Leibe hielt und eine erweiterte Reservation des Privatlebens um sie ausbreitete, auf ähnliche Weise gefunden: durch Untervermietung an so gut wie nicht vorhandene Personen. Es waren überseeische Ausländer, die im Lande oder auch anderswo reisten, jedoch einiger Zimmer bedurften, um die schönen alten Möbel und Bilder, Wandteppiche und Kunstgegenstände verschiedener Art, die sie allenthalben einkauften, an einem Punkte zu sammeln und unterzubringen. Ging man durch Döblingers Zimmer, dann konnte man da oder dort solch ein Prachtstück von Barock-Schrank sehen oder etwa einen Gobelin, der die halbe Wand bedeckte; die meisten Sachen waren wohl in Truhen verpackt; aber das wenige Sichtbare wirkte grotesk genug in der sonst recht moderat möblierten Behausung des Autors. Waren diese kunstsammelnden Herrschaften aber hier in der Stadt anwesend, was selten genug geschah, dann fiel es ihnen garnicht ein, unbequem zwischen ihren Schätzen zu hausen, sondern sie logierten im Hotel; und zudem eignete ihnen die bemerkenswerte Artigkeit, von ihrem Erscheinen immer lang vorher schon Kunde zu geben. Die Feuer- und Einbruchs-Versicherung, welche bei solcher Konzentration von Werten sich empfiehlt, bezahlten sie selbst. So lebten denn sowohl Zilek und seine Frau wie auch der Doctor Döblinger in einer Art von Museum, worin allerdings der kleinste Teil des Bestandes nur zur Aufstellung gelangt war.
Das Haus hatte vier Stockwerke. Auf der einen Seite waren diese durchwegs von gewerblichen Betrieben besetzt: es gab da einen Damenschneider, eine Hutmacherei und noch anderes. Gegenüber befand sich im ersten Stock das Lager einer Firma, die Drucksorten aller Art erzeugte. Im zweiten Stock wohnte Zilek, über ihm Döblinger, und obenauf war nun neuestens der Horn’sche Paukboden etabliert, in beiden einander gegenüber liegenden Wohnungen, die vereinigt worden waren. Es befanden sich sämtliche Marschräume ob dem Haupte des Autors, der Empfang, das Arbeitszimmer des Professors, Douche- und Ruheräume sowie ein Laboratorium über der Hutmacherei. Es mag wohl sein, daß der Professor nach langem Wählen diesem Hause eben darum den Vorzug gegeben hatte, weil es zum kleineren Teil Wohnungen, zum größeren jedoch Geschäfte und Magazine enthielt.
4
DIE TOTALE FAMILIE UND DIE ENTSTEHUNGEINER BART-TRACHT
Childerich von Bartenbruch hatte seine Kindheit und Jugend auf angestammtem Schlosse in Mittelfranken verbracht. Er behielt auch das Majorat Bartenbruch immer in der Hand, obwohl er nach erlangter Großjährigkeit mehr in der Stadt als auf dem Gute wohnte. Childerich verheiratete sich sehr bald, zum ersten Mal schon mit fünfundzwanzig Jahren, und zwar mit einer fünfundvierzigjährigen Dame.
Seine Jugend hatte ihn nur bedrückt. Von den zahlreichen Brüdern Bartenbruch war er zwar der älteste, doch der geringste von Ansehen, klein und weichlich, ganz frühzeitig schon faltig: während die anderen Kerle wie die Tannen aufwuchsen. Autorität besaß er zunächst – in jenem Alter nämlich, wo es noch vorwiegend auf die physische Überlegenheit ankommt – den jüngeren Brüdern gegenüber nicht die geringste, obwohl Childerich einen in solcher Jugend sehr erheblichen Vorsprung an Jahren hatte: von dem nächstältesten Bruder trennten ihn deren drei. Gleichwohl ward Childerich häufig verprügelt, und eine Zeitlang setzte es fast täglich Ohrfeigen und Fußtritte. Schwerste Raufereien zwischen den jungen Leuten waren auf Bartenbruch die Regel, gegen welche nicht einmal der Vater was vermochte (Childerichs Mutter, eine englische Dame, war wenige Jahre nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes Ekkehard verstorben). Nur die Faust konnte sich hier durchsetzen. Der künftige Majoratsherr führte daher ein gänzlich zurückgedrängtes, zerdrücktes, zerknittertes Jugend-Dasein.
Mit fünfzehn sah er aus wie ein trauriges Beutelchen. Das Gesicht war alt, die Backen schlaff. Kränklich allerdings war er nie. Childerich ist auch in seinem späteren Leben so gut wie niemals erkrankt und in ärztlicher Behandlung gewesen, mit Ausnahme jener des Professors Horn, die aber eigentlich wieder eine stabile Gesundheit geradezu voraussetzte.
Doch, auch in Childerich war Kraft: eine zurückgeschlagene, zurückgescheuchte, die sich nach innen hatte kehren müssen; hier sammelte sie sich. Ohne jemals für die Künste oder Wissenschaften sich im geringsten über jenes Maß hinaus zu erwärmen, welches der obligatorische Bildungsgang seines Standes als Minimum vorschrieb, schärfte sich gerade in der frühen Jugend, freilich an ganz anderen Gegenständen, schon Childerichs Geist: besonders sein Gedächtnis ward durch das genaue Registrieren einer Kette von erlittenen Beleidigungen und Mißhandlungen gestärkt. Und so entwickelte sich bei ihm ein ausgebautes System sorgfältigster Nachträgereien von seltener Subtilität. Er ward dabei groß im ‚Nehmen‘, wie ein Boxer sich ausdrücken würde. Unter alledem – und dies bildete den wesentlichen Inhalt seiner Jugend – aber bewohnte ihn eine ungeprüfte und unumstößliche Gewißheit, daß seine Stunde noch im Kommen sei, daß er nur bereit sein müsse mit sämtlichen Registern ihm angetaner Peinigungen, um dann, bei reifer Zeit, einen Feldzug gegen Welt und Leben zu eröffnen, der, nach sorgfältigster Vorbereitung, gar nicht anders als von Sieg zu Sieg führen konnte.
Bedeutung und Macht zu gewinnen – darüber sann und grübelte schon der Fünfzehnjährige. Wir sagten, daß er sann: und eben damit meinten wir auch, daß er nicht träumte. Die beispiellosen Wutanfälle, welche dereinst seine reifen Jahre erschüttern sollten, sie blieben zunächst bei ihm, angesichts des äußeren Überdruckes, in’s tiefste Innre gepreßt: und wie gewaltig muß dieser Druck gewesen sein, um solchen Grimm in verborgene Höhlen zu scheuchen! Allerdings, auch bei dem späteren, dem schon tobenden Childerich III., konnten wir doch sehen, daß die hageldichte Applikation kräftiger Ohrfeigen durch den behandelnden Arzt, Prof. Dr. Horn, nicht ohne Wirkung blieb. Solcher Hagel aber war in der frühen Jugend sein tägliches Brot gewesen. Sahen die Brüder bei ihm nur des tiefinnerlichsten Ergrimmens kleinstes Zeichen: schon setzte es Prügel, schon schlugen sie auf ihn ein. So stak denn die Wut in Childerich während seiner Jugend wie ein tief, ja samt dem Kopf in’s Holz geschlagener Nagel, den man kaum sieht. Zu seinem Glücke vollzog sich die weitere und höhere Erziehung der jüngeren Brüder in England, womit ein vormals ausgesprochener Wunsch von Childerichs III. englischer Mutter pietätvoll erfüllt wurde, den sie freilich auf den Ältesten und Majoratsherren nicht ausdehnen hatte können, denn die Burschen sollten ja drüben bleiben und ihren Boden erben, wenigstens die drei jüngeren nach Childerich, Dankwart, Rollo (Rolf) und Eberhard. Von dem spätgeborenen Ekkehard war freilich noch nicht die Rede.
Bedeutung und Macht zu gewinnen, darüber sann Childerich, und ganz klar, ganz ohne Selbsttäuschung. Das heißt, er war sich nicht nur seiner annoch herrschenden Ohnmacht bewußt, sondern auch darüber im Klaren, daß diese ihre guten Gründe hatte, und daß diese Gründe in ihm selber lagen, in seiner nichtsbedeutenden, elenden Schwächlichkeit, der Armseligkeit eines traurigen, greisenhaften Beutelchens: wäre er das nicht gewesen – gerade die äußeren Umstände hätten ihm, als dem Ältesten und künftigem Majoratsherren, eine Schreckensherrschaft über die jüngeren Geschwister (es gab auch Schwestern) ermöglicht, ja geradezu nahegelegt. Viel andere Möglichkeiten der Beziehung zwischen Familienmitgliedern als im ganzen das Prügeln oder Geprügeltwerden gab es schließlich nicht im Hause derer von Bartenbruch: der Vater etwa vermied das erste, wohl wissend, daß seine Söhne ihn glatterdings und alsbald zum Objekt des zweiten gemacht hätten. Und mit Childerich III. war es, auch als er schon fünfzehn geworden, an dem, daß nicht einmal die Schwestern, Gerhild und Richenza, sich ihm gegenüber des Ohrfeigens und Tretens enthielten.
Unter solchen Peinigungen und mancherlei anderen Vexationen und Huntzungen entdeckte Childerich in aller Stille das einzige Vehikel, das ihn zu Ruhm und Rache führen konnte: seine das gewöhnliche Maß weit übersteigende Manneskraft; ihrer vollen Stärke ward er um’s zwanzigste Jahr inne. Zugleich trat bei ihm enorme Bärtigkeit auf, er konnte kaum genug sich schaben, und doch trugen seine schlaffen Hängebacken stets tiefblaue Schatten.
Hier ward denn die Achse seines Lebens aufgepflanzt. Noch nicht fünfundzwanzig heiratete er die im fünfundvierzigsten Lebensjahr stehende reiche Witwe eines Kulmbacher Bierbrauers, namens Christian Paust, eine geborene von Knötelbrech: passabler, wenn auch nicht eben alter Adel. Diese Person, eine starkgebaute, hübsche Frau mit schwarzem glattem Roßhaar, erlebte in ihrer Ehe derartige Excesse, daß sie nach vier Jahren den Geist aufgab. Nicht selten war es geschehen, daß Childerich tief in der Nacht wie aus der Kanone geschossen in ihr Schlafzimmer hereinraste.
Seine erste Gemahlin hinterließ ihm, trotz der verhältnismäßig kurzen Zeit dieser Ehe, zwei kleine Mädchen, und daneben noch mehrere erwachsene oder beinah erwachsene Kinder des Bierbrauers Paust, deren ältestes, Barbara, ein großes, ungewöhnlich schönes Frauenzimmer, sich im Jahr der zweiten Heirat ihrer Mutter – die übrigens Christiane geheißen, also die weibliche Form von des seligen Bierbrauers Taufnamen – verehelichte, mit dem Amtsrichter Bein zu Kulmbach. Diese Ehe gestaltete sich glücklich und kinderreich, fand aber schon nach fünfzehn Jahren ein vorzeitiges Ende durch das Ableben des Gatten: der Amtsrichter hatte sich in Oberbayern, stark im Schweiße, dem kalten Bergwind ausgesetzt und stand von einer Lungenentzündung nicht mehr auf.
Ungefähr um die Zeit, als die geborene von Knötelbrech, jetzt Freifrau von Bartenbruch, ihren Geist aufgab, wurde im Hause derer von Bartenbruch ein erheblicher Skandal perfekt.
Es war dies die zweite Ehe von Childerichs Großvater, Childerich I. genannt. Dieses alte und schwer reiche Übel in der Familie – ein schlanker, knebelbärtiger, knotiger Greis von der Bosheit eines Pavians – begann mit bald fünfundachtzig dergestalt zu rappeln, daß er sich in eine sechsundzwanzigjährige schöne Person verschoss und vergeilte. Es war dieser Childerich I. übrigens der einzige Bartenbruch, der sich unter seinem Stande bewegte, was den von ihm ausgeübten Beruf betrifft: er besaß große Fabriken für Spielwaren im Thüringischen, wo solche Industrien bekanntlich heimisch sind. Was aber seine späten Liebesneigungen betrifft, so bewegte sich der alte Bartenbruch keineswegs unter seinem Stande, etwa als ein von irgendeinem hergelaufenen ordinären Frauenzimmer gegängelter und um den Verstand gebrachter Greis. Vielmehr war seine zweite und so junge Frau eine Gräfin Cellé, und obendrein war sie wohlhabender als er selbst, war volljährig und stand beinahe allein.
Es hat keinerlei Sinn, hier herumzuschriftstellern, um ein monströses Faktum durch Motivierungen mundgerecht zu machen. Vielmehr liegt’s auf der Hand, daß jene Verbindung irgendeinen kaum faßbaren, widerlichen Hintergrund hatte. In diesem Falle aber ward von der Bartenbruch’schen Seite bald der Geist aufgegeben, und die Baronin Clara, geborene Gräfin Cellé, fand eines Morgens, was an Resten oder Krüstchen von Childerich I. noch übrig war, bereits erkaltet neben sich in dem zweiten Bette.
Damit aber war für Childerich III. erst recht Feuer am Dach. Der Pavian, erbost durch die Mißbilligung, welche seine zweite Ehe in weitesten Familienkreisen fand, hatte seinen Sohn, Childerichs III. Vater also, auf den Pflichtteil gesetzt, alle sonstigen Hoffenden enterbt, und seine junge Frau zur Universalerbin gemacht. Es war leicht vorauszusehen, daß die geborene Cellé nicht lange würde ehelos bleiben: und so stand denn ein Abzweigen bedeutender Bartenbruch’scher Vermögenswerte in fremde Gleise für früher oder später zu erwarten.
Childerich III. ergrimmte auf’s äußerste. Es trat, bei der bloßen Vorstellung, daß die Dinge diese Wendung nehmen könnten, bei ihm zum ersten Mal einer jener gewaltigen, man möchte sagen, umfassenden Wutanfälle ein, mit welchen viel später der Professor Horn so große Mühe haben sollte.
Childerich hatte die Cellé-Bartenbruch noch garnicht persönlich kennen gelernt, da er sich an dem fast lückenlosen Boykott beteiligte, welchen die Bartenbruchs über des Pavians Haus schon bei der Kunde von seiner Verlobung verhängten, um so mehr, als dieser aus der Änderung seiner testamentarischen Verfügungen bereits damals kein Hehl machte. Nun, nicht allzu lange nach seines Großvaters Tode, als sich der ja zur Zeit schon verwitwete Childerich III. eines Nachmittags im Juni allein in seinem Stadthause befand, meldete der Diener ihm den Besuch seiner Stiefgroßmutter.
Childerich III., damals etwa im dreißigsten Lebensjahre stehend, sah, wenigstens mit normalen Augen betrachtet, recht widerlich aus. Seine geringe Körpergröße, die leicht vorhängende Haltung, das schlaffe, lasche, backentaschige Antlitz mit den blauschwarzen Bartschatten wirkten alles eher denn vorteilhaft, und dazu kam eine gewisse Vorgetriebenheit der Augen, jene Quelläugigkeit, die man nicht selten bei schweren Cholerikern findet. Nicht verschwiegen darf allerdings werden, daß dem Männlein bei alledem doch die Herkunft aus einer hervorragenden alten Familie in irgendeiner Weise aus allen Ritzen und Fältchen sah: er war in seinem Betragen oft nichts weniger als vornehm, unser Baron; aber er sah eben vornehm aus. Noch schwang die Tugend adliger Ahnen nach, wenn auch meist nur an der sichtbaren Oberfläche; noch immer war diese Oberfläche intakt: und wo nicht mehr Anzeige innrer Formkraft, doch immer noch Vorhang, dicht genug, Abscheuliches zu verbergen.
Man muß sich Childerich vorstellen, wie er sich da aus einer Sofa-Ecke erhob, um seiner Großmutter entgegen zu gehen. Diese hypertrophischen Augen hatten ja immerhin auch ihre Vorfahren, deren gewissermaßen nach außen überhängender Blick auf Generationen von Hintersassen und Leibeigenen geruht hatte; hervordrohend aus einer Sicherheit, deren absolute Selbstverständlichkeit niemals war angetastet worden, drückend, niederhaltend. Childerich trug einen sehr teuern Sommeranzug von dunklerer Farbe, etwa das, was man ‚Pfeffer und Salz‘ zu nennen pflegte, und – man schrieb 1920, aber schon für jene Zeit war’s etwas altmodisch! – weiße Gamaschen über hellbraunen Halbschuhen. Auch die Krawatte war weiß; letzteres bildete eine stets gepflogene Eigenheit bei Childerich, abseits aller Mode. Er hatte übrigens kürzlich erst, und etwas vorzeitig, die Trauerkleidung des Verwitweten wieder abgelegt.
Was die Cellé veranlassen mochte, ein Mitglied der feindlichen Familie Bartenbruch zu besuchen, und obendrein gerade ihren Enkel, das blieb dem Baron vollends undurchsichtig; und viel Zeit zum Nachdenken hatte er jetzt nicht: objectiv lag’s für ihn ganz außerhalb der Möglichkeit, auf die Wahrheit zu kommen. Diese war ebenso einfach wie widersinnig: Clara Cellé hatte den Baron mehrmals und vorlängst schon gesehen, vor Jahr und Tag schon, zum ersten Male bei Paris auf dem berühmten Rennplatze zu Auteuil. Man hatte ihn ihr gezeigt. Und sie hatte Wohlgefallen an ihm gefunden. Ein größeres allerdings dann späterhin am Paviane. Aber dieser war nun tot.
Ihren Besuch hier ermöglichte ein eigentümlicher Vorwand. Sie trug diesen Vorwand buchstäblich quer auf den Armen: ein langes, schmales Paket in braunem Papier.
Unschwer erriet ihr Stiefenkel, was dies für ein Ding war: daß sie es jedoch ihm und nicht seinem Vater brachte, dem es wohl eher zukommen mochte, entkräftete den Vorwand, machte das Erscheinen Clara Cellé’s hier bei ihm erst recht unverständlich. Warum überhaupt brachte sie dieses Familien-Altertum persönlich und bediente sich nicht ihres Rechtsanwaltes oder einfach eines Boten? Wollte sie dies aber nicht, aus irgend einem Grunde, dann hätte ihr der Weg zum Vater wohl leichter fallen müssen. Es war die Beteiligung Childerichs II. am Boykotte gegen den Pavian eine mangelhafte und nur durch die wilden brieflichen Drohungen seiner jüngeren Söhne erzwungene gewesen. Man mochte glauben, er verhielte sich aus Sohnesliebe so. Später sollte sich zeigen, daß er aus Gleichheit der in ihm schlummernden Neigungen jener verliebten Tollheit des Alten ein verzeihendes Verständnis entgegenbrachte. Childerich II. sah zudem seinem Vater sehr ähnlich. Auch ihm eignete etwas durchaus Pavianöses. War’s jedoch dort ein von Bosheit toller, so hier ein trauriger Cynocephalus.
Nachdem dessen englische Gemahlin verstorben war – das mag etwa 1908 gewesen sein – zog er sich ganz auf ein Nebengut in Franken zurück, übergab später seinem Ältesten, den er kurz nach 1910, somit vorzeitig, großjährig erklären ließ, Majorat und Stadtpalais, und lebte, als Dankwart, Rollo (Rolf) und Eberhard glücklich in England waren, ganz allein mit dem kleinen Ekkehard, einem hübschen, gutartigen Buben, der kerngesund war und spielend lernte. Ansonst schien Childerich II. von allem und jedem genug zu haben; doch sollte dieser Schein sich – allerdings viel später – als trügerisch erweisen. Nachdem sein Ekkehard kurz nach dem ersten Weltkriege mit etwa fünfzehn Jahren in ein teures Schweizer Erziehungs-Institut abgegangen war, blieb Childerich II. allein und, wie es eben schien, zunächst gleichsam verpuppt. Ekkehard ist später Fahnenjunker und dann Offizier im kleinen deutschen Heere geworden. Von seinem ältesten Bruder und auch von denen in England hat er sich fern gehalten.
So lebte denn Childerich III., ein junger Witwer, mit seinen beiden Töchterchen allein im mächtigen Palaste. Dessen ausgedehnter Garten grünte unter alten Bäumen von der Rückfront des Hauses an, das sich gegen den Park zu mit Altan und Loggien aufschloß. Hier, in einem kleinen Saal, empfing Childerich III. die Cellé.
Zwei Augenpaare hingen einander entgegen, denn auch dasjenige Clara’s zeigte sozusagen ein Übergewicht nach außen, zudem eine ungewöhnlich starke Wölbung, von jener Art etwa, wie sie den Augen des berühmten Königs von Schweden, Gustav Adolf, geeignet hatte; und, bemerkenswert genug, es befand sich jener heroische und unglückliche Fürst tatsächlich unter den Vorfahren der gräflichen Familie. Das sonstige Antlitz Clara’s war sparsam bedacht, was der geringen Größe ihres Hauptes durchaus entsprach. Über diesem aber erhob sich noch eine dicke, mächtige Haarkrone, turmartig oder topfartig schräg nach rückwärts aufgebaut, wie bei einer Pharaonin. Dabei überragte sie an sich schon Childerich III. um mindestens fünf Zoll, so daß der Freiherr klein vor ihr stand. Das Gesicht der Cellé nun erschien fast auf ein Minimum reduciert, dessen einzelne Bestandteile jedoch feist und fest waren: glatte Apfelbäckchen, die hervorstanden, rundes Kinn, und eine Kehle – Childerich konnte sie von unten gut sehen – von der gespannten Fülle und der Zartheit eines Froschbauches. Aber sonst war dies ganze Gesichtchen gleichsam im Begriffe, wieder in den Kopf zurückzuschrumpfen. Die Stumpfnase winzig, mit sehr sichtbaren Nasenlöchern, also fast schon eine kleine Stülpnase. Im ganzen: ein junges, hübsches Totenköpflein. Mit breitem Munde und mächtigen, schneeweißen Zähnen.
Zwei Augenpaare hingen einander entgegen; und bei dem ihren war’s wohl noch mehr und recht eigentlich der Fall, denn sie sah ja von oben hinab, während Childerichs III. Blick ihr von unten entgegenquoll. Es ist hier, wie’s denn in solchen Sachen zu gehen pflegt, wahrscheinlich schon in den ersten Sekunden alles Entscheidende geschehen: ja, man darf annehmen, daß in ihnen auch Childerichs III. eigentlicher Lebensplan seinen Ursprung hatte.
Er empfing das schwere, lange und breite Frankenschwert, denn ein solches enthielt das Paket auf ihren Armen, und trug es nun in der gleichen Weise auf den seinen. Aus der tiefgrünen Höhlung des Parks hörte man von einer hellen Frauenstimme einige Worte in englischer Sprache rufen, sodann Trappelschrittchen auf dem Kies und das Lachen eines Kindes: es war das ältere von Childerichs III. beiden Töchterchen, die er von der geborenen Knötelbrech hatte, und das englische Kinderfräulein kam eben mit der Kleinen unten vorbei. Aber dann blieb es auch schon still. Es wurde immer stiller. Die Summen der Stille und des Schweigens schwollen sprunghaft an. Und die beiden hier, aus den Gitterkäfigen zweier uralter Geschlechter einander mit den Augen entgegen quellend, hatten immerhin noch genug geerbt, daß sie dieses jetzt bis zu enormer Tiefe sich eröffnende Schweigen glotzend ertrugen, ohne jeden vergeblichen Versuch, die aufgerissene Schlucht mit dem Streusande der Conversation zu erfüllen, der dem Sichtbarwerden des wahren Gegenüberstehens zweier Menschen sonst meistens ein Ende macht. Ja, sie blieben stehen, an Ort und Stelle, wo sie waren, Childerich bot der Cellé keineswegs sogleich einen Platz an: das hätte zur Conversation geführt. Man konnte ihrer entraten. Und so ertrugen sie die Stille ganz leicht, weit leichter, als es dem Childerich jetzt wurde, die mächtige Waffe aus der Zeit der fränkischen Heerkönige auf seinen lächerlichen und kraftlosen Ärmchen zu tragen.
Ja, sie hatte ihm, und gerade ihm dies uralte Zeichen seines Stammes gebracht. Eine Legende knüpfte sich daran, die sich erhalten hatte, mochte sie auch, unter einem genaueren Gesichtswinkel, wenig Wahrscheinlichkeit für sich haben. Dies Schwert sollte jenem Krieger gehört haben, der, ein steifnackiger Vertreter altgermanischer Gemeinfreiheit, dem noch heidnischen Könige Chlodwig I. zu Soissons verwehrt hatte, ein kostbares Kirchengefäß aus der zusammengebrachten Kriegsbeute vor der Teilung herauszunehmen, um es einer Bischofskirche zurückzustellen, deren Haupt ihn darum gebeten hatte. Der grimme Chlodwig bemeisterte sich, trotz solcher Kühnheit des gemeinen Mannes, die allerdings nur das geltende Kriegsrecht vertrat. Jedoch hatten alle anderen Männer der Ausnahme unterwürfig zugestimmt. Nächsten Frühjahrs, am Märzfelde bei der Waffenmusterung, fand der König den Zustand der Ausrüstung gerade jenes selben Mannes zu tadeln: „Weder deine Lanze, noch dein Schwert, noch dein Schlachtbeil sind tauglich!“ So fuhr er ihn an und warf ihm das letztere – la francisque heißt es französisch – vor die Füße. Der Mann bückte sich eben, um es wieder aufzuheben. Der König zückte indem sein eigenes Beil und schlug ihm den Schädel ein. „Denk’ an Soissons!“ rief er dabei.
Jenem Krieger also, der zugleich als Ahnherr des Bartenbruch’schen Hauses gedacht wurde, sollte das Schwert gehört haben, welches die Cellé jetzt auf ihren Armen hereingetragen hatte. Es war in verhältnismäßig noch sehr gutem Zustande und sicherlich unter den Stücken von dieser Art eines der am besten erhaltenen. Eine Hiebwaffe, mit dem Griff etwa neunzig Centimeter lang. Der Knauf zeigte keine Parierstange, das heißt, Knauf und Parierstange waren dasselbe, es gab hier also noch keineswegs jenen Kreuzgriff, wie er an den Schwertern der nachfolgenden karolingischen Epoche, und dann das ganze Mittelalter hindurch, gesehen werden kann, und wie ihn etwa das Schwert Karls des Großen im Pariser Louvre zeigt; dieses letztere hat auch einen spitzen ‚Ort‘ (das alte Wort für die Spitze der Waffe). Bei jenem Bartenbruch’schen Schwerte, als reiner Hiebwaffe, war der ‚Ort‘ rund. Die Klinge mochte oben beim Knauf eine Breite von etwa sechs Centimetern haben und verjüngte sich gleichförmig. Es war ein Waffentypus etwa von der Art, wie wir ihn im Fürstenschwerte von Flonheim wiedererkennen können, das noch aus der Völkerwanderungszeit stammt. Es wird im Museum zu Worms aufbewahrt.
Angesichts der Beschaffenheit des Stückes ist es recht unwahrscheinlich, daß ein gemeiner fränkischer Krieger diese Waffe geführt habe (und einige Mitglieder des freiherrlichen Hauses vertraten denn auch aus diesem Grunde die Ansicht, daß die Herkunft der Familie eine weit höhere gewesen sei[3]). Vielmehr ist am Gürtel eines solchen Mannes eher der ‚Sax‘ anzunehmen, eine Hieb- und Stichwaffe von etwa zweiundsechzig Centimetern Länge und bis fünf Centimeter Breite, einseitig geschliffen und mit dicker Parierseite – während das eigentliche Schwert ja zweischneidig war – und mit einem etwa zwölf Centimeter langen Messergriff. Der Schliff geht um die Spitze herum und auf der Parierseite noch einige Centimeter hinauf.
Nun, es war also kein ‚Sax‘, sondern ein Frankenschwert.





























