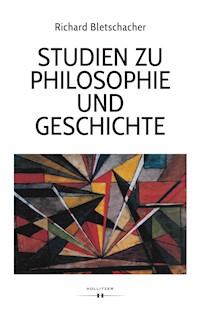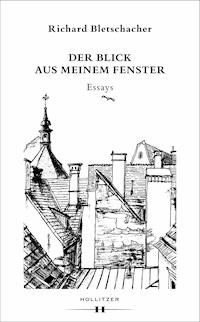Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Hollitzer Wissenschaftsverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Richard Bletschacher hat von den zahlreichen Minnesängern aus dem bayrisch-österreichischen Raum die bekanntesten sowie bestdokumentierten ausgewählt. Sie werden mit ihrer Biographie als auch einer Auswahl ihrer Werke, die vom Autor neu übersetzt wurden, vorgestellt. Zu den im Buch versammelten zählen: Der von Kürenberg, Dietmar von Aist, der Burggraf von Regensburg, der Burggraf von Rietenburg, Albrecht von Johansdorf, Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach, der Markgraf von Hohenburg, Neidhart von Reuental, der Tannhäuser, der von Suoneck, Hiltbold von Schwangau, Ulrich von Liechtenstein, Ulrich von Sachsendorf, der Hardegger, Reinmar von Brennenberg, Leuthold von Seven, Alram von Gresten, Gunther von dem Forste, der Litschauer, Heinrich von der Muore, der Mönch von Salzburg, Hugo von Montfort und Oswald von Wolkenstein. Das zeitliche Spektrum reicht von frühen Vertretern (ab Mitte des 12. Jahrhunderts) im Hochmittelalter bis zum letzten Nachfolger Oswald von Wolkenstein (1376–1445).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RICHARD BLETSCHACHER
DIE MINNESÄNGERIN BAYERN UND ÖSTERREICH
Lektorat und Layout: Johann Lehner (Wien, Österreich)
Korrektorat: Katharina Preindl (Wien, Österreich)
Cover: Nikola Stevanović (Belgrad, Serbien)
Druck und Bindung: Interpress (Budapest, Ungarn)
Umschlagbild:
Ausschnitt aus „Herr Alram von Gresten: Minnegespräch“
Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse), Universität Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 311r
Bildnachweis:
Abb. 1–23: Große Heidelberger Liederhandschrift (Codex Manesse), Universität Heidelberg, Cod. Pal. germ. 848Abb. 24: Anton Bryl (gemeinfrei)
Richard Bletschacher: Die Minnesänger in Bayern und Österreich.
Wien: HOLLITZER Verlag, 2016.
© HOLLITZER Verlag, 2016
HOLLITZER Verlag
der HOLLITZER Baustoffwerke Graz GmbH, Wien
www.hollitzer.at
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-99012-234-1 hbkISBN 978-3-99012-235-8 pdfISBN 978-3-99012-236-5 epub
INHALT
EINFÜHRUNG
DIE KUNST DES MINNESANGS
LEBEN UND WERKE DER MINNESÄNGER
DIE TEXTE UND DEREN ÜBERSETZUNGEN
Der von Kürenberg
Dietmar von Aist
Der Burggraf von Regensburg
Der Burggraf von Rietenburg
Albrecht von Johansdorf
Walther von der Vogelweide
Wolfram von Eschenbach
Der Markgraf von Hohenburg
Der Tannhäuser
Der von Suoneck
Hiltbold von Schwangau
Neidhart von Reuental
Ulrich von Liechtenstein
Ulrich von Sachsendorf
Leuthold von Seven
Reinmar von Brennenberg
Gunther von dem Forste
Der Hardegger
Alram von Gresten
Der Litschauer
Heinrich von der Muore
Der Mönch von Salzburg
Hugo von Montfort
Oswald von Wolkenstein
ZEITTAFEL
LITERATURHINWEISE
EINFÜHRUNG
Der Minnesang ist eine Kunst des weltlichen Lebens, der Liebe vor allem, der Huldigung, der Werbung, aber auch der Geselligkeit, eine Kunst, die auf allen Straßen und durch alle Gaue des Heiligen Römischen Reiches unterwegs und in allen Sälen, in denen man ihr Gehör schenken mochte, zu Hause war. Der Minnesang verbreitete aber auch die Nachrichten von den Reichsgeschäften und Händeln in die entlegeneren Winkel, er gab Kunde von den wichtigen Ereignissen und vom Glanz der Höfe, von der Schönheit der hohen Frauen und der Freigebigkeit der großen Herren. Der Minnesang war keine Kunst der Jahrmärkte und Tanzböden, er war eine Kunst der Burgen und Paläste, und seine Sänger waren, wenn nicht selbst aus adeligem Hause, so doch von dem Bestreben geleitet, aufgenommen zu werden in die erlesenen Kreise. Der Minnesang war eine profane und adelige Kunst und hat nur selten einen Blick in die Wunderwerke des Glaubens, die Kirchen und Kathedralen, getan und auch in die zahlreichen im Land verstreuten Klöster nur Einlass begehrt, um ein Nachtquartier oder eine Wegzehrung zu erbitten.
Man wird darum verstehen müssen, dass die großen architektonischen Leistungen, die geschaffen wurden durch die alles übersteigende Glaubensbereitschaft der Menschen, in diesem Buche nur am Rande Beachtung finden. Die mystische Übermacht der Kathedralen überwältigt auch heute noch jede Vorstellung, die wir uns von jener Epoche zu machen vermögen. Und dies nicht allein darum, weil die sakralen Gebäude noch in weit größerer Zahl und ursprünglicherer Gestalt erhalten blieben als Kaiserpfalzen, Fürstenpaläste, Stadttürme, Ritterburgen, Mühlen, Kornspeicher und Handelskontore. Meine Aufgabe kann es nicht sein, ein umfassendes Bild dieser großen Epoche des abendländischen Geistes zu entwerfen. Meine Aufgabe ist es vielmehr, die früheste Blüte der deutschen Sprache bewundernd aufzuzeigen und den Spuren ihrer oft mittellosen und unbehausten Dichter und Sänger forschend nachzugehen.
Dass einer, der die deutsche Sprache liebt und sich ein Leben lang auf den Grenzgebieten von Dichtung und Musik umgetrieben hat, ein Buch über die Minnesänger schreibt, wird darum nicht groß Wunder nehmen. Warum er aber seine Betrachtungen auf den bayerisch-österreichischen Raum eingegrenzt hat, das muss er doch mit ein paar Worten erklären.
Zum einen war das gesamte Gebiet des ehemaligen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, das während der Herrschaft der Staufer außer Elsass und Lothringen auch noch die Niederlande, die Schweiz, Burgund, Istrien, Krain und Böhmen umfasste, zu groß und waren die darin umherziehenden Minnesänger zu zahlreich, als dass man zwischen zwei Buchdeckeln nicht vieles über sie alle sagen könnte, was nicht schon weitum bekannt wäre. Die Zahl der Dichter und ihrer Dichtungen müsste in einem solchen Falle so vermindert werden, dass nur die bekanntesten Autoren und deren bekannteste Werke zitiert werden könnten. Das haben ohnehin schon andere besorgt. Der Kreis meiner Zuwendung muss sich daher, wenn ich mehr geben will als eine Blütenlese des Landläufigen, auf einen mir überschaubaren Raum beschränken. In ihm soll nicht versucht werden, von vielem weniges zu geben, sondern von wenigem vieles. Und darum soll er nur den Teil einschließen, der als bayerisch-österreichischer Raum zu bezeichnen ist. Dazu zwang ökonomische Einsicht.
Man muss die Zahl der deutschen Minnesänger jener Epoche insgesamt mit weit über die uns bekannt gewordenen zweihundert angeben. Manche Schätzungen gehen sogar über die Grenze von dreihundert hinaus. Diese Zahlen schwanken, weil man oft nicht recht entscheiden kann, ob der eine nur ein Nachsänger war, der fremdes Liedgut neu darbot, oder der andere ein Sammler, der die Gedichte unter seinem Namen nur zusammentrug. Die Überlieferung hat unter den bekannten Namen schon vor uns ihre eigene Auslese getroffen. Ob sie gerecht war, ist nicht immer zu sagen. Denn gewiss nicht alle Dichter und Sänger – und nur wenige der im Norden beheimateten – wurden den Sammlern im Südwesten des Reiches bekannt. Und von den wenigen nur die populären. Die Auswahl wurde damals, so wie dies auch heute geschieht, nicht immer nach dem künstlerischen Wert der Werke getroffen, sondern nach ihrer Darstellung in der Öffentlichkeit. Immerhin sind uns von der vermuteten Gesamtzahl etwa hundertsiebzig Minnesänger mit Namen und Texten – und viele davon auch mit Bildern – bekannt geworden. Aber auch von denen musste, wenn der Umfang eines einzigen Buches gewahrt bleiben sollte, eine Auswahl getroffen werden, sonst bliebe kein Raum für eine eingehendere Betrachtung, wie sie mir angelegen ist. Da es sich nun aber ergibt, dass viele der berühmtesten Minnesänger eben im Raum zwischen den Flüssen Etsch, Lech, Donau, Thaya, March und Mur zu Hause waren, kann durch die Beschränkung hierauf im Einzelnen manches gewonnen werden, was im Ganzen hätte übergangen werden müssen.
Der bayerisch-österreichische Raum ist der meiner eigenen Herkunft und Lebensführung und darum für mich mit größerer Vertrautheit zu überblicken als alle anderen. Es wäre durchaus nicht unberechtigt, wenn man mir hierin Parteilichkeit vorwerfen würde. Dem könnte ich entgegenhalten, dass ich aus biographischen Rücksichten ebenso gut den alemannischen Raum zum Thema hätte wählen können. Wenn ich mich nicht für den Letzteren entschieden habe, so liegt der Grund darin, dass ich seit langen Jahrzehnten meinen Wohnsitz in Wien genommen und von dieser Stadt aus meine Studien betrieben habe.
Während der Herrschaftsepoche der letzten Babenberger von Heinrich Jasomirgott über Leopold den Glorreichen bis zu Friedrich dem Streitbaren waren zahlreiche Minnesänger in Diensten oder zu Gast an dem von jeher sangesfreudigen Wiener Hof. Von denen sind Walther von der Vogelweide, Reinmar von Hagenau, genannt der Alte, der Tannhäuser und Neidhart von Reuental die bekanntesten. Neben ihnen aber sind nachzuweisen: Ulrich von Sachsendorf, Reinmar von Zweter und Bruder Wernher. Von Gottfried von Totzenbach, Rapot von Falkenberg, Zachäus von Himmelberg sind zumindest die Namen bekannt, wenn auch keine Werke von ihnen sich erhalten haben. Herzog Friedrich selbst und sein engster Berater Tröstelin sollen Frauenlieder gesungen haben. Und so war Wien in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts zum Mittelpunkt deutschen Minnesangs geworden.
Dies konnte darum geschehen, weil der kaiserliche Hof, der gewiss die größte Anziehung hätte ausüben müssen auf ein Gefolge von Künstlern aller Art, beständig unterwegs war und keinen eigentlichen Mittelpunkt kannte. Man mag es kaum glauben, dass über den ganzen Zeitraum des Mittelalters hin sich etwa vierhundert Orte im Reich zu sogenannten Kaiserpfalzen herausbildeten. Nur wenige von ihnen brachten es seither in den Rang von Städten. Manche verfielen und sind kaum mehr aufzufinden. Den Norden bereisten die Kaiser kaum je. Die nördlichsten Pfalzen waren Köln, Aachen, Goslar und Magdeburg. Und so überschritten auch die Minnesänger nur selten diese unsichtbare Grenze. Diese Abgelegenheit hat jedoch die große Unabhängigkeit und merkantile Macht der Seestädte befördert und in jenen Jahren eben zur Gründung des Städtebundes der Hanse geführt. Dort aber, wo der Kaiser für längere Zeit einen dauernden Aufenthalt nahm, bildete sich auch ein Kreis von Dichtern, Musikern, bildenden Künstlern und Gelehrten. Dies war während der staufischen Epoche nur einmal der Fall: Friedrich II. residierte während der meisten seiner 36 Regierungsjahre in Palermo. Und in Palermo erwuchs die erste italienische Dichterschule, die in der Landessprache zu schreiben begann. Im Deutschen Reich aber gab es, ehe Karl IV. sich in Prag niederließ, keinen Ort, an dem sich eine zentrale höfische Kultur auf Dauer hätte herausbilden können. Die freien Reichsstädte, die sich in jenen Jahren mächtig zu dehnen begannen, zeigten vorerst wenig Interesse an den Unterhaltungen der Adeligen. Nur wenn sich auf Reichstagen oder Synoden die großen Herren in ihre Mauern drängten, gab man auch den Minnesängern in deren Gefolge Raum. Und so wurden die Regierungssitze der Landesfürsten zu den lohnendsten Zielen der Reisen im Dienste des Minnesangs. Es wetteiferten Wimpfen, Landshut, Memmingen, Peiting, Passau, Prag, Meran, die Wartburg und Meißen als die Höfe der Staufer, Welfen, Wittelsbacher, Přemysliden, Görzer, Andechs-Meranier, Thüringer und Wettiner. Keiner jedoch wurde von den Zeitgenossen mehr gerühmt als der Wiener Hof der kunstsinnigen Babenberger.
Ein weiterer Umstand hat mich in der Beschränkung des Raumes bestätigt. Der nämlich, dass neben den berühmtesten Minnesängern auch einige der bedeutendsten epischen Dichter aus dem umschriebenen bayerisch-österreichischen Raume stammen, so der anonyme Autor des Nibelungenliedes, der des König-Rother-Volksbuches und der der König-Laurin-Sage, so auch Wolfram von Eschenbach, Wernher der Gartenaere, Ulrich von Liechtenstein, der Stricker und erstaunlicherweise sogar der Überlieferer der nordischen Gudrun-Sage. Dies alles gibt ein Zeugnis von der großen Neigung, die der Dichtkunst und der ihr damals mehr noch als heute verschwisterten Musik zu allen Zeiten in den Donauländern entgegengebracht wurde.
Nicht bei allen bekannt gewordenen Dichtern jedoch war mir deren landschaftliche Herkunft erkennbar. Auch wurden zahlreiche Texte ohne Nennung des Autors oder mit Nennung verschiedener Autoren in den Handschriften überliefert. Manch einer, wie Walther von der Vogelweide, Reinmar von Zweter oder Neidhart von Reuental, wählte sich eine zweite Heimat und starb weit entfernt vom Ort seiner Herkunft. Und so fehlt hier gewiss mehr als nur eine Handvoll Namen, die eigentlich in diesen Zusammenhang gehörten. Wie all meine Arbeiten bisher muss ich auch diese mit dem Bewusstsein abschließen, dass nicht alles getan ist.
Österreich war von Bayern aus besiedelt worden und blieb lange Jahrhunderte mit diesem in politischem wie geistlichem Verbund. So etwa wurden die meisten Klöster von Bayern aus gegründet und geleitet. Als Beispiel möge das Wiener Schottenstift gelten, das sein Mutterkloster in St. Jakob in Regensburg hatte. Auch gehörten noch bis ins 13. Jahrhundert, ehe Wien einen eigenen Bischof erhielt, die Glaubensgemeinschaften des ganzen Landes zur Passauer Diözese. Zwischen den beiden Ländern gab es keine Sprachbarrieren. Teile des heutigen Österreich bis hin zum damaligen Grenzfluss Enns gehörten in jener Zeit noch zu Bayern. Später mochte man etwa den oberösterreichischen Hausruck als Grenze ansehen. Zumal in den Regierungsjahren des streitbaren Friedrich waren die Herrschaftsgebiete oft umstritten. Und so sollen sie auch hier, wo es um die gemeinsamen Werke der Sprachkunst geht, nicht stärker voneinander abgegrenzt werden, da die Mundart überall die gleiche war. Salzburg war ein eigenes Fürstbistum, das zwar von Bayern besiedelt, aber nur dem Kaiser verantwortlich war. Tirol und Vorarlberg waren unabhängige Grafschaften, die erst im 14. Jahrhundert an Österreich kamen. Dagegen lassen sich die Grenzen des bayerisch-österreichischen Raumes nach Norden, Osten und Süden leicht daran ausmachen, dass jenseits von ihnen eine andere Sprache gesprochen wurde. Dabei darf man sich die Übergänge nicht so hart vorstellen, wie sie durch die späteren Nationalstaaten herausgebildet wurden. Der mysteriöse Klingsohr aus Ungarland etwa schrieb und sang wohl in derselben deutschen Mundart wie die anderen Minnesänger auch. Die Sprachen übersprangen während vieler Jahrhunderte noch sehr leichtfüßig die Gräben. Im Westen muss die Grenze gegen Schwaben hin mit dem Lechfluss gezogen werden, auch wenn das heutige Bayern weit darüber hinausgreift und einen Teil des alten Schwaben und das ganze Frankenland an sich gezogen hat. Ich habe mich aus diesem Grunde entschlossen, die Franken Konrad von Würzburg und Rudolf von Rothenburg ebenso auszuschließen wie die Schwaben Meinloh von Sefelingen und den Augsburger Domherrn Ulrich von Winterstetten. Sie alle und einige andere mehr wären nur als Bayern zu bezeichnen, wenn man nicht das alte bayerische Herzogtum, sondern den heutigen Freistaat als das Land ihrer Herkunft ansehen wollte. Ein Gleiches gilt für all die Dichter, von denen man ein Wirken in den gezogenen Grenzen wohl mit guten Gründen annehmen, aber nicht schlüssig nachweisen kann. Als Beispiele seien nur Reinmar der Alte, Reinmar von Zweter, Reinmar der Fiedler oder der Marner genannt. Albrecht von Hohenberg, ein Schwager König Rudolfs I., lebte und wirkte gewiss in den ersten Jahren nach 1278 am habsburgischen Hof in Wien, war aber doch vermutlich ein schwäbischer Landsmann des Königs. Hug von Mülndorf, Chuonz von Rosenhein, Engelhart von Adelnburg, Geltar, Rubin von Ruedeger, der von Scharpfenberg und der von Mezze wären wohl auch, wenn man Genaueres über sie wüsste, unter die Bayern oder Österreicher zu zählen. Von den Herren von Totzenbach, von Falkenberg und von Himmelberg war oben schon die Rede. Sie alle aber haben entweder keine oder keine bedeutenden Gedichte hinterlassen oder treten als Personen zu wenig ins Licht, als dass sie hier angeführt werden müssten. Man könnte die Zahl der bayerisch-österreichischen Minnesänger leicht um anderthalb Dutzend vermehren, wenn man die alle in den Kreis einbeziehen wollte. Manchem, den ich übergehe, tue ich vielleicht Unrecht, ohne es besser zu wissen. Jede Auswahl wird auch bestimmt von den vorhandenen Unterlagen und vom Kenntnisstand des Auswählenden. Und so fällt, wenn ich einen wahren Meister hier nicht beachtet habe, die Schuld auf mich. Im Falle des Vorarlberger Grafen von Montfort, der ohne Zweifel ein Alemanne war, habe ich mich aus den oben genannten Gründen dennoch entschieden, ihn hier aufzunehmen. Wohl war Vorarlberg seit dem 7. Jahrhundert ein Teil des Herzogtums Schwaben, im 14. Jahrhundert und noch zu Lebzeiten des Grafen aber kam es in habsburgischen Besitz und somit wurde das Geschlecht derer von Montfort zu einem österreichischen.
Es ist mir wohl bewusst, dass solche Grenzziehungen etwas Leidiges haben; andererseits lässt sich nur durch eine Verengung des Sichtfeldes der Blick für das Einzelne schärfen. Und es ist nicht das geringste Ziel meiner Arbeit, zumindest in Betreff einer kleinen Zahl von Minnesängern manches von dem beizubringen, was bisher wenig beachtet wurde und sich dennoch zu wissen lohnt.
Wenn dieses Buch von dem staunenswerten Gebäude der mittelalterlichen deutschsprachigen Literatur die geistliche Dichtung ebenso außer Betracht lässt wie die epische und sich ganz auf die lyrische des Minnesangs beschränkt, so wird doch auch an ihr eine wahre Fülle von jenen Inhalten und Formgesetzen zu entdecken sein, die aller Sprachkunst zu Grunde liegen. Und wenn trotz aller Bemühung nur ein Bruchstück gezeigt werden kann, so doch ein Bruchstück, das erahnen lässt, welch großes Erbe uns überantwortet worden ist aus einer Zeit, die trotz aller Beschränkung an Weltkenntnissen und Lebenshilfen kulturelle Werte geschaffen hat, vor denen wir heute in Bewunderung stehen.
Um den ganzen Reichtum der literarischen Werke dieser Epoche sichtbar zu machen, soll ein kurzer Blick auch den von näherer Betrachtung ausgeschlossenen zugewandt werden. Da wäre zunächst der schwäbisch-schweizerische oder alemannische Kreis zu nennen. Dass dessen Dichter uns so zahlreich dem Namen nach bekannt geworden sind, liegt an zwei bedeutsamen Umständen. Zum einen drängten sich die Großen des Reiches um die bevorzugten Aufenthaltsorte der schwäbischen Staufer, die den Künsten sehr zugetan waren und sich gelegentlich selbst, wie Heinrich VI. und Konradin und vermutlich auch Beatrix, die Gattin Barbarossas, im Minnesang übten. Um diese dilettierenden Großen scharten sich wiederum auch die „hauptberuflichen“ Dichter und Sänger. Zum anderen gelangte über das vermittelnde Reichsgebiet Burgund der mächtig befruchtende Einfluss der provenzalischen und französischen Dichtung ins deutsche Land. So wurden endlich auch die großen Liedersammlungen in Schwaben und in der Schweiz erstellt. Es geschah hundert Jahre nach der Blütezeit des Minnesangs, zuerst vermutlich in Konstanz am Bodensee, dann vermutlich in Straßburg am Rhein und etwa zehn Jahre später ganz gewiss in der Stadt Zürich, dass sich Freunde der Dichtung die Aufgabe stellten, alle erreichbaren Texte des deutschen Minnesangs zusammenzutragen, auf Pergament zu schreiben und mit Illustrationen zu versehen. Diese verdienstvollen Männer wiederum haben sich zuerst in ihrer Nachbarschaft umgesehen und vom Entlegenen nur mehr das weithin Auffälligste wahrgenommen. Und so sind uns allein auf dem Gebiet der heutigen Schweiz zweiunddreißig Minnesänger bekannt geworden, von denen die meisten nicht eben zu den berühmten zählen. Der Schweizer Minnesang wurde durch gesonderte Darstellungen aus diesem weiten Feld herausgehoben durch Publikationen von Karl Bartsch im 19. Jahrhundert und auch von Olga Janssen im Jahr 1984.
Nach dem in der Überlieferung dominierenden alemannischen Kreis ist, weiter nordwärts gelegen, auch der thüringisch-sächsische zu nennen. Die Höfe des Landgrafen auf der Wartburg und in Gotha und die Burg des Markgrafen von Meißen gehörten zu den wichtigsten Zielen der umherziehenden Sänger und boten ihnen oftmals Herberge für längere Zeit. Auch standen sie mit dem kunstliebenden Königshof in Prag in freundschaftlichen Beziehungen. Dem politisch sehr wankelmütigen Landgrafen Hermann verdankten manche der Dichter großzügige Beherbergung, vielleicht auch die Ausrichtung von Sängerwettstreiten, gewiss aber thematische Anregungen. Denn der Landgraf unterhielt gute Verbindungen zum französischen Raum. Aus dem Geschlecht der Markgrafen von Meißen ging zumindest ein Minnesänger hervor, und auf ihrer Burg fanden mehrere von dessen wandernden Kunstgenossen Zuhörerschaft, Löhnung und Unterkunft.
Mit besonderem Nachdruck ist auf den rheinischen Raum zu verweisen, der die Dichter umfasst, die sich um die Kaiserpfalzen von Hagenau, Mainz, Speyer, Gelnhausen, Ingelheim, Soest und Goslar sowie in den Bischofstädten Trier und Köln sammelten. So hat etwa der unglückliche Sohn Friedrichs II. König Heinrich (VII.) in Wimpfen einen Kreis von Minnesängern um sich versammelt, zu denen einige der bekanntesten seiner Epoche gehörten.
Dass wir von Sängern im Norden so wenig wissen, liegt wohl daran, dass selbst die sächsischen Kaiser diese Gaue des Reiches nur selten besuchten. Der Osten wurde gar erst unter der Herrschaft Friedrichs II. kolonisiert. Und der mächtige Kolonisator, Heinrich der Löwe, zeigte weder an seinem Braunschweiger noch an seinem Münchener Hof großes Interesse an den Künsten. Unsere Unkenntnis über dortige Quellen mag zum einen an deren großer Entfernung von den Orten liegen, an denen die Liederhandschriften gesammelt wurden, zum anderen aber daran, dass die niederdeutsche Mundart nicht überall im mittleren oder südlichen Deutschland verstanden wurde. Sie beherrschte im Mittelalter etwa das halbe Reichsgebiet und wurde auch noch im südlichen Westfalen gesprochen. Aus Verordnungen der Stadtverwaltungen in Westfalen und Niedersachsen kann man ersehen – ich kenne solche von Göttingen und Hildesheim, um nur zwei Beispiele zu nennen –, dass dort eine Sprache gebraucht wurde, die eher dem Niederländischen vergleichbar war als dem Ober- oder Hochdeutschen, in dem die kaiserlichen Dokumente und die Lieder der Minnesänger niedergeschrieben wurden.
Und so finden wir auch im Norden und Osten jenseits der genannten Kreise nur mehr Mitglieder der privilegierten Stände unter die Minnesänger gereiht, wobei es scheint, als hätten diese Herren sich nur hin und wieder in der Kunst versucht, als Liebhaber mehr denn als Konkurrenten der Sänger. Von dem, was sie geschrieben und gesungen haben mögen, ist nur wenig erhalten. Unter diese Stimmen des Nordens und Ostens wären zu zählen: der Graf von Anhalt, der Markgraf Otto von Brandenburg, der Fürst Wizlav von Rügen, der Herzog Heinrich von Breslau und der König Wenzel von Böhmen.
Dass es aber auch am Niederrhein in jener Zeit Dichter in der Landessprache gegeben haben muss, sehen wir am Beispiel des Herzogs Johann von Brabant. Der war ein Mitglied des hohen Adels. Sein Dichterruhm konnte sich darum, ohne dass er viel zu reisen brauchte, mit dem Ansehen seines Namens verbreiten. Dies war anderen Minnesängern in Flandern und den Niederlanden nicht ebenso möglich. Wenn es sie gab, woran man kaum zweifeln mag, so blieben sie den Sammlern im Süden verborgen und uns Nachfahren unbekannt.
Das Schaffen all der Vorgenannten zu erforschen würde nicht nur meine Kenntnisse überfordern, sondern auch meine Kräfte. Die Begrenzung des Raumes erlaubt ein genaues Eingehen auf biographische und geographische Daten, die noch nicht überall bekannt sind. Sie erlaubt aber auch eine nähere Zuwendung zu einzelnen Werken durch Übersetzungen, die sowohl deren Inhalt treu zu vermitteln als auch die Formen der Strophen, Verse, Rhythmen und Reime so gut zu bewahren suchen, als es irgend möglich ist in unserer durch viele Jahrhunderte verwandt gebliebenen, aber doch auch verwandelten Sprache.
Aus all dem Angemerkten ersieht man, dass ich der Absicht folge, ein Buch für Freunde der Dichtung und nicht ein wissenschaftliches Buch zu schreiben. Und nachdem ich einen großen Teil der Literatur zu meinem Thema sorgsam durchgesehen habe, weiß ich sehr wohl, warum ich das tue.
Zur Gliederung des Buches ist abschließend noch zu sagen, dass im ersten Teil zunächst ein Überblick gegeben wird zu den Lebens- und Schaffensbedingungen der Minnesänger im hohen Mittelalter. Dem folgt im zweiten Teil eine biographische Würdigung der einzelnen Sänger. Im dritten und umfangreichsten Teil endlich werden die von mir ausgewählten und übersetzten Lieder präsentiert. Von denen war – das versteht sich – wegen der großen Fülle eine Auswahl zu treffen. Die hat sich vor allem, aber nicht nur, nach dem mir sich erschließenden literarischen Wert der Texte gerichtet. Überdies musste ich bei dieser Auswahl auch darauf Rücksicht nehmen, welche Texte zu übersetzen mir unter Beibehaltung der rhythmischen Struktur und des Binnen- und Endreims nach bestem Vermögen zu gelingen schien. Darum kann auch die Wertschätzung, die ich dem einen oder anderen Dichter zuerkenne, nicht an der Anzahl meiner Übersetzungen gemessen werden. Vielmehr war ich sogar bei manchem weniger bekannten wie Hiltbold von Schwangau und Ulrich von Sachsendorf darum bemüht, ihn besser ins Licht zu heben. Bei berühmteren wie Walther von der Vogelweide und Neidhart von Reuental durfte ich darauf vertrauen, dass man anderswo leicht an ihre Werke gelangen und sein Wissen ergänzen kann. Gerechtigkeit ist hier wie auch sonst nur in Annäherungen zu erreichen.
Die einzelnen Minnesänger sind nach ihren Lebensdaten angeführt, soweit sich diese mit unterschiedlicher Sicherheit heute noch feststellen lassen. Dass nach dem Grafen von Montfort und dem Mönch von Salzburg auch Oswald von Wolkenstein als weit verspäteter Nachzügler in die Reihe aufgenommen wurde, erklärt sich nicht allein aus der Bedeutung seines wahrlich staunenswerten Werkes, sondern auch aus der Tatsache, dass er, der mit der hohen Minne nur mehr wenig im Sinn hatte, doch die äußere Form der alten Lieder in freier Weise bewahrte. Vor allem aber hat er in seinen längeren autobiographischen Texten einen wirklichkeitsnahen Einblick in den Alltag eines weit umherreitenden Sängers gegeben. Von ihm belehrt können wir zurückblicken auf die sonst nirgends in solcher Ausführlichkeit geschilderten Reisen seiner Vorgänger. Oswald selbst hat überdies zahlreiche kunstvoll mit Texten und Noten beschriebene Pergamente hinterlassen, die uns erkennen lassen, dass er in der Gewissheit der historischen Bedeutung seiner Kunst gelebt haben muss.
Die Gedichte im dritten Teil sind, soweit dies bei den wenigen überlieferten Daten möglich war, chronologisch geordnet. Deren neue und möglichst form- und inhaltsgetreue Übersetzungen vorzustellen war mir das erste Anliegen, dieses Buch zu verfassen. Nachdem sich die Arbeit unter meiner Hand verselbständigt und erweitert hat, soll ihr nun auch der Auftrag zukommen, einen Beitrag zum besseren Verstehen einer dichterischen Tradition zu geben, die zu den reichsten und wertvollsten unserer deutschen Sprache gehört. Endlich lag mir auch – das muss ich eingestehen – nicht wenig daran, mein Augenmerk auf die Dichter meiner engeren und weiteren Heimat zu lenken. Es hat wohl mancher schon in der Geschichte seiner Herkunft mit Gewinn nach den Wurzeln seines eigenen Wesens gesucht.
Richard Bletschacher
DIE KUNST DES MINNESANGS
Der deutsche Minnesang hat seinen Ursprung in der Epoche des Hochmittelalters, in der sich, durch verschiedenste Umstände begünstigt, die Bevölkerung nicht nur des römisch-deutschen Reiches, sondern ganz Europas so stark vermehrte, dass sie an ihrem Ende gegen 1300 doppelt so viele Menschen umfasste wie an ihrem Beginn, der etwa mit der Ergreifung der Regierungsgewalt durch Friedrich Barbarossa anzusetzen ist. Es war, als ob ein neu gewonnener Atem durch die europäischen Länder ging. Man besann sich der eigenen Sprachen. Man zog in weit entlegene Länder. Man gründete die ersten Universitäten, erbaute die großen Kathedralen und besann sich wieder einer Kunst, die man allzu lange den Kirchen und Klöstern überlassen hatte, man besann sich der Musik. Friedrich Barbarossa hatte 1156 die burgundische Landeserbin Beatrix geheiratet, eine junge Dame, die sowohl Provenzalisch wie auch Französisch sprach, sich im Saitenspiel und Gesang geübt und gewiss den einen oder anderen Troubadour im Gefolge hatte. Der Glanz und die ständig wachsende Macht des staufischen Hofes trugen dazu bei, in den Menschen im Deutschen Reich neue Hoffnungen zu erwecken. Wenn man diese Zeit der Angliederung des alten Fürstentums Burgund an das Römische Reich als einen ersten Ausgangspunkt einer neuen höfischen Kultur begreifen mag, so wird man das Jahr 1184 als einen der großen Höhepunkt der Epoche erkennen. Der neue Glanz wurde nirgends so mächtig vor aller Augen geführt wie in dem vielgerühmten Pfingstfest von Mainz, zu welchem an die 70.000 Ritter, das will wohl sagen: berittene Männer, aus allen Teilen des Reiches herbeigekommen waren, um die Schwertleite der Kaisersöhne zu feiern. Sie kamen aus dem Hennegau, aus Namur, aus den Niederlanden, aus dem Arelat, aus der Schweiz, aus Flandern, Burgund, Luxemburg, Lothringen, Brandenburg, Böhmen, Sachsen, Thüringen, Schwaben, Franken, Bayern, Tirol, Steiermark, Istrien, Kärnten und Krain. Die einzelnen Fürsten wurden von bis zu 2.000 Rittern begleitet. Sie suchten einander an Freigebigkeit zu übertreffen, um ihre Ansprüche durch ihren Reichtum vor allen zu erweisen. Bei dieser und mancher anderen Gelegenheit waren nicht nur Gaukler und Spielleute in ihrem Gefolge, sondern auch Minnesänger, um aus allen Gegenden und in allen Sprachen neue maere zu erfahren, zu verkünden und altbekannte neu zu singen. Hier trafen einander Troubadoure, Trouvères und Minnesänger.
Dass uns die weltliche Dichtung des Minnesangs, auch wenn wir von der Gestalt und dem Klang seiner musikalischen Ergänzung kaum etwas Rechtes wissen, so sehr mit Staunen, Verwunderung und oft sogar mit stolzer Freude erfüllt, liegt an der Morgenstimmung des erwachenden Selbstbewusstseins, an der Keuschheit und Unbefangenheit ihrer ersten Blüte und der Bemühung um eine spirituelle und sittliche Reifung aller in ihrem Umkreis Versammelten, Teilhabenden und Betroffenen. Es liegt aber auch an der zumindest in den adeligen Kreisen erwachenden Neubesinnung auf die Würde und Anmut der Frauen. Die Haltung, die wir heute noch Höflichkeit oder Ritterlichkeit nennen, hat ihren Urspung im höfischen Frauendienst des hohen Mittelalters und der wiederum ist geeignet, dem Manne ebensoviel an Ansehen zurückzugeben, wie er der Frau an Achtung erweist. Dies war und blieb noch lange Jahrhunderte danach das Richtmaß allen sittlichen Verhaltens in unseren Ländern.
Dass diese Neubesinnung aber in einer Epoche geschah, als sich die Kirche in ihren führenden Vertretern, Bischöfen, Äbten und Predigern anschickte, das Sexual- und Eheleben durch Beichtbefragungen zu durchleuchten und mit inquisitorischen Mitteln die Unterwerfung der Frau unter die Herrschaft des Mannes – und vor allem des Priesters – zu betreiben, macht sie nur umso bemerkenswerter. Und so wie auf der politischen Ebene die geistliche Macht des Papstes gegen die weltliche des Kaisers zum Kampf um die Vorherrschaft angetreten war, so suchten die Reformatoren in den Klöstern, die Inquisitoren in den Gemeinden und die Prediger an den Fürstenhöfen über das innerste Gewissen der Gläubigen Gewalt zu gewinnen. Zu keiner Zeit der Geschichte stellte sich die Kirche lebensfeindlicher dar. Während sie einerseits die Heereszüge der Kreuzfahrer forderte und den, der sich fügte, von Sünden freisprach und manchen, der sich weigerte, mit dem Bann belegte, suchte sie andererseits in die innersten Verhältnisse der Menschen einzudringen. Es ist das 12. Jahrhundert die Epoche, in welcher Sündenprediger die Schreckensvision des Fegefeuers erfanden, von der in den Büchern des Testaments und der Kirchenväter bislang keine Rede war. Es ist das 12. Jahrhundert, in dem Inquisitoren durch Höllendrohungen und Foltern Bekenntnisse erzwangen, die sie zu den furchtbarsten Strafen zu berechtigen schienen. Ehe und Beichte wurden in dieser Zeit von einer sich neuer Macht bewussten Kirche zu Sakramenten erklärt, um sich durch Belehrung und Überwachung in das alltägliche Leben einzudrängen. Indem sie alle fleischliche Lust zur Beschmutzung einer unsterblichen Seele erklärte, machte sie alle Gläubigen zu Schuldigen. Diese Vergewaltigung der Gemüter weckte Widerstand eben zu einer Zeit, als diese sich öffnen wollten für neue Lebensentwürfe und Hoffnungen. Und so muss uns die weltliche Dichtung wie der Versuch einer Befreiung erscheinen und als Einspruch gegen die Sünden- und Bußmoral der Geistlichkeit. Die Entscheidung, sich in der Landessprache gegen die bisher waltende Übermacht der lateinischen Präskriptionen zu wenden, fiel an den Höfen der Adeligen und in den Häusern der Patrizier, die sich des Lesens kundig erwiesen, als es galt, das Wort zu ergreifen, um sich zur Wehr zu setzen. Und dass dies mit den friedlichen Mitteln der Poesie geschah und den Lohn der Liebe verhieß, ließ die Drohungen der Bußgebote, des Kirchenbanns und der ewigen Verdammnis als sich überhebende Anmaßung der Geistlichkeit erscheinen. Der Umstand, dass einzelne besitzlos umherziehende Männer sich gegen die tausendjährigen Institutionen der römischen Kirche wandten, um sich in den Dienst der Liebe zu stellen, gewann ihrer Kunst die Herzen. Es wäre von keinem geringen Interesse, die aus religiösen Zwängen sich befreiende Liebeslyrik Blatt für Blatt neben die Bußbücher und Erbauungsbriefe der Klostervorsteher und Hofprediger zu legen. Dies ließe deutlich erkennen, in welchen Zwiespalt die Gemüter in der Zeit der Kreuzzüge und der Heldenepen geraten waren und welchen Akt der Befreiung aus dumpfer Ergebenheit in die geistliche Bevormundung der Minnesang für die gebildeten Menschen bedeuten musste. Auch darf ein Hinweis nicht fehlen, dass durch die Kreuzzüge die Lepra in Europa eingeschleppt worden war und eine Aussonderung der Betroffenen aus der menschlichen Gemeinschaft zur Folge hatte. Vor allem das 12. Jahrhundert war eine Epoche der heftigsten Gegensätze von höfischer Sitte, religiösem Fanatismus, nationaler Selbstbesinnung, sozialem Elend, städtischem Freiheitsstreben und der künstlerischen Blüte des Kathedralenbaus. Da ein solcher Diskurs jedoch, je ertragreicher er würde, umso weiter abführen müsste von dem Gegenstand, der hier gewählt wurde, sollen die gesellschaftlichen Zusammenhänge von Kunst, Religion und Alltagsleben in der Folge nur am Rande hin und wieder beachtet werden, ohne sie ganz zu vergessen. Das Hauptaugenmerk dieser Betrachtung soll nicht der sozialen und politischen Geschichte der Stauferzeit gelten, sondern den Dichtern des Minnesangs und der Kunst, die sie schufen. Wie man bald erkennen wird, wird auch das Feld, auf das wir so gelangen werden, sich weitläufiger erweisen, als unsere Augen reichen.
Die Frage nach dem Ursprung des Minnesangs hat man auf vielerlei Weise versucht zu beantworten. Man hat auf die Liebeslyrik des arabischen Hofes in Córdoba verwiesen, und man hat mit Recht vermutet, dass die Begegnung der Völker auf den Kreuzzügen viel vordem Unbekanntes weitum unter die Leute gebracht hat. Und vor allem und mit Recht hat man vorgebracht, dass die Troubadoure der Provence und bald nach ihnen die Trouvères Nordfrankreichs ein Menschenalter vor den deutschen Minnesängern mit ihren Dichtungen und Gesängen hervorgetreten waren. Auch die lateinische Liebeslyrik der spätrömischen Zeit hat man zur Vorgängerin erklärt. Das alles hat gewiss befruchtend und fördernd zusammengewirkt. Nicht erlaubt jedoch scheint es mir, den Minnesang von der im Volke wachsenden Marienverehrung beeinflusst zu sehen. Die beiden entspringen allzu verschiedenen Quellen. Der Erstere der traditionellen Achtung der germanischen Völker vor der Würde der Frau und der weltlich ritterlichen Gesinnung des Adels, die andere dem Volks- und Aberglauben, der alten Sehnsucht nach einer Muttergöttin in der Männerwelt der katholischen Kirche. Ich bin überzeugt von einer Entwicklung, die angeregt wurde von den maurischen und provenzalischen Einflüssen der Kreuzfahrerzeit. Ebenso aber glaube ich auch an eine weitere eigenständige Ausgestaltung. Die Themen und Formen des deutschen Minnesangs entfernten sich im weiteren Verlauf immer deutlicher von denen der westlichen Länder. Sicherlich haben lateinisch sprechende und singende Scholaren und Vaganten manche Anregung hin und wieder getragen. Aber der unvergleichbar eigene Ton des deutschen Minnesangs ist nicht zu überhören. Er geht uns, die wir unsere Sprache lieben, ohne andere gering zu schätzen, auch heute noch ganz unmittelbar nahe.
Zu Grunde liegt aller abendländischen Literatur des Mittelalters das christliche Weltbild, zu Grunde liegt auch die monarchische und feudale Gesellschaftsordnung, zu Grunde liegen das – wenn auch vorerst nur bruchstückhaft bekannt gewordene – antike Erbe, die keltische und germanische mündliche Überlieferung der Heldensagen und schließlich, seit längerer Zeit bereits im maurischen Spanien und dann während der Kreuzzüge erneut, die staunende Begegnung mit der hochentwickelten islamischen Kultur. Durch die Neubesinnung auf die eigenen Landessprachen gelangten bisher nur mündlich tradierte Erzählungen, Gebete, Anrufungen, Huldigungen oder Zaubersprüche christlichen und heidnischen Ursprungs zu neuer Beachtung. All dies aber war in glücklichen Augenblicken poetischer Inspiration wie weggewischt vor dem unverstellten Bild reiner Menschlichkeit, die sich nirgends schöner erwies als im Lobpreis der irdischen Liebe. Deren Verkünder waren die Minnesänger. Durch ihr Bekenntnis des eigenen Empfindens, und nicht durch ihren Bezug auf die ihr Wissen nährenden älteren Traditionen, haben ihre besten Werke bis zum heutigen Tage nichts von ihrem Zauber verloren.
Ob man tatsächlich das 12. Jahrhundert als die Epoche bezeichnen kann, in welcher „die Liebe erfunden“ wurde, wie man gelegentlich liest, das wage ich nicht zu sagen. Gewiss haben Abaelard und Eloïse in dessen frühen Jahrzehnten gelebt, aber die Stoffe der großen Liebeserzählungen, etwa die von Tristan und Isolde, von Herwig und Gudrun, Rothar und Oda, Lanzelot und Ginevra oder Peire von der Provence und der schönen Magelone stammen allesamt aus älteren Tagen, von Siegfried und Brünhild ganz zu schweigen. Immerhin erhielten fast alle von ihnen erst um die Wende vom 12. zum 13. Jahrhundert ihre literarische Gestalt, die sie allen historischen Zeiten entrückt und dem Gedächtnis des Abendlandes übergaben. „Erfunden“ wurde nicht die Liebe, wohl aber eine schöne Form des literarischen Frauendienstes, die uns Einblick gewährt in das Verhältnis der Geschlechter zueinander, und zwar in den Kreisen der kunstsinnigen und schriftkundigen adeligen Gesellschaft der staufischen Epoche.
Dass die Verehrung der Frau aus den Herrschaftsgebieten des Islam durch die Kreuzzüge erst in die Provence und von dort über den Rhein ins Reich gekommen sei, das sollte man nicht glauben. Den Frauen war in den Ländern des Nordens von jeher große Achtung entgegengebracht worden, größere als anderswo in den bekannten Ländern des Südens oder Ostens, zumal den Frauen des Adels. Ihnen wurde oft auch die Herrschaft anvertraut, und dies nicht nur in Haus und Hof, in Spinnstuben und Klöstern, sondern auch auf den Thronen des Heiligen Römischen Reiches. Man war sich wohl bewusst, dass ohne ihr Wirken alles Leben und alle irdischen Freuden erstürben. Die Liebesgöttin Freia war dafür die Garantin. Dass aber die erlesene Kultur des Orients die Phantasie der Dichter neu erregt und gesteigert haben muss, davon haben wir vielfaches Zeugnis. Mehr als nur ein Troubadour oder Minnesänger hat sich auf den Weg gemacht, hat die Pilgerreise oder gar die Kreuzfahrt gewagt und hat manches vernommen, was ihn bewegt haben mag. Leonore von Aquitanien, Gattin erst des französischen, dann des englischen Königs und Mutter von Richard Löwenherz, wurde von vielen Dichtern besungen. Und so wie sie ließen es sich andere hohe Damen gefallen. Auch ist die Laute vermutlich aus den arabischen Ländern über Spanien nach Frankreich und über Sizilien nach Deutschland gekommen. Und bald war sie das liebste Instrument, auf dem sich die Singenden begleiten ließen. Anders als die vordem schon beliebten Fiedeln, Flöten, Schellen, Kastagnetten und Trommeln diente sie nicht, um zum Tanz aufzuspielen. Sie war für Liebesgeständnisse wie geschaffen, und dies nicht zuletzt durch ihre Form, die weich in der Hand lag und oft mit der eines weiblichen Körpers verglichen wurde.
Die Bindungen, welche die neuen landessprachlichen Dichtungen zur Musik ihrer Zeit eingingen, und die Erfordernisse ihres öffentlichen Vortrags ließen vielfältige lyrische und epische Gattungen entstehen, die sich oft sehr genau gegeneinander abgrenzten. Die Liebe von Mann und Frau war wie in aller lyrischen Dichtung das alles beherrschende Thema. Aber die Dichter schufen in der Zeit der staufischen Kaiser – die hier vor allem behandelt werden soll – nicht allein Minnelieder, sondern auch Tanzlieder, Sinnsprüche, Tagelieder, Reihen, Pastourellen, politische oder moralisierende Sprüche, Spottlieder, Sauflieder, Kreuzfahrerlieder und die eigene Sprachform des Leichs, einer umfänglicheren, weiter ausholenden, vieles umgreifenden und auch mit reicheren musikalischen Mitteln versehenen Gattung, die sich einer nordischen Tradition verdankt. Nebenher gingen die unterschiedlichen Formen der ernsten und satirischen Parodie oder Kontrafaktur. Die fanden gerade im Gegenüber des Minnesangs wegen dessen erstaunlich engem Themenkreises immer neuen Anlass zu Spott und Hohn ebenso wie zu Widerrede und konkurrierendem Wettstreit.
Bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts hatte alles Dichten und Berichten in deutschen Landen fast zur Gänze in den Händen von Geistlichen gelegen. Die aber hatten sich, meist unter Ausschluss des alltäglichen Lebens, in Hymnen auf die Dreifaltigkeit oder die Jungfrau Maria, in theologischen Meditationen oder Interpretationen der ihnen heiligen Schriften ergangen. Manches davon wird heute erst nach und nach wieder entdeckt, übersetzt und gewürdigt. Einiges ist seit jeher unvergessen wie das Stabat mater, das Dies irae oder das Veni creator spiritus. Vom frühen Latein des Mittelalters aber kennt man nur mehr wenige Dichternamen. Dass bereits in der römischen Spätantike erstmals Endreime gebraucht wurden, beweist uns der anonyme Osterhymnus Ad cenam agni providi aus dem 5. Jahrhundert. Reime bleiben aber auch weiterhin die Ausnahme. Sie sollten erst in den Landessprachen zum zwingenden Formprinzip werden. Die lateinische Sprache und mit ihr ein Gutteil des römisch-katholischen Geistes herrschte noch über alle Schreibstuben und Kanzleien. Sogar die erhalten gebliebenen Liebesbriefe wurden in Latein abgefasst. Weitaus die meisten von ihnen wanderten zwischen den Zellen von Mönchen und Nonnen hin und her. Weniges nur, aber darum umso Kostbareres, in den Landessprachen der Völker Geschriebenes ist uns erhalten. Wohl hat Otfried, ein Mönch des Klosters Weißenburg im Elsass und Schüler des berühmten Abtes von Fulda Hrabanus Maurus, gegen Ende des 9. Jahrhunderts mit seiner Evangelienharmonie eine erste Reimdichtung in fränkischer Sprache verfasst. Danach jedoch vertrocknen wieder die Quellen. Texte in althochdeutscher Sprache kommen nur in geringer Zahl noch auf uns. Und bei diesen halten sich die Autoren weiterhin meist an die Bindungen des germanischen Stabreims.
Dass die Volkssprachen sich nun aber um die Mitte des 12. Jahrhunderts durch die Wiederaufnahme des Endreims und die Einbeziehung der Musik so deutlich zu Wort meldeten, hat seine bedeutsamen Gründe. Der erste Kreuzzug im Jahre 1099 hatte eine nicht nur mörderische, sondern auch befruchtende Begegnung mit dem Islam gebracht. Auch mit dem byzantinischen Kaiserreich, das sich als Nachfolger des römischen verstand und einen gleichen Anspruch westlicher Herrscher bisher zurückgewiesen hatte, hatten die westeuropäischen Länder einmal höflich, einmal gewaltsam versucht sich neu zu verständigen. Im Jahre 1204 hatten sie endlich auf Betreiben und unter Führung Venedigs die oströmische Hauptstadt Konstantinopel erobert. Neue Quellen zur Philosophie der Griechen waren dadurch erschlossen, neue Tänze und Musikinstrumente waren zurückgebracht worden. Der Blick war über fremde Länder und Meere hin geweitet worden. Provenzalen, Lombarden, Burgunder, Franzosen, Normannen, Engländer, Dänen und Deutsche hatten sich zu gemeinsamen Taten verbrüdert. Ein neues politisches und kulturelles Selbstbewusstsein war erwacht. Dass dies innerhalb von wenigen Jahrzehnten zu allgemeiner Geltung drängte und eigenständige, unvergleichliche Kunstwerke schuf in der romanischen und daneben schon in der gotischen Baukunst, in der Plastik, in der Glasmalerei und nun auch in der Dichtkunst muss man im Rückblick als das große Ereignis des hohen Mittelalters betrachten. Die Laiendichtung in der Sprache des Volkes entfaltete sich rasch und mächtig zu wundersamer Blüte und schenkte den Menschen sowohl ein vermehrtes Verständnis untereinander als auch ein neues Mittel zur Selbstbetrachtung. Wenn man die Literatur dieser Zeit mit einem Blick überschaut, so fällt einem ins Auge, dass die lateinische Sprache ebenso wie die antiken, biblischen oder geistlichen Themen nur mehr eine geringe Rolle spielten. So großes Eigenleben hatte die neue landessprachliche Dichtung in wenigen Jahren gewonnen. Man hatte erkannt, dass sich in der Sprache der Charakter und das Selbstverständnis eines Volkes am deutlichsten ausdrücken. Und dass jede Hinneigung zur Aufnahme fremden Sprachguts einerseits einen Akt der Einsicht und zwischenmenschlichen Kultur, andererseits aber auch einen Akt der Unterwerfung bedeutet.
Es hat sich mir in der Betrachtung des staunenswerten Ereignisses der mittelalterlichen Hochkultur die Überzeugung bestätigt, dass große Epochen der Kunst nach einer glückhaften Entstehung sich gleichsam in einem organischen Wachstum entfalten. Auch da, wo man sie oft nicht erwartet hätte, dringen, wie aus einem unterirdisch verzweigten Myzel, neue Sprossen hervor. Und so finden wir an begrenzten Orten eine wie auf körperlicher Ansteckung beruhende Vermehrung von Talenten. Dies geschah im Verlauf der abendländischen Kunst immer wieder, sei es auf den Gebieten der Literatur, der Musik, der Philosophie oder der bildenden Künste. Beispiele von den griechischen Dramatikern, den bildenden Künstlern der Renaissance bis zum Weimarer „Musenhof“ und den französischen Impressionisten kennt ein jeder. Es erübrigt sich, sie aufzuzählen.
Niemand wird heute zweifeln, dass das hohe Mittelalter auf den Gebieten der Philosophie, der Medizin, der Rechtsprechung, der Hygiene, der theatralischen Künste und der militärischen Strategie die verlorene Höhe der Antike nicht wieder erreicht hat; was aber die Dichtung, die bildende Kunst, die religiöse Inspiration, die Architektur und bald auch die Musik anlangt, so ist der Begriff eines Erwachens neuer autochthoner Kräfte keine Übertreibung. Allenthalben entstanden nicht mehr nur Kirchen und Klöster, sondern mächtig ummauerte bürgerliche Städte und zahllose Burgen und Ansitze sowohl an den Grenzen wie auch auf dem offenen Land. Viel unterwegs waren die Könige und Kaiser von jeher mit ihrem Gefolge von Pfalz zu Pfalz. Nun aber war vom Papst zu den Kreuzzügen aufgerufen worden und es ritten die deutschen Ritter rhôneabwärts an den Mittelmeerhafen Marseille und zogen die flämischen und französischen Heere durch deutsches Gebiet der Donau entlang nach Südosten. Viel Neues erfuhren voneinander die Herren und ihre Ministerialen, viel Neues aber auch die Handelsleute und Künstler. Ehe noch im Norden Frankreichs die ersten Kathedralen entstanden und am Rhein die prachtvollen Buchmalereien und Glasfenster geschaffen wurden, waren im Süden, in der Provence, in Okzitanien und Katalonien, die Stimmen der Troubadoure erwacht. Es ist hier nicht der Ort, zu untersuchen, wie viel sie den Mauren im islamischen Spanien verdankten. Gewiss ist jedenfalls, dass sie die Laute, das ideale Begleitinstrument für die menschliche Stimme, von dorther übernahmen. Von der Provence aus wurde die neue weltliche Sangeskunst nach Norden und Osten getragen und weckte bald in den französischen Trouvères und den deutschen Minnesängern Nachfolger in anderen Sprachen. Sicher scheint, dass die Heirat Friedrich Barbarossas mit Beatrix, der Erbin von Burgund, dafür von großer Bedeutung war. Nicht geringer war die des Herzogs von Bayern und Sachsen, Heinrichs des Löwen, mit Mathilde, der Tochter des normannischen Königs von England und der vielbesungenen Leonore von Aquitanien, der einige der frühesten Gesänge der Troubadoure gewidmet waren. Kein Zweifel kann daran bestehen, dass in den Häusern der Staufer und Welfen auch hin und wieder französisch gesprochen wurde.
Es war dies aber die Zeit, in der die epischen Dichtungen, die bisher nur von Mund zu Mund gegangen waren, nach und nach ihre Niederschrift fanden. Die hatte man bisher nicht in lateinische Verse kleiden wollen. Sie waren aus einem anderen als mönchischem Geist. Nun aber war wie in einem einzigen Frühlingserwachen in wenigen Jahrzehnten eine Fülle von Werken der Dichtkunst emporgekommen, wie sie noch Jahrhunderte danach nicht mehr ihresgleichen gefunden hat. Hier waren wiederum die französischen Epiker und unter ihnen vor allen anderen der erstaunliche Chrétien de Troyes die Ersten. Zu größerer Fülle und mächtigerer Wirkung aber gelangten die epischen Werke der deutschen Dichter. Die erschufen innerhalb dreier Jahrzehnte die in gereimte Verse gebundenen Erzählungen von Erec, Iwein, Gregorius, von Parzival, Willehalm, Titurel, von Wigalois, von Gudrun, von Wieland dem Schmied, von Roland, vom König Laurin, von Tristan und Isolde, dazu die Rabenschlacht des Dietrich von Bern und vor allen anderen das Nibelungenlied. Daneben sollen die sogenannten Volksbücher vom Herzog Ernst, vom König Rother, vom König Oswald, von Salman und Morolf, vom „gehürnten“ Siegfried und von Orendel sowie schließlich vom Meier Helmbrecht nicht vergessen werden, denn die Grenzen von der einen zur anderen Gattung sind nicht immer klar zu erkennen.
Die Träger der neuen landessprachlichen Dichtung waren – im Deutschen Reich ebenso wie in der Provence, in Nordfrankreich oder in Italien – nun nicht mehr die Geistlichen oder die Schreiber und Schriftgelehrten der Höfe und Städte, sondern freie Männer meist adeligen Standes. Sie mussten wohl auch reich genug sein, um sich ein Pferd und einen Knappen leisten zu können, ein Musikinstrument dazu und warme Kleidung für den Winter. Und höfisches Gewand, um sich vor nobler, kunstsinniger Gesellschaft zu zeigen. Sie mussten in ihrer Jugend auf Schulen oder bei privaten Lehrern Lesen und Schreiben und das Spielen auf zumindest einem Instrument erlernt haben. Und zudem konnte wohl keiner ohne einen eigenen Groschen im Beutel ausreiten und hoffen, auf Kosten anderer unterzukommen und sich zu ernähren. Die Straßen waren keineswegs sicher in jenen Tagen. Man musste sich bewaffnen, um sich zu wehren, wenn man überfallen wurde, denn „Gewalt fuhr auf der Straße“. All das war einem Bürgerlichen nur in seltenen Fällen gegeben. Hinzu kam, dass der um das Jahr 1235 entstandene Sachsenspiegel die herumziehenden Spielleute für vogelfrei erklärte. Mit denen wollte man nicht verwechselt werden. Es gab wohl mehr als einen Minnesänger, dem es gelang, sich unter die Schutzherrschaft eines großen Herrn zu begeben, seinem Namen Geltung zu verschaffen und die Mittel zu erwerben, um wohlbewahrt durch die Lande zu ziehen. Wenn sich in den großen Epen dieser Epoche kein Hinweis findet auf die Tätigkeit der Minnesänger, wohl aber auf die der Spielleute, so ist der Grund vielleicht darin zu suchen, dass man den Minnesang als eine neue, zeitgenössische Kunst erachtete, die sich nicht in die alten Historien fügen und nicht dazu dienen wollte, die Taten der Helden zu rühmen.
Gesungen wurde der Minnesang vor allem an den Höfen der Reichen und Mächtigen. Von denen war nicht nur Lohn und Herberge zu erwarten, sondern auch Verständnis und Einverständnis für das Lob der edlen Frauen. Der Minnesang war eine Kunst für feine Ohren. Das eigentlich Neue an ihm war seine Abkehr von der oft großsprecherisch auftrumpfenden Heldendichtung, die die Taten der Männer in den Mittelpunkt stellte; das Neue war die Selbstbescheidung der Dichter vor der sittigenden Macht des schwachen Geschlechts in ihrer Verkörperung als hoher Frau.