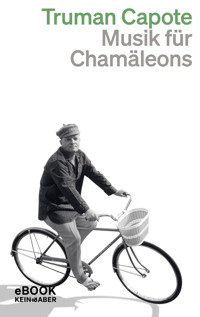11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1955 begleitet Truman Capote als Reporter ein afroamerikanisches Ensemble von »Porgy und Bess« auf einer Russlandtournee und schreibt darüber seinen ersten »Tatsachenroman« »Die Musen sprechen«. Der Titel stammt aus der Rede eines Mitarbeiters des sowjetischen Kulturministeriums, der den amerikanischen Reisenden durch Russland erklärte: »Wenn die Kanonen zu hören sind, schweigen die Musen. Wenn die Kanonen schweigen, hört man die Musen.«
Als absoluter Pionier auf dem Feld des Journalismus als eigener Kunstform erzählt Truman Capote in seinem literarischen Reisebericht auch von einer Zeit im nahen 20. Jahrhundert, in der das Ensemble Erfahrungen macht, die unser aller Haltung zu Rassismus bis heute neu zu beleuchten vermögen.
Zum 100. Geburtstag des Jahrhundertgenies erscheint Capotes gesamtes journalistisches Werk bei Kein & Aber neu in drei Einzelbänden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Truman Capote wurde 1924 in New Orleans geboren. 1948 erschien sein erster Roman Andere Stimmen, andere Räume, der als das sensationelle Debüt eines literarischen Wunderkindes gefeiert wurde. Das 1958 veröffentlichte Frühstück bei Tiffany erlangte auch dank der Verfilmung mit Audrey Hepburn große Berühmtheit. 1966 erschien der mehrmals verfilmte »Tatsachenroman« Kaltblütig, 1973 Die Hunde bellen (Storys und Porträts), 1980 Musik für Chamäleons (Erzählungen und Reportagen). Posthum wurden 1987 der unvollendete Roman Erhörte Gebete und 2005 das neu entdeckte, eigentliche Debüt Sommerdiebe veröffentlicht. Truman Capote starb 1984 in Los Angeles. Das gesamte Werk von Truman Capote erscheint auf Deutsch in der Zürcher Ausgabe, herausgegeben von Anuschka Roshani, bei Kein & Aber.
ÜBER DAS BUCH
1955 begleitet Truman Capote als Reporter ein afroamerikanisches Ensemble von Porgy and Bess auf einer Russlandtournee und schreibt darüber seinen ersten »Tatsachenroman« Die Musen sprechen. Der Titel stammt aus der Rede eines Mitarbeiters des sowjetischen Kulturministeriums, der den amerikanischen Reisenden durch Russland erklärte: »Wenn die Kanonen zu hören sind, schweigen die Musen. Wenn die Kanonen schweigen, hört man die Musen.«
Als absoluter Pionier auf dem Feld des Journalismus als eigener Kunstform erzählt Truman Capote in seinem literarischen Reisebericht auch von einer Zeit im nahen 20. Jahrhundert, in der das Ensemble Erfahrungen macht, die unser aller Haltung zu Rassismus bis heute neu zu beleuchten vermögen.
DIE MUSEN SPRECHEN
Mit Porgy and Bess durch Russland
Westberlin, Samstag, 17. Dezember 1955: An diesem nebligen nasskalten Tag fand sich die gesamte vierundneunzigköpfige Belegschaft der Produktion Porgy and Bess im Probenraum zu einem so genannten »Briefing« ein, das von Botschaftsrat Mr. Walter N. Walmsley Jr. sowie dem Zweiten Sekretär der amerikanischen Botschaft in Moskau, Mr. Roye L. Lowry, durchgeführt wurde. Mr. Walmsley und Mr. Lowry waren eigens aus Moskau angereist, um den Mitgliedern der Truppe Verhaltensmaßregeln für die bevorstehenden Auftritte in Leningrad und Moskau mitzuteilen und gegebenenfalls Fragen zu beantworten.
Die Reisenach Russland, eine absolute Premiere für ein amerikanisches Ensemble, sollte der Höhepunkt der vierjährigen Welttournee von Porgy and Bess werden. Sie war das Resultat monatelanger, atmosphärisch hochbelasteter Verhandlungen zwischen der UdSSR und den Produzenten der Gershwin-Oper, Robert Breen und Blevins Davis, die unter dem Namen Everyman Opera Incorporated firmierten.
Auch wenn die Russen noch keine Visa ausgestellt hatten, stand dieser Riesenverein aus achtundfünfzig Schauspielern, sieben Bühnenarbeitern, zwei Dirigenten, diversen Ehefrauen und Sekretärinnen, sechs Kindern samt Lehrerin, drei Journalisten, zwei Hunden und einem Psychotherapeuten bereit, innerhalb der nächsten achtundvierzig Stunden per Zug von Ostberlin über Warschau und Moskau nach Leningrad zu reisen, elfhundert Kilometer mit einer voraussichtlichen Fahrzeit von drei Tagen und drei Nächten.
Auf dem Weg zu diesem diplomatischen Briefing teilte ich mir ein Taxi mit Mrs. Ira Gershwin und einem Kleiderschrank namens Jerry Laws, einem ehemaligen Berufsboxer, der jetzt als Sänger engagiert ist. Mrs. Gershwin ist die Schwägerin von George Gershwin und verheiratet mit dem Songtexter Ira Gershwin, der auch das Libretto zu Porgy and Bess geschrieben hat. In den letzten vier Jahren hat sie des Öfteren ihren Mann in Beverly Hills zurückgelassen, um das Ensemble auf seiner Reise um die Welt zu begleiten. »Ira kriegt ja den Hintern nicht hoch. Von ihm ist es schon zu viel verlangt, sich auch nur ins nächste Zimmer zu begeben. Aber weißt du, Darling, ich bin eigentlich eine Zigeunerin. Bei mir müssen die Räder rollen.« Für ihre Freunde heißt sie Lee, eine Abkürzung für Lenore. Sie ist eine kleine, zierliche Frau mit Hang zu Brillantschmuck, den sie schon am Morgen trägt. Sie hat sonnengebleichte Haare und ein herzförmiges Gesicht. Der atemlose Redestrom, abgegeben von einer Kleinmädchenstimme, die sich trotz des gesenkten Tons nicht darum schert, wer sonst noch mithört, ist durchsetzt von Kosebezeichnungen wie Darling, Schatz oder Honey.
»Ach, Schatz«, sagte sie, als wir über den nieseligen Kurfürstendamm fuhren, »hast du schon gehört? Die Russen stellen für uns sogar einen Weihnachtsbaum auf. In Leningrad. Wenn das nicht nett ist. Ich meine, dafür, dass sie nicht an Weihnachten glauben. Sie glauben doch nicht an Weihnachten – oder, Schatz? Auf jeden Fall kommt ihr Weihnachten viel später. Sie haben nämlich einen anderen Kalender. Stimmt doch, Schatz?«
»Dass sie nicht an Weihnachten glauben?«, fragte Jerry Laws.
»Aber nein, Darling«, sagte Mrs. Gershwin ungeduldig. »Das mit den Mikros. Und den Fotos.«
Seit einigen Tagen regten sich im Ensemble nämlich Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre in Russland. Es ging das Gerücht, sämtliche Briefe würden zensiert und alle Hotelzimmer seien mit Wanzen und versteckten Kameras gespickt.
Nach einer gedankenschweren Pause sagte Laws: »Anzunehmen.«
»Schatz, das ist nicht dein Ernst!«, protestierte Mrs. Gershwin. »Das kann doch nicht sein, wo soll man denn da in Ruhe tratschen? Etwa auf dem Klo, bei laufender Spülung? Und was die Kameras angeht …«
»Kameras gibt es auch«, sagte Laws.
Mrs. Gershwin versank in nachdenklichem Schweigen, bis wir in die Straße einbogen, in der sich der verspiegelte Probenraum befand. Dort sagte sie enttäuscht: »Na immerhin, wenigstens das mit dem Weihnachtsbaum ist nett.«
Wir waren fünf Minuten zu spät und fanden zwischen den Klappstühlen, die an einem Ende des verspiegelten Saals aufgestellt waren, nur schwer einen Platz. Eng war es und gut geheizt, trotzdem hätte man meinen können, der eisige Wind der Tundra sei bereits spürbar, denn viele saßen in Schals und dicke Wollmäntel vermummt da, die sie speziell für diese Reise angeschafft hatten. Es herrschte gewissermaßen ein Wettstreit um den besten Kälteschutz, und einige trugen geradezu Eskimo-Look.
Dann eröffnete Robert Breen die Zusammenkunft. Er war nicht nur Koproduzent von Porgy and Bess, sondern auch der Regisseur. Nachdem er die Abgesandten der Moskauer Botschaft vorgestellt hatte, Mr. Walmsley und Mr. Lowry – sie saßen an einem Tisch direkt hinter ihm –, ergriff Mr. Walmsley, ein untersetzter Herr mittleren Alters mit einem Mittelscheitel wie H. L. Mencken, das Wort, indem er versicherte, welch »einzigartige Chance« die anstehende Reise bot, und gratulierte schon im Voraus zu dem »großen Erfolg«, der alle Beteiligten hinter dem Eisernen Vorhang erwartete.
»Da in der Sowjetunion nichts geschieht, was nicht von langer Hand geplant wäre, und Ihr Erfolg nun einmal fest vorgesehen ist, bin ich in der erfreulichen Lage, Sie schon jetzt zu Ihrer Leistung zu beglückwünschen.«
Als habe er den Haken an diesem vermeintlichen Kompliment entdeckt, beeilte sich Mr. Lowry, ein ziemlich junger, recht schulmeisterlich wirkender Mann, hinzuzufügen, dass wir, unbeschadet der – ansonsten völlig korrekten – Ausführungen seines Kollegen, davon ausgehen könnten, dass man in Russland unserem Besuch »regelrecht entgegenfiebert«. Wörtlich sagte er: »Die Leute kennen Gershwins Musik. Mir erzählte ein Bekannter sogar, drei Freunde von ihm hätten auf einer Party neulich Bess, You Is My Woman Now gesungen, und zwar von Anfang bis Schluss.«
Die Truppe lächelte erfreut, und Mr. Walmsley fuhr fort. »Ja wirklich, es gibt auch nette Russen, sehr nette sogar. Sie haben nur eine schlechte Regierung«, sagte er bedächtig. »Denken Sie immer daran: Dieses Regierungssystem ist dem unseren grundsätzlich feindlich gesinnt. Es ist eine Kommandogesellschaft, wie Sie sie in Ihrem Leben noch nicht gesehen haben. Zumindest habe ich – und glauben Sie mir, ich verfüge über langjährige Erfahrungen – bisher nichts Vergleichbares erlebt.«
Jemand aus dem Ensemble, John McCurry, hob die Hand zu einer Frage. McCurry spielt den Gewalttäter Crown und sieht der Rolle entsprechend aus, groß, schwer und irgendwie brutal. Er wollte wissen: »Angenommen, jemand lädt uns zu sich nach Hause ein – ich meine, das ist normal und kommt dauernd vor. Meine Frage jetzt: Dürfen wir das?«
Die Diplomaten tauschten einen amüsierten Blick.»Wie Sie sich sicher denken können«, sagte Mr. Walmsley, »haben wir dieses Problem noch nie gehabt. Privat lädt man uns nie ein, nur offiziell. Möglich, dass es bei Ihnen anders ist. Und wenn es so sein sollte, sagen Sie zu, lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Aber soweit ich weiß, haben Ihre Gastgeber ein umfangreiches Rahmenprogramm organisiert, das heißt, man wird Sie keine einzige Minute in Ruhe lassen. Wenn sie danach noch Lust haben, bitte …«
Ein paar Jüngere schnalzten bei diesen Aussichten mit der Zunge, doch einer meinte: »Also, ich rühre keinen Tropfen Alkohol an, das sage ich gleich. Man hört aber, dass dauernd irgendwelche Toasts angebracht werden. Wie kommt man denn möglichst elegant darum herum, das Zeug auch zu trinken?«
Schulterzucken seitens Mr. Walmsley. »Wenn Sie nichts trinken wollen, tun Sie es einfach nicht.«
»Das finde ich aber auch«, bestärkte ihn ein anderer. »Keiner darf zum Trinken gezwungen werden. Und wenn du was nicht willst, gib es mir.«
Dann kamen die Fragen Schlag auf Schlag. Eltern zum Beispiel, sie waren hauptsächlich besorgt um ihre Kinder. Gab es in Russland pasteurisierte Milch? Ja, gab es. Gleichwohl empfahl Mr. Lowry die Mitnahme einer ausreichenden Menge von Starlac-Trockenmilch, seine beiden Kinder bekämen die auch immer. Und wie stand es mit dem Wasser, war das trinkbar? Absolut, keinerlei Bedenken. Er selbst trinke regelmäßig russisches Leitungswasser. Und wie redete man einen Sowjetbürger an? »Nun«, erwiderte Mr. Walmsley, »mit Genosse würde ich sie jedenfalls nicht ansprechen, Mr. und Mrs. sind vollkommen ausreichend.« Und Shopping in Russland, war es teuer? Antwort: »Extrem teuer sogar.« Was aber unerheblich war, da es ohnehin nichts zu kaufen gab. Und wie kalt wurde es? Oh, an manchen Tagen leicht unter dreißig Grad minus. War dann wenigstens das Hotelzimmer warm? Auf jeden Fall, normalerweise sogar völlig überheizt.
Als diese grundlegenden Fragen abgehakt waren, meldete sich eine Stimme aus dem hinteren Teil des Saals. »Hier sind so viele Schauermärchen im Umlauf, angeblich sollen wir sogar rund um die Uhr beschattet werden. Stimmt das?«
»Beschattet?« Mr. Walmsley lächelte. »Möglich. Aber bestimmt nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Wenn Ihnen jemand folgt, dann höchstens zu Ihrem Schutz. Sie müssen damit rechnen, überall erhebliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das heißt, es ist mit größeren Menschenansammlungen zu rechnen. Das ist nicht so wie in Berlin, wo Sie ungestört über die Straße laufen können. Aus diesem Grund hat man für Sie einige Bewacher abgestellt, ja, aber das ist eigentlich schon alles.«
»Sie dürfen nicht vergessen«, sagte Mr. Lowry, »die Russen wollten Sie um fast jeden Preis ins Land holen, also wird man Ihnen all die Schikanen ersparen, die dieser Staat für seine wenigen Touristen normalerweise bereithält.«
Die Stimme aus dem Hintergrund, beinahe enttäuscht, ließ aber nicht locker. »Also wir haben gehört, wir werden beschattet. Und dass unsere Briefe geöffnet werden.«
»Ach du lieber Gott«, sagte Mr. Walmsley, »das dürfen Sie nicht so eng sehen. Ich zum Beispiel rechne immer damit, dass meine Post aufgemacht wird.«
Leichte Unruhe im Saal. Blicke, die so viel bedeuteten wie: »Na bitte, was habe ich gesagt?« Nancy Ryan, die Sekretärin von Robert Breen, erhob sich. Miss Ryan (Radcliffe College, Jahrgangsstufe 1952) war vor drei Monaten aus ihrer Leidenschaft für das Theater zu der Truppe gestoßen. Sie kommt aus New York, hat blonde Haare und sehr blaue Augen, ist knapp unter eins achtzig groß und ähnelt ihrer Mutter, Mrs. William Rhinelander Stewart, der oft fotografierten Stil-Ikone. Sie wollte nur einen Vorschlag machen: »Mr. Walmsley, wenn es stimmt, dass unsere Post so oder so zensiert wird, wäre es da nicht besser, gleich Postkarten zu schreiben? Ich meine, dann müssten sie nicht alles extra aufmachen und die Post wäre schneller in Amerika.«
Mr. Walmsley hielt aber Miss Ryans Vorgehensweise weder für zeitsparend noch für praktikabel. Unterdessen schob Mrs. Gershwin ihren Jerry Laws vor. »Los, Darling, frag ihn das mit den Mikros.«
Laws gelang es, den Diplomaten auf sich aufmerksam zu machen. »Viele von uns«, sagte er, »viele von uns fragen sich, ob unsere Hotelzimmer abgehört werden.«
Mr. Walmsley nickte. »Ich denke, damit müssen Sie rechnen. Noch einmal: Diese Sachen sind in Russland völlig normal. Genau weiß das allerdings niemand.«
In der darauffolgenden Stille fummelte Mrs. Gershwin nervös an ihrer Brillantbrosche. Sie wartete darauf, dass Jerry Laws auch die versteckten Kameras zur Sprache brachte, doch McCurry war schneller.
McCurry beugte sich vor, und sein Kopf versank zwischen den mächtigen Schultern. Er sagte, den Kleinkram hätten sie jetzt, aber was wäre mit dem »eigentlichen Problem«? Das eigentliche Problem: Was sollten sie sagen, wenn sie zu politischen Themen gefragt wurden. »Ich meine vor allem die Situation der Schwarzen in Amerika.«
McCurrys Stimme verwandelte die schlichte Frage in eine Welle, die alle im Saal mitriss. Mr. Walmsley zögerte, als wisse er noch nicht, ob er sich der Welle anvertrauen oder durch sie hindurchschwimmen sollte. Auf keinen Fall aber wollte er sich ihr direkt entgegenstellen.
»Auf so etwas sollten Sie gar nicht eingehen. Die Russen tun das umgekehrt auch nicht.« Walmsley räusperte sich: »Das ist gefährliches Terrain. Ein einziger Eiertanz.« Das Gemurmel im Saal deutete darauf hin, dass man die Antwort für unzureichend erachtete. Lowry flüsterte Walmsley etwas ins Ohr, und McCurry beriet sich mit seiner melancholischen Frau, die ihre dreijährige Tochter auf dem Schoß hielt. Dann setzte McCurry nach: »Aber die Rassenfrage kommt garantiert. Letztes Jahr in Jugoslawien haben sie uns das dauernd gefragt …«
»Ich weiß«, sagte Walmsley schroff. »Das ist es ja. Das ist ja das Problem.«
Walmsleys Antwort (oder vielleicht nur die Art, wie sie vorgebracht wurde) machte es aber nicht besser, und Jerry Laws, bekannt für sein aufbrausendes Temperament, sprang hoch und konnte sich kaum noch beherrschen. »Und jetzt? Sollen wir sagen, wie es ist? Sollen wir ihnen die Wahrheit sagen oder ist es Ihnen lieber, wir reden drumherum?«
Walmsley blinzelte nervös. Er nahm seine Hornbrille ab und putzte sie mit seinem Taschentuch. »In Gottes Namen sagen Sie ihnen die Wahrheit«, erwiderte er. »Glauben Sie mir, Sir, die Russen kennen die Rassenproblematik so gut wie Sie. Aber sie ist ihnen im Grunde völlig egal, sie benutzen sie nur für ihre Propaganda, wie sie alles benutzen, was ihren Interessen dient – mehr aber auch nicht. Im Übrigen sollten Sie nie vergessen, dass alles, was Sie in Russland sagen, in der Heimat nachgedruckt wird.«
Die Frau in der ersten Reihe, die schon ganz zu Anfang gesprochen hatte, stand auf. »Wir alle wissen, es gibt Diskriminierung bei uns«, sagte sie mit leiser, schüchterner Stimme, die aber automatisch alle Aufmerksamkeit auf sich zog. »Und trotzdem haben die Neger in den vergangenen acht Jahren große Fortschritte gemacht. Es war ein weiter Weg, das stimmt, aber heute können wir mit Stolz auf unsere schwarzen Wissenschaftler und Künstler verweisen. Es nutzt der Sache mehr, wenn wir das auch in Russland sagen.«
Andere stimmten ihr zu und äußerten sich entsprechend vor der Gruppe. Willem Van Loon, russisch sprechender Sohn des jüngst verstorbenen Historikers und zuständig für die PR bei Everyman Opera, meinte, er sei sehr, sehr froh, dass auf die Frage so ausführlich eingegangen werde. »In den vergangenen Tagen habe ich mit einigen aus dem Ensemble ein Interview für einen amerikanischen Soldatensender hier in Germany aufgenommen, und da war bei der Behandlung dieses Themas, also der Rassenfrage, ebenfalls großes Fingerspitzengefühl gefragt. Ostberlin ist nicht weit und hat tausend Ohren …«
»Das ist leider richtig«, unterbrach Walmsley behutsam. »Sie wissen wahrscheinlich, dass auch in diesem Moment Informanten mit im Saal sitzen.«
Die allgemeine Verblüffung zeigte aber, dass weder Van Loon noch die anderen dies gewusst hatten. Verunsichert blickten sich alle um und überlegten, wen Walmsley wohl gemeint haben könnte. Vergebens, denn verdächtige Gestalten gab es einfach nicht. Anders als geplant führte Van Loon sein Thema nicht weiter aus, sondern stammelte ein paar abschließende Worte, dann war auch dies erledigt – wie auch die Zusammenkunft als solche. Beide Diplomaten wurden ganz rot, als ihnen warmer Applaus entgegenbrandete.
»Ich danke Ihnen«, sagte Walmsley. »Es war mir eine Freude, mit Ihnen zu reden. Mr. Lowry und ich, wir haben nicht oft Gelegenheit, uns mit den … den Brettern, die die Welt bedeuten, zu unterhalten.«
Robert Breen, der Regisseur, rief seine Mannschaft zur nächsten Probe zusammen, aber noch gingen die Meinungen über dieses »Briefing« hin und her. Jerry Laws fasste die seine mit den Worten »wenig sachdienlich« zusammen. Mrs. Gershwin dagegen war geradezu erschlagen von der Menge an Information. »Darling, ich fasse es immer noch nicht. Stell dir vor, du müsstest immer so leben. Überall Abhörgeräte, aber nichts Genaues weiß man nicht. Im Ernst, Darling: Wo kann man da in Ruhe tratschen?«
Draußen hatte ich Gelegenheit, mit Warner Watson, Mr. Breens Produktionsassistenten, ins Hotel zurückzufahren. Er stellte mich Dr. Fabian Schupper vor, der ebenfalls im Taxi saß. Dr. Schupper war Student am Deutschen Institut für Psychoanalyse und sollte auf dieser Reise mögliche Stress-Symptome im Ensemble auffangen. Zu seiner großen Enttäuschung wurde daraus schließlich nichts, weil man im Management zu der Überzeugung gelangt war, ein eigener Psychologe sei am Ende doch etwas zu viel des Guten. Eine Rolle mag auch gespielt haben, dass die Psychoanalyse und deren Vertreter in der Sowjetunion grundsätzlich nicht willkommen sind. Vorerst aber gab Dr. Schupper Warner Watson den guten Rat, sich zu entspannen.
Mit erkennbar zitternden Händen zündete sich Watson eine Zigarette an und sagte: »Wenn Sie auf einem schäbigen Samowar eine Riesenproduktion wie diese am Kochen halten sollen, können Sie sich aber nicht entspannen.«
Watson ist Ende dreißig. Er hat einen angegrauten Meckischnitt und ängstliche, resignierte braune Augen. Sein Gesicht, sein ganzes Wesen strahlt etwas Weiches aus, das aus einer vorzeitigen Erschöpfung herrührt. Er war früher einmal Schauspieler und ist von Beginn an dabei gewesen, also seit 1952, dem Gründungsjahr von Everyman Opera. Sein Job besteht hauptsächlich darin, »die Sache in trockene Tücher zu bekommen«, wie er sagt. In den vergangenen zwei Wochen hätte er fast in der Sowjetischen Botschaft übernachten könnten, so schwierig war es, die letzten Dinge in trockene Tücher zu kriegen. Denn immer taten sich neue Probleme auf, die ein Tuch noch nicht einmal gesehen hatten. Unter anderem die Pässe des Ensembles, die immer noch bei den Russen lagen und auf den Visumstempel warteten. Dann gab es Schwierigkeiten mit dem Zug, der sie nach Leningrad bringen sollte. Everyman Opera hatte vier Schlafwagen angefordert, die Russen aber hatten Watson knapp beschieden, mehr als drei Wagen der zweiten Klasse (ausgestattet mit so genannten »Komfort-Betten«, sollte heißen: mit schlichten Kojen) könne er nicht haben. Drei Waggons sowie ein Gepäckwagen für die Requisiten sollten an den Blauen Express angehängt werden, der regelmäßig zwischen Ostberlin und Moskau verkehrte. Aber es schien unmöglich, von den Russen ein Wagendiagramm zu bekommen, sodass er auch keinen Belegungsplan erstellen konnte. Er sah deshalb Szenen wie aus einer Slapstick-Walpurgisnacht voraus: »Das wird eng wie in einer Sardinenbüchse. Wahrscheinlich werden wir die Leute in den Kojen stapeln müssen.« Außerdem war völlig unklar, wo die Truppe in Moskau oder Leningrad absteigen sollte. »Sie sagen dir nie alles auf einmal. Wenn sie A sagen, erfährst du im Prinzip auch B, aber wann das sein wird, weiß kein Mensch.«
Umgekehrt schienen die Russen nicht geneigt, dieselbe Langmut walten zu lassen, die sie von anderen erwarteten. Einige Stunden zuvor war aus Moskau ein Telegramm eingetroffen, das bei Watson ebenjenes Handzittern ausgelöst hatte. PARTITUR ABSOLUT ZWINGEND ABGABE BEI BOTSCHAFT BERLIN ANDERNFALLS VERSCHIEBUNG PREMIERE LENINGRAD SOWIE KÜRZUNG DER GAGE. Schon seit Wochen hatten die Sowjets nach dieser Partitur verlangt, damit das russische Orchester schon vor der Ankunft der Sänger mit den Proben beginnen konnte. Das hatte Breen abgelehnt, denn er besaß nur ein einziges Exemplar und fürchtete, es könne verlorengehen. Erst dieses Telegramm mit seiner unmissverständlichen Drohung schien bei ihm einen Sinneswandel herbeigeführt zu haben, und Watson war jetzt auf dem Weg in die sowjetische Botschaft.
»Keine Angst«, sagte Watson, indem er sich die Schweißperlen von der Oberlippe wischte, »wir kriegen das alles noch in trockene Tücher. Ich für meine Person sehe da überhaupt kein Problem, überhaupt kein Problem.«
»Entspannen Sie sich doch«, sagte Dr. Schupper.
Zurück im Hotel Kempinski, wo ein Großteil des Ensembles logierte, schaute ich noch in der Suite der Breens vorbei, um mit Breens Frau Wilva zu sprechen. Sie war für einen Tag nach Brüssel geflogen, um sich nochmals wegen ihrer Bauchbeschwerden untersuchen zu lassen, die sie seit einiger Zeit plagten. Vor ihrem Abflug hatte sie eigentlich mit einer sofortigen Operation gerechnet, wodurch ihre Russlandreise notgedrungen ausfiel. Erst im vergangenen Oktober war sie in Vorbereitung der Tournee zehn Tage in Moskau gewesen, »eine faszinierende Erfahrung«, wie sie sagte, die Lust machte auf mehr.
»Alles in Ordnung, der Arzt sagt, ich kann fahren. Mir war gar nicht klar, wie sehr ich mich auf diese Reise gefreut habe – erst als alles in den Sternen stand«, sagte sie lächelnd. Ihr Lächeln ist weniger Gefühlsausdruck als Unsicherheit. Mrs. Breen hat Grübchen und große braune Augen. Riesige, waffentaugliche Haarnadeln halten ihren hellbraunen Wuschelkopf in Schach. Im Augenblick trägt sie ein violettes Wollkleid. Violett ist ihre Farbe, denn »Robert ist ganz verrückt nach Violett«. Sie und Breen sind sich auf der University of Minnesota begegnet, das Graduiertenkolleg im Fach Theaterwissenschaft hat sie zusammengebracht. Mittlerweile sind sie seit achtzehn Jahren verheiratet. Obwohl Mrs. Breen auch schon auf der Bühne gestanden hat, unter anderem als Shakespeares Julia, gilt ihr ganzes Trachten, wie eine ihrer Mitarbeiterinnen sagte, »ihrem Robert«. Ihrem Robert und dessen Karriere. »Und wenn sie genügend Packpapier auftreiben könnte, würde sie die ganze Welt einwickeln und ihm zu Füßen legen.«
Allerdings scheint Papierknappheit erst einmal nicht Mrs. Breens Hauptproblem zu sein, denn sie wohnt zwischen Bergen aus Briefen, Zeitungsausschnitten und Akten. Sie kümmert sich um die gesamte Korrespondenz von Everyman Opera und sorgt im Übrigen dafür, »dass es allen gut geht«. In ihrer letztgenannten Eigenschaft hat sie aus Brüssel ein ganzes Paket Spielsachen mitgebracht, mit denen sie später zu Weihnachten – in Leningrad – die Kinder des Ensembles beschenken will. »Das heißt, falls ich die Sachen von Robert loseisen kann, um sie wieder einzupacken«, sagte sie und zeigte in das Badezimmer, wo eine Armada von Schiffchen mit Aufziehmotor in der Wanne dümpelte. »Ehrlich gesagt, Robert ist verrückt nach Spielzeug«, seufzte sie. Verschiedene Gegenstände im Zimmer, das auch als Büro diente, stellten selbst erfahrene Reisende vor echte Verpackungsprobleme, etwa jene rückenschonende Entspannungswippe, bekannt als »Relaxer Board«. »Ich begreife nicht, warum ich mein Relaxer Board nicht mit nach Russland nehmen kann. Ich war damit schon überall, das Ding tut mir wahnsinnig gut.«
Dann fragte sie mich, ob ich mich auf den Blauen Express freute – und freute sich ihrerseits zu hören, dass ich mich freute. »Ach, wissen Sie, auch Robert und ich würden uns nie verzeihen, diese Bahnreise verpasst zu haben! Und alle im Ensemble sind ja auch so was von nett. Ich weiß schon jetzt, das wird ein Erlebnis, von dem wir noch ein Leben lang sprechen. Allerdings …«, sagte sie mit einer Betrübnis in der Stimme, die nicht ganz echt klang, »leider Gottes haben Robert und ich beschlossen, doch lieber das Flugzeug zu nehmen. Natürlich bringen wir Sie alle noch zum Bahnhof – und in Leningrad sind wir schon da und holen Sie ab, versprochen. Ich hoffe bloß, es klappt alles. Ganz sicher bin ich mir aber immer noch nicht. Ich meine, dass es wirklich Wirklichkeit wird.« Sie hielt inne, und einen Moment legte sich ein Stirnrunzeln über ihre fleckenlose Begeisterung. »Eines Tages erzähle ich Ihnen mal die ganze Geschichte. O ja, es hat Menschen gegeben, die alles verhindern wollten. O ja, es hat Rückschläge gegeben.« Sie klopfte sich an die Brust. »Wir waren schmerzhaften Anwürfen ausgesetzt, und sie sind noch längst nicht vorbei. Auch jetzt noch, bis zur letzten Minute, kann praktisch alles passieren«, sagte sie und sah auf den Stoß Telegramme auf dem Tisch.
Einige der Schwierigkeiten im Vorfeld waren bereits bekannt. Zum Beispiel hieß es immer, die Initiative zu dieser Tournee sei von den Russen ausgegangen: ein bisschen gelebter Geist von Genf. In Wahrheit hatte sich Everyman Opera selbst eingeladen. Breen hatte eine Russlandtournee schon länger vorgehabt, sie war die logische Fortsetzung der bisherigen Goodwill-Auftritte der Truppe. Also setzte er sich hin und schrieb einen Brief an den sowjetischen Ministerpräsidenten Marschall Bulganin, in dem er von sich aus die Porgy-and-Bess-Tour durch Russland anbot – das heißt, falls man sie in der Sowjetunion überhaupt haben wollte. Das Schreiben muss Eindruck gemacht haben, denn Bulganin leitete es weiter ans Kulturministerium unter Leitung von Nikolai Michailow, eine Riesenbehörde, ohne die in Russland nichts läuft. Egal ob Theater, Musik, Film, Verlagswesen oder Malerei, über alles wacht das strenge Auge dieser in Moskau ansässigen Krake. Mit Bulganins Segen trat das Ministerium also in die Verhandlungen mit Everyman Opera ein, aber die Entscheidung dafür dürfte nicht leicht gewesen sein. Dabei waren schon andere Theatergruppen in Russland gewesen, etwa ein Jahr zuvor die Comédie Française oder die Engländer mit einer Hamlet-Produktion, die im Herbst 1955 in Moskau Erfolge gefeiert hatte. Doch sowohl aus Sicht der Gäste wie der Gastgeber waren die Risiken seinerzeit höchstens künstlerischer Natur gewesen, denn Molière und Shakespeare eigenen sich nun einmal schlecht für moderne Propaganda.
Bei Porgy and Bess ist das anders. Für Amerikaner wie Russen berührt der Stoff sensibelste Punkte. Und unter dem dialektischen Mikroskop gar wimmelte es in der Gershwin-Oper nur so von sozialschädlichen Gedankenbazillen, die das Sowjetregime überhaupt nicht verträgt. Zum einen die offene Erotik, eine Provokation in einem Land mit einer rigiden Sexualmoral, wo man bereits für einen Kuss in der Öffentlichkeit verhaftet werden kann. Dann die Religion. Die Oper lässt ja keinen Zweifel an einem Jenseits und den Tröstungen, die dem Menschen allein aus dem Glauben an Gott zuwachsen – nach sowjetischer Auffassung nichts als »Opium fürs Volk«. Auch Aberglauben gibt es in dieser Oper reichlich, siehe The Buzzard Song. Und als wären der Reizthemen nicht genug, trällert es noch von der Bühne herunter, dass man sogar mit »plenty o’ nuttin’« sauglücklich werden kann. Das alles hört ein guter Apparatschik gar nicht gern.