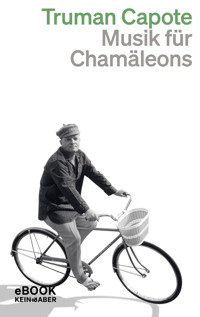
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit seinem »Tatsachenroman« »Kaltblütig« revolutionierte Truman Capote die Literaturgeschichte und den Journalismus, indem er die journalistische Beobachtung mit den Mitteln des Schriftstellers verband. Immer bestrebt, der Wirklichkeit in einzigartigen Gattungen gerecht zu werden, schuf er etwa die Konversationsporträts – Begegnungen wie mit Marilyn Monroe, die er aus langen Dialogen komponierte. Durch ihr hochamüsantes Gespräch über sexuellen Klatsch, Ängste und Berühmtheiten lässt er uns einen intimen Blick in die Seele der Hollywoodikone werfen. Doch Capotes Zugewandtheit gilt ebenso dem Mörder oder der Witwe, die Dutzende toter Katzen in ihrer Tiefkühltruhe verwahrt. Die Terrains von Wahrheit und Dichtung lotet er überraschend anders auch in »Handgeschnitzte Särge« aus, seinem »Tatsachenbericht« über ein Verbrechen. In diesem Buch, seinem letzten zu Lebzeiten, wagt er es zudem, mit entwaffnender Ehrlichkeit von sich selbst zu erzählen.
Zum 100. Geburtstag des Jahrhundertgenies erscheint Capotes gesamtes journalistisches Werk bei Kein & Aber neu in drei Einzelbänden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Truman Capote wurde 1924 in New Orleans geboren. 1948 erschien sein erster Roman Andere Stimmen, andere Räume, der als das sensationelle Debüt eines literarischen Wunderkindes gefeiert wurde. Das 1958 veröffentlichte Frühstück bei Tiffany erlangte auch dank der Verfilmung mit Audrey Hepburn große Berühmtheit. 1966 erschien der mehrmals verfilmte »Tatsachenroman« Kaltblütig, 1973 Die Hunde bellen (Storys und Porträts), 1980 Musik für Chamäleons (Erzählungen und Reportagen). Posthum wurden 1987 der unvollendete Roman Erhörte Gebete und 2005 das neu entdeckte, eigentliche Debüt Sommerdiebe veröffentlicht. Truman Capote starb 1984 in Los Angeles. Das gesamte Werk von Truman Capote erscheint auf Deutsch in der Zürcher Ausgabe, herausgegeben von Anuschka Roshani, bei Kein & Aber.
ÜBER DAS BUCH
Mit seinem »Tatsachenroman« Kaltblütig revolutionierte Truman Capote die Literaturgeschichte und den Journalismus, indem er die journalistische Beobachtung mit den Mitteln des Schriftstellers verband. Immer bestrebt, der Wirklichkeit in einzigartigen Gattungen gerecht zu werden, schuf er etwa die Konversationsporträts – Begegnungen wie mit Marilyn Monroe, die er aus langen Dialogen komponierte. Durch ihr hochamüsantes Gespräch über sexuellen Klatsch, Ängste und Berühmtheiten lässt er uns einen intimen Blick in die Seele der Hollywoodikone werfen. Doch Capotes Zugewandtheit gilt ebenso dem Mörder oder der Witwe, die Dutzende toter Katzen in ihrer Tiefkühltruhe verwahrt. Die Terrains von Wahrheit und Dichtung lotet er überraschend anders auch in Handgeschnitzte Särge aus, seinem »Tatsachenbericht« über ein Verbrechen. In diesem Buch, seinem letzten zu Lebzeiten, wagt er es zudem, mit entwaffnender Ehrlichkeit von sich selbst zu erzählen.
VORWORT
Mein Leben – zumindest das als Künstler – lässt sich so präzise aufzeichnen wie eine Fieberkurve: die Höhen und Tiefen, die deutlich erkennbaren Schaffenszyklen.
Zu schreiben begonnen habe ich mit acht Jahren – aus heiterem Himmel, ohne jedes Vorbild. Ich kannte damals niemanden, der schrieb. Es war sogar so, dass ich kaum jemanden kannte, der las. Trotzdem interessierten mich nur vier Dinge: Bücher lesen, ins Kino gehen, Stepptanz und zeichnen. Und dann fing ich eines Tages an zu schreiben, nicht ahnend, dass ich mich auf Lebenszeit an ein nobles, jedoch unbarmherziges Handwerk kettete. Wenn Gott einem eine Gabe verleiht, liefert er auch gleich die Peitsche mit, und die ist allein zur Selbstgeißelung gedacht.
Aber das wusste ich natürlich noch nicht. Ich verfasste Abenteuergeschichten, Kriminalromane und Satiren, außerdem Anekdoten, die mir ehemalige Sklaven und Bürgerkriegsveteranen erzählt hatten. Das alles bereitete mir viel Freude – zumindest anfänglich. Die Freude verflog, als ich den Unterschied zwischen guter und schlechter Literatur erkannte und dann eine sogar noch beunruhigendere Entdeckung machte, nämlich den Unterschied zwischen sehr guter Literatur und wahrer Kunst; er ist subtil, aber grausam. Danach kam die Peitsche zum Einsatz!
Wie gewisse junge Leute vier bis fünf Stunden pro Tag Klavier oder Geige üben, spielte ich mit Papier und Bleistift. Ich sprach mit niemandem über das, was ich produzierte. Wenn ich gefragt wurde, was ich in all den Stunden so treibe, behauptete ich, ich würde Hausaufgaben erledigen. In Wirklichkeit machte ich nie Hausaufgaben. Ich war vollauf mit meiner literarischen Arbeit beschäftigt, meiner Lehrzeit, meinem Niederknien vor dem Altar der Technik und der Kunstfertigkeit; mit den tückischen Feinheiten der Gliederung, der Interpunktion, der Platzierung von Dialogen. Ganz zu schweigen vom Gesamtentwurf, dem großen, anspruchsvollen Bogen von der Mitte zum Anfang und von dort zum Ende. Es gab so viel zu lernen, und aus so vielen Quellen. Nicht nur aus Büchern, sondern auch von der Musik, von der Malerei und der ganz einfachen alltäglichen Beobachtung.
In der Tat waren die interessantesten literarischen Arbeiten, die ich in jenen Tagen zu Papier brachte, die einfachen Alltagsbeobachtungen, die ich in meinem Tagebuch notierte. Beschreibungen einer Nachbarin. Lange, wortgetreue Wiedergaben mitgehörter Gespräche. Klatsch und Tratsch. Eine Art der Berichterstattung, ein Stil des »Hörens« und »Sehens«, der mich später wesentlich beeinflussen sollte, auch wenn ich es damals noch nicht wusste. Denn all meine »offiziellen« Arbeiten, jene Texte, die ich auf Hochglanz polierte und sorgfältig abtippte, waren mehr oder weniger fiktional.
Mit siebzehn war ich bereits ein vollendeter Schriftsteller. Wäre ich Pianist gewesen, hätte nun mein erstes öffentliches Konzert angestanden. So jedoch beschloss ich, bereit zu sein für eine Publikation meiner Texte. Ich schickte sie an die wichtigsten literarischen Zeitschriften und an die überregionalen Magazine, die damals die beste sogenannte »Qualitätsliteratur« druckten – an Story, den New Yorker, Harper’s Bazaar, Mademoiselle, Harper’s Magazine, Atlantic Monthly –, woraufhin prompt Erzählungen von mir in diesen Medien erschienen.
Dann, im Jahr 1948, veröffentlichte ich einen Roman: Andere Stimmen, andere Räume. Er wurde von der Kritik gut aufgenommen und entwickelte sich zum Bestseller. Außerdem legte er dank eines aus der Norm fallenden Fotos seines Urhebers auf dem Schutzumschlag den Grundstein für einen gewissen Ruf, der mir seither anhaftet und mich all die Jahre begleitet hat. Viele schrieben den kommerziellen Erfolg des Romans diesem Foto zu. Andere taten das Buch als bizarren Zufallstreffer ab. »Erstaunlich, dass eine derart junge Person schon so gut schreiben kann!« Erstaunlich? Ich tat seit vierzehn Jahren tagein, tagaus nichts anderes! Der Roman war dennoch ein befriedigender Abschluss meiner ersten Entwicklungsphase.
Ein Kurzroman – Frühstück bei Tiffany – beendete 1958 die zweite. Während der dazwischenliegenden zehn Jahre experimentierte ich mit nahezu jedem Aspekt des Schreibens, unternahm den Versuch, mir eine möglichst große Bandbreite an Schreibtechniken anzueignen, eine technische Virtuosität zu erlangen, die so strapazierfähig und dehnbar war wie ein Fischernetz. Natürlich versagte ich auf manchem Terrain, auf das ich mich wagte, doch trifft es zu, dass man aus Fehlern mehr lernt als aus Erfolgen. Bei mir war es so, und ich konnte später das derart Gelernte zu meinem Vorteil anwenden. Jedenfalls verfasste ich während dieses Jahrzehnts des Erkundens Kurzgeschichtensammlungen (Baum der Nacht, Eine Weihnachtserinnerung), Essays und Porträts (Lokalkolorit, Observations, die Arbeiten, die in Die Hunde bellen enthalten sind), Theaterstücke (Die Grasharfe, Das Blumenhaus), Drehbücher (Schach dem Teufel, Schloss des Schreckens) und eine Menge Reportagen, die meisten davon für den New Yorker.
Tatsächlich erschien auch die – unter dem Gesichtspunkt meiner kreativen Bestimmung betrachtet – interessanteste Arbeit dieser gesamten zweiten Phase zunächst als mehrteiliger Artikel im New Yorker, bevor sie später als Buch herauskam, unter dem Titel Die Musen sprechen. Es ging darin um den ersten Kulturaustausch zwischen der UdSSR und den USA, nämlich die Russlandtournee eines Ensembles schwarzer Amerikaner im Jahr 1955 zur Aufführung von Porgy and Bess. Ich gestaltete das ganze Abenteuer als einen kurzen komischen »Tatsachenroman«; es war der erste.
Einige Jahre zuvor hatte Lillian Ross Picture veröffentlicht, ihren Bericht über die Arbeit an dem Film Die rote Tapferkeitsmedaille; mit seinen schnellen Schnitten, den Vor- und Rückblenden wirkte er selbst wie ein Film, und als ich den Bericht las, fragte ich mich, was wohl gewesen wäre, wenn die Autorin ihre strenge, nüchtern berichtende Disziplin aufgegeben und ihr Material stattdessen wie Fiktion behandelt hätte – hätte das Buch dadurch gewonnen oder verloren? Ich beschloss, einen Versuch zu wagen, sobald das richtige Thema auftauchte, und auf Porgy and Bess sowie Russland im tiefsten Winter schien genau das zuzutreffen.
Die Musen sprechen erhielt hervorragende Kritiken; selbst jene Organe, die mir sonst nicht freundlich gesinnt waren, sahen sich dazu veranlasst, das Buch zu loben. Dennoch erregte es keine besondere Aufmerksamkeit und verkaufte sich eher bescheiden. Für mich hingegen stellte es ein wichtiges Ereignis dar, denn mir wurde während des Schreibprozesses klar, dass ich womöglich eine Lösung für das gefunden hatte, was schon immer mein größtes kreatives Dilemma gewesen war.
Seit mehreren Jahren fühlte ich mich zunehmend zum Journalismus als eigenständiger Kunstform hingezogen. Dafür gab es zwei Gründe: Erstens warich der Meinung, dass sich seit den Zwanzigerjahren nichts wirklich Innovatives mehr in der Prosadichtung oder überhaupt in der Literatur getan hatte, und zweitens war der Journalismus als Kunst ein nahezu jungfräuliches Gebiet – ganz einfach deshalb, weil sich nur sehr wenige Literaten je im erzählenden Journalismus versucht hatten, und wenn doch, dann in Form von Reiseberichten oder Autobiografien. Die Musen sprechen hatte meine Gedanken allerdings in eine vollkommen neue Richtung gelenkt: Ich wollte einen journalistischen Roman schreiben, ein groß angelegtes Werk, das die Glaubwürdigkeit des Tatsachenberichts, die Unmittelbarkeit des Films, die Tiefe und Freiheit von Prosa und die Präzision der Lyrik in sich vereinte.
1959 stieß ich, geleitet von einem mysteriösen Bauchgefühl, auf das geeignete Thema, einen obskuren Mordfall, der sich in einem abgelegenen Teil von Kansas ereignet hatte. Und erst 1966 konnte ich das Ergebnis vorlegen: Kaltblütig.
In einer Erzählung von Henry James, ich glaube, es ist Die mittleren Jahre, lamentiert der Held, ein kreativ gereifter, desillusionierter Schriftsteller, sinngemäß: »Wir leben im Dunkeln, wir tun, was wir können, der Rest ist der Wahnsinn der Kunst.« Mr James legt hier die Karten auf den Tisch, er sagt uns die Wahrheit. Und das Dunkelste der Dunkelheit, das Wahnsinnigste des Wahnsinns ist das unaufhörliche Pokern, das mit dem Erzeugen von Kunst verbunden ist. Schriftsteller, zumindest jene, die wirklich etwas riskieren, die bereit sind, in den sauren Apfel zu beißen, sprichwörtlich über die Planke zu gehen, haben viel mit einer anderen Spezies einsamer Männer gemeinsam: jenen, die sich ihren Lebensunterhalt am Billardtisch oder beim Kartenspiel verdienen. Nicht wenige hielten mich für verrückt, weil ich sechs Jahre lang in Kansas durch die Prärie streifte; andere lehnten mein gesamtes Konzept des »Tatsachenromans« ab und erklärten es als eines »seriösen« Schriftstellers unwürdig. Norman Mailer bezeichnete es als »Versagen der Vorstellungskraft«, was vermutlich bedeuten sollte, dass man als Romancier über Erfundenes zu schreiben hatte statt über Reales.
Es war durchaus wie beim Pokern mit hohem Einsatz: Sechs nervenaufreibende Jahre lang wusste ich nicht, ob ein Buch dabei herauskommen würde oder nicht. Es waren lange Sommer und eisige Winter, aber ich spielte einfach weiter, holte aus meinem Blatt heraus, was ich konnte. Und dann erwies sich, dass das Ergebnis tatsächlich ein Buch war. Mehrere Kritiker monierten, »Tatsachenroman« sei ein reißerisches Etikett, reiner Hokuspokus – was ich getan hätte, sei nicht wirklich originell oder neu. Doch da waren auch jene, die anders dachten, Schriftstellerkollegen, die den Wert meines Experiments erkannten und sich beeilten, ihren Nutzen daraus zu ziehen – wobei keiner so rasch handelte wie Norman Mailer, der mit dem Schreiben von Tatsachenromanen viel Geld verdient und zahlreiche Preise gewonnen hat (Heere aus der Nacht, Auf dem Mond ein Feuer, Gnadenlos – Das Lied vom Henker), auch wenn er es stets tunlichst vermied, sie als »Tatsachenromane« zu bezeichnen. Egal, er ist ein guter Schriftsteller und ein feiner Kerl, und ich bin dankbar dafür, dass ich ihm einen kleinen Dienst erweisen konnte.
Der Zickzackkurs meiner Reputation als Schriftsteller hatte unterdessen einen soliden Höhepunkt erreicht, und ich verharrte dort, bevor ich meine vierte und, wie ich annehme, letzte Schaffensphase eröffnete. Vier Jahre lang, ungefähr von 1968 bis 1972, verbrachte ich den Großteil meiner Zeit damit, meine eigenen Briefe, die Briefe anderer, meine Tagebücher und Aufzeichnungen (die detaillierte Schilderungen Hunderter Szenen und Gespräche enthalten) aus den Jahren 1943 bis 1965 zu lesen, ausgewählte Stellen umzuschreiben und das benötigte Material zu katalogisieren. Ich hatte vor, es für ein Buch zu verwenden, das ich seit Langem plante: eine Variation des Tatsachenromans. Ich nannte das Buch Erhörte Gebete, nach einem Ausspruch der heiligen Theresa, die gesagt hat: »Es werden mehr Tränen über erhörte Gebete vergossen als über nicht erhörte.« 1972 begann ich mit der Arbeit an diesem Buch, indem ich zuerst das letzte Kapitel schrieb (es ist immer gut zu wissen, wohin die Reise geht). Dann verfasste ich das erste Kapitel, »Unverdorbene Ungeheuer«. Dann das fünfte, »Eine ernsthafte Beleidigung des Verstands«. Dann das siebte, »La Côte Basque«. Und so verfuhr ich weiter, schrieb die Kapitel unabhängig von ihrer Reihenfolge. Das konnte ich nur, weil die Handlung, oder vielmehr die Handlungen der Realität entsprachen und sämtliche vorkommenden Personen echt waren. Es fiel mir nicht schwer, den Überblick zu behalten, denn ich hatte ja nichts erfunden. Und doch ist Erhörte Gebete nicht als gewöhnlicher Schlüsselroman gedacht, ein Genre, bei dem Fakten als Fiktion getarnt werden. Meine Intention ist das Gegenteil: Schleier zu lüften, statt Dinge zu verhüllen.
In den Jahren 1975 und 1976 veröffentlichte ich vier Kapitel des Buchs in der Zeitschrift Esquire. Das rief den Zorn gewisser Kreise hervor, in denen man der Ansicht war, ich missbrauche Vertrauen, trete Freunde und/oder Feinde mit Füßen. Darüber werde ich mich nicht auslassen, denn dabei geht es um gesellschaftspolitische Fragen, nicht um künstlerische Meriten. Ich sage lediglich so viel:
Alles, was ein Schriftsteller für seine Arbeit zur Verfügung hat, ist das Material, das er aufgrund seiner eigenen Bemühungen und Beobachtungen zusammengetragen hat; es ist nicht rechtens, ihm das Verwenden desselben zu verwehren. Verurteilt es, aber verwehrt es ihm nicht.
Dennoch stellte ich im September 1977 die Arbeit an Erhörte Gebete ein, ein Umstand, der nichts mit der Reaktion der Öffentlichkeit auf die bereits publizierten Teile des Buchs zu tun hatte. Zu der Unterbrechung kam es vielmehr, weil ich in höllischen Schwierigkeiten steckte: Ich durchlebte gleichzeitig eine künstlerische und eine persönliche Krise. Da Letztere mit Ersterer überhaupt nichts, oder nur sehr wenig, zu tun hatte, genügt es, wenn ich mich zu dem kreativen Chaos äußere, das dadurch entstand.
So quälend das Ganze für mich war, so froh bin ich heute, dass es dazu kam; schließlich veränderte sich dadurch mein gesamtes Verständnis vom Schreiben, meine Einstellung zur Kunst und zum Leben und zur Balance zwischen diesen beiden, meine Auffassung vom Unterschied zwischen dem, was wahr ist, und dem, was wirklich wahr ist.
Zunächst einmal glaube ich, dass die meisten Schriftsteller, sogar die besten, zu viel in ihre Werke hineinpacken. Ich ziehe es vor, so wenig wie möglich zu schreiben. Schlicht und klar wie ein Gebirgsbach. Zum Zeitpunkt meiner Krise hatte ich das Gefühl, dass meine Prosa zu dicht wurde, dass ich drei Seiten brauchte, um eine Wirkung zu erzielen, die auch in einem einzigen Absatz zu erreichen gewesen wäre. Immer wieder las ich durch, was ich in Erhörte Gebete geschrieben hatte, und begann zu zweifeln – nicht an meinem Material oder meinem erzählerischen Ansatz, sondern an der Textur des Geschriebenen an sich. Ich las Kaltblütig erneut und reagierte genauso: Es gab zu viele Stellen, an denen ich nicht so gut geschrieben hatte, wie ich es eigentlich konnte, an denen ich nicht das volle Potenzial ausgeschöpft hatte. Langsam, jedoch mit zunehmender Beunruhigung, las ich jedes Wort, das ich jemals veröffentlicht hatte, und gelangte zu der Erkenntnis, dass ich nicht ein einziges Mal in meiner Laufbahn als Schriftsteller die volle Dynamik und den vollen ästhetischen Reiz erschlossen hatte, die das jeweilige Material zu bieten hatte. Selbst wenn etwas gut war, erkannte ich, dass ich nicht mehr als die Hälfte, manchmal sogar nur ein Drittel, der mir zur Verfügung stehenden Wirkmacht eingesetzt hatte. Warum?
Die Antwort, die sich mir nach monatelanger Grübelei offenbarte, war einfach, aber nicht sehr zufriedenstellend. Sie war jedenfalls nicht geeignet, meine Depression zu lindern, im Gegenteil, sie verschlimmerte sie noch. Denn diese Antwort schuf ein offenkundig unlösbares Problem, und wenn ich ebenjenes nicht lösen konnte, konnte ich auch gleich mit dem Schreiben aufhören. Das Problem lautete: Wie kann ein Autor in einer einzigen literarischen Form – sagen wir, in einer Kurzgeschichte – erfolgreich zusammenbringen, was er über jede andere literarische Form weiß? Denn das war der Grund, warum meine Arbeit häufig nicht hell genug strahlte; die Voltzahl war hoch genug, doch indem ich mich auf die Schreibtechniken der jeweiligen literarischen Form, in der ich arbeitete, beschränkte, brachte ich nicht alles ein, was ich vom Schreiben verstand – alles, was ich aus Drehbüchern, Theaterstücken, Reportagen, Gedichten, Kurzgeschichten, Novellen und Romanen gelernt hatte. Als Schriftsteller sollte man sämtliche Farben, sämtliche Fähigkeiten auf ein und derselben Palette zum Mischen bereit haben (und bei passender Gelegenheit zur simultanen Anwendung). Nur wie?
Ich nahm mir noch einmal Erhörte Gebete vor, strich ein Kapitel ganz und schrieb zwei weitere um. Eine Verbesserung, ganz eindeutig. Die nüchterne Wahrheit war, dass ich noch einmal zurück in die Vorschule musste. Da saß ich also und ließ mich wieder einmal auf eine jener unerbittlichen Pokerpartien ein. Und doch war ich freudig erregt, spürte eine unsichtbare Sonne auf meiner Haut. Meine ersten Experimente waren trotzdem unbeholfen. Ich fühlte mich wahrlich wie ein Kind mit einer Schachtel Malstifte.
Aus technischer Sicht hatte die größte Schwierigkeit beim Schreiben von Kaltblütig darin bestanden, mich selbst komplett aus dem Werk herauszuhalten. Normalerweise muss sich der Berichterstatter selbst als handelnde Person und Beobachter einsetzen, um glaubwürdig zu wirken. Aber ich hatte das Gefühl, es sei für den scheinbar distanzierten Ton des Buchs unerlässlich, dass der Autor abwesend war. Tatsächlich hatte ich in all meinen Reportagen versucht, mich selbst so unsichtbar wie möglich zu machen.
Nun jedoch stellte ich mich mitten auf die Bühne und rekonstruierte auf schonungslose, minimalistische Weise gewöhnliche Gespräche mit alltäglichen Menschen: dem Hausmeister meines Wohngebäudes, einem Masseur im Fitnessstudio, einem alten Schulfreund, meinem Zahnarzt. Nachdem ich Hunderte Seiten mit derart schlichten Dingen gefüllt hatte, entwickelte ich schließlich einen Stil. Ich hatte einen Rahmen gefunden, in den ich alles einfügen konnte, was ich vom Schreiben verstand.
Später schrieb ich mithilfe einer modifizierten Version dieser Technik einen kurzen Tatsachenroman (Handgeschnitzte Särge) und einige Kurzgeschichten. Das Ergebnis ist der vorliegende Band: Musik für Chamäleons.
Und wie hat sich das alles auf meine andere im Entstehen begriffene Arbeit Erhörte Gebete ausgewirkt? Beträchtlich. Unterdessen sitze ich hier in meinem dunklen Wahnsinn, mutterseelenallein mit meinen Pokerkarten – und natürlich der Peitsche, die Gott mir gegeben hat.
Truman Capote, 1979Übersetzt von Verena Kilchling
KONVERSATIONSPORTRÄTS
UND DANN IST EBEN ALLES PASSIERT
Ort: Eine Zelle im Hochsicherheitstrakt von San Quentin in Kalifornien. Die Zelle ist lediglich mit einer Pritsche ausgestattet, sodass Dauergast Robert Beausoleil und sein Besucher mit dieser unbequemen Sitzgelegenheit vorlieb nehmen müssen. Die Zelle ist sauber und aufgeräumt, in einer Ecke steht eine auf Hochglanz polierte Gitarre. Aber es ist ein Winternachmittag, Kälte mit einem Hauch Feuchtigkeit hängt in der Luft, als hätte der Nebel über der San Francisco Bay die Gefängnismauern infiltriert.
Trotz der Kälte trägt Beausoleil kein Hemd, sondern nur diese blauen Drillichhosen, Knastuniform. Es ist unverkennbar, dass er mehr als zufrieden ist mit seiner äußeren Erscheinung und ganz besonders mit seinem Körper, der offenbar selbst nach zehnjähriger Haft nichts von seiner raubtierhaften Kraft und Geschmeidigkeit eingebüßt hat. Brust und Arme sind eine einzige Tattoo-Galerie: fauchende Drachen, geschlängelte Chrysanthemen, entschlängelte Schlangen. Manche halten Beausoleil für außerordentlich gutaussehend, und das ist nicht verkehrt. Er sieht gut aus, aber eher auf diese Macho-Zuhälterart. Es überrascht nicht, dass er schon als Kind in mehreren Hollywood-Streifen aufgetreten ist. Eine Zeit lang war er der Liebling des Filmemachers und Autors Kenneth Anger (Scorpio Rising, Hollywood Babylon). Anger gab ihm sogar die Hauptrolle in Lucifer Rising, doch der Film wurde nie fertig.
Der inzwischen einunddreißigjährige Robert Beausoleil ist die schillerndste Gestalt aus der Manson-Sekte. Denn was weder in den Ermittlungen noch in den Verhandlungen je auf den Tisch kam: Er ist die Schlüsselfigur hinter dieser so genannten Manson-Family und ihrer bestialischen Mordserie, die mit dem Tod von Sharon Tate sowie Leno und Rosemary LaBianca ihren grausigen Höhepunkt fand.
Begonnen hatte alles im August 1969 mit dem Mord an Gary Hinman, einem Berufsmusiker mittleren Alters, der sich mit verschiedenen Mitgliedern der Manson-Bruderschaft angefreundet und das Pech hatte, in einem kleinen abgelegenen Haus im Topanga Canyon in Los Angeles County zu wohnen. Hinman war gefesselt und über mehrere Tage lang gefoltert worden (unter anderem wurde ihm ein Ohr abgeschnitten), ehe sie seinen Qualen ein Ende setzten und seine Kehle aufschlitzten. Als die aufgeblähte und mit Fliegen übersäte Leiche schließlich gefunden wurde, entdeckte die Polizei an den Wänden der bescheidenen Bleibe dieselben blutigen Schmierereien (»Tod den reichen Schweinen!«) wie später auch in den Häusern von Sharon Tate und des Industriellenehepaars LaBianca.
Denn nur wenige Tage vor den Tate-LaBianca-Massakern war Robert Beausoleil in Hinmans Wagen erwischt worden und befand sich seitdem aufgrund dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. Manson und seine Kumpane hofften wohl, durch weitere Bluttaten im selben Stil den Verdacht von Beausoleil abzulenken, denn wenn Beausoleil zum Zeitpunkt dieser Verbrechen im Gefängnis saß, konnte er für Hinmans Tod schlecht verantwortlich sein. So oder so ähnlich muss man in der Manson-Bande wohl kalkuliert haben. Dies wiederum würde bedeuten, dass sich Tex Watson und jenes Killerbabe-Trio, bestehend aus Susan Atkins, Patricia Krenwinkel und Leslie Van Houten, allein aus Liebe zu ihrem Bobby Beausoleil auf diesen teuflischen Amoklauf begeben hatten.
RB: Ist schon seltsam. Ich meine mein Name. Beausoleil. Beausoleil ist französisch und heißt »schöne Sonne«. Fuck! Hier in dieser Ferienanlage kannst du Sonne vergessen. Oder hör doch mal die Nebelhörner. Hören sich an wie eine Eisenbahn. Duuuhn! Duuuhn! Im Sommer ist es noch schlimmer. Na ja, kein Wunder, im Sommer ist auf der Bay auch mehr Nebel als im Winter. Überhaupt das Wetter – fuck! Das Wetter ist mir scheißegal, ich geh sowieso nicht raus. Hörst du, schon wieder: Duuuhn! Duuuhn! Und sonst? Was läuft so?
TC: Na ja, ich war zufällig gerade im Hause. Hab mich ein bisschen mit Sirhan1 unterhalten.
RB (lacht): Sirhan B. Sirhan, den kenne ich aus meiner Zeit in Death Row. Der hat einen an der Klatsche, den sollten sie mal auswuchten, der gehört nach Atascadero2. Kaugummi? Wie es aussieht, kennst du dich allmählich hier aus. Hab dich unten auf dem Hof gesehen. Hat mich gewundert, dass die Knastleitung einen von draußen hier ganz allein herumspazieren lässt. Nicht dass dich noch einer absticht.
TC: Aber warum sollte das jemand tun?
RB: Nur so, für den Kick. Aber die Jungs sagen, du wärst schon oft hier gewesen.
TC: Vielleicht ein halbes Dutzend Mal, wegen verschiedener Recherchen.
RB: Weißt du, was ich hier noch nie gesehen habe? Den kleinen apfelgrünen Raum. Den würd ich mir gern mal ansehen. Als sie mir die Hinman-Sache angehängt haben und ich die Todesstrafe bekam, war ich ziemlich lang in Death Row. Da fragt man sich schon, wie es in diesem kleinen grünen Raum mal aussehen wird.
TC: Es sind eher drei Räume als einer.
RB: Also ich hab mir das so vorgestellt: ein kleiner runder Raum mit einer Art Iglu in der Mitte, also ein Iglu aus Glas. Mit Fenstern, damit die Zeugen draußen auch schön sehen können, wie der Betreffende gerade an Veilchenduft verreckt.
TC: Ja, das ist der Raum mit der Gaskammer. Aber wenn der Häftling vom Todestrakt heruntergebracht wird, kommt er vom Aufzug erst einmal in einen so genannten »Gewahrsamsraum«, der liegt direkt neben dem Zeugenzimmer. In diesem Gewahrsamsraum sind zwei Zellen für den Fall, dass zwei Hinrichtungen stattfinden. Das sind übrigens ganz normale Zellen, so wie diese hier. Darin verbringt der Häftling die Nacht vor der Hinrichtung. Da kann er lesen, Radio hören oder mit den Wärtern Karten spielen. Aber das Interessanteste an dieser kleinen Suite ist das dritte Zimmer, rechts neben dem Gewahrsamsraum. Die Tür ist zwar zu, doch man kann ganz einfach hineingehen, die Wärter haben nicht einmal etwas dagegen. Es ist eine Rumpelkammer gewissermaßen, aber es gehört zum Unheimlichsten, was ich je gesehen habe. Wissen Sie, was sich in diesem Zimmer befindet? All die persönlichen Gegenstände, die die Verurteilten dabeihatten, als sie in den Gewahrsamsraum kamen. Bücher, Bibeln, Westernhefte oder Romane von Erle Stanley Gardner oder James Bond. Alte vergilbte Zeitungen, manche über zwanzig Jahre alt. Unvollendete Kreuzworträtsel. Halb geschriebene Briefe. Fotos von der Freundin. Verblasste, zerknickte Kinderbilder. Erschütternd.
RB: Schon mal gesehen, wie einer vergast wird?
TC: Ein Mal. Aber der Mann sah das irgendwie gelassen. Er schien froh zu sein, dass endlich Schluss war. Er hat sich in diesen Stuhl gesetzt, als wäre er beim Zahnarzt und wollte sich bloß die Zähne reinigen lassen. In Kansas hingegen war ich einmal dabei, wie zwei Männer gehängt wurden.
RB: Das war dieser Perry Smith, richtig? Und dieser andere, wie hieß er noch? Dick Hickock. Na ja, ich nehme mal an, wenn sich der Strang so mit voller Wucht zuzieht, merkt man davon nicht mehr viel.
TC: Ja, das wird immer behauptet. Aber in Wirklichkeit lebt man weiter, manchmal fünfzehn, zwanzig Minuten lang. Das ist der eigentliche Todeskampf, denn der Körper schnappt immer noch nach Luft, ringt um jede Sekunde. Also ich konnte mir nicht helfen, ich habe gekotzt, als ich das sah.
RB: Bist am Ende wohl doch nicht so cool, wie du immer tust, was? Komisch, von außen siehst du erst mal so aus. Wie auch immer. Und Sirhan? Hat er dir was von den Haftbedingungen im Bunker vorgeheult?
TC: So ähnlich. Er leidet unter der Einsamkeit. Er wäre lieber bei den anderen Häftlingen im normalen Vollzug. Er will wieder dazugehören.
RB: Aber nur, weil der Blödmann nicht weiß, was gut für ihn ist. Draußen legt ihn garantiert einer um.
TC: Wieso denn das?
RB: Aus demselben Grund, aus dem er Kennedy abgeknallt hat. Ruhm und Ehre. Jeder Zweite von denen, die andere Leute kaltmachen, tut es allein aus Angeberei. Sie wollen eben ihr Bild mal in der Zeitung sehen.
TC: Aber Gary Hinman haben Sie nicht deswegen umgebracht.
RB: (keine Antwort)
TC: Das war, weil Manson und Sie an Hinmans Wagen wollten und an sein Geld, und als er Widerstand leistete … nun ja …
RB: (keine Antwort)
TC: Wissen Sie, mir ist da etwas Merkwürdiges aufgefallen. Ich kenne Sirhan, aber ich kannte auch Robert Kennedy. Ich kannte Lee Harvey Oswald, aber auch John F. Kennedy. Ist Ihnen klar, wie gering die statistische Chance ist, dass ein einzelner Mensch all diese vier Personen kennt? Wahrscheinlich astronomisch gering.
RB: Oswald? Du hast Oswald gekannt – echt?
TC: Ich bin ihm in Moskau begegnet, kurz nachdem er sich abgesetzt hatte. Ich wollte mit einem Freund, einem italienischen Zeitungskorrespondenten, zu Abend essen, und der fragte mich, ob ich ihn vorher noch zu einem Interview mit einem jungen amerikanischen Überläufer begleiten will, einem gewissen Lee Harvey Oswald. Oswald wohnte im Metropol, einem alten Hotel aus der Zarenzeit nahe dem Roten Platz. Die Hotelhalle des Metropol ist ein düsteres Schattenreich voller vertrockneter Topfpalmen. Aber da saß er, in einer zwielichtigen Ecke unter einer vertrockneten Palme. Blass und dünn, mit schmalen Lippen und diesem verhungerten Ausdruck im Gesicht. Er trug einfache Chinos, Tennisschuhe und ein Holzfällerhemd, und er knirschte buchstäblich mit den Zähnen. Dann dieser flackernde Blick. Vom ersten Moment an schimpfte er nur herum. Er ließ niemanden aus, nicht die amerikanische Botschaft, nicht die Russen. Er schäumte vor Wut, weil er nicht in Moskau bleiben durfte. Wir sprachen etwa eine halbe Stunde lang mit ihm, dann stand für meinen italienischen Freund fest, dass dieser Typ keine eigene Story wert war. Nur ein weiterer Spinner, und mit diesen Leuten konnte man damals in Moskau die Straße pflastern. Erst viele Jahre später erinnerte ich mich wieder an diese Begegnung – und zwar als nach dem Kennedy-Attentat sein Bild über alle Fernsehstationen ging.
RB: Also bist du der Einzige, der sie beide gekannt hat, Oswald und Kennedy?
TC: Nein, da ist noch Priscilla Johnson. Sie arbeitete als Dolmetscherin bei der amerikanischen Botschaft in Moskau. Sie kannte Kennedy und ist auch Oswald begegnet, etwa zur selben Zeit wie ich. Aber noch etwas anderes ist merkwürdig, und das betrifft die Leute, die von Ihren Freunden ermordet wurden.
RB: (keine Antwort)
TC: Ich kannte sie nämlich ebenfalls, das heißt, ich kannte vier der fünf Mordopfer im Haus von Sharon Tate. Sharon war ich beim Filmfestival von Cannes begegnet. Jay Sebring – der Starfriseur – hatte mir mehrmals die Haare geschnitten. Und mit Abigail Folger und ihrem Freund Voyteck Frykowski hatte ich in San Francisco schon zu Mittag gegessen. Mit anderen Worten, ich kannte sie unabhängig voneinander. Aber an diesem einen Abend waren sie alle zusammengekommen und warteten auf ihre Mörder. Das nennt man wohl Koinzidenz.
RB (zündet sich eine Zigarette an, lächelt): Das kann man auch anders sehen. Die Bekanntschaft mit dir scheint irgendwie lebensgefährlich zu sein. Shit. Hörst du das? Duuuhn. Duuuhn. Mann, ist dir auch so kalt wie mir?
TC: Warum ziehen Sie sich kein Hemd an?
RB: (keine Antwort)
TC: Mit solchen Tätowierungen hat es eine seltsame Bewandtnis. Ich habe schon mit mehreren Hundert Männern gesprochen, die wegen Mordes, meist mehrfachen Mordes einsitzen. Alles höchst unterschiedliche Leute, aber was sie alle gemeinsam haben: Tätowierungen. Über achtzig Prozent waren heftig tätowiert. Richard Speck. York und Lathan. Smith und Hickock.
RB: Ich ziehe mir einen Pullover an.
TC: Eine Frage: Wenn Sie jetzt nicht im Gefängnis säßen, sondern tun und lassen könnten, was Sie wollten und vor allem wo Sie es wollten, wo würden Sie am liebsten sein und was würden Sie tun?
RB: Ich würde auf meiner Honda durch die Gegend brettern, immer an der Küste lang. Super Kurvenkombis gibt es da, da kannst du dich richtig reinhängen. Und unten das Meer und die Brandung. Und Sonne. Oder die Strecke von San Francisco nach Mendocino, durch die Redwood-Wälder, das ist schon schön. Klar, und bumsen würde ich. Am Strand, am Lagerfeuer, und dann bumsen. Musik machen, bumsen und mir dann einen Joint mit bestem Acapulco Gold reinziehen und mir den Sonnenuntergang ansehen. Und Treibholz nachlegen, damit das Feuer nicht ausgeht. Ich sage immer: Muschis, Marihuana und ’ne geile Maschine, was braucht ein Mann mehr?
TC: Marihuana kriegen Sie auch hier.
RB: Nicht nur das. Hier kriegst du jede Art Shore – wenn du die Kohle hast. Die Typen nehmen alles – bis auf ein Bad.
TC: Sah so Ihr Leben aus, ehe sie verhaftet wurden, Sex and Drugs and Rock ’n’ Roll? Hatten Sie keinen Job?
RB: Nur gelegentlich. Hab in Bars Musik gemacht.
TC: Wie man hört, lagen Ihnen die Frauen zu Füßen. Sie hatten einen regelrechten Harem. Wissen Sie, wie viele Kinder Sie gezeugt haben?
RB: (keine Antwort, aber er zuckt grinsend mit den Schultern und inhaliert)
TC: Mich überrascht, dass Sie hier eine Gitarre haben dürfen. In manchen Gefängnissen ist das nicht erlaubt, da man die Saiten als Würgewerkzeug missbrauchen kann. Wie lange spielen Sie schon?
RB: Oh, schon immer. Ich war einer von diesen Kinderstars in Hollywood, hab in mehreren Filmen mitgespielt. Aber meine Eltern waren dagegen, sie sind ganz normale Leute und haben ihre Grundsätze. Auch mir war die Schauspielerei letztlich egal, ich wollte nur Musik machen.
TC: Und wie war das mit Kenneth Anger? Sie sollten doch in Lucifer Rising mitspielen.
RB: Tja.
TC: Wie sind Sie denn mit Anger zurechtgekommen?
RB: Ganz okay eigentlich.
TC: Und warum trägt Kenneth Anger noch immer ein Medaillon mit Ihrem Bild um den Hals? Auf der anderen Seite des Medaillons ist übrigens ein Frosch mit der Inschrift: »Bobby Beausoleil hat sich durch Kenneth Anger in einen Frosch verwandelt.« Gewissermaßen ein Voodoo-Amulett, das Sie mit einem Fluch belegt, weil Sie ihn abgezogen haben. Mitten in der Nacht haben Sie sich seinen Wagen genommen und noch die eine oder andere Kleinigkeit und sind abgehauen.
RB (mit misstrauisch verengten Augen): Hat er dir das erzählt?
TC: Nein, ich kenne ihn gar nicht. Aber ein paar andere Leute stellen das so dar.
RB (greift nach seiner Gitarre, stimmt sie, schlägt ein paar Saiten an, singt): »This is my song, this is my song, this is my dark song, my dark song …« Normalerweise wollen die Leute immer wissen, wie ich mit Manson zusammengekommen bin. Es war durch unsere Musik. Er spielt nämlich auch Gitarre. Eines Abends fuhr ich mit meinen Mädels durch die Gegend, und wir kamen da an dieser alten Pinte vorbei mit jeder Menge Autos auf dem Parkplatz. Wir also angehalten und reingegangen, und drinnen war Charlie mit ein paar von seinen Mädels. Wir kamen ins Gespräch und haben zusammen ein bisschen Musik gemacht. Am nächsten Tag besuchte mich Charlie in meinem Tourbus. Kurz darauf kampierten wir zusammen, seine Leute und meine. Wie Brüder und Schwestern. Eine Familie.
TC: Betrachteten Sie Manson als Anführer? Hatten Sie den Eindruck, dass Sie unter seinem Einfluss standen? RB: Scheiße, das nun überhaupt nicht. Er hatte seine Leute, ich hatte meine. Wenn überhaupt einer irgendwen beeinflusst hat, dann ich ihn.
TC: Ja, er war offenbar sehr von Ihnen angezogen, war Ihnen regelrecht verfallen, das sagt er jedenfalls. Sie wirken überhaupt sehr stark auf andere Menschen, egal ob Mann oder Frau.
RB: Ja, aber das ist nicht meine Schuld. Was passiert, passiert. Das ist schon in Ordnung so.
TC: Sie meinen, der Mord an fünf unschuldigen Menschen ist in Ordnung?
RB: Wer hat gesagt, sie wären unschuldig?
TC: Davon wäre noch zu reden. Aber zunächst möchte ich Sie nach Ihrer ganz persönlichen Ethik fragen. Wie unterscheiden Sie zwischen Gut und Böse?
RB: Gut und Böse? Alles ist gut, im Prinzip jedenfalls. Wenn etwas passiert, dann muss es gut sein, sonst würde es nicht passieren. Ich meine, so läuft es doch im Leben. Alles fließt – und ich fließe mit. Ich stelle das nicht in Frage.
TC: Anders gesagt, Sie stellen auch einen Mord nicht in Frage? Sie halten Mord für »gut«, weil er, wie sie sagen, »passiert« und weil er dadurch gerechtfertigt ist?
RB: Weißt du, ich habe meine eigene Gerechtigkeit, ich lebe nach meinem eigenen Gesetz. Ich habe keinen Respekt vor den Gesetzen dieser Gesellschaft. Diese Gesellschaft respektiert ja nicht einmal ihre eigenen Gesetze. Ich mache mir mein eigenes Gesetz, danach lebe ich, nach nichts anderem. Ich habe mein eigenes Gerechtigkeitsgefühl.
TC: Und worin besteht Ihr Gerechtigkeitsgefühl?
RB: Ich glaube, dass jeder bekommt, was er verdient. Und: Am Ende kommen wir alle unter die Erde. So läuft das im Leben, und das akzeptiere ich.
TC: Das ergibt aber keinen Sinn, zumindest nicht für mich. Ich halte Sie auch nicht für dumm. Deshalb will ich die Frage anders formulieren: Wenn es also in Ihren Augen gerechtfertigt ist, dass Tex Watson und die Mädchen von Manson losgeschickt werden, um in diesem Haus ein Massaker an fünf ihnen vollkommen unbekannten, unschuldigen Menschen …
RB: Noch mal: Wer hat behauptet, sie wären unschuldig? Sie haben Leuten schlechtes Dope angedreht. Sie haben minderjährige Mädchen vom Sunset Strip abgeschleppt und mit ihnen ihre perversen SM-Spielchen veranstaltet, mit Auspeitschen und so. Sie haben das Ganze sogar gefilmt. Frag die Cops, die haben die Filme gefunden. Problem ist nur, dass du von denen nicht die Wahrheit zu hören kriegst.
TC: Nun ja, eine Wahrheit ist, dass die LaBiancas und Sharon Tate ermordet wurden, um Sie zu entlasten. Der Tod dieser Menschen stand in direktem Zusammenhang mit dem Mord an Gary Hinman.
RB: Schon verstanden, das war ja klar. Du solltest wirklich nicht alles glauben, was sie dir sagen.
TC: Diese Verbrechen waren eindeutig Nachahmungstaten des Hinman-Mordes. So sollte bewiesen werden, dass Sie Hinman nicht umgebracht haben konnten. Alles zielte darauf ab, Sie freizubekommen.
RB: Mich freizubekommen. (Er nickt, lächelt und seufzt geschmeichelt.) Das konnten sie nie beweisen. Die Mädels wollten ja aussagen, wollten erklären, wie alles passiert ist, aber keiner hat ihnen zugehört. Die Leute haben nur noch das geglaubt, was die Medien ihnen sagten. Und für die Medien war die Sache klar: Wir wollten einen Rassenkrieg anzetteln. Böse Nigger waren ausgezogen, um gute Weiße abzuschlachten. Okay, wie du schon sagtest … die Medien behaupteten, wir wären eine »Familie« gewesen, und das ist so ziemlich das Einzige, was an den ganzen Horrorgeschichten stimmt. Wir waren eine Familie. Eine Familie mit Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Tochter, Sohn. Und wenn ein Familienmitglied in der Klemme steckt, dann lassen wir es nicht im Stich. Alle diese Morde sind im Grunde nur aus Liebe zu einem Bruder passiert, der wegen einer Mordsache im Knast saß, nur deswegen.
TC: Bereuen Sie, dass es so kam?
RB: Nein. Wenn meine Brüder und Schwestern es getan haben, dann ist es gut. Alles im Leben ist gut. Alles ist im Fluss. Und deswegen ist auch alles gut. Alles ist Musik.
TC: Nochmals zu Ihrer Zeit im Todestrakt: Da alles im Fluss ist, wären Sie also auch nicht abgeneigt gewesen, wenn Sie dieser Fluss direktemang in die Gaskammer befördert hätte, wo Sie den Veilchenduft hätten schnuppern dürfen?
RB: Wenn es so gekommen wäre, wieso nicht? Alles, was passiert, ist gut.
TC: Auch Krieg? Auch verhungernde Kinder? Auch Schmerz? Brutalität? Dummheit? Gefängnisse? Verzweiflung? Gleichgültigkeit? Alles gut?
RB: Weswegen guckst du mich so an?
TC: Nichts. Ich wollte nur sehen, ob sich an Ihrer Miene irgendetwas verändert. Wissen Sie, bei Ihnen reicht eine Kleinigkeit, und Sie wirken plötzlich so jungenhaft-unschuldig, dass man sich nur wundern kann, ein echter Charmeur. Aber dann auch wieder wie der 42nd-Street-Luzifer. Haben Sie jemals Griff aus dem Dunkel gesehen, ein alter Film mit Robert Montgomery? Nicht? Jedenfalls geht es darin um einen anscheinend völlig harmlosen jungen Mann, der in England über die Dörfer fährt, nette alte Damen bezirzt und sie dann umbringt. Genauer gesagt, er schneidet ihnen die Köpfe ab und trägt sie in einer ledernen Hutschachtel mit sich herum.
RB: Und was hat das mit mir zu tun?
TC: Ich dachte nur. Angenommen, man machte von diesem Film ein amerikanisches Remake und würde dabei auch die Montgomery-Figur entsprechend verändern, sagen wir in einen jungen Herumtreiber mit haselnussbraunen Augen und rauer Stimme. Dann wären Sie die Idealbesetzung.
RB: Willst du damit sagen, ich wäre ein Psychopath? Das ist doch Quatsch, ich bin nicht verrückt. Wenn ich Gewalt anwenden muss, dann tue ich es, aber ich glaube nicht an Mord und Totschlag.
TC: Dann war ich vorhin wohl etwas schwerhörig. Oder sagten Sie nicht, egal, was ein Mensch dem anderen antut, es wäre alles gleich gut?
RB: (keine Antwort)
TC: Verraten Sie mir eines, Bobby: Wie sehen Sie sich selbst?
RB: Als Strafgefangener.
TC: Und darüber hinaus?
RB: Als Mann. Als weißer Mann. Und als jemand, der genau das vertritt, was ein weißer Mann nun mal vertreten muss.
TC: Ja. Ein Wärter hat mir vorhin gesagt, Sie seien der Anführer der Arischen Bruderschaft.
RB (feindselig): Was weißt du von der Bruderschaft?
TC: Ich weiß zum Beispiel, dass sie sich ausschließlich aus weißen Schlägertypen zusammensetzt und dass sie faschistische Tendenzen aufweist. Ich weiß, dass sie in Kalifornien gegründet wurde, aber inzwischen in allen amerikanischen Haftanstalten vertreten ist – nicht eben zur Freude des Justizapparats, da die Arische Bruderschaft als außerordentlich gewaltbereit gilt.
RB: Ein Mann muss sich gerademachen, wir sind ohnehin in der Minderzahl. Du hast keine Ahnung, was hier abgeht. Vor dem ganzen Gesocks hier haben wir mehr Angst als vor den Bullenschweinen. Wenn du hier eine Sekunde nicht aufpasst, hast du eine Klinge im Rücken. Die Schwarzen, die Chicanos, sie alle haben doch auch ihre Gangs. Sogar die Indianer. Oder sollte ich lieber sagen Native Americans, wie sich die Rothäute neuerdings nennen – Mann, was für Witz! Nein, mein Freund, hier geht es hart zur Sache: Rassenkonflikte, Politik, Drogen, Glücksspiel, Sex. Die Schwarzen zum Beispiel fahren voll auf kleine weiße Jungs ab, schieben ihre dicken Niggerschwänze gerne in enge weiße Ärsche.
TC: Haben Sie sich jemals Gedanken gemacht, was Sie mit Ihrem Leben anstellen wollen, wenn Sie irgendwann vielleicht vorzeitig entlassen werden?
RB: Halte ich für ausgeschlossen. Dieses Spiel geht endlos so weiter. Sie werden Charlie nie mehr rauslassen.
TC: Ich hoffe, Sie haben recht. Ja, auch ich denke, das ist ausgeschlossen. Aber Sie, Sie könnten eines Tages freikommen, vielleicht früher, als Sie denken. Und was dann? RB (schlägt einen Akkord an): Ich würde gerne eine eigene Platte machen, die dann im Radio läuft und so.
TC: Davon hat Perry Smith auch geträumt. Und Charlie Manson will das auch. Vielleicht habt ihr ja doch mehr gemeinsam als lediglich die Tattoos.
RB: Ganz unter uns, Charlie ist nicht gerade ein Supertalent. (Er schlägt weitere Akkorde an.) »This is my song, my dark song, my dark song.« Ich habe mit elf Jahren meine erste Gitarre bekommen. Hab sie bei meiner Großmutter auf dem Dachboden gefunden. Seitdem will ich nur noch Musik machen. Meine Großmutter war eine herzensgute Frau, und ihr Dachboden war mein Lieblingsplatz. Ich habe gern da oben gelegen und dem Regen zugehört. Oder mich da versteckt, wenn mein Dad mich wieder mal verhauen wollte. Shit. Hörst du das? Duuuhn. Duuuhn. Davon wird man langsam verrückt.
TC: Noch eine Frage, Bobby. Aber überlegen Sie sich die Antwort gut. Angenommen, Sie werden tatsächlich entlassen und jemand – sagen wir Charlie – kommt auf Sie zu und fordert Sie auf, wieder ein Gewaltverbrechen zu begehen, meinetwegen einen Mord: Würden Sie es tun?
RB (nach einer halben Zigarette Bedenkzeit): Möglich. Hängt davon ab. Ich … ich wollte Gary Hinman eigentlich gar nichts tun, nichts Ernstes jedenfalls. Aber dann führt immer eines zum anderen, und am Ende … am Ende ist es eben passiert.
TC: Und das war gut.
RB: Alles war gut.
1 Sirhan Bishara Sirhan beging am 5. Juni 1968 das Attentat auf Robert F. Kennedy.
2 Atascadero State Hospital, geschlossene Anstalt des Maßregelvollzugs für psychisch kranke Straftäter in Kalifornien.
EIN TAGEWERK
Die Szene: Ein regnerischer Aprilmorgen im Jahr 1979. Ich gehe die Second Avenue in New York entlang und trage eine Einkaufstasche aus Wachstuch, in der sich allerlei Putzutensilien befinden. Die Tasche gehört Mary Sanchez, die neben mir geht und einen Regenschirm über uns hält, was ihr nicht schwerfällt, da sie mit ihren Einmeterachtzig größer ist als ich.
Mary Sanchez ist Putzfrau, für fünf Dollar die Stunde, sechs Tage die Woche. Sie arbeitet etwa neun Stunden täglich und kommt zwischen Montag und Samstag durchschnittlich in vierundzwanzig Häuser oder Wohnungen. Im Allgemeinen greifen ihre Kunden einmal pro Woche auf ihre Dienste zurück.
Mary ist siebenundfünfzig Jahre alt, stammt aus einer Kleinstadt in South Carolina, hat aber bereits vor vierzig Jahren »in den Norden rübergemacht«. Ihr puertoricanischer Mann ist im vergangenen Sommer verstorben. Sie hat eine verheiratete Tochter in San Diego und drei Söhne. Einer ist Zahnarzt, ein anderer sitzt wegen bewaffneten Raubüberfalls eine zehnjährige Haftstrafe ab, der dritte ist »einfach fort, Gott weiß wohin. Er hat zuletzt Weihnachten angerufen, seine Stimme klang ziemlich weit weg. Ich habe ihn gefragt: ›Pete, wo bist du?‹ Aber das wollte er nicht sagen. Ich sagte: ›Dein Vater ist tot.‹ Und er sagte, klasse, das wäre das schönste Weihnachtsgeschenk, das ich ihm machen kann. Ich habe dann einfach so aufgelegt und hoffe, er ruft nie wieder an. Ich meine, das ist doch so, wie wenn er auf das Grab seines Vaters spuckt. Natürlich, Pedro war nie besonders nett zu den Kindern. Oder zu mir. Den ganzen Tag nur gesoffen und Würfel gespielt. Und mit schlechten Frauen rumgemacht. Sie fanden ihn eines Tages tot auf einer Bank im Central Park, mit einer fast leeren Flasche Jack Daniel’s zwischen den Knien, in einer braunen Tüte. Tja, so war er, hat getrunken wie ein Loch, aber immer nur vom Feinsten. Trotzdem meine ich, so etwas wie Pete kann man nicht machen: zu sagen, dass er froh wäre, dass sein Vater tot ist. Er schuldete ihm immerhin das Leben, oder nicht? Und auch ich schuldete ihm etwas. Denn ohne ihn wäre ich immer noch eine dumme Baptistin, eine verlorene Seele. Aber ich habe in einer katholischen Kirche geheiratet, und die katholische Kirche hat ein Licht in mein Leben gebracht, das nachher nie wieder ausgegangen ist und auch in Zukunft nicht ausgehen wird, nicht einmal wenn ich sterbe. Ich habe meine Kinder im rechten Glauben erzogen; aus zweien ist was geworden, und daran hat die Kirche einen größeren Anteil als ich.«





























