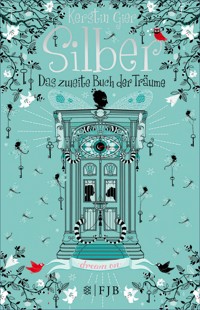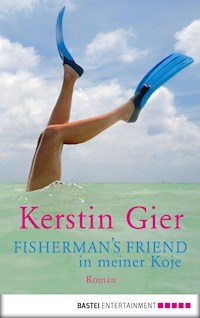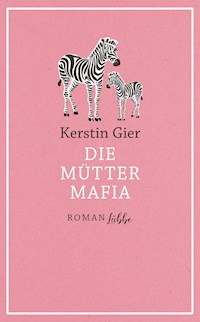
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mütter-Mafia
- Sprache: Deutsch
Es gibt sie, die perfekten Mamis und Bilderbuch-Mütter, die sich nur über Kochrezepte, Klavierunterricht und Kinderfrauen austauschen. Doch eigentlich sind sie der Albtraum jeder Vorstadtsiedlung. Dagegen hilft nur eins. Sich zusammenrotten und eine kreative Gegenbewegung gründen: die MÜTTER-MAFIA! Ab jetzt müssen sich alle braven Muttertiere warm anziehen ... Band 1 der erfolgreichen Mütter-Mafia-Trilogie - verfilmt mit Annette Frier in der Hauptrolle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Nachwort
Über die Autorin
Kerstin Gier, Jahrgang 1966, lebt mit ihrer Familie in einem Dorf in der Nähe von Bergisch Gladbach. Sie schreibt mit großem Erfolg Romane. Ihr Erstling MÄNNER UND ANDERE KATASTROPHEN wurde mit Heike Makatsch in der Hauptrolle verfilmt. EIN UNMORALISCHES SONDERANGEBOT wurde 2005 mit der »DeLiA« für den besten deutschsprachigen Liebesroman ausgezeichnet. FÜR JEDE LÖSUNG EIN PROBLEM wurde ein Bestseller und mit enthusiastischen Kritiken bedacht.
KERSTIN GIER
DieMütter-Mafia
ROMAN
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2005 by Autorin und Bastei Lübbe AG, Köln
Texredaktion: Gerke Haffner
Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München unter Verwendung von Motiven von © arigato / shutterstock.com; © CSA Images / gettyimages
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0066-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für meine Mutter
22. Januar
Wie versprochen hier mein Rezept für den viel gelobten schnellen Apfelkuchen von unserem letzten Clubnachmittag: Das Rezept hat meineMutti noch von ihrer Mutti! Ein Teig aus 250 Gramm Butter, 180 Gramm Zucker, 3 Eiern, etwas Vollmilch, 600 Gramm Mehl und einem Päckchen Backpulver zusammenrühren, die sämige Masse in eine Springform füllen, klein geschnittene Äpfel darauf verteilen und eindrücken, das Ganze im Ofen bei 180 Grad Umluft eine Stunde backen – fertig.
Zur Erinnerung: Dienstag kommender Woche beginnt mein Kurs Knüpfen mit Kleinkindern im Familienbildungswerk. Bisher haben sich leider noch nicht genug Teilnehmer angemeldet. Was ist mit euch? Wir wollen einen Wäschesack knüpfen, den man im Badezimmer von der Decke hängen lassen kann. Das spart viel Platz und sieht schön aus.
Mami Gitti
22. Januar
Nichts für ungut, Gitti, aber keiner, der auf seine Linie achtet, würde diese Fett- und Zuckerbombe nachbacken. Außerdem heißt es nicht »Ein Teig … zusammenrühren«, sondern »Einen Teig«, weil der Teig in diesem Fall das Objekt darstellt. Immer daran denken: Wir müssen ein Vorbild für unsere Kinder sein. Was den selbst geknüpften Wäschesack angeht: Mein Mann würde Zustände bekommen, wenn wir so ein Teil in unser Designerbad hängen würden. Ich hätte aber sowieso keine Zeit gehabt, bin augenblicklich beruflich wahnsinnig eingespannt.
Frau Porschke, unsere Kinderfrau, hat uns heute mitgeteilt, dass sie nur noch bis zum Sommer bei uns arbeiten kann, da sie wegen der Versetzung ihres Mannes umziehen werden. Natürlich sind wir traurig darüber, denn Frau Porschke hat ein goldenes Herz, sie liebt unsere Mäuse wirklich abgöttisch und kann hervorragend bügeln, aber ich hatte ja von Anfang an meine Zweifel, ob jemand ohne Schulabschluss der richtige Umgang für zwei so aufgeweckte Mädchen ist. Auf jeden Fall brauchen wir ab August eine neue Betreuungslösung, gern auch weniger kostenintensiv. Wer von euch hat Erfahrung mit Au-pair-Mädchen oder -Jungen? Muss Schluss machen, habe morgen wichtiges Meeting, danach zwei Tage Tagung in Berlin, muss noch vorkochen, Beine epilieren (wegen Spa-Bereich in 5-Sterne-Tagungshotel) und Koffer packen.
Sabine
23. Januar
Wir hatten nach Sophies Geburt zwei Jahre lang Au-pairs, insgesamt fünf Mädchen aus fünf Nationen, damit ich sofort wieder Teilzeit, später wieder voll arbeiten konnte. Ich wollte auf keinen Fall den Anschluss im Job verlieren, na ja, ihr kennt das ja: Wenn man mit dem ersten Kind schwanger ist, denkt man noch, dass alles bleibt, wie es ist, und dass man problemlos weiter Karriere machen kann. Jedenfalls hielt ich Au-pair für eine gute Lösung, weil ich leider keine gute Freundin hatte, die mich gewarnt hat. Erst, als ich mitten in der Misere steckte, kamen sie alle an mit ihren Horrormeldungen. Aber da war es schon zu spät. Deshalb hier meine Frühwarnung: Nimm bloß keine Polin, Lettin oder Russin! Die können zwar in der Regel gut kochen und jammern auch nicht über zu viel Arbeit, aber insgeheim sind diese Osteuropäerinnen doch nur scharf auf einen deutschen Mann, und da machen sie auch vor deinem nicht Halt. Und was haben deine Kinder schon davon, so eine überflüssige Sprache wie Polnisch, Russisch oder Lettisch zu lernen? Spanierinnen und Italienerinnen kannst du allerdings ebenfalls vergessen, die sind viel zu verwöhnt, mäkeln ständig am Essen rum und wissen nicht, dass man Kleider in einem Schrank aufbewahrt, gebügelt und gefaltet. Wenn man ihnen Glauben schenken will, liegen in Spanien und Italien die Klamotten allesamt in Haufen auf dem Fußboden herum. Ebenso das Kinderspielzeug. Meine Freundin Susanne hatte schon eine Belgierin, die in ihrem Zimmer fortlaufend Hasch geraucht hat, und eine Französin marrokanischer Herkunft, die für viertausend Euro im Monat nach Hause telefoniert hat. Ich weiß auch aus erster Hand, dass Südafrikanerinnen und Argentinierinnen mindestens genauso heikel sind. Für ihr englisches Au-pair musste Susanne ein Jahr lang eine komplizierte Diät kochen, weil sie gegen Gluten allergisch war, was ja praktisch überall drin ist. Ekelhaft: Irinnen rasieren sich das Schamhaar in der Dusche, und du musst ihre Wolle hinterher aus dem Siphon pulen.
So billig ist das Ganze auch nicht, die Au-pairs zocken nämlich unverhältnismäßig viel Taschengeld ab, und du spielst den ganzen Tag den Chauffeur, weil die meisten keinen Führerschein haben und ständig in die Disko wollen. Ich hätte ja gern vergleicheshalber mit einem männlichen Aupair experimentiert, aber die sind leider sehr schwer zu bekommen. Am besten vergisst du diese Au-pair-Sache also ganz schnell wieder. An deiner Stelle würde ich mir wieder so eine liebe, fleißige Kinderfrau wie deine Frau Porschke suchen. Bei der musst du wenigstens keine Angst haben, dass sie dir deinen Mann ausspannt. Wenn ich jemanden wie Frau Porschke gefunden hätte, dann hätte ich meinen Job ganz sicher nicht wieder an den Nagel hängen müssen. Aber man braucht ein absolut perfekt funktionierendes häusliches System, um als Mutter wieder arbeiten gehen zu können, nicht an schlechtem Gewissen zugrunde zu gehen und trotzdem eine gute Ehe zu führen. Mit Au-pairs kannst du das vergessen: Wenn du mal früher nach Hause kommst, sitzt deine zweijährige Tochter vor dem Fernseher, und dein Mann liegt mit dem Au-pair im Ehebett. Willst du das?
Sonja
24. Januar
An alle Mamis: Jubel! Der Frauenarzt hat heute meine Schwangerschaft bestätigt! Danke für den Kissen-unter-den-Po-schieben-und-liegen-bleiben-Tipp, Frauke! Ich bin supi-glücklich und freue mich schon supi-doll auf die morgendliche Übelkeit! Es passt auch ganz genau: Übernächste Woche geht mein verlängerter Erziehungsurlaub zu Ende, und wenn ich meiner Chefin sage, dass ich wieder schwanger bin, brauche ich wahrscheinlich gar nicht erst wiederzukommen. Sie weiß noch vom letzten Mal, dass meinetwegen ständig das Klo besetzt war, hihi, und sie (kinderlos!) hält Schwangere grundsätzlich für gehirnamputiert. Ich hoffe nur, sie lässt mich bei vollem Lohnausgleich zu Hause bleiben. Ich persönlich finde ja, dass eine Mami wenigstens in den ersten Jahren auf ihre Karriere verzichten und bei ihren Kindern bleiben sollte, ganz gleich, wie gut eine Kinderfrau auch sein mag. Aber das muss natürlich jeder selber wissen.
Ich war übrigens auch mal Au-pair, in den USA, und ich kann deine Vorurteile ABSOLUT nicht bestätigen, Sonja. Ich war kein einziges Mal in der Disko, habe gegessen, was auf den Tisch kam, und den Herrn des Hauses hätte ich nicht mal mit der Zange angefasst. Wie wär’s also mit einem DEUTSCHEN Au-pair-Mädchen, Sabine? Damit kannst du garantiert nichts falsch machen.
Mami (demnächst zweifach!) Ellen
P. S. Hat dein Mann tatsächlich was mit eurem Au-pair angefangen, Sonja? Ich finde es unter diesen Umständen sehr heroisch von dir, dass ihr noch zusammen seid.
24. Januar
Das sollte doch nur ein Beispiel sein! Natürlich ist das nicht mir passiert, aber der Freundin meiner Freundin. Mit einer Lettin. Übrigens meine allerherzlichsten Glückwünsche zur Schwangerschaft, Ellen. Du hast so ein Glück, dass du dir die Pfunde vom letzten Mal noch nicht runtergehungert hast, sonst wäre das jetzt alles für die Katz.
Sonja
25. Januar
Zurück aus Berlin (berauschendes Weltstadtfeeling, hatte zwischendurch sogar Zeit für einen Einkaufsbummel, Armani lässt grüßen) und irritiert über deine Aussage, Ellen. Wir von der Mütter-Society wollen uns doch gerade von der leidigen Diskussion darüber, wer nun die bessere Mutter ist, »Nur-Hausfrau« oder »Karrierefrau«, distanzieren. Eine zufriedene Mutter ist eine gute Mutter, das ist ja wissenschaftlich nun wirklich hinlänglich bewiesen. Allerdings würde es mir auch leichter fallen, auf meine »Karriere« zu verzichten, wenn ich Zahnarzthelferin wäre.
Meine allerherzlichsten Glückwünsche zu deiner Schwangerschaft bei vollem Lohnausgleich! (Deine Chefin wäre gehirnamputiert, wenn sie das macht!)
Sabine
26. Januar
Es liegen mir immer noch nicht alle Anmeldungen für die Farbberatung nächste Woche vor. Frau Merkenich ist eine Koryphäe auf ihrem Gebiet; ich bin sehr stolz, sie für die Mütter-Society gewonnen zu haben. Ihre Beratung kann Leben verändern, es lohnt sich also vor allem für diejenigen von uns, die immer noch glauben, dass ihnen Lila steht.
Frauke
1.
Julius und ich fuhren erster Klasse im ICE von Hamburg nach Köln. Weil nämlich der Spartarif erster Klasse billiger war als der Normaltarif zweiter Klasse, was ich zwar nicht verstand, aber ich war noch nie gut im Rechnen gewesen. Außerdem soll man nehmen, was man kriegen kann, wie meine Mutter immer sagt. In der ersten Klasse haben die Sitze hübschere Polster, und man hat mehr Platz für die Beine. Allerdings hatten wir keine Platzreservierung, und die einzigen nebeneinander liegenden, nicht reservierten Plätze lagen mit dem Rücken zur Fahrtrichtung, und statt auf den eingebauten Bildschirm in der Rückenlehne des Vordersitzes schauten wir in die Gesichter von Herrn und Frau Meyer »met Ypsilon aus Offebach bei Frankfott, ei, der Klee is aber süß, wie alt issen der?«, die ebenfalls in Hamburg eingestiegen waren und aus einem unerschöpflichen Vorrat Salamistullen verzehrten. Beides, Salamigeruch und verkehrte Sitzposition, verursachen Übelkeit bei mir, und Julius hatte das wohl von mir geerbt, wie wir nun feststellen konnten. Kurz vor Bielefeld erbrach er sich ohne vorherige Ankündigung über den Tisch, der uns vom Ehepaar Meyer trennte.
Die Zeitschriften, die die Meyers bis jetzt noch nicht gelesen hatten und nun wohl auch nicht mehr lesen würden, wurden mit Julius’ Frühstück und den drei Päckchen »Hohes C« getränkt, die sie dem Jungen zuvor förmlich aufgedrängt hatten. »Kleine Kinder brauchen Vitamine, trink nur, des is gesund.«
Das hatten sie jetzt davon.
»Kommt noch mehr?«, fragte ich Julius, während ich hektisch unsere Papiertaschentücher auffaltete und gar nicht wusste, wo ich mit dem Aufwischen beginnen sollte.
»Ich glaube nicht«, sagte Julius vorsichtig.
Herr Meyer entfernte sich diskret, während Frau Meyer rührig aufsprang und aus ihrem Gepäck eine Packung Feuchttücher hervorzauberte, so wie ich sie immer mit mir herumgeschleppt hatte, als Julius noch Windeln trug.
Mit den Tüchern wurde alles ganz schnell wieder sauber. Frau Meyer ließ sie mit den Zeitschriften in einem ebenfalls herbeigezauberten Müllbeutel verschwinden. Zum Schluss öffnete sie das Fenster, strahlte mich an und sagte: »Des hätte mer geschafft!«
Ich entschuldigte und bedankte mich ungefähr tausendmal.
»Des muss Ihne doch net peinlisch sein, Kindsche«, versicherte Frau Meyer und streichelte Julius über den Kopf. »So sin Kinder nu mal, die habens oft mittem Magen, da muss man dorsch! Des is so ein lieber kleiner Kerl, gell, so vernünftisch für seine vier Jahre, und Sie sind eine ganz sympathische, patente junge Mutti, wecklisch, das muss Ihne gar net peinlisch sein.«
Ich hatte plötzlich das dringende Bedürfnis, mich an Frau Meyers Brust zu werfen und sie zu fragen, ob sie mich nicht adoptieren wolle. Es war lange her, dass jemand etwas so Nettes zu mir gesagt hatte. Leider hatte Frau Meyer aber schon jede Menge Töchter und Söhne und Enkelkinder und daher vermutlich kein Interesse an einer Adoption. Außerdem – wenn sie mich näher kennen lernte, würde sie das mit der »patenten Mutti« sicher schnell zurücknehmen. Sympathisch ja, patent nein. Mein eigener Mann hatte mich vor nicht allzu langer Zeit als das »am schlechtesten organisierte, lebensuntüchtigste Weibsstück, das ich kenne« bezeichnet und kurz darauf die Scheidung eingereicht. Und wirklich jung war ich auch nicht mehr. Ich meine, mit fünfunddreißig kann man sich zwar wie zwanzig fühlen, aber man sieht nicht mehr so aus.
Gerade deswegen schloss ich Frau Meyer für immer in mein Herz.
Leider mussten wir in Köln Hauptbahnhof aussteigen und sahen die Meyers nie wieder. Ich zerrte unsere Koffer und Julius auf den Bahnsteig und kollidierte dabei mit einem circa einen Meter neunzig großen himmelblauen Hasen mit einer Bierfahne. Noch während ich mir vor Schreck ans Herz griff, rülpste der Hase ein »Hoppla« und hoppelte weiter. Jetzt erst sah ich, dass er einer ganzen Gruppe pastellfarbener Nagetiere angehörte, die voller Begeisterung um die Abfalleimer herumhopsten und dabei »Bier her, Bier her« sangen. Ein Flickenclown, der einen Reisekoffer schleppte, und eine Frau mit blauer Lockenperücke, die sich etwas wackelig, aber energisch an seinen freien Arm klammerte, hielten mit »Mer losse de Dom in Kölle« dagegen.
Es war Karneval in Köln.
An einem Karnevalssonntag nach Köln zu kommen, nachdem man sieben Wochen auf der winterlich-verschlafenen Watteninsel Pellworm verbracht hat, ist in etwa so, wie mit einem Raumschiff auf einem fremden Planeten zu landen, allerdings ohne dass die Außerirdischen großartig von einem Notiz nehmen. Ich sah mich nach Lorenz um, meinem zukünftigen Exmann, dem Vater meiner Kinder. Aber von Lorenz war keine Spur zu sehen, obwohl ich ihm die Ankunftszeit mehrfach telefonisch durchgegeben hatte. Ich hatte auch nicht wirklich mit seinem Erscheinen gerechnet. Seit das Scheidungsverfahren lief, fühlte er sich in keiner Weise mehr für mich verantwortlich, und das bedeutete in diesem Fall wohl, dass wir die S-Bahn nehmen mussten.
Ich griff fester nach Julius’ Hand und bahnte mir einen Weg durch das Getümmel. Auf dem Weg von Gleis fünf nach Gleis elf sahen wir nur wenige Menschen, die nicht verkleidet und/ oder betrunken waren, und selbst eine Gruppe Japaner – echte, unverkleidete Japaner – schien von dem Treiben völlig eingeschüchtert zu sein. Eng aneinander gedrängt schauten sie sich verunsichert um, und nicht einer von ihnen fotografierte.
»Mir ist schlecht«, sagte Julius.
Alarmiert ließ ich den Koffer fallen und schubste einen langhaarigen Vampir vom nächsten Abfallbehälter. Ich musste Julius hochheben, damit er in die Öffnung spucken konnte, und der Vampir machte mich zu spät darauf aufmerksam, dass es sich hier nicht um Restmüll, sondern um Papiermüll handelte. Aber an einem Tag wie heute, an dem halb Köln in die Papierkörbe reiherte, konnte er mir damit kein schlechtes Gewissen machen.
Neben dem Vampir lungerte ein vermutlich männliches Wesen mit einer Gerhard-Schröder-Maske herum, das, dem strengen Geruch nach zu urteilen, schrecklich unter dem Latex zu schwitzen schien.
»Willste ’n Bier mit uns trinken kommen?«, fragte er mich.
Julius spuckte. Offenbar war immer noch genug »Hohes C« in seinem Magen gewesen.
»Is ja ekelhaft«, sagte der Vampir. »Ist das deiner?«
»Kleine Kinder haben es nun mal mit dem Magen«, sagte ich, ganz wie Frau Meyer mit Y und streichelte Julius über den Kopf. »Des muss uns net peinlisch sein. Da müsse mer dorsch.«
»Iiiih, ’ne Hessensau«, sagte Gerhard Schröder. »Und mit der wollte ich ein Bier trinken.«
»Trotzdem, geiler Arsch«, sagte der Vampir.
»Helau«, sagte ich. Langsam machte ich mir Sorgen. Möglicherweise hatte Julius doch nicht nur meine Reaktion auf Rückwärtsfahrten und Salamigeruch geerbt, sondern einen Magen-Darm-Infekt erwischt. Er gehörte sicherheitshalber mit einer Vomex ins Bett.
Ich studierte den Fahrplan. In sieben Minuten kam unsere S-Bahn, das war zu überleben.
Ein Rentner mit einem gelb getupften Hütchen auf der Glatze rempelte mir seinen Ellenbogen in die Rippen und sagte unfreundlich: »Gleis 10, Giesela, und damit basta! Wie oft willst du denn noch nachgucken?«
Mittlerweile war meine Stimmung auch ziemlich gereizt.
Ich rempelte dem Renter meinerseits den Ellenbogen in den Bierbauch und erwiderte: »Auch wenn du mir die Rippen brichst, Karl-Heinz, ich nehme den Zug von Gleis 11.«
Der Rentner starrte mich verwundert an. Ich kannte ihn nicht, wusste aber gleich, dass er zu der Sorte alter Männer gehörte, die sich nie entschuldigen und vorm Supermarkt auf dem Mutter-Kind-Parkplatz parken. Hinter ihm stand eine sehr dicke, kleine Frau um die siebzig, verkleidet mit einer Lamettaperücke und einer pinkfarbenen Herz-Brille. Giesela, wie ich annahm.
»Hier bin ich, Heinrich«, sagte sie mit hoher Fistelstimme und klopfte dem Rentner auf die Schulter. Heinrich. Da hatte ich mit Karl-Heinz ja gar nicht so falsch gelegen.
Heinrich schaute eine Weile zwischen mir und Lametta-Giesela hin und her und kratzte sich an seinem jecken Hütchen. Dann sagte er: »Isch hab euch eben verwechselt, dat kann ja mal passieren, oder nit?«
Oder nit???
Ich schaute mir Giesela genau an und hoffte sehr, dass Heinrich den grauen Star hatte, und zwar in weit fortgeschrittenem Stadium.
Die S-Bahn fuhr ein und öffnete seufzend ihre Türen.
»Mir ist schlecht«, sagte Julius. Leider konnte Heinrich nicht mehr rechtzeitig beiseite springen.
»Dat kann ja mal passieren«, sagte ich.
*
Wir wohnten im ersten Stock eines raffiniert sanierten Altbaus. Niemand, der von außen zu den Fenstern hochsah, konnte vermuten, dass hier eine Wohnung mit den Ausmaßen eines Fußballfeldes Platz hatte. Lorenz und ich hatten die Wohnung gekauft, als Lorenz vor zehn Jahren zum Staatsanwalt berufen worden war. Das heißt, Lorenz hatte sie gekauft, ich war nur mit eingezogen.
Lorenz war sieben Jahre älter als ich. Als wir uns kennen gelernt hatten, war ich gerade mal zwanzig gewesen, im zweiten Semester meines Psychologie-Studiums und immer noch völlig verloren in der großen Stadt. Vor allem das Straßenbahn- und U-Bahnnetz war mir nicht geheuer. Seit ich auf dem Weg zu der Lerngruppe bei einer Kommilitonin, die nur zwei Bahnstationen entfernt wohnte, verloren gegangen und ohne Brieftasche in einem geheimnisvollen Ort namens Zülpich-Ülpenich gelandet war, fuhr ich nur noch mit dem Fahrrad, egal wie weit es auch sein mochte. Im Fahrradfahren war ich gut. Ich bin auf der Nordseeinsel Pellworm geboren und aufgewachsen. Meine Eltern haben dort einen Bauernhof, überwiegend Milchkühe. Eigentlich hätte ich ein Junge werden und den Hof später mal übernehmen sollen. Mit Mädchen können meine Eltern bis heute nichts anfangen.
»Natürlich haben wir dich trotzdem lieb, Constanze«, sagt mein Vater immer, aber als drei Jahre nach mir mein Bruder geboren wurde, haben sie, glaube ich, ernsthaft darüber nachgedacht, das überflüssige Kind, also mich, zur Adoption freizugeben. Wenn ich das meinen Eltern sage – und manchmal sage ich es ihnen heute noch –, verdrehen sie nur die Augen und sagen, das sei wieder mal typisch Mädchen, und ich solle endlich erwachsen werden.
Dass die ZVS mich damals ausgerechnet nach Köln geschickt hatte, hat meinen Eltern aber auch nicht gefallen. Sie meinten, ich wäre noch nicht reif für die Großstadt. Leider hatten sie Recht. Ich wäre lieber nach Hamburg gegangen, das war näher an zu Hause und hatte ein übersichtlicheres öffentliches Verkehrsnetz. Die Rheinländer sind meiner Erfahrung nach auch höchstens halb so offen und herzlich, wie man ihnen nachsagt: Ohne einen Cent in Zülpich-Ülpenich – das war kein Vergnügen gewesen. Niemand wollte mir sein Fahrrad leihen oder mir Geld für die Rückfahrt geben oder mich auch nur telefonieren lassen. Von rheinischer Herzlichkeit keine Spur. Der Taxifahrer, der mich schließlich nach Hause brachte, kam aus der Türkei.
Wie gesagt, ich hatte es schwer, mich in Köln einzuleben. Ich sah sehr friesisch aus, groß, hellblond und schlaksig, mit überproportional großen Füßen und Händen. Ich trug eine Nickelbrille, kaute Fingernägel und stotterte, wenn ich aufgeregt war. Um kleiner zu wirken, ließ ich meine Schultern nach vorne fallen, und aus demselben Grund hatte ich mir einen schlurfenden Gang angewöhnt. Um den Neuanfang und meinen Erwachsenenstatus zu demonstrieren, hatte ich in Köln gleich als Erstes einen Friseur aufgesucht, der meinen meterlangen Zopf abgeschnitten und mir eine – nach eigener Auskunft – »pfiffige Kurzhaarfrisur« verpasst hatte. Aber die Frisur war nicht pfiffig, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es überhaupt eine Frisur war. Immerhin war sie unauffällig und schmucklos und passte so hervorragend zu meinen vorwiegend in Grau und Dunkelblau gehaltenen Klamotten. Ich trug meistens Jeans zu sackähnlichen Oberteilen, bequeme Gesundheitstreter und kein Make-up. Mit diesem Outfit fiel ich im Psychologie-Seminar auch kein bisschen aus dem Rahmen. Um mein Zugehörigkeitsgefühl noch mehr zu stärken, unterhielt ich ein unglückliches Liebesverhältnis mit einem der Jungs aus meiner WG, Jan Kröllmann. Aus falscher Scham hatte ich Jan nicht verraten, dass er der Erste für mich gewesen war, was wiederum keine gute Basis für unsere Beziehung darstellte. Ich war so verschüchtert und verklemmt, dass Jan mich nur nackt sehen durfte, wenn es stockdunkel im Raum war – also gar nicht. Er betrog mich auch recht bald mit der Freundin einer anderen Mitbewohnerin, die, wie er sagte, das bequemere Bett hatte. Da die beiden es aber nicht nur im Bett miteinander trieben, sondern auch auf dem Teppich im Flur, in der Badewanne und auf dem Küchentisch, vermutete ich ganz stark, dass sie außer dem Bett auch noch andere Vorteile mir gegenüber hatte. Aus lauter Angst, über die beiden zu stolpern, wagte ich mich kaum mehr aus meinem Zimmer und verbrachte unverhältnismäßig viel Zeit in der Uni-Bibliothek. Die Tatsache, dass ein weiterer WG-Bewohner sich hartnäckig anbot, Jans Nachfolge bei mir anzutreten, machte die Sache auch nicht gerade unkomplizierter, zumal dieser WG-Bewohner einen Kopf kleiner war als ich und einen durchdringenden Eigengeruch besaß. Ich war kurz davor, mein Studium hinzuschmeißen und zurück nach Pellworm zu gehen, um dort bis an mein Lebensende Kühe zu melken. Glücklicherweise lernte ich genau zu diesem Zeitpunkt Lorenz kennen und überdachte die Sache noch einmal.
Ich überfuhr Lorenz ganz romantisch mit meinem Fahrrad. Er stand mitten auf dem Radweg. Bis zum letzten Augenblick dachte ich, er würde zur Seite springen, denn ich klingelte wie verrückt und machte scheuchende Handbewegungen, außerdem schimpfte ich ziemlich laut über ignorante Fußgänger auf Radwegen. Aber Lorenz war so sehr in seine Akten vertieft, dass er mich weder hörte noch sah. Ich wich im letzten Augenblick auf den Gehweg aus, aber dort kam mir ein anderer Radfahrer entgegen, der Lorenz ebenfalls hatte ausweichen wollen. Wir kollidierten alle drei miteinander, es gab einen ziemlichen Lärm, und es dauerte eine Weile, bis wir unsere Gliedmaßen und Fahrräder wieder voneinander getrennt hatten. Es war ein Wunder, dass sich niemand ernstlich verletzt hatte, von den Schürfwunden, die ich davontrug, mal abgesehen. Lorenz sah freundlicherweise auch fast sofort ein, dass er an dem Unfall die Hauptschuld trug. Er wartete, bis der andere Radfahrer fluchend weitergefahren war, dann lud er mich zum Essen ein. Heute denke ich, dass es purer Zufall war, dass er mich eingeladen hat: Wäre der andere Radfahrer eine Frau und besser aussehend gewesen als ich, dann wäre Lorenz vermutlich heute mit ihr verheiratet. Er hatte damals nämlich beschlossen, dass es nun Zeit sei, sich ernsthaft zu binden, und wenn Lorenz sich einmal zu etwas entschlossen hatte, dann war er davon auch nicht mehr abzubringen. Er war ein aufstrebender junger Rechts-Referendar mit genau definierten Zukunftsplänen, und mir kam er vor wie ein Geschenk vom lieben Gott. Jan Kröllmann war ein Nichts gegen Lorenz Wischnewski, das war mir sofort klar.
Rückblickend denke ich, dass wirklich nicht viel dazu gehörte, mich verliebt zu machen. Der Einfachheit halber verliebte ich mich immer in den Erstbesten, der mir über den Weg lief.
Lorenz war aber der erste Mann, der erkannte, dass ich eigentlich gar kein hässliches junges Entlein war, sondern ein Schwan. Unter seiner Regie musterte ich meine sackähnlichen Oberteile aus, kaufte mir eng anliegende T-Shirts, fand Gefallen an Pumps in Schuhgröße einundvierzigeinhalb und tauschte schließlich sogar die Nickelbrille gegen farbige Kontaktlinsen. Derart verwandelt – drei Wochen nach unserem Kennenlernen hätte mich zu Hause auf Pellworm wohl nur noch der Hund wieder erkannt – stellte mich Lorenz ganz stolz zuerst seinen Freunden und dann seiner Mutter vor.
Dass er mich der Öffentlichkeit erst nach meiner Typveränderung präsentierte, hätte mich misstrauisch stimmen müssen, aber ich war verliebt. Es gab keinen Grund mehr, die Schultern nach vorne fallen zu lassen und zu schlurfen, denn Lorenz war auch dann noch größer als ich, wenn ich Pumps trug. Endlich mal ein Mann, der wusste, was er wollte – nämlich mich! Ich konnte gar nicht schnell genug aus meiner WG aus- und bei Lorenz einziehen.
Fast genauso beeilte ich mich damit, schwanger zu werden.
Das allerdings war keine Absicht. Als meine Periode ausblieb, geriet ich in Panik. Schwanger! Ausgerechnet jetzt, wo sich mein Leben so wunderbar entwickelte! Lorenz – der erste Mann, der mich nackt gesehen hatte – würde mich achtkantig wieder aus seiner Wohnung schmeißen, meine Eltern würden mich umbringen, auf Pellworm würde ich mich nie wieder blicken lassen dürfen. Noch im Wartezimmer des Frauenarztes betete ich darum, eine schreckliche, gerne auch unheilbare Krankheit zu haben, bitte, bitte, ich habe doch immer gewissenhaft jeden Tag um dieselbe Zeit meine Pille genommen, bitte, lass mich krank sein, eine heimtückische Zyste, ein bösartiges Myom, alles, alles, nur keine Schwangerschaft.
Mein Gebet wurde nicht erhört. Nachdem ich das Baby auf dem Ultraschall gesehen hatte, war ich dann auch ganz froh darüber, dass ich noch nicht sterben musste.
Und ich hatte mich getäuscht, sowohl in Lorenz als auch in meinen Eltern. Als Lorenz von der Schwangerschaft erfuhr, warf er mich nicht aus seiner Wohnung, sondern machte mir einen Heiratsantrag. Und als meine Eltern von dem Heiratsantrag hörten, luden sie uns beide nach Pellworm ein, um Lorenz den Nachbarn vorzustellen und die Auswahl des Kinderwagenmodells zu diskutieren.
Ungefähr acht Monate später wurde unsere Tochter Nelly geboren, später Julius, und für vierzehn Jahre war alles in bester Ordnung. Ich hatte das Studium an den Nagel gehängt, meine Kinder großgezogen und mich bemüht, mein Leben mit den richtigen Dingen auszufüllen: den richtigen Büchern zum richtigen Party-Smalltalk, den richtigen Schuhen zum richtigen Kleid, den richtigen Urlaubszielen mit den richtigen Freunden, den richtigen Gerichten zum richtigen Anlass und dem richtigen Umgang mit der richtigen Putzfrau. Von allen Dingen war Letzteres am schwierigsten für mich gewesen. Es hatte ein paar Jahre gedauert, bis ich kapiert hatte, dass es nicht sinnvoll ist, mit der Frau, die den Dreck für einen wegmacht, befreundet sein zu wollen. Am Ende sitzt man die ganze Zeit mit der neuen »Freundin« bei einem Kaffee, hört sich ihre schlimmen Ehegeschichten an und gibt gute Ratschläge, die niemals befolgt werden. Jeden Mittag gibt man der Freundin beim Abschied das vereinbarte Geld, um sich dann selber auf die Hausarbeit zu stürzen. Merkwürdigerweise halten solche Freundschaften nur so lange, bis man sich entscheidet, jemand anderen zum Putzen einzustellen, damit man mehr Zeit für die Eheprobleme der Freundin hat. Der Ehemann bezeichnet einen nicht zu Unrecht als selten doofes Schaf – jedenfalls war das bei mir so. Aber ich war sehr jung und in solchen Sachen absolut unerfahren (meine Mutter hatte selbstredend niemals eine Putzfrau gehabt), und deshalb musste ich aus der Erfahrung lernen. Immerhin: Frau Klapko, die erste Zugehfrau, mit der ich mich nicht duzte, putzte, bügelte und staubsaugte nun schon seit fünf Jahren für uns, und dank ihr sah unsere Wohnung immer so sauber und aufgeräumt aus wie für ein Einrichtungs-Magazin fotografiert.
Bei uns lief also alles richtig. Bis mein Mann vor vier Monaten plötzlich und unerwartet die Scheidung verlangt hatte.
Ich war damals aus allen Wolken gefallen. Der Abend hatte wie so viele andere begonnen: Lorenz hatte Überstunden gemacht, ich hatte die Kinder ohne ihn ins Bett gebracht, ihm dann sein Abendessen aufgewärmt und bei einem Glas Rotwein mit ihm über den Tag geplaudert.
Und mittendrin hatte er ohne weitere Einleitung verkündet: »Conny, ich möchte, dass wir uns scheiden lassen.«
Es hätte nicht viel gefehlt, und ich wäre vom Stuhl gerutscht.
»Soll das ein Witz sein?«, fragte ich.
»Natürlich nicht. Über so eine ernste Sache würde ich wohl kaum Witze reißen«, antwortete Lorenz streng.
Fassungslos starrte ich ihn an und überlegte, welchen Teil des Films ich wohl verpasst hatte. Hallo? Hört mich jemand?
Währenddessen unterbreitete mir Lorenz seine Pläne, mein und sein weiteres Leben betreffend: »Selbstverständlich bleiben die Kinder bei dir, dafür behalte ich die Wohnung, allein schon wegen der Nähe zum Gericht. Ulfi wird den ganzen Finanzkram für uns regeln, darüber müssen wir uns nicht den Kopf zerbrechen, aber ich dachte, dass es schön wäre, wenn du und die Kinder im Haus meiner Mutter leben würdet. Die Kinder hätten einen Garten, und ihr hättet sogar noch mehr Platz als hier. Außerdem ist es mein Elternhaus, und es an Fremde zu verkaufen, fände ich irgendwie nicht richtig. Was hältst du davon, Conny?«
Hallo? Hallo? Ich funkte immer noch Hilferufe in den Weltraum. Aber niemand antwortete.
»Conny?«
»Hm?« Ich stand ganz klar unter Schock. Vermutlich lief mir Spucke übers Kinn oder so. Ich versuchte, einzelne Bruchstücke von dem, was Lorenz sagte, zu einem logischen Ganzen zusammenzusetzen, aber es war vergeblich. Seine Mutter war vor vier Wochen dreiundachtzigjährig an einem Schlaganfall gestorben. Vielleicht waren Lorenz’ Scheidungsideen eine verspätete Reaktion auf ihren Tod? Ich versuchte, die Überbleibsel meiner Psychologiekenntnisse zu aktivieren: Gab es möglicherweise eine Art … äh … ödipalen … äh … Scheidungszwangs … äh … postmortal? Ich erinnerte mich nicht daran, jemals von so etwas gehört zu haben. Eigentlich gab es nur zwei mögliche Erklärungen. Entweder Lorenz hatte einen Gehirntumor oder … –
»Julius könnte in die ›Villa Kunterbunt‹ gehen, das ist der Kindergarten nur eine Straße weiter, der hat einen fantastischen Ruf, und der Anteil ungezogener Ausländer- und Sozialhilfekinder ist sozusagen gleich null«, unterbrach Lorenz meinen wirren Gedankenstrom. »Dort bekommt er nicht täglich eins mit der Schaufel übergebraten, und die Erzieherinnen tragen kein Kopftuch. Das wäre also eine ganz klare Verbesserung gegenüber diesem integrativen, alternativen Saftladen, wo er jetzt hingeht, findest du nicht? Nelly kann natürlich auf ihrer Schule bleiben, sie müsste nur eine längere Bahnfahrt auf sich nehmen. Wenn sie allerdings wechseln will: Das Gymnasium dort ist sogar mit dem Fahrrad zu erreichen und hat ebenfalls einen guten Ruf. Aber ich denke, das können wir sie selbst entscheiden lassen, was meinst du?«
Entweder er hatte einen Gehirntumor oder … –
»Hast du eine andere?«, platzte ich heraus.
»Wie bitte?« Lorenz sah mich an, als habe ich den Verstand verloren. »Wie kommst du denn jetzt darauf ?«
»Ja, sag mal!«, rief ich aus. »Warum würdest du sonst plötzlich die Scheidung wollen? Bei uns ist doch alles in Ordnung.«
Lorenz seufzte. »Ich wusste, dass es schwer werden würde, vernünftig mit dir darüber zu reden. Du bist so emotional.«
Einer von uns beiden war hier ganz offensichtlich verrückt geworden. Fieberhaft durchforstete ich die letzten vierzehn Jahre nach einer Erklärung für Lorenz’ Scheidungswunsch und fand nichts, nicht mal einen handfesten Ehestreit. Gut, ich hatte mein Studium an den Nagel gehängt und nie versucht, einen Beruf auszuüben, weswegen ich mich manchmal schlecht fühlte. Die Frauen in unserem gemeinsamen Bekanntenkreis waren nicht nur gewandter im richtigen Umgang mit der richtigen Putzfrau, sie waren in der Regel auch trotz ihrer Kinder berufstätig, die meisten waren sogar irgendwas Tolles wie Investmentberaterin, Richterin oder Ärztin. Da konnte man sich schon mal ein bisschen minderwertig fühlen, wenn alle sich bei einem Abendessen über ihren Alltag austauschten, über einen aufregenden Strafrechtsprozess, einen in letzter Sekunde wiederbelebten Patienten oder den wackeligen Nikkei, während das schwerwiegendste Problem, das man selber an diesem Tag gelöst hatte, ein Kaugummi war, der sich in den Haaren der kleinen Tochter verklebt hatte. Aber Lorenz hatte gar nichts dagegen einzuwenden gehabt, dass ich zu Hause geblieben war, er hatte immer gesagt, er verdiene genug Geld für uns beide, und das stimmte ja auch. (Zumal er das einzige Kind in einer Familie mit zwei kinderlosen Erbonkels war, die im Verlauf unserer Ehe nacheinander das Zeitliche gesegnet hatten. Wenn sie auch den größten Teil ihres Vermögens irgendwelchen Stiftungen vermachten, blieben doch genügend Wertpapiere, Gemälde und Geldmarktfonds für ihren einzigen Neffen und Großneffen übrig.) Außerdem konnte man im Laufe der Jahre beobachten, wie viele Ehen in unserem Bekanntenkreis auseinander gingen, obwohl die Frauen so tüchtig und patent waren. Nein, es gab keine grundlegenden Diskrepanzen zwischen uns, sogar unser Sexualleben war völlig normal. Ein- oder zweimal in der Woche schliefen wir miteinander, wenn die Kinder im Bett waren, und das war weit mehr, als die meisten anderen Paare mit kleinen Kindern von sich behaupten können. Es hatte gelegentlich nur ein paar kleinere harmlose Auseinandersetzungen in unserer Ehe gegeben. Etwa darüber, dass ich meistens meine »Tchibo«-Handtasche trug, obwohl Lorenz mir doch eine »Louis-Vuitton«-Handtasche geschenkt hatte, oder darüber, dass ich vor Jahren einmal Julius’ Windeleimer im Flur hatte stehen lassen, als der Oberstaatsanwalt und seine Frau zu uns zum Essen kamen. Mir fiel überhaupt nur eine einzige Sache ein, über die Lorenz sich wirklich aufgeregt hatte, und das war die Sache mit dem neuen Nachbarn.
Kürzlich hatte ich den Müll runtergebracht und mich dabei selber ausgesperrt, ein Klassiker, wir kennen das alle: Die Tür war zugefallen, der Schlüssel steckte innen im Schloss. Drinnen schmorte eine Gemüselasagne im Ofen, und Julius hielt seinen Mittagsschlaf. Außerdem war ich barfuß, eine blöde Angewohnheit. Die Nachbarin, die unseren Wohnungsschlüssel hatte, um dort nach dem Rechten zu sehen, wenn wir in den Ferien waren, war nicht zu Hause, und Nelly kam erst in zwei Stunden von der Schule. Weil die Lasagne so gut wie gar war, klingelte ich kurz entschlossen an der Wohnung über uns, wo gerade jemand neu eingezogen war, ein altersloser, bärtiger Mann, der es bis dahin versäumt hatte, sich vorzustellen. Er war glücklicherweise zu Hause. Ich hatte es etwas eilig, weil ich nicht wollte, dass Julius aufwachte und mich nicht in der Wohnung vorfand, darum sagte ich hastig, aber nicht unfreundlich: »Hallo, mein Name ist Constanze Wischnewski, ich wohne unter Ihnen, willkommen in unserem Haus, Brot und Salz bringe ich Ihnen ein anderes Mal vorbei, dürfte ich bitte mal auf Ihren Balkon?«
Der Bärtige war damit wohl etwas überfordert, er glotzte nur verdutzt auf meine nackten Füße. Aber ich konnte nicht warten, bis er aus seiner Erstarrung erwachte.
»Sehr hübsch haben Sie’s hier«, sagte ich, während ich mich an ihm vorbei ins Wohnzimmer schob und über den kompletten Mangel an Möbeln staunte. Nur »Bang & Olufsen« und deckenhohe CD-Regale. »So reduziert.«
Weil der Mann immer noch nichts sagte, öffnete ich die Balkontür und kletterte, nicht ohne mich vorher noch einmal höflichst zu bedanken, an den mit Knöterich bewachsenen Edelstahlrohren hinab auf unseren Balkon. Der Rest war ein Klacks: Ein Flügel des Schlafzimmerfensters stand auf Kipp, ich griff routiniert durch den Spalt, öffnete den anderen Flügel und kletterte hinein. Ich war stolz auf mich: Weder die Lasagne noch Julius waren zu Schaden gekommen.
Als ich Lorenz am Abend die Geschichte schildern wollte, wusste er schon Bescheid. Der Bärtige hatte ihn nämlich im Treppenhaus abgefangen und sich nach den Psychopharmaka erkundigt, die ich einnehmen müsse. Und sich darüber beschwert, dass der Vermieter ihm vorher nichts von mir erzählt habe. Offenbar witterte er eine Chance auf Mietminderung. Meinetwegen! Als ob ich gemeingefährlich sei! Lorenz war das schrecklich peinlich gewesen. An diesem Abend hatte er dann auch diesen beleidigenden Satz von sich gegeben, von wegen, ich sei das am schlechtesten organisierte, lebensuntüchtigste Weibsstück, das er kenne. Außerdem sei ich leichtsinnig und unverantwortlich und Barfußlaufen eine bäuerliche Unsitte.
Aber er würde sich doch wohl kaum scheiden lassen wollen, weil ich barfuß herumlief, oder?
»Hast du eine andere?«, wiederholte ich mit wackeliger Stimme.
»Nei-in!«, sagte Lorenz mit Nachdruck.
Ich wusste nicht weiter, also fing ich an zu heulen, weniger aus Kummer, mehr aus Hilflosigkeit. Und weil ich nicht mehr aufhören konnte zu weinen, erbarmte sich Lorenz endlich und versuchte, seine Entscheidung zu erklären.
Er sagte, dass sich seine Gefühle für mich geändert hätten, das sei alles. Dass unser Potenzial einfach erschöpft sei, wir uns gemeinsam nicht mehr weiterentwickeln könnten. Und dass wir noch zu jung seien, um eine Ehe ohne Gefühle zu führen. Und dass ich, wenn ich ganz tief in mich hineinhören würde, ebenfalls zu dieser Erkenntnis gelangen würde.
In den folgenden Wochen gab ich mir große Mühe, tief in mich hineinzuhören und nach dieser Erkenntnis zu suchen, während Lorenz bereits tatkräftig an der Umsetzung seiner Pläne arbeitete. Wenn er sich einmal zu etwas entschlossen hatte, dann gab es kein Zurück mehr. Er erklärte den Kindern, dass Mami und Papi einander noch sehr lieb hätten, aber nicht mehr lieb genug, um zusammen zu wohnen. Und dass Papi deswegen jetzt erst mal im Gästezimmer schlafen müsse. Aber das Haus von der Omi, das sei schrecklich traurig, weil es doch leer stünde, und deshalb würden sie, die Kinder, mit der Mami, also mir, dort einziehen, sobald die Heizung repariert sei. Dann wäre das Haus wieder froh, und der Papi müsse nicht mehr im Gästezimmer schlafen. Und im Garten von Omis Haus könne man eine wunderschöne Schaukel aufbauen und einen Sandkasten, und Papi würde ganz oft dort vorbeikommen und sie besuchen. Und sie könnten jederzeit zu Papi kommen, um ihn zu besuchen, und alles würde ganz, ganz toll funktionieren.
Julius leuchtete das alles auch völlig ein, er stellte keine weiteren Fragen und war ausgeglichen und fröhlich wie immer. Aber Nelly war keine vier mehr, sondern fast vierzehn, und sie fand Lorenz’ Erklärungen ausgesprochen fadenscheinig. Außerdem war sie mit Schaukeln und Sandkästen nicht mehr zu ködern. Gemeinerweise gab sie die Schuld an dem Schlamassel aber allein mir.
»Ich lass mich doch nicht von euch verarschen«, sagte sie. »Was hast du getan?«
Nichts. Ich hatte nichts getan, absolut nichts. Vielleicht war das ja zu wenig gewesen?
»Ich will nicht in Omis Haus ziehen, da ist es mega-öde«, rief Nelly. »Du musst dich also wieder mit dem Papi vertragen.«
Tja, wenn das so einfach gewesen wäre.
»Aber wir haben uns doch gar nicht gestritten, Schätzchen«, sagte ich und versuchte, beruhigend, überlegen und erwachsen zu klingen.
»Was denn dann?«, rief Nelly. »Hat Papi eine andere?«
»Nei-in!«, sagte ich mit Nachdruck, genau wie Lorenz.
»Aber warum liebt er dich denn dann nicht mehr?«
Ich zuckte mit den Achseln. »Weißt du, Gefühle können eben manchmal …«
»Ach, fuck!«, schrie Nelly und fing an zu heulen. »Ich will nicht in diese Spießerkiste in die Vorstadt ziehen. Ich find das so scheiße, dass du gar nichts dagegen tust. Ihr versaut mir das ganze Leben.«
Aber was sollte ich denn tun? Lorenz’ Entscheidung stand bombenfest. Er hatte keine Zeit verloren, alle unsere Freunde, Bekannten und Verwandten über unsere bevorstehende Scheidung zu informieren. Sie waren überrascht, wenn auch nicht ganz so überrascht wie ich. So etwas kam eben in den besten Familien vor.
Alle waren sehr freundlich und sehr neutral, und auch, wenn man neutrales Verhalten in einem solchen Fall theoretisch für korrekt befinden würde, ist Neutralität doch etwas, was man in der konkreten Situation wirklich nicht gebrauchen kann. Ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass neutrale Freunde gar keine Freunde sind. Wenn ich Trudi nicht gehabt hätte, wäre ich mir einsamer denn je vorgekommen.
Trudi, die eigentlich Gertrud hieß, war die Einzige in meinem Bekanntenkreis, die nicht »richtig« war, jedenfalls nach Lorenz’ Maßstäben. Ich hatte sie an der Uni kennen gelernt, als ich zwei Jahre nach Nellys Geburt versucht hatte, mein Studium doch noch zu Ende zu bringen. (Was ich – nebenbei bemerkt – aber nie geschafft hatte.) Trudi hatte, um es mit Lorenz’ Worten zu sagen, einen Sprung in der Schüssel, sie glaubte an seltsame Geistwesen und Außerirdische und kannte sämtliche Stationen ihrer zahlreichen früheren Leben. Sie war eine brillante Psychologiestudentin gewesen, hatte den besten Abschluss des Semesters gemacht und zwei tolle Job-Angebote in den Wind geschlagen, weil sie sich »nicht gut anfühlten«. Seit dieser Zeit hatte sie eine Reihe von geheimnisvollen, kostenintensiven Fortbildungen gemacht, die sie dazu befähigten, Wasseradern und elektromagnetische Felder aufzuspüren, Naturgeister zu besänftigen und die Aura eines alten Autoreifens zu analysieren. Davon abgesehen war sie aber eine wirklich gute Freundin, eine von der Sorte, die man auch nachts um vier anrufen kann, wenn man Hilfe braucht.
Trudi verhielt sich als Einzige nicht neutral, sie nahm mich in den Arm und sagte: »Lorenz ist ein alter Saftsack, Connylein. Ich hab das schon hundertmal im Bekanntenkreis miterlebt. Das ist die Midlife-Crisis. Es ist normal, dass Männer sich in dieser Zeit von ihrer Familie trennen und ihre Frauen gegen eine jüngere eintauschen. Und ihren Volvo gegen ein Porsche-Cabrio. Deshalb habe ich gar nicht erst geheiratet.«
»Aber Lorenz hat keine andere«, sagte ich. Er hatte allerdings einen Volvo.
Trudi schaute ungläubig drein. »Da bin ich mir aber ziemlich sicher. Mein Gefühl täuscht sich niemals.«
»Er liebt mich nur nicht mehr, das ist alles«, sagte ich. »Und das ist irgendwie noch schlimmer.«
»So ein Blödmann!« Trudi legte den Arm um meine Schultern und reihte all die Plattitüden aneinander, die man in solchen Lebensmomenten am liebsten hört. »Er hat dich gar nicht verdient. Ich fand immer, dass ihr eigentlich gar nicht zusammenpasst. Und sieh es doch mal positiv: Fällt eine Tür im Leben zu, öffnet sich immer eine andere. Wer weiß, was das Schicksal noch für dich bereithält. Jetzt kommt für dich das große Abenteuer, ist das nicht herrlich? Wenn Lorenz eine andere hat, finden wir für dich auch einen anderen. Einen Besseren. Das wäre doch gelacht, so wie du aussiehst. Es wird nur schwer werden, jemanden zu finden, der größer ist als du. Ich kann mir nicht helfen, aber in solchen Dingen bin ich altmodisch. Wenn die Männer heutzutage schon nicht klüger als wir sein können, dann sollten sie einen wenigstens körperlich überragen. Ach, das wird herrlich werden: Mit Mitte dreißig kann man das Single-Leben ganz anders genießen.«
Aber ich wollte ja überhaupt kein Single-Leben.
»Trudi«, sagte ich mit Nachdruck. »Lorenz hat keine andere. Er liebt mich nur nicht mehr, und ich weiß nicht, warum, und das macht mich ganz krank. Mir wäre es wirklich lieber, wenn er eine andere hätte, das fände ich dann wenigstens normal.«
Ich hatte immer gedacht, seine Familie käme für Lorenz an erster Stelle. Gleich hinter seiner Karriere. Dass er uns nach vierzehn gemeinsamen Jahren ins Haus seiner Mutter abschieben wollte, nur weil seine Gefühle sich »geändert« hatten, schien mir so gar nicht zu ihm zu passen.
Wenn Lorenz keine andere hatte, dann musste er eben doch unter einem Gehirntumor leiden. Das war die einzig plausible Erklärung, und ich klammerte mich an sie wie an einen Rettungsanker.
Statt zum Neurologen ging Lorenz aber zu seinem Freund und Anwalt Ulfi Kleinschmidt, der mich nur noch mehr verwirrte, indem er mir die Trennungsformalitäten derart juristisch verschnörkelt auseinander setzte, dass ich nur Bahnhof verstand. Ich wollte mir aber keine Blöße geben und unterschrieb alles, was Ulfi mir vorlegte, damit »das Verfahren beschleunigt wird«. Obwohl ich gar nicht wollte, dass das Verfahren beschleunigt wurde. Vielleicht wurde Lorenz ja noch vor der Scheidung von seinem Tumor dahingerafft. So etwas konnte ganz schnell gehen.
»Ich bin kerngesund«, sagte Lorenz. »Und du musst endlich akzeptieren, dass es zwischen uns aus ist.«
Aber so schnell konnte ich einfach nicht umschalten. Während ich so zusah, wie Lorenz unsere Ehe sorgfältig in ihre Bestandteile zerlegte und nur noch ohne mich zu Abendeinladungen ging – unsere gemeinsamen so genannten Freunde hatten entschieden, dass Lorenz wohl der Wichtigere von uns beiden war –, kam ich mir in der Wohnung zunehmend überflüssig vor, wie ein unerwünschter Gast. Halbherzig begann ich damit, meine Sachen und die der Kinder zusammenzupacken, was Nelly mit hysterischen Kreischanfällen quittierte.
»Meine Sachen bleiben hier! Ich werde sowieso die meiste Zeit hier sein. In diese Omi-Spießer-Kiste gehe ich allerhöchstens zum Schlafen! Dahin werde ich ganz sicher keine einzige meiner Freundinnen einladen, so viel ist klar. Papi hat gesagt, mein Zimmer hier wird immer mein Zimmer bleiben.«
Viel gab es ohnehin nicht zu packen, weil eigentlich alles Lorenz gehörte. Er hatte es ausgesucht, und er hatte es bezahlt. In Geschmackssachen hatte ich mich immer an Lorenz gehalten, nicht umgekehrt, das zog sich wie ein roter Faden durch unsere Ehe. Die ganze Wohnung war mit sündhaft teurem, silbergrauem Ziegenhaarvelours ausgelegt, es gab »Rolf-Benz«-Sofas mit schwarzen Lederbezügen, einen Couchtisch im Wert eines Kleinwagens und riesige abstrakte Gemälde, deren Wiederverkauf die Ausbildungskosten unserer Kinder decken würde.
Nur das Weichholzküchenbüfett, das ich Lorenz zur Hochzeit geschenkt hatte, hob sich deutlich vom Rest der Einrichtung ab. Ich hatte es daheim auf Pellworm im Kuhstall unseres Nachbarn gefunden, unter mehreren Schichten Farbe. Es hatte mich Wochen gekostet, bis ich es abgelaugt und -geschliffen und mit Leinöl und ätherischem Orangenöl den Kuhstallgeruch weggepinselt hatte.
Lorenz war sehr gerührt gewesen, als ich ihm den Schrank präsentiert hatte, umwickelt mit einer weißen Schleife.
Ich musste weinen, als ich mich daran erinnerte. Ich musste überhaupt viel weinen, während ich mich an vieles erinnerte. An manchen Tagen wurden meine Augen gar nicht mehr trocken vor lauter Weinen. Trudi fand das alarmierend. Sie sagte, dass meine Aura ganz vergiftet sei und dass ich sofort ausziehen solle, um meine Seele zu retten. Sie ließ sich auch nicht von meiner Gehirntumortheorie überzeugen, sondern bot an, mich und die Kinder bei sich aufzunehmen, bis Lorenz die Heizung im Haus seiner Mutter hätte reparieren lassen. Aber mal abgesehen davon, dass Nelly wegen dieses Vorschlags einen weiteren hysterischen Kreischanfall erlitt, war die Idee auch nicht wirklich gut. Trudi wohnte mit ihren drei Siamkatzen und einer ganzen Menge für uns glücklicherweise unsichtbarer Geistwesen in einer kleinen Zweizimmerwohnung und hatte keine Vorstellung davon, was es heißen würde, diese nun mit einem Teenager, einem Kleinkind und einer akut depressiven Mittdreißigerin zu teilen. Hätte ich keine Kinder gehabt, hätte ich ihr Angebot sofort angenommen. Wir hätten jeden Abend mehrere Flaschen Rotwein gekillt und traurige Filme auf Video angesehen. Nichts ist tröstlicher, als stockbesoffen die Titanic untergehen zu sehen – ich meine, da fühlt man sich doch gleich besser. Aber wegen der Kinder musste ich vernünftig bleiben.
»Ach, komm schon!«, sagte Trudi abenteuerlustig. »Wir machen uns eine schöne Zeit! Ihr drei bekommt ein Matratzenlager im Wohnzimmer, und wir machen Energiemassagen und Aromatherapie und Picknick vor dem Fernseher und so …«
»Nein, nein«, sagte ich. »Sonst ändern sich auch deine Gefühle für mich, und dann hat mich gar keiner mehr lieb.«
Statt zu Trudi zu ziehen, fuhr ich also ganz vernünftig mit den Kindern nach Pellworm, obwohl es dort für mich weder eine tröstende Freundin noch Titanic-Videos oder Rotwein gab. Aber wir hatten jedes Jahr die Weihnachtsferien auf dem Hof meiner Eltern verbracht, und ich wollte, dass für die Kinder das Leben so normal wie möglich weiterging. Dummerweise waren während der Feiertage keine Installateure für die Heizung im Haus von Lorenz’ Mutter aufzutreiben, und als Lorenz endlich jemand gefunden hatte, stellte sich heraus, dass die Heizung nicht mehr zu reparieren war, sondern völlig erneuert werden musste. Das bedeutete, dass wir noch länger bei meinen Eltern bleiben mussten. Nur Nelly fuhr am Ferienende zurück nach Hause, um die Schule nicht zu verpassen. Sie war ausgesprochen guter Stimmung, als sie sich von uns verabschiedete, denn meine Eltern hatten für Mädchen immer noch nicht viel übrig, und außerdem versuchten sie Nelly ständig einzureden, dass sie mein genaues Ebenbild sei.
»Wirklich, ganz genau wie Constanze in dem Alter«, sagten sie. Mädchen hören so etwas nicht gerne. Ich möchte meiner Mutter auch heute noch so wenig ähnlich wie nur möglich sein. Nelly hatte zu allem Überfluss meine Konfirmandenfotos gefunden – ich als Vierzehnjährige mit hängenden Schultern, Nickelbrille und Collegeschuhen in Größe einundvierzigeinhalb – und war darüber in Tränen ausgebrochen.
»Und so soll ich aussehen?«, heulte sie.
»Aber nein, mein Schatz«, versuchte ich sie zu beruhigen. »Du hast nur die guten Seiten von mir geerbt.«
»Was denn für gute Seiten?«, heulte Nelly unhöflich.
Während meine Tochter also froh war, endlich zurück nach Köln fahren zu dürfen, blieb Julius und mir nichts anderes übrig, als auf Pellworm auszuharren, bis die verdammte Heizung endlich eingebaut war.