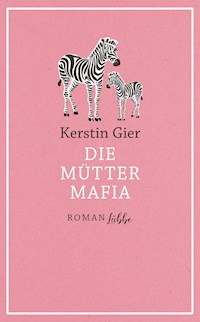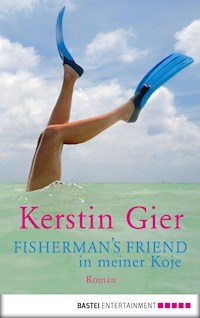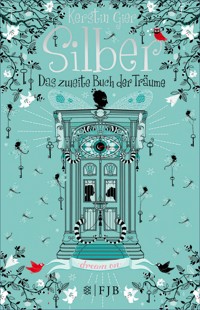
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Silber-Trilogie
- Sprache: Deutsch
›Das zweite Buch der Träume‹ ist die fulminante, spannende Fortsetzung der SILBER-Trilogie. Liv ist erschüttert: Secrecy kennt ihre intimsten Geheimnisse. Woher nur? Und was verbirgt Henry vor ihr? Welche düstere Gestalt treibt nachts in den endlosen Korridoren der Traumwelt ihr Unwesen? Und warum fängt ihre Schwester Mia plötzlich mit dem Schlafwandeln an? Albträume, mysteriöse Begegnungen und wilde Verfolgungsjagden tragen nicht gerade zu einem erholsamen Schlaf bei, dabei muss Liv sich doch auch schon tagsüber mit der geballten Problematik einer frischgebackenen Patchwork-Familie samt intriganter Großmutter herumschlagen. Und der Tatsache, dass es einige Menschen gibt, die noch eine Rechnung mit ihr offen haben – sowohl tagsüber als auch nachts …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2014
Sammlungen
Ähnliche
Kerstin Gier
Silber
Das zweite Buch der Träume
Roman
Über dieses Buch
›Das zweite Buch der Träume‹ ist die fulminante, spannende Fortsetzung der SILBER-Trilogie.
Liv ist erschüttert: Secrecy kennt ihre intimsten Geheimnisse. Woher nur? Und was verbirgt Henry vor ihr? Welche düstere Gestalt treibt nachts in den endlosen Korridoren der Traumwelt ihr Unwesen? Und warum fängt ihre Schwester Mia plötzlich mit dem Schlafwandeln an?
Albträume, mysteriöse Begegnungen und wilde Verfolgungsjagden tragen nicht gerade zu einem erholsamen Schlaf bei, dabei muss Liv sich doch auch schon tagsüber mit der geballten Problematik einer frischgebackenen Patchwork-Familie samt intriganter Großmutter herumschlagen. Und der Tatsache, dass es einige Menschen gibt, die noch eine Rechnung mit ihr offen haben – sowohl tagsüber als auch nachts …
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Kerstin Gier, Jahrgang 1966, hat als mehr oder weniger arbeitslose Diplompädagogin 1995 ihr erstes Buch veröffentlicht. Mit riesigem Erfolg: Ihre Romane wie die »Müttermafia« oder »Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner« sind längst Kult und auf allen Bestenlisten zu finden, genauso wie »Rubinrot«, »Saphirblau« und »Smaragdgrün«, die auch international zu Bestsellern wurden. Im März 2013 kam mit »Rubinrot« bereits die zweite Verfilmung eines ihrer Bücher mit Starbesetzung in die Kinos. »Silber« ist ihre neue phantastische Trilogie. Die Autorin lebt mit ihrer Familie und zwei Katzen in der Nähe von Köln.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Book
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Covergestaltung: bürosüd°, München, unter Verwendung einer Illustration von Eva Schöfmann-Davidov
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402967-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Für Leonie. Ich bin so stolz auf dich.
»If you can dream it, you can do it.«
Walt Disney
1.
Charles hatte es mir wirklich nicht schwergemacht, seine Tür zu finden: Sie war mit einem lebensgroßen Foto von ihm selber bedruckt, breit grinsend in einem blütenweißen Kittel, auf dessen Brusttasche »Dr. med. dent. Charles Spencer« stand, und darunter: »Der Beste, den Sie für Ihre Zähne bekommen können.«
Womit ich allerdings nicht gerechnet hatte, war, dass das Foto zu singen anfing, als ich die Türklinke berührte.
»Working hard to keep teeth clean!«, schmetterte es voller Inbrunst und mit hübscher Tenorstimme auf die Melodie von »Twinkle, twinkle little star«. Erschrocken schaute ich mich im Korridor um. Meine Güte, ging es vielleicht auch etwas leiser? Ich hatte ohnehin schon die ganze Zeit das Gefühl, beobachtet zu werden. Obwohl außer mir und Foto-Charles niemand zu sehen war, nur Türen, so weit das Auge reichte. Meine eigene lag gleich um die nächste Ecke, und im Grunde wollte ich nichts lieber, als dorthin zurückzulaufen und die Aktion abzubrechen. Mein Gewissen brachte mich beinahe um. Das hier war in etwa so, als würde man jemandes geheimes Tagebuch lesen, nur noch viel schlimmer. Obendrein hatte ich einen Diebstahl dafür begehen müssen, auch wenn man sich durchaus darüber streiten konnte, ob das wirklich so unmoralisch war, wie es klang. Juristisch betrachtet, war es natürlich ein Diebstahl, aber diese Sorte fellgefütterte Trappermütze mit Ohrenklappen, die ich Charles entwendet hatte, stand nur den wenigsten Menschen gut. Die meisten sahen darin aus wie unterbelichtete Schafe, und Charles machte da keine Ausnahme, also hatte ich ihm im Grunde sogar einen Gefallen getan. Hoffentlich kam nur niemand in mein Zimmer und sah mich mit der dämlichen Mütze im Bett liegen. Denn das war es, was ich gerade wirklich tat: im Bett liegen und schlafen. Mit einer geklauten Trappermütze auf dem Kopf. Nur dass ich nicht irgendwas Nettes träumte, sondern jemanden im Traum ausspionierte. Jemanden, der möglicherweise gerade im Begriff war, Lottie (ihres Zeichens beste Verrückte-Frisuren-Flechterin, Plätzchenbäckerin, Hundeflüsterin und Mädchenseelentrösterin der Welt) das Herz zu brechen. Und da niemand auf der Welt ein sanftmütigeres Herz hatte als Lottie (offiziell übrigens unser Kindermädchen), durfte das auf keinen Fall passieren. Also heiligte in diesem Fall doch hoffentlich der Zweck die Mittel. Oder?
Ich seufzte. Warum musste eigentlich immer alles so kompliziert sein?
»Ich tu’s ja nicht für mich, ich tu’s für Lottie«, sagte ich halblaut und nur für den Fall, dass ich einen unsichtbaren Zuhörer hatte, dann holte ich tief Luft und drückte die Klinke hinunter.
»Na, na, nicht pfuschen!« Foto-Charles hob seinen Zeigefinger und fing wieder an zu singen. »Working hard to keep teeth clean, front and back and …?«
»Ähm … in between?«, flüsterte ich verlegen.
»Richtig! Auch wenn es gesungen viel hübscher ist.« Während die Tür aufschwang, schmetterte Charles fröhlich weiter: »When I brush for quite a while, I will have a happy smile!«
»Ich kann wirklich nicht nachvollziehen, was Lottie an dir findet«, murmelte ich, während ich über die Schwelle schlüpfte, nicht ohne mich ein letztes Mal im Korridor umzublicken. Immer noch nichts zu sehen.
Hinter der Tür wartete glücklicherweise keine Zahnarztpraxis auf mich, sondern ein sonnenbeschienener Golfplatz. Und Charles, diesmal in 3D, der in karierten Hosen den Golfschläger schwang. Sehr erleichtert, dass ich nicht in einen unanständigen Traum geplatzt war (laut Studien handeln über fünfunddreißig Prozent aller menschlichen Träume von Sex), passte ich mein Outfit rasch den Gegebenheiten an: Poloshirt, Leinenhose, Golfschuhe und – weil ich nicht widerstehen konnte – eine stilechte Schirmmütze. So selbstverständlich wie möglich schlenderte ich näher. Die Tür zum Korridor hatte sich sanft hinter mir geschlossen und stand nun wie ein seltsam anmutendes Kunstwerk mitten auf dem Rasen.
Nach der Landung rollte Charles’ Ball mit einer eleganten Kurve direkt in das Loch, und Charles’ Begleiter, ein Mann in seinem Alter mit auffallend schönen Zähnen, fluchte leise.
»Na, was sagt man denn dazu?« Charles drehte sich zu ihm um, ein triumphierendes Lächeln auf den Lippen. Dann fiel sein Blick auf mich, und er lächelte noch breiter. »Oh, hallo, kleine Liv. Hast du das gesehen? Das war ein Hole-in-one. Und damit habe ich unsere kleine Partie hier haushoch gewonnen.«
»Ähm, ja, ganz toll«, sagte ich beifällig.
»Ja, nicht wahr?« Charles lachte glucksend auf und legte einen Arm um meine Schulter. »Darf ich vorstellen? Der, der so grimmig schaut, ist mein alter Studienfreund Antony. Aber keine Sorge, ihm geht es gut, er ist es nur nicht gewohnt, gegen mich zu verlieren.«
»Allerdings nicht.« Antony schüttelte mir die Hand. »Ich bin die Sorte Freund, die einfach in allem besser ist: Ich hatte die besseren Noten, fahre die schickeren Autos, führe die erfolgreichere Praxis und habe immer die hübschere Freundin abgeschleppt.« Er lachte. »Und im Gegensatz zu Charlie habe ich noch alle meine Haare.«
Aha, diese Art Traum war das also. Jetzt tat es mir noch mehr leid, ihn stören zu müssen.
Während Antony sich mit fünf Fingern durch sein volles Haar fuhr, verflüchtigte sich der Triumph aus Charles’ Miene. »Es soll Frauen geben, die Männer mit Glatzen durchaus attraktiv finden«, murmelte er.
»O ja!«, stimmte ich ihm hastig zu. »Lottie zum Beispiel.«
Und meine Mum. Die war schließlich in Charles’ kahlköpfigen Bruder Ernest verliebt. Aber vermutlich nicht wegen der Glatze, sondern einfach nur trotzdem.
»Wer ist Lottie?«, erkundigte sich Antony, und ich war mindestens so gespannt auf die Antwort wie er. Jetzt würde sich zeigen, ob Charles es mit Lottie ernst meinte.
Zumindest lächelte er wieder, als er ihren Namen aussprach. »Lottie wird … was ist das?« Ein hoher Ton, der plötzlich über den Golfplatz schwang, hatte ihn unterbrochen.
Ausgerechnet jetzt. »Für den Wecker ist es jedenfalls noch zu früh«, murmelte ich alarmiert, und als Antony hinzusetzte: »Für mich klingt das eher wie ein Rauchmelder«, drehte ich mich leicht panisch zur Tür um. Wenn Charles jetzt aufwachte, würde der ganze Traum kollabieren und ich ins Nichts stürzen, eine äußerst unangenehme Erfahrung, die ich so schnell nicht noch einmal machen wollte. Während der hohe Ton immer weiter anschwoll und der Himmel bereits von Rissen durchzogen wurde, sprintete ich zurück zur Tür und ergriff die Klinke in genau dem Moment, in dem der Boden unter mir wegzusacken begann. Mit einem großen Schritt rettete ich mich über die Schwelle in den Korridor und zog die Tür hinter mir ins Schloss.
Gerettet. Aber meine Mission war eindeutig gescheitert. Ich war, was Charles’ Gefühle für Lottie anging, genauso schlau wie vorher. Auch wenn er bei der Erwähnung ihres Namens gelächelt hatte.
Foto-Charles begann wieder seinen Zahnputzsong zu singen.
»Ach, halt die Klappe«, schnauzte ich, und Foto-Charles verstummte beleidigt. Und da hörte ich es, mitten in das plötzliche Schweigen hinein: ein vertrautes, unheilvolles Rascheln, nur ein paar Meter entfernt. Obwohl niemand zu sehen war und eine vernünftige Stimme in meinem Kopf sagte, dass das hier sowieso nur ein Traum sei, konnte ich nicht verhindern, dass Angst in mir hochkroch, genauso unheilvoll wie das Rascheln. Ohne genau zu wissen, was ich tat und vor wem ich davonlief, fing ich wieder zu rennen an.
2.
Mein Atem ging so laut, dass ich nichts anderes hören konnte, aber ich war mir sicher, dass das Rascheln mir dicht auf den Fersen war. Und es kam näher. Schwungvoll schlidderte ich um die Ecke in den nächsten Gang, in dem meine Tür lag. Rascheln trifft es auch nicht wirklich, da denkt man eher an eine harmlose Ratte – und dieses Rascheln hier war alles andere als harmlos. Es war das unheimlichste Geräusch, das ich je gehört hatte (und ich hatte es heute eingerechnet schon ein paarmal gehört) – wie von einem Vorhang, der beiseitegezogen wird und hinter dem ein hohlwangiger, irre mit den Augen rollender Kettensägenmörder mit blutüb…
Ich bremste abrupt. Neben meiner Tür wartete nämlich bereits jemand auf mich. Zu meinem Glück kein hohlwangiger Kettensägenmörder, sondern jemand viel Hübscheres.
Henry. Mein Freund seit nunmehr achteinhalb Wochen. Und nicht nur im Traum, sondern auch im echten Leben. (Allerdings schien es mir, dass wir weit mehr Zeit in unseren Träumen miteinander verbrachten als in wachem Zustand.) Er lehnte wie so oft mit dem Rücken an der Wand, hatte seine Arme vor der Brust verschränkt und lächelte. Dieses ganz spezielle Henry-Lächeln, das nur mir galt und mir jedes Mal das Gefühl gab, das glücklichste Mädchen auf der ganzen Welt zu sein. Normalerweise hätte ich zurückgelächelt (mit einem hoffentlich genauso speziellen Liv-Lächeln) und mich in seine Arme geworfen, aber dafür war jetzt keine Zeit.
»Nächtliches Fitnesstraining?«, erkundigte er sich, als ich vor ihm stehen blieb und mit der Faust gegen die Tür hämmerte, anstatt ihn zu küssen. »Oder läufst du vor etwas weg?«
»Erzähl ich dir drinnen!«, keuchte ich, ohne mit dem Hämmern aufzuhören. Die Briefkastenklappe öffnete sich, und jemand schob – quälend langsam – zuerst einen Zettel und dann einen Stift hinaus.
»Das heutige Kennwort bitte aufschreiben, den Zettel korrekt falten und wieder hindurchschieben«, flötete die freundliche Stimme von Mr Wu hinter der Tür.
Ich fluchte leise. Mein Sicherheitssystem war zwar super gegen fremde Eindringlinge, aber nicht besonders gut, wenn man sich selber schnell in Sicherheit bringen wollte.
»Im Traum gibt es wirklich effektivere Methoden als wegzurennen, Liv.« Henry hatte sich gründlich im Gang umgeschaut und trat nun neben mich. »Du kannst einfach wegfliegen oder dich in etwas uneinholbar Schnelles verwandeln. Zum Beispiel in einen Geparden. Oder eine Mondrakete …«
»Es fällt aber nun mal nicht jedem so leicht wie dir, sich zu verwandeln, schon gar nicht in eine doofe Mondrakete!«, fuhr ich ihn an. Der Stift in meiner Hand zitterte ein wenig, aber in Henrys Gegenwart hatte sich meine Angst deutlich gemildert. Kein Rascheln mehr zu hören. Trotzdem war ich sicher, dass wir nicht allein waren. War es nicht dunkler geworden? Und kälter?
»Neulich warst du so eine süße kleine Katze«, sagte Henry, der nichts davon zu merken schien.
Ja, war ich. Aber erstens hatte ich mich gar nicht in eine süße kleine Katze, sondern in einen gefährlichen großen Jaguar verwandeln wollen, und zweitens hatte mich da auch niemand verfolgt, sondern Henry und ich hatten nur zum Spaß ein bisschen herumprobiert. Es war mir ein Rätsel, wie man sich konzentrieren und schnell in etwas verwandeln sollte, wenn man von etwas Furchteinflößendem, Unsichtbarem bedroht wurde und vor Angst mit den Knien schlotterte. Wahrscheinlich war Henry nur so gut in diesem ganzen Verwandlungskram, weil er nie Angst hatte. Auch jetzt grinste er nur sorglos.
Mit zusammengebissenen Zähnen hatte ich endlich »Filzpantoffelpompom« auf den Zettel gekritzelt, ihn zu einem Dreieck zusammengefaltet und wieder durch den Briefkastenschlitz geschoben.
»Ein bisschen schlampig, aber korrekt«, sagte Mr Wu von innen, und die Tür öffnete sich. Ich packte Henry am Arm, zog ihn über die Schwelle und knallte die Tür hinter uns ins Schloss. Dann atmete ich erleichtert auf. Das hatten wir schon mal geschafft.
»Geht es nächstes Mal vielleicht ein bisschen schneller?«, fauchte ich Mr Wu an. (Etwas, das ich mich dem echten Mr Wu gegenüber niemals getraut hätte.)
»Schildkröten können dir mehr über den Weg erzählen als Hasen, Miss Olive.« Mr Wu verneigte sich vor mir (etwas, das der echte Mr Wu niemals getan hätte) und schenkte Henry ein knappes Nicken. »Willkommen in Miss Olives Restaurant der Träume, fremder Junge mit wuscheligen Haaren.«
Wir waren tatsächlich in einer Art Restaurant gelandet, wie ich feststellen musste, einem ziemlich hässlichen Restaurant mit schwarzen Resopal-Tischen, grellroten Tischläufern und von der Decke herabbaumelnden orangefarbenen Lampions. Aber es roch bestechend nach scharf angebratenem Hühnchenfleisch. Jetzt erst merkte ich, wie hungrig ich war. Es war eine dumme Idee gewesen, ohne Abendessen ins Bett zu gehen, denn dann gerieten meine Träume immer leicht außer Kontrolle.
Henry starrte Mr Wu verdutzt an. »Ist der neu?«
»Ich bin heute Nacht hier der Torwächter«, erklärte Mr Wu feierlich. »Man nennt mich Wu, die Tigerpranke, Beschützer der Waisen und Bedürftigen. Gib einem Hungrigen Fisch, und er wird satt. Lehre ihn fischen, und er wird nie mehr Hunger leiden.«
Henry kicherte, und ich merkte, wie ich rot anlief. Meine Träume waren mitunter ein wenig peinlich. Der sprücheklopfende Traum-Mr Wu trug zu allem Überfluss einen schwarzen, glänzenden Seidenpyjama mit einem aufgestickten Tigerkopf, und an seinem Hinterkopf baumelte ein meterlanger Zopf. Sein reales Vorbild, mein erster Kung-Fu-Lehrer in Kalifornien, wäre nicht mal an Halloween so herumgelaufen.
»Na gut«, sagte Henry immer noch kichernd. »Ich hätte dann bitte gern einmal Ente süß-sauer.«
»Vielen Dank, Mr Wu«, sagte ich hastig und wischte Mr Wu und das ganze Restaurant mit einer Handbewegung fort. Stattdessen standen wir nun in dem kleinen Park in den Berkeley Hills in Kalifornien, in den ich Henry im Traum schon ein paarmal mitgenommen hatte, das erstbeste Szenario, das mir in den Sinn gekommen war. Von hier hatte man eine großartige Aussicht bis hinab in die Bucht, über der gerade die Sonne unterging und den Himmel mit spektakulären Farben übergoss.
Henry verzog trotzdem unzufrieden das Gesicht. »In dem Restaurant roch es so verdammt lecker«, sagte er. »Und jetzt knurrt mein Magen.«
»Meiner auch, aber egal, wie viel wir gegessen hätten, wir wären ja doch nicht satt geworden.« Ich ließ mich auf eine Bank fallen. »Das ist schließlich nur ein Traum. Mist, ich hätte Mr Wu noch ein neues Kennwort sagen müssen. Wer weiß, wer mir eben beim Schreiben über die Schulter geguckt hat.«
»Na ich. Fußpilztrüffelpardon ist ein sehr kreatives Passwort.« Lachte Henry etwa schon wieder? »Ich meine, da kommt doch so schnell niemand drauf.«
»Es heißt Filzpantoffelpompom.« Jetzt musste ich aber auch lachen.
»Ehrlich? Du hast echt eine Sauklaue«, sagte Henry und setzte sich neben mich.
»Und jetzt würde ich gerne wissen, wovor du weggelaufen bist. Und warum ich nicht mal einen Begrüßungskuss bekommen habe.«
Sofort wurde ich wieder ernst. »Da war wieder dieses … Rascheln. Hast du es denn nicht gehört?«
Henry schüttelte den Kopf.
»Es war aber da. Eine unsichtbare, bösartige Präsenz.« Ich merkte selber, dass ich mich anhörte, als würde ich aus einem schlechten Gruselroman vorlesen. Sei’s drum. »Ein Rascheln und Wispern, das näher und näher kommt.« Ich schauderte. »Genau wie damals, als es uns verfolgt hat und du uns durch Amys Traumtür gerettet hast.«
»Und wo genau hast du das gehört?« Leider verriet Henrys Miene nicht, was er dachte.
»Im übernächsten Quergang links.« Ich machte eine vage Handbewegung Richtung Meer. »Meinst du, das war Anabel? Sicher ist sie perfekt darin, sich unsichtbar zu machen und böse zu rascheln. Oder es war Arthur. Nichts würde er lieber tun, als mich zu Tode erschrecken.« Und das konnte ich ihm nicht mal verübeln. Schließlich hatte ich Arthur Hamilton vor ziemlich genau achteinhalb Wochen den Kiefer gebrochen. Klingt schrecklich, ich weiß, dazu nur so viel (es wird sonst zu lang und kompliziert): Er hatte es verdient. Besonders viel genutzt hatte es mir in dem Augenblick aber leider nicht. Weil nämlich eigentlich seine Freundin Anabel die Böse in der Geschichte war. Oder vielmehr die Verrückte, wie sich hinterher herausstellte. Politisch korrekt hieß es »akute, polymorphe psychotische Störung mit Symptomen einer Schizophrenie«, weshalb sie jetzt weit weg von London in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt lebte und niemandem mehr etwas tun konnte – außer wenn sie schlief. Anabel war fest davon überzeugt, dass es ein Dämon war, der uns die Fähigkeit verliehen hatte, einander im Traum zu treffen und unsere Träume bewusst zu gestalten, ein ziemlich bösartiger Nachtdämon aus vorchristlichen Zeiten, der nichts weniger als die Weltherrschaft übernehmen wollte. Zu meinem Glück war die Weltherrschaftsübernahme aber rechtzeitig gescheitert, als Anabel mit Arthurs Unterstützung mein Blut dafür vergießen wollte. (Wie gesagt, es ist lang und kompliziert![1]) Der Glaube an den Dämon war ein Teil ihrer Krankheit, und ich war sehr froh darüber, dass dieser Dämon nur in Anabels kranker Phantasie existierte, weil ich grundsätzlich ein Problem mit übersinnlichen Phänomenen hatte und mit Dämonen im Besonderen. Eine wirklich schlüssige Erklärung für diese Traumsache hatte ich allerdings auch nicht. Ich schob es der Einfachheit halber in die Kategorie: »absolut logisch erklärbare psychologisch-naturwissenschaftliche Phänomene, die man leider mit dem derzeitigen Stand der Wissenschaft noch nicht vollständig erklären kann.« Das war doch allemal vernünftiger, als an Dämonen zu glauben. Auch wenn meine Überzeugung bei diesem Rascheln vorhin mal wieder kurz ins Wanken geraten war … Aber das wollte ich Henry gegenüber lieber nicht erwähnen.
Der wartete immer noch darauf, dass ich weiterredete. »Übernächster Quergang links«, wiederholte er. Anabel und Arthur ließ er unerwähnt. Er sprach höchst ungern über die beiden, denn bis vor diesem Ereignis am Abend des Herbstballs vor achteinhalb Wochen hatten sie noch zu seinen besten Freunden gehört. »Und dort warst du, weil …?« Er sah mich fragend an.
»Weil ich da was zu erledigen hatte.« Unbehaglich kratzte ich an meinem Arm und senkte meine Stimme automatisch zu einem Flüstern. »Etwas total Unmoralisches. Ich wollte … nein, ich musste jemanden im Traum ausspionieren.«
»Das ist doch nicht unmoralisch, sondern höchst praktisch«, sagte Henry. »Ich mache das andauernd.«
»Wirklich? Bei wem? Und warum?«
Er zuckte mit den Schultern und blickte kurz zur Seite. »Kann manchmal ganz nützlich sein. Oder unterhaltsam, je nachdem. Und wen wolltest äh … musstest du ausspionieren?«
»Charles Spencer.«
»Graysons langweiligen Zahnarztonkel?« Henry sah ein bisschen enttäuscht aus. »Warum ausgerechnet den?«
Ich seufzte. »Mia« – das war meine kleine Schwester – »hat Charles im Café gesehen, mit einer anderen Frau. Und sie schwört, die beiden hätten verliebte Blicke ausgetauscht und beinahe Händchen gehalten. Ich weiß, Lottie und Charles sind offiziell noch kein Paar, aber er flirtet immer sehr mit ihr, und sie waren schon zweimal zusammen im Kino. Selbst ein Blinder sieht, wie verliebt Lottie in ihn ist, auch wenn sie es nicht zugibt. Sie filzt ihm Pantoffeln zu Weihnachten, das sagt doch schon … grins nicht so blöd! Das ist wirklich ernst. Noch nie war Lottie so euphorisch, was einen Mann angeht, und es wäre schlimm, wenn er nur mit ihr spielt.«
»Entschuldige!« Henry versuchte vergeblich, seine Mundwinkel unter Kontrolle zu bringen. »Immerhin weiß ich jetzt, woher dein Kennwort … schon gut, erzähl weiter.«
»Ich musste dringend herausfinden, was Charles wirklich für Lottie empfindet. Also habe ich ihm seine fiese Trappermütze geklaut und bin heute in seinen Traum geplatzt.« Mir fiel wieder ein, dass ich in ebendiesem Augenblick mit der Mütze in meinem Bett lag – wahrscheinlich waren meine Haare schon ganz verschwitzt. Und vermutlich stellte sich Henry gerade vor, wie ich wohl aussehen mochte mit der Mütze auf meinem Kopf. Gleich würde er garantiert wieder anfangen zu lachen, und ich konnte es ihm nicht mal verdenken.
Aber er erwiderte meinen prüfenden Blick mit einem treuherzigen Augenaufschlag. »Sehr gut. Und wie hast du das angestellt?«
Ich runzelte verständnislos die Stirn. »Na, ich bin durch seine Tür gegangen.«
»Schon klar. Aber als was oder wer?«
»Als ich selber, natürlich. Ich hatte ein Käppi auf, weil der Traum auf einem Golfplatz spielte und ich mich kleidungstechnisch anpassen musste. Gerade hatte ich Charles so weit, dass er etwas über Lottie erzählen wollte, nur genau dann ist sein blöder Feuer…« Erschrocken schlug ich mir die Hand vor den Mund. »Ach du Scheiße! Das habe ich ja ganz vergessen! Der Feuermelder! Er ist losgegangen, und ich hab nur daran gedacht, wie ich schnell aus dem Traum rauskomme, bevor Charles aufwacht. Ich bin wirklich ein schlechter Mensch! Ich hätte aufwachen und die Feuerwehr anrufen müssen.«
Henry schien Charles’ möglicher Wohnungsbrand vollkommen kaltzulassen. Er lächelte mich an und streichelte mit den Fingerspitzen über meine Wange. »Liv, dir ist schon klar, dass Menschen in ihren Träumen nicht zwingend ehrlich sein müssen, oder? Meiner Erfahrung nach fällt den meisten das Lügen im Traum sogar noch leichter als im wirklichen Leben. Wenn du die Wahrheit über jemanden herausfinden willst, nutzt es also gar nichts, einfach nur in seinen Traum hereinzuspazieren und Fragen zu stellen, denn dann antwortet er dir doch haargenau dasselbe, was er dir auch im wachen Zustand sagen würde.«
Das klang natürlich einleuchtend, und um ehrlich zu sein, war mir der Gedanke auch schon gekommen. Im Grunde genommen war ich vollkommen planlos in Charles’ Traum gestolpert, kein bisschen raffiniert, einzig beseelt von dem Gedanken, Lottie zu beschützen. »Aber wie hätte ich es sonst anstellen sollen? Und jetzt sag nicht, ich hätte mich in eine Mondrakete verwandeln müssen.«
»Na ja, am besten ist es immer, wenn sie gar nicht merken, dass man da ist. Als unsichtbarer Zuschauer und Zuhörer erfährt man im Traum ziemlich viel über einen Menschen. Mit etwas Geduld eigentlich sogar alles.«
»Ich will aber gar nicht alles über Charles wissen«, sagte ich und schüttelte mich bei der Vorstellung.[2] »Ich will nur wissen, ob er es mit Lottie ernst meint. Denn wenn er das nicht tut, dann …« Ich ballte meine Hände zu Fäusten. Mia und ich würden auf keinen Fall zulassen, dass jemand Lottie weh tat, schon gar nicht Charles. Mia wollte sie ohnehin viel lieber mit dem gutaussehenden Tierarzt in der Pilgrim’s Lane verkuppeln. »Andererseits – vielleicht ist der arme Charles gerade an einer Rauchvergiftung gestorben, weil ich es versäumt habe, die Feuerwehr zu rufen, und die Sache hat sich ohnehin erledigt.«
»Ich liebe dich«, sagte Henry unvermittelt und zog mich enger an sich heran. Sofort vergaß ich Charles. Henry ging nicht gerade verschwenderisch mit den magischen drei Wörtern um. In den vergangenen achteinhalb Wochen hatte er sie genau dreimal gesagt, und jedes Mal, wenn er es tat, stürzte es mich irgendwie in Verlegenheit. Die einzig richtige, allgemeingültige Erwiderung auf diesen Satz war wohl »Ich liebe dich auch«, aber irgendwie brachte ich das nie über die Lippen. Nicht, weil ich ihn nicht liebte, ganz im Gegenteil, sondern weil »Ich liebe dich auch« lange nicht so viel Gewicht hatte wie ein ganz aus dem Nichts gesprochenes »Ich liebe dich«.
»Obwohl ich mich nicht in eine Mondrakete verwandeln oder unsichtbar machen kann?«, sagte ich also stattdessen.
Henry nickte. »Das wirst du alles noch lernen. Du bist ungeheuer talentiert. In jeder Beziehung.« Dann beugte er sich vor und begann mich zu küssen. Und so wurde es doch noch ein richtig schöner Traum.
Fußnoten
[1]
Die ganze Geschichte kann man nachlesen in »Silber – Das erste Buch der Träume.«.
[2]
Wir erinnern uns: Über 35 Prozent aller Träume handeln von Sex. Igitt.
3.
Der Nachteil an diesen nächtlichen Träumen mit vollem Bewusstsein war, dass man am nächsten Morgen nicht wirklich ausgeschlafen war. Ich hatte aber im Lauf der letzten Monate Methoden entwickelt, den Schlafmangel auszugleichen: eine heiße Dusche, danach literweise kaltes Wasser fürs Gesicht und schließlich einen vierfachen Espresso für den Kreislauf, getarnt mit einer Haube aus geschäumter Milch, damit Lottie mir keinen Vortrag über die Empfindlichkeit von jugendlichen Magenwänden halten musste. Der italienische Kaffeeautomat, der auf Knopfdruck frische Bohnen mahlte und Milch aufschäumte, war einer der Gründe, warum es gar nicht so übel war, im Hause Spencer zu leben. Lottie war zwar der Ansicht, dass man Kaffee frühestens mit achtzehn trinken dürfe, aber für Mum galten solche Altersgrenzen ja nicht mal für Alkohol, Sex und Drogen, deshalb hatte ich unbegrenzten Zugang zu Koffein.
Auf halbem Weg in die Küche traf ich meine kleine Schwester. Sie war mit unserer Hündin Buttercup draußen gewesen und drückte mir ihre eiskalte Hand an die Wange. »Da, fühl mal!«, sagte sie begeistert. »In den Nachrichten haben sie gesagt, es könnte dieses Jahr sogar weiße Weihnachten geben und den kältesten Januar seit elf Jahren … dummerweise habe ich einen Handschuh verloren. Einen von den grauen mit den Tupfen. Du hast ihn nicht zufällig irgendwo gesehen? Das sind nämlich meine Lieblingshandschuhe.«
»Nein, tut mir leid. Hast du in Butters Verstecken nachgeschaut?« Buttercup hatte sich vor mir auf den Boden geworfen und sah so unschuldig und niedlich aus, als würde sie niemals auf die Idee kommen, Handschuhe, Socken und Schuhe zu verschleppen und sie erst wieder herauszurücken, wenn sie völlig zerkaut waren. Ich kraulte ihr ausgiebig den Bauch und redete eine Weile in Babysprache auf sie ein (das liebte sie!), bevor ich mich wieder erhob und hinter Mia her Richtung Küche, genauer gesagt, Richtung Kaffeeautomat trabte. Buttercup folgte mir. Sie hatte es allerdings nicht auf den Kaffee, sondern auf das Roastbeef abgesehen, das Ernest gerade auf den Frühstückstisch stellte.
Wir wohnten jetzt schon beinahe vier Monate in London, in diesem weitläufigen, gemütlichen Backsteinhaus im Stadtteil Hampstead, aber obwohl ich die Stadt sehr mochte und zum ersten Mal seit Jahren ein großes, hübsches Zimmer nur für mich hatte, kam ich mir immer noch ein bisschen wie ein Gast vor.
Vielleicht, weil ich einfach nie gelernt hatte, mich irgendwo zu Hause zu fühlen. Bevor Mum Ernest Spencer kennengelernt und beschlossen hatte, den Rest ihres Lebens mit ihm zu verbringen, war sie mit Mia, Lottie, Buttercup und mir beinahe jedes Jahr umgezogen. Wir hatten in Deutschland gelebt, in Schottland, in Indien, in den Niederlanden, in Südafrika und natürlich in den USA, woher Mum stammte. Unsere Eltern hatten sich scheiden lassen, als ich acht war, aber genau wie Mum neigte auch Papa nicht gerade zur Beständigkeit. Er freute sich immer, wenn seine Firma ihm eine neue Stelle in einem Land anbot, das er noch nicht kannte. Papa war Deutscher, und zurzeit lebten er und seine zwei Koffer (mehr als das, was in zwei Koffer passe, müsse kein Mensch besitzen, pflegte er zu sagen) in Zürich, wo Mia und ich ihn in den Weihnachtsferien besuchen würden.
War es ein Wunder, dass wir uns all die Jahre nichts sehnlicher gewünscht hatten, als irgendwo sesshaft zu werden? Wir hatten immer von einem Haus geträumt, in dem wir bleiben und uns dauerhaft einrichten konnten. Ein Haus mit viel Platz, einem Zimmer für jeden von uns, einem Garten, in dem Buttercup herumtollen konnte, und einen Apfelbaum zum Draufklettern. Jetzt wohnten wir zwar in ziemlich genau so einem Haus (sogar den Kletterbaum gab es, nur war es ein Kirschbaum), aber es war trotzdem nicht dasselbe: Es war eben nicht unser Haus, sondern das von Ernest und seinen beiden Kindern, den siebzehnjährigen Zwillingen Florence und Grayson. Außer ihnen gab es noch einen freundlichen roten Kater namens Spot, und sie alle hatten schon ihr ganzes Leben hier verbracht. Und ganz gleich, wie oft Ernest auch wiederholen mochte, dass sein Haus nun auch unser Haus sei – es fühlte sich nicht so an. Das mochte daran liegen, dass hier nirgendwo Kerben in die Türrahmen geschlagen waren, an denen unsere Namen standen, und dass wir mit der dunklen Stelle im Perserteppich oder der Macke in den Küchenfliesen eben keine Geschichte verknüpfen konnten, weil wir nicht dabei waren, als beim Fondueessen vor sieben Jahren plötzlich eine Serviette brannte oder Florence als Fünfjährige so wütend auf Grayson gewesen war, dass sie eine Sprudelflasche nach ihm geworfen hatte.
Vielleicht brauchte es einfach nur noch ein bisschen Zeit. Aber fest stand, dass wir in der kurzen Zeit noch keine Spuren und Geschichten hinterlassen hatten.
Mum allerdings arbeitete bereits daran. Sie bestand seit jeher sonntagmorgens auf einem ausgiebigen, gemeinsamen Frühstück (früh im wahrsten Sinne des Wortes), ein Brauch, den sie auch gleich bei den Spencers eingeführt hatte, sehr zum Missfallen von Florence und Grayson, vor allem heute. Florence’ Miene nach zu schließen, war sie durchaus wieder in Stimmung, mit einer Sprudelflasche zu werfen. Sie waren nämlich bis halb vier auf einer Party gewesen und gähnten nun in einem fort, Florence hinter vorgehaltener Hand, Grayson ganz ungeniert, begleitet von »Uuuuaaaaaah«-Geräuschen. Immerhin war ich nicht die Einzige, die gegen Müdigkeit ankämpfen musste, allerdings unterschieden sich unsere Methoden, damit umzugehen. Während ich meinen Kaffee schlürfte und darauf wartete, dass das Koffein in meinem Blut ankam, spießte Florence Orangenstückchen auf eine Gabel und führte sie geziert zum Mund. Offensichtlich setzte sie bei Übermüdung auf Vitamin C. Die Schatten unter ihren karamellbraunen Augen würden sicher gleich verschwunden sein, und sie würde makellos wie immer aussehen. Grayson wiederum schaufelte bergeweise Rührei und Toast in sich hinein und hatte keinerlei Schatten unter den Augen vorzuweisen. Wäre das Gähnen nicht gewesen, hätte man ihm die Müdigkeit nicht angemerkt. Allerdings brauchte er dringend eine Rasur.
Mum, Ernest und Lottie strahlten uns alle ausgeschlafen und gutgelaunt an, und da Mum ausnahmsweise vollständig angezogen und frisiert war und nicht, wie sonst gerne am Sonntagmorgen, in einem offenherzigen Negligé (mit wohlgemerkt nichts darunter) am Tisch saß, lächelte ich zurück.
Vielleicht auch, weil Mums Glück irgendwie ansteckend war und alles so heimelig und weihnachtlich wirkte. Die Wintersonne schien durch die girlandengeschmückten Erkerfenster und ließ die roten Papiersterne leuchten, in der Luft lag ein Hauch von gebratener Butter, Orange, Vanille und Zimt (Lottie hatte einen Berg Waffeln gebacken, die mich von der Mitte des Tischs anlachten), und Mia neben mir sah aus wie ein rosenwangiger, bebrillter kleiner Weihnachtsengel.
Allerdings benahm sie sich nicht so.
»Sind wir hier im Zoo oder was?«, fragte sie, als Grayson sich beim Gähnen zum schätzungsweise achten Mal fast seinen Kiefer ausrenkte.
»Ja«, sagte Grayson ungerührt. »Fütterung der Nilpferde. Schieb doch bitte mal die Butter rüber.«
Ich grinste. Grayson war ein weiterer Grund, warum ich es mochte, in diesem Haus zu wohnen, er übertraf sogar noch die Kaffeemaschine. Erstens konnte er mir in Mathe helfen, wenn ich nicht weiterwusste (schließlich war er zwei Klassen über mir), zweitens war er ein wirklich erfreulicher Anblick, sogar wenn er übernächtigt war und gähnte wie ein Nilpferd, und drittens war er … er war einfach nett.
Seine Schwester nicht ganz so.
»Schade, dass Henry gestern schon wieder … keine Zeit hatte«, sagte sie zu mir, und obwohl ihre Stimme vordergründig vor Mitleid nur so triefte, hörte ich genau die Schadenfreude dahinter. Allein schon die Art, wie sie die kleine Kunstpause vor »keine Zeit« eingelegt hatte … »Ihr habt wirklich was verpasst. Wir hatten so viel Spaß. Stimmt’s, Grayson?«
Grayson gab nur einen weiteren Gähnlaut von sich, aber meine Mutter beugte sich sofort vor und musterte mich bekümmert. »Liv, Schätzchen, du bist gestern ohne Abendessen in deinem Zimmer verschwunden. Muss ich mir Sorgen machen?«
Ich öffnete den Mund, um zu antworten, aber Mum sprach einfach weiter. »Normal ist es in deinem Alter jedenfalls nicht, an einem Samstagabend zu Hause rumzuhocken und früh ins Bett zu gehen. Nur weil dein Freund keine Zeit hat, musst du ja nicht wie eine Nonne leben und Partys meiden.«
Durch meine Brille warf ich ihr einen finsteren Blick zu. Das war wieder mal typisch meine Mum. Wir redeten hier von der Geburtstagsparty eines Typs aus der Abschlussklasse, den ich kaum kannte, und ich war ohnehin nur als Henrys Begleitung mit eingeladen gewesen – da wäre ich mir doch mehr als blöd vorgekommen, wenn ich ohne ihn hingegangen wäre. Mal abgesehen davon, dass ich – egal, was Florence auch sagte – vermutlich ohnehin nichts verpasst hatte. Partys waren doch alle gleich: zu viele Menschen auf engem Raum, zu laute Musik und zu wenig zu essen. Man konnte sich nur schreiend unterhalten, irgendwer trank immer zu viel und benahm sich daneben, und wenn man tanzte, bekam man andauernd Ellenbogen in die Rippen gerammt – meine Vorstellung von Spaß sah wirklich anders aus.
»Außerdem …« Mum beugte sich noch ein Stückchen weiter vor. »Außerdem, wenn Henry bei seinen kleinen Geschwistern babysitten muss – was ich natürlich sehr löblich finde –, was spricht dann dagegen, dass du ihm dabei hilfst?«
Damit traf sie dummerweise ziemlich genau ins Schwarze, mitten in meinen wunden Punkt. In den achteinhalb Wochen unserer Beziehung hatte Henry mich oft hier besucht, wir hatten Zeit in meinem Zimmer verbracht, im Park, im Kino, auf Partys, in der Schulbibliothek, im Café um die Ecke[1] und natürlich in unseren Träumen. Aber ich war noch nicht ein einziges Mal bei ihm zu Hause gewesen.
Von Henrys Familie kannte ich nur seine kleine vierjährige Schwester Amy und auch die nur aus dem Traum. Ich wusste, dass er noch einen Bruder hatte, Milo, der zwölf war, aber Henry redete selten über ihn und über seine Eltern so gut wie gar nicht. In letzter Zeit hatte ich mich mehr als einmal gefragt, ob Henry mich möglicherweise mit Absicht von seinem Zuhause fernhielt. Die meisten Fakten über seine Familie hatte ich nicht von ihm, sondern aus Secrecys Blog. Von ihr wusste ich, dass seine Eltern getrennt waren und dass sein Vater schon dreimal verheiratet gewesen war und nun offensichtlich plante, aus einem ehemaligen bulgarischen Unterwäschemodell Ehefrau Nummer vier zu machen. Außer Milo und Amy hatte Henry laut Secrecy noch eine Reihe von älteren Halbgeschwistern.
Mum zwinkerte mir zu, und ich schob meine Gedanken hastig beiseite. Wenn Mum zwinkerte, wurde es meist anzüglich. Und damit peinlich.
»Ich hatte früher immer viel Spaß beim Babysitten. Vor allem, wenn die Babys schliefen.« Sie zwinkerte noch einmal, und nun ließ auch Mia alarmiert ihr Messer sinken. »Besonders gut erinnere ich mich an das Sofa der Millers …«
So viel zur heimeligen Sonntagmorgen-bald-ist-Weihnachten-Stimmung.
»Mu- um!«, sagte Mia scharf, und ich sagte zur gleichen Zeit: »Nicht jetzt!« Das Sofa der Millers kannten wir bereits. Und wir wollten auf keinen Fall, dass Mum am Frühstückstisch erzählte, was sie darauf erlebt hatte. Schon in ihrem eigenen Interesse.
Bevor sie erneut Luft holen konnte (das Schlimme war, dass sie nie nur eine peinliche Geschichte auf Lager hatte, sondern einen nahezu unerschöpflichen Vorrat davon besaß), fügte ich rasch hinzu: »Ich bin gestern zu Hause geblieben, weil ich mich ein bisschen erkältet fühlte. Außerdem hatte ich noch so viel für die Schule zu tun.« Dass ich in geheimer Mission früh ins Bett hatte gehen wollen, und zwar bekleidet mit der unfassbar hässlichen Trappermütze, die ich Charles geklaut hatte, konnte ich ja schlecht sagen. Was wir nachts in unseren Träumen taten, hatten wir natürlich niemandem verraten – vermutlich hätte man es uns ohnehin nicht geglaubt. Und uns gleich mit Anabel in die Psychiatrie gesteckt. Von den Anwesenden wusste nur Grayson von der Traumsache, aber ich war ziemlich sicher, dass er seit den Ereignissen vor achteinhalb Wochen keinen Schritt mehr durch seine Traumtür getan hatte, mehr noch, er glaubte, wir würden uns ebenfalls von den Korridoren fernhalten. Grayson hatte sich nie gut dabei gefühlt, in den Träumen anderer herumzuspazieren, er hielt das Ganze für unheimlich und gefährlich, und er wäre entsetzt gewesen, wenn er gewusst hätte, dass wir es einfach nicht lassen konnten. Und anders als Henry hätte er meine Aktion von gestern Nacht ganz sicher als unmoralisch verurteilt.
Ich hatte meine Haare übrigens zweimal waschen müssen, bevor sie den Schafwollgeruch der Mütze wieder losgeworden waren, aber irgendwas stimmte immer noch nicht mit ihnen. Als Lottie, die sich eine zweite Ladung Rührei geholt hatte, sich wieder auf ihren Platz neben mich setzte, knisterten meine Haare vernehmlich und stellten sich mit einem Schlag auf, um sich dann an Lotties rosa Angorapullover zu schmiegen. Alle fingen nacheinander an zu lachen, sogar ich, nachdem ich einen Blick in den Spiegel über der Anrichte geworfen hatte.
»Wie ein Stachelschwein«, sagte Mia, während ich versuchte, die Haare wieder an den Kopf zu drücken. »Wirklich der reinste Zoo hier heute Morgen. Apropos Zoo: Für wen ist eigentlich das überzählige Gedeck gedacht?« Sie zeigte auf den leeren Teller neben Lottie. »Kommt Onkel Charles auch zum Frühstück?«
Lottie und ich zuckten bei der Erwähnung des Namens gleichermaßen zusammen, sie vermutlich aus Freude, ich eher schuldbewusst. Wie aufs Stichwort hörten wir, wie die Haustür geöffnet wurde, und ich versuchte, mich auf das Schlimmste gefasst zu machen. Der versengte Geruch, der mir plötzlich in die Nase stieg, stammte aber zu meiner Erleichterung nur vom Toastbrot.
Und die energischen Schritte, die den Flur entlangklapperten, gehörten auch gar nicht Charles, sondern jemand anderem. Unverkennbar. Mia stöhnte leise und warf mir einen vielsagenden Blick zu. Ich verdrehte ebenfalls die Augen. Da wäre mir ein angesengter Charles wirklich noch lieber gewesen. Natürlich nur ein ganz leicht angesengter Charles.
Der allerletzte Rest warmer, weihnachtlicher Gefühle schien sich aus dem Raum zu verflüchtigen, und da stand es auch schon im Türrahmen: das Biest in Ocker. Auch »der Teufel mit dem Hermès-Tuch« genannt, mit bürgerlichem Namen Philippa Adelaide Spencer, oder – wie Grayson und Florence zu sagen pflegten – Granny. Ihre Freundinnen vom Bridgeclub nannten sie angeblich »Peachy Pippa«, aber das würde ich erst glauben, wenn ich es mit eigenen Ohren hörte.
»Oh, ihr habt schon ohne mich angefangen, wie ich sehe«, sagte sie anstelle eines Morgengrußes. »Sind das amerikanische Sitten?«
Mia und ich tauschten einen weiteren Blick. Wenn die Haustür nicht offengestanden hatte, dann besaß das Biest in Ocker wohl einen Haustürschlüssel. Beängstigend.
»Du bist ja auch über eine halbe Stunde zu spät, Mutter«, sagte Ernest und stand auf, um sie auf beide Wangen zu küssen.
»Tatsächlich? Welche Uhrzeit hattest du mir denn genannt?«
»Gar keine«, sagte Ernest. »Du hast dich gestern selber eingeladen, weißt du nicht mehr? Du hast auf den Anrufbeantworter gesprochen, dass du um halb zehn zum Frühstück hier sein wirst.«
»Unsinn, von Frühstück habe ich nichts gesagt. Ich habe natürlich schon zu Hause gegessen. Danke, mein Lieber.«
Grayson hatte ihr den (ockerfarbenen) Mantel abgenommen, für dessen Kragen ein Fuchs sein Leben hatte lassen müssen, und Florence strahlte und sagte: »Oh, du hast das« – (ockerfarbene) – »Twinset an, das dir so gut steht, Granny!«
Lottie neben mir hatte ebenfalls versucht, sich zu erheben, aber ich hielt sie eisern am Ärmel ihres Pullovers fest. Das letzte Mal hatte sie vor dem Biest geknickst, und das sollte auf keinen Fall noch einmal vorkommen.
Mrs Spencer senior war eine hochgewachsene, schlanke Frau, die deutlich jünger wirkte als ihre fünfundsiebzig Jahre. Mit ihrer anmutigen, aufrechten Haltung, dem langen Hals, dem eleganten Kurzhaarschnitt und den kühlen, blauen Augen, mit denen sie uns jetzt der Reihe nach musterte, wäre sie die Idealbesetzung für Schneewittchens böse Stiefmutter gewesen – bei einem »Dreißig Jahre später«-Special.
Um das klarzustellen: Wir waren nicht immer so feindselig eingestellt gewesen. Anfangs hatten wir ernsthaft versucht, Ernests Mutter zu mögen oder zumindest Verständnis für sie aufzubringen. Sie war Ende August zu einer dreimonatigen Weltreise auf der Queen Elizabeth aufgebrochen, und als sie Ende November erholt, braungebrannt und mit Souvenirs beladen zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Lieblingssohn sich eine Amerikanerin ins Haus geholt hatte, samt Töchtern, Kindermädchen und Hund. Nachvollziehbar, dass sie erst einmal aus allen Wolken gefallen und vor lauter Überraschung sprachlos gewesen war. Aber leider nicht lange, denn dann hatte sie losgelegt und bis heute nicht aufgehört. Hauptsächlich ging es vor allem darum, Mum mit erstaunlicher Offenheit zu unterstellen, sich als Erbschleicherin zu betätigen und Ernest mit miesen Tricks geangelt zu haben. Meist verband sie damit einen generellen Rundumschlag gegen Amerikaner, die sie für unzivilisiert, dümmlich und eitel hielt. Dass Mum gleich zwei akademische Titel besaß, beeindruckte sie auch nicht weiter, schließlich hatte sie die in den USA erworben und nicht in einem zivilisierten Land. (Die Tatsache, dass Mum als Professorin in Oxford arbeitete, ignorierte sie geflissentlich.) Noch schlimmer als Amerikaner fand Mrs Spencer senior nur noch Deutsche, weil die den Zweiten Weltkrieg angezettelt hatten. Unter anderem. Deshalb hielt sie Mia und mich nicht nur für unzivilisiert, eitel und dümmlich (mütterlicherseits) sondern auch für naturgemäß gemein und hinterhältig (väterlicherseits). Lottie wiederum war, weil ganz und gar deutscher Herkunft, nur gemein und hinterhältig, und unser Hund – nun, Mrs Spencer mochte wohl grundsätzlich keine Tiere, außer gebraten in Soße auf dem Teller. Oder als Pelz um den Hals.
Wir konnten uns noch so sehr bemühen, ihre Ressentiments zu widerlegen und ihre Sympathie zu wecken – es gelang uns einfach nicht. (Okay, sehr bemühen ist vielleicht ein bisschen übertrieben.) Und mittlerweile versuchten wir es auch gar nicht mehr. Wie sagte Lottie immer? Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder hinaus. Oder so ähnlich. Wir waren jedenfalls ein ziemlich angepisster Wald. Zumindest Mia und ich. Mum hoffte immer noch auf eine wundersame Wendung, und Lottie – ach, Lottie war ein hoffnungsloser Fall. Sie glaubte fest an das Gute in den Menschen. Sie glaubte sogar an das Gute im Biest.
Das starrte Lottie jetzt an und sagte gallenbitter: »Für mich bitte nur Tee. Earl Grey. Schwarz mit einem Spritzer Zitrone.«
»Kommt sofort!« Jetzt gab es für Lottie kein Halten mehr, sie sprang auf, und um ein Haar wäre ihr Pullover gerissen, weil ich mich immer noch am Ärmel festkrallte. Grayson sagte zwar »Das kann ich doch auch machen«, aber Lottie schob ihn beiseite. Wir hatten Mrs Spencer schon mehrfach erklärt, dass Lottie nicht unser Dienstmädchen war (außerdem hatte sie sonntags frei), aber unsere Erklärungen hatten ihr partout nicht einleuchten wollen. Sie war der Ansicht, dass jemand, dem man Gehalt bezahlte, nicht gleichzeitig eine Freundin sein konnte.
»In einer richtigen Teetasse, bitte, nicht in einem dieser dickwandigen Becher, aus denen ihr alle euren grässlichen Kaffee trinkt.« Mrs Spencer setzte sich. Wie immer in ihrer Gegenwart hatte ich plötzlich das Gefühl, nicht warm genug angezogen zu sein. Ich sehnte mich nach einer dicken Strickjacke. Und nach noch mehr Kaffee in dickwandigen Tassen.
»Bocker«, flüsterte Mia mir zu.
»Wie bitte?«, flüsterte ich zurück.
»Biest in Ocker ist einfach zu lang. Nennen wir sie Bocker.«
»Einverstanden.« Ich kicherte. Bocker passte ganz hervorragend.
Bocker musterte uns tadelnd (Mum und Florence ebenfalls – Flüstern und Kichern bei Tisch zeugte ja auch wirklich nicht gerade von guter Erziehung), befand dann aber wohl, dass es sich nicht lohnte, das Wort an uns zu richten.
»Grayson, mein Schatz, wo ist denn die liebe kleine Emily?«, erkundigte sie sich stattdessen.
»Mit etwas Glück liegt sie noch in ihrem Bett und schläft.« Grayson machte sich schon wieder über das Rührei her und schmierte sich Toastbrot. Schätzungsweise die siebzehnte Scheibe. Unglaublich, was er in sich hineinstopfen konnte, ohne auch nur ein Gramm Fett anzusetzen. »Die liebe kleine Emily.«
Klang das ein klitzekleines bisschen ironisch? Ich starrte Grayson neugierig an. Emily war seine Freundin, ebenfalls in der Abschlussklasse, Chefredakteurin der Schülerzeitung, preisdekorierte Dressurreiterin und weder lieb noch klein. Das Biest in … äh Bocker hatte Emily aber ganz offensichtlich in ihr Herz geschlossen, sie versäumte niemals, sie lobend zu erwähnen und Grayson für seinen exquisiten Frauengeschmack zu loben, den er ja anscheinend nicht von seinem Vater geerbt hatte.
Jetzt seufzte sie indigniert[2]. »Oh, ich hatte nur gehofft, sie hier zu treffen. Aber heute habt ihr offensichtlich nur das Personal eingeladen.«
Ich sah mich hastig nach Lottie um, aber sie hatte nichts gehört, sie klapperte zu laut mit dem Teegeschirr, in dem Bedürfnis, den perfekten Tee zu bereiten.
»Lottie wohnt hier«, sagte Mia, ohne sich die geringste Mühe zu geben, freundlich zu klingen. »Wo soll sie denn sonst bitte frühstücken?«
Mrs Spencer zog wieder ihre Augenbraue hoch. »Nun, soviel ich weiß, hat meine Enkelin eurem Kindermädchen die Räumlichkeiten unter dem Dach überlassen müssen – da ist nun weiß Gott mehr als genug Platz.«
Ah, das nun wieder.
»Mutter! Das haben wir doch nun wirklich oft genug erörtert. Können wir bitte über etwas anderes reden?« Ernest sah überhaupt nicht mehr glücklich aus. Und Mum klammerte sich am Tischtuch fest, als habe sie Angst, sonst aufzuspringen und wegzurennen.
»Also gut, Themenwechsel: Du musst vorbeikommen und die Batterien in meinen Feuermeldern austauschen, Ernest«, sagte Mrs Spencer senior. »Bei Charles gab es heute mitten in der Nacht einen Alarm, weil die Batterie leer war.« (Oh, gut. Dann lebte er noch!) »Ich würde einen Herzinfarkt erleiden, wenn das bei mir passieren würde.« Sie griff sich demonstrativ ans ockerfarbene Twinset, ungefähr an die Stelle, an der ihr Herzschrittmacher angebracht gewesen wäre, wenn sie denn ein empfindliches Herz gehabt hätte. Was aber nicht der Fall war. Sie war gesund wie ein Ochse.
»Bitte schön.« Lottie stellte die Teetasse vor ihr ab. »Earl Grey, mit einem Spritzer Zitrone.«
»Danke, Miss äh …«
»Wastlhuber.«
»Whastle-whistle«, wiederholte Mrs Spencer.
»Ach, sagen Sie doch einfach Lottie«, sagte Lottie.
Mrs Spencer starrte sie entgeistert an. »Ganz sicher nicht«, sagte sie dann mit Nachdruck und begann, in ihrer Handtasche zu kramen. Vermutlich nach Riechsalz.
»Ach, mach dich locker, Bocker«, reimte Mia leise und auf Deutsch vor sich hin. Von den Spencers verstand niemand Deutsch, deshalb verwendeten wir das manchmal als eine Art Geheimsprache. Nur in Notfällen, natürlich.
Das Bocker ließ ein Stückchen Süßstoff aus ihrer persönlichen Pillendose in den Tee fallen und rührte in der Tasse herum. »Weshalb ich aber eigentlich hier bin … Wie ihr ja wisst, veranstalte ich jedes Jahr im Januar meine kleine Dreikönigs-Teeparty.«
»Klein ist gut«, murmelte Grayson, aber das ging in Florence’ enthusiastischem »Ich liebe, liebe, liebe deinen Dreikönigstee, Granny!« unter. Als ob es sich dabei um die groovigste Veranstaltung aller Zeiten handelte.
Mrs Spencer lächelte schwach. »Nun ja, ich hatte gehofft, es nicht tun zu müssen, aber da meine Freundinnen immer nachfragen und hier offenbar niemand zur Vernunft kommen will« – an dieser Stelle räusperte sie sich und sah Ernest traurig an –, »bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als meine Einladung auf deine neue Entourage auszudehnen, mein Sohn.«
Als niemand reagierte – Mia und ich nicht, weil wir nicht wussten, was Entourage hieß, und überlegten, ob es wohl etwas Abfälliges sein könnte –, setzte sie seufzend hinzu: »Das bedeutet, dass ich mich« – wieder räusperte sie sich, und dieses Mal nahm sie Mum ins Visier –, »dass ich mich sehr freuen würde, dich, liebe Ann, und deine beiden Töchter bei mir begrüßen zu können.«
Es war merkwürdig, aber sie schaffte es, diese Worte wie einen Befehl klingen zu lassen. Und garantiert hatte noch nie ein Mensch bei den Worten »sehr freuen« weniger erfreut ausgesehen als sie.
Ernest fand das wohl auch. »Wenn du …«, begann er mit gerunzelter Stirn, aber Mum fiel ihm ins Wort.
»Das ist so nett von dir, Philippa«, sagte sie warm. »Wir kommen sehr gern, nicht wahr, meine Mädchen?«
Es dauerte ein paar Sekunden, aber weil Mum so hoffnungsvoll dreinschaute, rangen wir uns schließlich ein Lächeln ab und nickten.
Na gut – dann würden wir am Dreikönigstag eben zu einer englischen Teeparty gehen und uns von alten Damen neugierig anstarren lassen. Wir hatten schon Schlimmeres erlebt.
Mrs Spencer nippte zufrieden an ihrem Tee. Ganz sicher hätte sie sich verschluckt, wenn sie gewusst hätte, dass der Dreikönigstag Mr Snuggles Todestag sein würde und sie soeben seine Mörder zu sich nach Hause eingeladen hatte. Die wiederum hatten nicht den geringsten Schimmer, wer Mr Snuggles überhaupt war. Vollkommen ahnungslos griffen wir nach den Zimtwaffeln.
25. Dezember