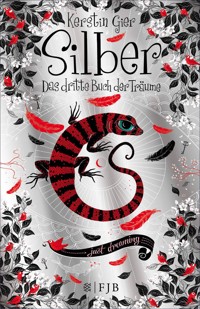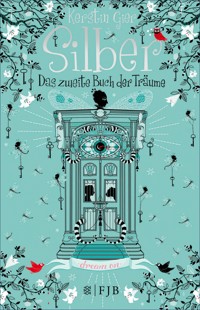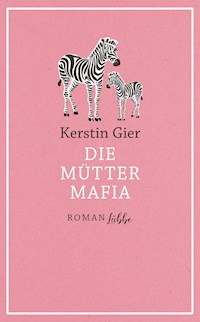9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mütter-Mafia
- Sprache: Deutsch
Was macht Frauen glücklich? Mit der Boutique Pumps und Pomps kann sich die MÜTTER-MAFIA, die kreative Gegenbewegung zu allen Super-Muttis, bald alle Träume selbst erfüllen. Hier gibt es nicht nur traumhafte Stilettos, wunderschöne Stiefel und köstlichen Cappuccino, sondern auch die besten Tipps in Herzensangelegenheiten. Und die kann Constanze, genannt DIE PATIN, selber gut gebrauchen. Denn die Zukunftspläne ihrer ganz großen Liebe Anton passen leider so gar nicht zu ihren eigenen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Nachwort
Über die Autorin
Kerstin Gier, Jahrgang 1966, lebt mit ihrer Familie in einem Dorf in der Nähe von Bergisch Gladbach. Sie schreibt mit großem Erfolg Romane. Ihr Erstling MÄNNER UND ANDERE KATASTROPHEN wurde mit Heike Makatsch in der Hauptrolle verfilmt. EIN UNMORALISCHES SONDERANGEBOT wurde 2005 mit der »DeLiA« für den besten deutschsprachigen Liebesroman ausgezeichnet. FÜR JEDE LÖSUNG EIN PROBLEM wurde ein Bestseller und mit enthusiastischen Kritiken bedacht.
Der vorliegende Roman ist – nach DIE MÜTTER-MAFIA und DIE PATIN − der dritte Band der so genannten »Mütter-Mafia-Romane«.
Kerstin Gier
Gegensätzeziehen sich aus
Roman
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Copyright © 2008 und 2024 by Kerstin Gier und Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Covergestaltung: Kristin Pang unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock (Piyapong89; Romanova Ekaterina)
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-0070-0
luebbe.de
lesejury.de
Eva, dieses Buch ist für dich.
Freundinnen sind wie Schuhe: Man denkt, man kann nicht genug davon haben, aber letztendlich sind es immer die gleichen, mit denen man sich wohl fühlt.
1. Kapitel
Anton wollte meine Eltern kennen lernen. Und nicht nur das. Er wollte auch, dass seine Eltern meine Eltern kennen lernten.
Als ob es mit uns nicht schon kompliziert genug wäre: zwei Haushalte, zwei Ex-Ehepartner, zwei Kinder und ein Teufelsbraten.
»Ich habe endlich die Antwort auf die Frage gefunden, was Frauen glücklich macht«, sagte meine Freundin Trudi. »Und es ist nicht tantrischer Sex.«
»Nicht?«, sagte ich zerstreut. Genau genommen waren es sogar vier Kinder, zwei von mir, zwei von Anton, aber seine ältere Tochter lebte bei seiner Exfrau in England.
Der Teufelsbraten war seine jüngere Tochter, Emily.
Vorgestern Abend hatte mir mein Sohn Julius beim Gute-Nacht-Sagen die Arme ganz fest um den Hals gelegt und in mein Ohr geflüstert: »Du, Mami, kannst du den Orca-Sarg nicht noch mal umtauschen?«
Mir war ein kleines bisschen das Herz stehen geblieben. Hatte er wirklich »Sarg« geflüstert?
»Orca – was?«, fragte ich und strich ihm die hellblonden Locken aus der Stirn.
»Ich will lieber einen Delphin-Sarg, bitte«, sagte Julius. »Wenn du ihn noch umtauschen kannst.«
»Aber Krümelchen, warum willst du denn einen Sarg haben?«, fragte ich entgeistert.
»Weil mein Gehirn schrumpft und ich bald sterben muss«, sagte Julius.
»Wie kommst du denn bloß auf so eine Idee?«, rief ich aus. Alle Härchen auf meinen Armen hatten sich aufgerichtet.
»Emily hat es mir verraten«, sagte Julius.
Es dauerte ein Weilchen, bis ich begriffen hatte, was passiert war: Emily hatte Julius eingeredet, er leide unter einer unheilbaren Krankheit und wir würden bereits hinter seinem Rücken seine Beerdigung vorbereiten. Drei Tage lang war Julius mit seinem vermeintlich schrumpfenden Gehirn umhergegangen und hatte sich Sorgen über den Tod gemacht. Es war nicht einfach, ihn davon zu überzeugen, dass er ein vollkommen gesunder Vierjähriger war und, so Gott wollte, noch ein langes und erfülltes Leben vor sich hatte.
»Das war gemein und sehr grausam von dir«, sagte ich zu Emily, als Anton sie am Abend zum Essen mitbrachte. Ich hätte sie gern geschüttelt und gerüttelt, aber das tat ich natürlich nicht. Schließlich war sie erst sechs Jahre alt und ein ausgesprochen zierliches Kind mit schmalen Schultern.
»Das war doch nur ein Spiel«, sagte sie und sah mir dabei direkt in die Augen. Sie hatte wunderschöne mandelförmige Augen, die sie von ihrer Mama geerbt hatte. Antons Exfrau hatte eine interessante Erbmasse: Zur einen Hälfte thailändische Prinzessin, zur anderen Hälfte schottischer Geldadel. Oder umgekehrt, halb thailändischer Geldadel, halb schottische Prinzessin, das wusste ich nicht mehr so genau.
»Kein sehr lustiges Spiel«, sagte Anton streng. »Julius hat das sehr ernst genommen.«
Emily sah mir immer noch in die Augen. Ihre waren so schwarz, dass man nicht erkennen konnte, wo die Pupillen aufhörten und die Iris anfing. Ich bemühte mich, ohne Blinzeln zurückzuschauen, weil es sicher fatal gewesen wäre, Emily merken zu lassen, dass ich mich vor ihr fürchtete.
»Es tut mir leid«, sagte Emily schließlich. Es klang aufrichtig.
Anton lächelte mir zu. Für ihn war die Sache damit erledigt.
Für mich nicht. Denn als Anton nach dem Essen auf die Toilette ging, sagte Emily unvermittelt: »Ich will dich nicht. Ich werde dich wegmachen. Die anderen habe ich auch weggemacht.«
Möglicherweise war es ja lächerlich, aber ich nahm ihre Drohung ernst. Nach der Trennung von Emilys Mutter hatte Anton, wie meine Freundin Mimi es ausdrückte, »nichts anbrennen lassen«. Und wo waren meine Vorgängerinnen alle hin? Sie waren weg. Weggemacht.
Ich wollte nicht, dass Emily das auch mit mir machte. Anton war das Beste, was mir in Sachen Mann jemals untergekommen war. Er war freundlich und klug, großzügig und witzig, und Sex mit ihm war einfach phänomenal gut.
Ich liebte Anton.
»Was also macht Frauen glücklich?«, fragte Trudi.
»Zu lieben und geliebt zu werden«, sagte ich inbrünstig. Wie in diesem Song aus »Moulin rouge«: The greatest thing you’ll ever learn, is just to love and be loved in return.
»Ach nein«, sagte Trudi. »Viel einfacher!«
Ich wusste nicht, ob Anton mich genauso liebte wie ich ihn, aber er schien mich ganz offensichtlich für die nächsten zwanzig, dreißig Jahre in seinem Leben fest mit eingeplant zu haben. Obwohl wir erst ein paar Wochen zusammen waren, sagte er ständig so Sachen wie: »Für nächsten Sommer werden wir uns ein Wohnmobil ausleihen und durch Kanada touren.«
Oder: »Wenn die Kinder größer sind, können wir an den Coq au vin auch wirklich mal Wein machen.«
Oder eben: »Wann lerne ich denn endlich mal deine Eltern kennen?«
»Am liebsten gar nicht«, murmelte ich, aber das hörte Anton nicht.
»Meine Eltern sind auch schon ganz neugierig auf deine Eltern«, sagte er.
Das glaubte ich ihm sofort.
Ich konnte mir gut vorstellen, wie seine Mutter sich den Burberry-Rock unter dem Kaschmir-Ensemble glatt strich und sagte: »Nun, lieber Anton, wenn es dir ernst ist mit Constanze, dann wird es wohl langsam Zeit, dass wir ihre Eltern kennen lernen. Es ist immer gut zu wissen, aus welchem Stall man kommt, nicht wahr?«
Im Fall meiner Eltern konnte man das mit dem Stall wörtlich nehmen: Sie kamen direkt aus unserem Kuhstall auf der Nordseeinsel Pellworm. In meiner Ahnenreihe hielt man vergeblich nach königlichem Blut und Geldadel Ausschau, dafür fand man jede Menge schlaue nordfriesische Milchbauern mit mehrfach prämierten Kühen.
Aber nicht, dass wir uns falsch verstehen: Mir waren weder meine Eltern noch meine Ahnen, noch die Kühe peinlich. Es war vielmehr umgekehrt. Aus irgendwelchen Gründen hielten meine Eltern nicht besonders viel von mir, und zum Beweis für meine angeborene Unfähigkeit kramten sie ständig Geschichten aus meiner Kindheit hervor, in denen ich keine besonders gute Figur machte.
»Ihr Bruder konnte noch vor ihr Rad fahren, dabei ist er drei Jahre jünger!«
»Wochenlang roch das Kind noch nach Jauche, besonders bei Regenwetter.«
»Warum sie die Straßenlaterne angeleckt hat, ist mir bis heute schleierhaft. Wir hatten minus elf Grad, und es dauerte eine Ewigkeit, bis wir genug Kabel für den Föhn zusammenhatten …«
Außer diesen Geschichten wussten meine Eltern natürlich auch, dass einige der Dinge, die ich Anton in Anfällen geistiger Umnachtung über mich erzählt hatte, definitiv nicht stimmten. Und sie würden mich garantiert auffliegen lassen. Denn ich hatte niemals in den Ferien als Rettungsschwimmerin gejobbt, noch war ich schleswig-holsteinische Vize-Jugendmeisterin im Schach gewesen, noch hatte ich jemals in einer Band gesungen.
Ich hörte meine Mutter schon lachen: »Constanze und singen? Da ist ja unsere Berta musikalischer.« Berta war eine Kuh.
Ich wusste gar nicht so genau, wie es überhaupt hatte passieren können, dass ich Anton so was über mich erzählt hatte. Es war sozusagen im Affekt geschehen, als ich das dringende Bedürfnis gehabt hatte, Emily zu beeindrucken. Außerdem neigte ich dazu, ganz spontan Lügengeschichten zu erfinden, das war beinahe wie ein angeborener Reflex. Bis jetzt war ich aber noch nicht dazu gekommen, Anton dieses seltsame Phänomen zu erklären. So glaubte er zum Beispiel wirklich, ich hätte mein Psychologiestudium bis zum Diplom durchgezogen und wäre eine großartige Schwimmerin. Aber das einzig Positive, das ich über meine Schwimmkünste sagen konnte, war, dass ich im Badeanzug ziemlich gut aussah, jedenfalls, solange ich nicht schwamm. Das Psychologiestudium hatte ich wirklich bis zum Diplom durchgezogen, aber dann auf die Prüfungen und die Diplomarbeit verzichtet. Nicht, dass ich bei Anton das Gegenteil behauptet hätte, aber er nahm aus irgendwelchen Gründen wie selbstverständlich an, dass »Ich habe Psychologie studiert« dasselbe war wie »Ich bin Diplompsychologin«. Ich wartete immer noch auf eine gute Gelegenheit, ihm die Wahrheit schonend beizubringen, ohne dabei wie eine notorische Lügnerin dazustehen.
Ich wartete auch noch auf eine gute Gelegenheit, meinen Eltern von Anton zu erzählen, um ehrlich zu sein. Julius hatte es bereits versucht. Er hatte meiner Mutter am Telefon gesagt, dass er mit Anton eine ganz tolle Raumstation aus »Lego« gebaut habe. Aber da hatte ich ihm auch schon den Hörer aus der Hand gerissen.
»Ist Anton Julius’ neuer kleiner Freund?«, hatte meine Mutter gefragt, und ich hatte geantwortet: »Also, klein ist er nicht gerade.« Und dann war ich ganz schnell auf das Wetter zu sprechen gekommen, darüber sprach meine Mutter mit mir ohnehin am liebsten. Über das Wetter und über das Raucherbein von Tante Gerti.
»Was macht Frauen glücklich?«, fragte Trudi wieder, diesmal ein bisschen ungeduldiger.
»Die, ähm, Kraft der positiven Gedanken?«, schlug ich vor, denn Trudi war eine glühende Anhängerin esoterischer Ideen. Auf meinem Nachttisch stapelten sich die Bücher, die sie mir ständig aufdrängte: Bestellungen beim Universum, Magische Alltags-Rituale zur Verbesserung des Karmas, Transzendenz durch Schamanismus, Erfolgreich durch Selbstbetrug und so weiter und so fort. »Die Fähigkeit, alles in rosarotem Licht zu sehen?«
Anton besaß diese Fähigkeit. Er war offensichtlich felsenfest davon überzeugt, dass sich die Probleme mit Emily von ganz allein geben würden.
»Sie muss sich nur erst an die neue Situation gewöhnen«, meinte er. »In ein paar Wochen seid ihr beste Freundinnen. Sie wird dich dann genauso gern mögen wie du sie.«
Das Problem war, dass ich Emily leider kein bisschen mochte. Ich versuchte es, aber es gelang mir einfach nicht. Natürlich konnte ich das Anton unmöglich sagen.
»Nein«, sagte Trudi und strahlte mich an. Offensichtlich hatte sie beschlossen, mich nicht länger auf die Folter zu spannen. »Es sind – Schuhe!«
»Schuhe? Mit irgendwelchen Magnetsohlen, die die Erdstrahlen absorbieren?«
»Quatsch«, sagte Trudi. »Einfach schicke Schuhe. Schuhe machen Frauen glücklich.«
»Ach.« Unwillkürlich sah ich hinab auf meine neuen schwarzen Slipper mit der verschnörkelten silbernen Schnalle. Ich hatte schon vier Paar schwarze Schuhe, aber dieses hier hatte mich aus dem Schaufenster heraus so freundlich angelacht …
»Es ist wahr«, sagte Trudi. »Durch tolle Schuhe wird jede Frau zu einem vollkommenen Menschen, vollkommen und glücklich.«
Na ja. Das war vielleicht ein bisschen banal, aber es war was Wahres dran. Schickt eine schlecht gelaunte Frau mit einem Zweihundert-Euro-Schein in ein Schuhgeschäft, und sie kommt garantiert gut gelaunt wieder heraus.
»Wenn man die Welt also wirklich verbessern will, sollte man einen Schuhladen aufmachen«, sagte Trudi.
»Das ist nicht mal eine schlechte Idee«, sagte ich. »Allein schon wegen der Prozente, die man in seinem eigenen Laden kriegen könnte.«
Trudi umarmte mich. »Dann ist es also abgemacht: Die Mütter-Mafia eröffnet einen Schuhladen in der Insektensiedlung.«
»Äh«, sagte ich.
»Ich habe die Idee, du hast das Geld, und Mimi hat das Knowhow. Anne kann vielleicht nach der Geburt des Babys als Teilzeitverkäuferin einsteigen, wenn sie will.«
Ich war wie immer vollkommen überrumpelt von Trudis enormem Tempo, aber schlau genug, um nicht sofort einen Haufen Gegenargumente aus der Tasche zu ziehen. Bemerkungen wie »Meinst du nicht, du bist ein wenig voreilig?«, brachten Trudi regelmäßig auf die Palme.
»Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das Universum uns einen passenden Laden schickt«, sagte sie.
»Ja, genau«, sagte ich. Bis das Universum das tat, würde Trudi längst wieder eine neue, weltbewegende Idee haben, für die sie mich als Investor vorgesehen hatte, da war ich mir ganz sicher. Ich musste aber zugeben, dass ein Schuhladen die bisher beste Idee war, viel besser als ein »Tempel des Lichts«, ein »Bio-Danza-Zentrum« oder eine Praxis für »Chakrenstimmulation durch Edelsteine«.
Ich hatte übrigens wirklich relativ viel Geld, und das einfach nur, weil ich mich hatte scheiden lassen. Mein Exmann Lorenz war nicht nur ein recht gut verdienender Oberstaatsanwalt, sondern hatte auch noch diverse kinderlose Verwandte sowie seine Eltern beerbt. Zwei der Onkels waren so nett gewesen, mich in ihrem Testament zu berücksichtigen, und Lorenz hatte mit dem vielen Geld an der Börse spekuliert – alles während unserer sogenannten »Zugewinngemeinschaft«. Hatte man selber kein Erbe zu erwarten, weil die sechzig Milchkühe mitsamt dem Hof und den Ferienwohnungen bereits dem kleinen Bruder überschrieben worden waren, war »Zugewinngemeinschaft« das Wort der Stunde, ganz im Gegensatz zu »Gütertrennung«. Ich konnte »Zugewinngemeinschaft« wirklich wärmstens weiterempfehlen, vor allem, wenn der Ehemann was von Aktien verstand. Und Anton konnte ich natürlich auch empfehlen, er war mein Scheidungsanwalt und hatte mir nicht nur die Hälfte des Zugewinns gesichert, sondern auch noch eine stattliche Summe von etwas, das sich »Versorgungsausgleich« nannte. Nelly und Julius, unsere Kinder, hatte ich mitnehmen dürfen, da war mein Exmann viel großzügiger gewesen als mit seinen Investmentfonds. Das mochte daran gelegen haben, dass er bereits einige Monate vor unserer Trennung ein umwerfend schönes und auch noch intelligentes Fotomodell namens Paris (sprich: »Pärris«) kennen gelernt hatte und von einem Leben träumte, in dem ein Kleinkind und eine pubertierende Tochter nur störten.
Natürlich war ich am Boden zerstört gewesen, als Lorenz mich abservierte, aber mittlerweile war mir klar, dass es das Beste war, was mir passieren konnte. Dank Lorenz hatte ich ein neues Leben, ein neues Haus, neue Nachbarn, neue Freundinnen – und Anton.
Lorenz hatte Paris, das umwerfend schöne und intelligente Fotomodell, und hätte auch glücklich und zufrieden sein müssen. Aber seit Paris mit Zwillingen schwanger war, hatte ich den Eindruck, dass er ein wenig mit seinem Schicksal haderte. Er war uns ja gerade erst losgeworden, um ein Leben ohne Verantwortung und voller Spontaneität, Spaß und Sportwagen zu führen. Mit Zwillingsbabys konnte er das für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre getrost vergessen. Eine gewisse Schadenfreude konnte ich mir daher manchmal nicht verkneifen.
Aber auch in meinem neuen Leben gab es ja durchaus den ein oder anderen Wermutstropfen.
Emily. Meine Eltern. Golf.
Nein, das ist kein Druckfehler, ich meinte wirklich Golf, nicht Rolf oder Wolf, die vielleicht bei anderen Leuten für Probleme sorgen. In Antons Familie spielten alle Golf. Und alle Freunde und Bekannte von Anton spielten ebenfalls Golf. Sogar Emily spielte Golf, mit ganz niedlichen kleinen Schlägerchen, Handschühchen und einer putzigen karierten Schirmmütze.
Anton war überzeugt davon, dass allen Menschen, die nicht Golf spielten, ein grundlegendes Element zu einem erfüllten Leben fehlte, und deshalb hatte er mir einen Schnupperkurs in seinem Golfclub geschenkt. Ich hatte mir sofort eine putzige karierte Schirmmütze gekauft mit dazu passenden Hosen. Aber das hatte nichts genutzt: Von allen Teilnehmern war ich mit Abstand die talentfreiste gewesen. Die einzige, der sich die Regeln nicht erschlossen hatten. Die einzige mit karierten Hosen. Und die einzige, die dem Trainer den Golfschläger in die Kniekehlen gedonnert hatte. Aus Versehen natürlich, auch wenn er das nicht zu glauben schien.
»Und? Hat es Spaß gemacht?«, hatte Anton mich gefragt, als ich nach Hause gekommen war.
Die korrekte Antwort wäre »Nein« gewesen. Aber ich brachte es einfach nicht übers Herz, Anton zu enttäuschen. Außerdem wollte ich nicht undankbar wirken. Also lächelte ich und sagte, dass ich es toll gefunden hätte.
Das war ein dummer Fehler gewesen. Denn jetzt hatte Anton mich für einen weiteren Kurs angemeldet: Zur Platzreife in nur vierzehn Trainings-Tagen.
Aber niemand konnte mir Schwarzseherei nachsagen: Ich hatte mir von meiner Freundin Mimi jede Menge Schläger geliehen und ein Buch mit dem Titel »Golf für Dummies« bestellt. Und ein Paar hübsche Golfschuhe. Aus Liebe zu Anton würde ich mich da schon durchbeißen.
Das Unangenehme an den Elternabenden im Kindergarten ist, dass man stundenlang auf den winzig kleinen Stühlchen der Kinder sitzen muss. Wenn man wie ich einen Meter achtzig groß ist und Beine hat, die einem bis unter die Achseln reichen, ist es besonders schwierig, eine bequeme und dennoch schickliche Position zu finden. Da ich keinen Bandscheibenvorfall erleiden wollte, blieb mir nichts anderes übrig, als meine Riesenfüße bis in die Kreismitte vorzuschieben, wodurch alle Anwesenden ausgiebig Gelegenheit hatten, meine neuen Schuhe zu bewundern. Wirklich hübsche Schuhe erkennt man übrigens daran, dass sie auch noch in Größe 42 gut aussehen.
»Hallo«, sagte ich zu der Mutter links neben mir. »Ich bin Constanze. Die Mutter von Julius.«
»Hallo«, sagte die Frau und lächelte mich an. Sie hatte es geschafft, ihre Beine elegant übereinanderzuschlagen. »Ich bin die Mami von Dennis, dem mit dem Toff-Tog-Klamotten.«
»Ach, Dennis ist doch der, der immer alle beißt«, erwiderte ich. Julius und sein Freund Jasper berichteten mir täglich von Dennis’ Beißattacken. Er biss nicht nur die Kinder und die Erzieherinnen, sondern auch in die Tischplatte und die Wassergläser, und das fanden die Kinder komisch.
Dennis’ Mutter stellte abrupt das Lächeln ein. »Das macht er nur, weil er sich nicht anders ausdrücken kann«, fauchte sie und drehte sich beleidigt weg.
Ach herrje, ich hatte sie doch gar nicht beleidigen wollen. Ich hatte nicht mal die Absicht, ihr Vorwürfe zu machen, weil ihr kleiner Toff Tog (mangels anderer Ausdrucksmöglichkeiten, wie ich ja jetzt wusste) meinem Sohn das halbe Ohr abgebissen hatte. Ich meine, so was kommt halt vor unter Kindern. Aber vielleicht sollte ich nachher mal anregen, dass die Erzieherinnen bedürftigen Kindern wie Dennis ein paar saftige Schimpfwörter beibrachten, damit sie nicht mehr gezwungen waren zu beißen.
»Und jetzt, liebe Kinder, lockern wir mal unsere Unterkiefer und rufen alle zusammen: Blö-der Af-fen-arsch! Ja, toll, das könnt ihr doch schon sehr gut. Und noch einmal alle: Blö …«
»Zu Punkt eins«, sagte Frau Siebeck, und die Hälfte der Anwesenden seufzte tief. Wie immer, wenn ein neues Kindergartenjahr begonnen hatte, stand die »Getränkefrage« auf der Tagesordnung. Die neuen Eltern wurden darüber informiert, dass es ganz und gar verboten war, dem Kind Flüssiges von zu Hause mitzugeben, erst recht dann, wenn es sich um Apfelsaft handelte.
»Die Kinder bekommen hier ungesüßten Früchtetee oder Wasser so viel sie wollen«, sagte Frau Siebeck. »Es ist nicht gut für das Gemeinschaftsgefühl, wenn jedes Kind etwas anderes in einer eigenen Trinkflasche mitbringt.«
Es entspann sich die übliche Diskussion darüber, ob man, um drohender Dehydrierung entgegenzuwirken, der armen, den Geschmack von purem Wasser nun mal seit der Geburt verabscheuenden Ella nicht wenigstens Apfelschorle anbieten könne, wenn sie verspräche, immer direkt die Zähne zu putzen, und dass Kombucha-Getränke nachweislich die Konzentration förderten, während man so etwas von Früchtetee noch nie gehört habe, und so weiter und so weiter.
Meine Freundin Anne, die Mutter von Julius’ Freund Jasper, grinste mir von der gegenüberliegenden Seite des Stuhlkreises aus zu und verdrehte die Augen. Sie trug wie immer ausgebeulte Jeans, und auf ihrem T-Shirt prangte ein heller Fleck, vermutlich Zahnpasta. Ihre braunen Locken hatte sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden, und sie war ungeschminkt. Das heißt, am Morgen hatte sie sicher Wimperntusche aufgetragen, diese aber im Laufe des Tages rund um die Augen verteilt, bis nur noch ein schwacher, dunkelgrauer Schatten zu sehen war. Im Kontrast zu ihrer extrem nachlässigen Aufmachung registrierte ich aber ein Paar brandneue silberne Riemchensandaletten mit einem anmutigen Absatz.
»Apfelschorle enthält jede Menge Calcium«, sagte Ellas Mutter. »Was wiederum sehr wichtig für Ellas Knochenwachstum ist.«
Frau Siebeck sagte, dass es Ella und den anderen Kindern freistünde, am Nachmittag so viel Apfelschorle und Kombucha-Getränke zu sich zu nehmen, wie sie wollten, und Frauke WernerKröllmann, die Vorsitzende des Elternrates, sagte: »Der Früchtetee ist aus biologisch-dynamischem Anbau.«
Das schien Ellas Mutter und den Mann, der für die Einführung von Kombucha plädiert hatte, ein wenig zu besänftigen.
»Aber Elton mag nur Capri-Sonne«, sagte eine Frau, deren Popo ein wenig zu groß für das Kinderstühlchen war.
Ein Raunen ging durch die versammelte Elternschaft. Hatte die Frau wirklich Capri-Sonne gesagt? Frauke Werner-Kröllmann griff sich an ihren kugelrunden Bauch, gut möglich, dass der Schock über das Gehörte vorzeitige Wehen ausgelöst hatte. Selbst Frau Siebeck schien den Faden verloren zu haben. Capri-Sonne – das war in all den Jahren noch nie vorgekommen.
Schweigen dehnte sich im Raum aus, und die Elton-Mutter rutschte unruhig auf ihrem Stühlchen hin und her.
»Dann wird Elton eben lernen, etwas anderes als Capri-Sonne zu trinken«, sagte die Frau, die rechts neben mir saß, in energischem Tonfall. »Und ich wäre sehr dankbar, wenn wir nun endlich zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen könnten, denn ich habe nur bis halb zehn einen Babysitter.«
»Aber …«, sagte Eltons Mutter.
Meine energische Nachbarin fiel ihr ins Wort: »Kein aber! Capri-Sonne ist schlecht für die Zähne, also seien Sie froh, dass das Kind hier im Kindergarten die Gelegenheit hat, seine schlechte Angewohnheit abzulegen. Wenn wir jetzt bitte fortfahren dürften!«
Eltons Mutter schlug eingeschüchtert die Augen nieder, und der Kombucha-Mann klatschte Beifall. Auch ich war schwer beeindruckt.
Während Frau Siebeck über das anstehende Herbstfest redete und nach Freiwilligen für den Ausschank der Kürbissuppe fragte, beugte ich mich zu meiner Nachbarin hinüber.
»Das haben Sie gut gemacht«, sagte ich. »Normalerweise dauert die Getränkediskussion bis nach neun. Und dann geht das Gleiche noch mal mit den Brotbelägen los, und die Elternschaft teilt sich in Gegner und Befürworter der Bärchenwurst.«
Die Frau schnaubte durch ihre Zähne. »Mit solchen Diskussionen verschwendet man nur meine kostbare Zeit. Ich bin für klare Ansagen und das Einhalten von Regeln.« Sie streckte mir ziemlich zackig ihre Hand hin. »Gestatten: Hitler!«
Ich kicherte. Humor hatte sie auch noch. Die Frau gefiel mir.
Herzhaft schüttelte ich ihre Hand. »Freut mich. Mussolini mein Name! Auch ich bin für das totalitäre Regime.«
»Wie bitte?« In den Augen der Frau las ich Verwirrung. Und als Frau Siebeck im gleichen Augenblick fragte: »Frau Bauer, Frau Hittler, möchte eine von Ihnen den Kuchenstand übernehmen?«, wusste ich auch, warum.
Herrje! Die arme Frau hieß wirklich Hitler. Wie blöd von mir. Über so einen Namen machte doch niemand Scherze. Hittler mit zwei t, wie ich später auf der Anwesenheitsliste las.
Vor lauter Schreck verpflichtete ich mich, den Kuchenstand zu übernehmen, und starrte den Rest des Abends peinlich berührt vor mich hin. Weder die Mama von Dennis dem Beißer noch Frau Hittler würdigten mich mehr eines Blickes.
Vor der Kindergartentür schüttelte ich meine steifen Beine und suchte in meiner Tasche nach dem Schlüssel für das Fahrradschloss.
»Das hätten wir überstanden«, sagte Anne.
»Ja«, sagte ich. »Und zwar in Rekordzeit. Dank Hittler.« Frau Hittler unterhielt sich auf dem Parkplatz mit Frauke Werner-Kröllmann. Sie waren beide mit dem gleichen silber-metallicfarbenen Familien-Van gekommen, die sich nur durch den Aufkleber mit der Aufschrift »Muttermilch – die Wissenschaft kennt nichts Besseres« unterscheiden ließen, der auf Fraukes Auto pappte.
Anne erriet, was ich dachte. »Ich wette mit dir, dass sie Hittler ganz schnell in ihren obskuren Verein aufnehmen«, sagte sie. Sie meinte die »Mütter-Society«, das Netzwerk, dem Frauke vorstand.
Unsere Mitgliedschaft hatten sie übrigens abgelehnt. Also hatten wir einen eigenen Club gegründet: die streng geheime Mütter-Mafia. Wir hatten keine Clubsatzung, nur ein Motto: »Einer für alle, alle für einen.« Man musste nicht mal Kinder haben, um Mitglied bei der Mütter-Mafia zu werden: Mimi und Trudi waren kinderlos. Trudi wollte keine bekommen, und Mimi konnte keine bekommen. Anne hatte zwei Kinder, Jasper, der Julius’ bester Freund war, und den vierzehnjährigen Max, der in die Parallelklasse meiner Tochter Nelly ging. Wie ich hatte auch Anne sich von ihrem Mann getrennt. Sie lebte nun mit Jo zusammen, der selber eine Tochter in diese Beziehung mit eingebracht hatte. Das Ganze war noch genauso frisch wie die Sache mit mir und Anton, und sie war zusätzlich kompliziert, weil Anne schwanger war und schon im März ein Kind von Jo bekommen würde. Ihr Noch-Ehemann war darüber wenig erfreut.
»Wie läuft’s bei dir zu Hause?«, fragte ich. Ich suchte nach einer Überleitung, um ein bisschen jammern zu können.
»Max vermisst seine Laura-Kristin und möchte auch ins Internat, und Jasper will unbedingt eine von diesen superhässlichen Lava-Lampen haben«, sagte Anne.
»Ja, Julius will auch eine Lava-Lampe haben«, sagte ich. »Und Anton will meine Eltern kennen lernen.«
»Das ist doch schön«, sagte Anne.
So etwas konnte nur jemand sagen, der meine Eltern nicht kannte. Aber ich hatte keine Lust, Anne etwas über meine Eltern vorzujammern. Ihre eigenen waren nämlich tot. Also jammerte ich über ein anderes Thema.
»Emily hasst mich«, sagte ich.
»Das wird sich geben«, sagte Anne. Sie hatte gut reden. Jos Tochter Joanne betete Anne an. Sie nannte sie »Mami« und kletterte ihr in einer Tour auf den Schoß. Und sie war ganz entzückend zu Annes Söhnen. Niemals wäre sie auf die Idee gekommen, Jasper zu erzählen, dass man ihm bereits einen Sarg bestellt habe, weil sein Gehirn schrumpfe.
Ich seufzte. »Das sagt Anton auch.«
»Man muss den Kindern einfach ein bisschen Zeit geben«, sagte Anne. »So eine Patchworkfamilie erfordert viel Fingerspitzengefühl.«
»Hm, ja, wahrscheinlich.«
»Und ich wette, Nelly macht es Anton auch nicht gerade leicht«, sagte Anne.
»Ach, sie ist eigentlich ganz nett zu ihm.« Das war eine Tatsache, die mich im Grunde selber erstaunte. Nelly neigte nämlich nicht unbedingt zu Nettigkeiten. Dass sie mit Anton so freundlich umging, schob ich darauf, dass sie selber gerade glücklich verliebt war. Wahrscheinlich war sie in Gedanken immer nur bei ihrem Kevin. Und nicht nur in Gedanken: Sie verbrachte eigentlich jede freie Minute mit ihm. Das wiederum bereitete meinem Exmann Lorenz große Sorgen.
»Warst du schon mit ihr beim Frauenarzt, um ihr die Pille verschreiben zu lassen?«, hatte er mich neulich erst am Telefon angeschnauzt. »Ich habe keine Lust, noch für ein fünftes Kind zu blechen!«
»Nelly hat mir versichert, dass sie noch keine Verhütung braucht, aber sie hat versprochen, Bescheid zu sagen, wenn es so weit ist«, hatte ich erwidert. »Ich meine, bevor es so weit ist.«
»Wenn du dich auf das Wort einer Vierzehnjährigen verlässt, bist du bekloppt«, hatte Lorenz gesagt.
Möglicherweise war ich ja bekloppt, aber noch bekloppter fand ich es, eine Vierzehnjährige zu zwingen, die Pille zu schlucken, obwohl sie noch gar keinen Geschlechtsverkehr hatte. Zumal sie nicht mal Pickel hatte.
»Weißt du was?« Anne lachte, und ich konnte wieder einmal ihre Grübchen bewundern. »In ein paar Jahren schreiben wir beide einen Ratgeber: Die Patchworkfamilie – 1000 legale Tricks zum Überleben. Das wird garantiert ein Bestseller.«
»Ja, und dann bekommen wir eine eigene Erziehungs-Ratgeberseite in Eltern«, sagte ich. »Fragen Sie die Mütter-Mafia. Das heißt, wenn Emily mich bis dahin nicht weggemacht hat.«
»Ach, du wirst dich doch von einer Sechsjährigen nicht unterbuttern lassen!«
Ich war mir da nicht so sicher und schaute betreten zu Boden. Dabei fiel mein Blick auf Annes glitzernde Sandaletten. »Neu?«
»Jahaa«, sagte Anne ein bisschen verlegen. »Sie haben mir vom Schaufenster aus zugewunken. Kauf uns, kauf uns, wir machen dich schön, haben sie geflüstert, und da konnte ich einfach nicht widerstehen. Zumal heute Morgen meine Lieblingsjeans nicht mehr zuging. Die Verwandlung in einen Wal hat begonnen.«
Ich war ein bisschen erleichtert, dass ich nicht die Einzige war, die von Schuhen im Schaufenster angesprochen wurde. Annes Schuhe winkten und flüsterten, meine lächelten.
»Manche schreien auch«, sagte Anne.
Oh, ja, das war richtig. Aber die schreienden Schuhe kaufte ich nie. Ich mochte die zurückhaltenden lieber. Die, deren stilles Lächeln man erst auf den zweiten Blick bemerkte. Das waren meistens auch die, bei denen man fast in Ohnmacht fiel, wenn man den Preis entdeckte.
»Trudi will, dass die Mütter-Mafia einen Schuhladen aufmacht«, sagte ich. »Sie behauptet, Schuhe machen Frauen glücklich.«
»Da hat sie ausnahmsweise mal recht«, sagte Anne. »Diese Sandaletten haben heute meinen Tag gerettet.«
»Trudi sagt, mit einem Schuhladen könne man die Welt verbessern. Sie wartet nur noch, dass das Universum uns das passende Ladenlokal vom Himmel wirft.«
Anne zog ihre Stirn kraus. »Haushaltswaren Moser im Rosenkäferweg macht dicht. Ich habe dort heute ein Salatschüssel-Set zum Ausverkaufspreis erstanden.«
»Oh, wirklich?!« Das Ladenlokal von Moser hatte noch diese wunderbaren Schaufenster, die in einem Viertelkreis auf die Eingangstür zuschwangen. Und wenn man sich Mosers klobige Leuchtreklame wegdachte … Ich räusperte mich. »Sicher stehen dort die Leute Schlange wegen einer Übernahme.«
»Ja, bestimmt«, sagte Anne sofort. »Der Rosenkäferweg ist ja auch eine super Lage für ein Geschäft. Unwahrscheinlich, dass der Laden noch zu haben ist.«
Wir schwiegen ein paar Sekunden.
»Ein Schuhladen also«, sagte Anne. »War das wirklich Trudis Idee?«
Ich nickte.
»Ich sage es ja ein bisschen ungern, aber die Idee gefällt mir«, sagte Anne. »Ich meine, hier in der Siedlung gibt es ja kaum Konkurrenz. Nur diesen überteuerten Hänsel-und-Gretel-Kinderschuhladen und die Gesundheitsschuhabteilung vom Sanitätshaus Hermanns.«
»Das stimmt«, sagte ich.
»Aber natürlich habe ich schon einen Job«, sagte Anne. Sie war Hebamme von Beruf. »Und wer weiß, ob man mit Schuhen überhaupt Geld verdienen kann.«
»Genau«, sagte ich. Wieder schwiegen wir eine Weile. »Auf der anderen Seite, wenn man es richtig gut aufzieht … – Schuhe braucht schließlich jeder.«
»Also, man könnte ja mal mit Moser reden«, sagte Anne. »Vielleicht hat er ja noch nicht entschieden, wem er den Laden übergibt. Ich meine, so ganz unverbindlich nachfragen kostet ja nichts.«
Ich nickte nur. In Gedanken schob ich bereits die Toaster, Mixgeräte, Joghurtbereiter und Salatbestecke aus Mosers Schaufensterauslage beiseite und stellte stattdessen Schuhe hinein: glitzernde Riemchen-Sandaletten, hochhackige Pumps, bestickte Ballerinas, weiche Wildlederstiefel – lauter glücklich machende Schuhe.
Plötzlich war mir danach, die Welt zu verbessern.
Fragen Sie die Patin
Die exklusive Familienberatung der
streng geheimen Mütter-Mafia
Liebe Mütter-Mafia, ich erziehe meine Kinder frei von Zwängen und Einschränkungen. Ein Beispiel zum besseren Verständnis: Dennis (3) möchte nur in die Badewanne, wenn sein Bobby-Car mit hineindarf. Ja, warum denn auch nicht? Wo steht denn geschrieben, dass ein Bobby Car nicht in die Badewanne darf? Leider ecke ich mit meinen unkonventionellen Methoden mehr und mehr an. So wird zum Beispiel die Tatsache, dass Dennis in Konfliktsituationen seinem Instinkt folgt und lieber beißt, als sich auf Diskussionen einzulassen, von den Müttern der gebissenen Kinder und zunehmend auch von den Erzieherinnen als Verhaltensstörung verkannt. (Ich möchte noch erläuternd hinzusetzen, dass die Wunden harmlos sind, schnell verheilen und fast nie bluten.) Was kann ich gegen diese Diskriminierung unternehmen? Ihre Carola Heidkamp.
Liebe Frau Heidkamp!
Vorneweg: Ich finde es wunderbar, dass Sie sich über Konventionen hinwegsetzen und den Kindern eine kreative Gestaltung des Alltags ermöglichen. Vielleicht wären Sie ja bereit, für unser geplantes Erziehungs-Ratgeberbuch das Kapitel »Baden mit Bobby-Car« zu übernehmen?
Zum Thema Konfliktbewältigung durch Beißen: Auch wenn es mir fernläge, Ihren Dennis wegen seines instinkthaften Verhaltens in Konfliktsituationen zu diskriminieren, so glaube ich doch, dass diese Handlungsweise mit zunehmender Bestückung des Milchgebisses abnehmen und Alternativen weichen sollte. Ein Ja zum Beißen würde konsequenterweise auch ein Ja zu Hauen, Boxen, Schubsen, Kratzen und an den Haaren ziehen bedeuten, und die Kinder könnten nur noch mit einer Eishockey-Torwart-Ausrüstung miteinander spielen. Wo will man hier die Grenzen ziehen? Was ist mit Kindern, die eine Konfliktsituation instinktiv mit der Kettensäge ihres Vaters austragen wollen?
Nein, um Alternativen kommen wir hier nicht herum.
Nehmen wir dafür ein Beispiel aus Dennis’ Kindergartenalltag: Ein Kind spielt mit einem Spielzeug, das Dennis gerne haben würde. Altes Verhaltensmuster: Dennis beißt das Kind so lange und so fest, bis das Kind das Spielzeug loslässt und medizinischer Versorgung bedarf. Ergebnis: Dennis hat zwar sein Ziel erreicht, sein Verhalten provoziert aber negative Aufmerksamkeit der Erzieherinnen.
Bieten Sie Ihrem Kind deshalb ganz zwanglos neue Verhaltensmuster an: Dennis bittet das Kind, das Spielzeug mit ihm zu teilen, Dennis sucht sich ein anderes Spielzeug, Dennis fragt, ob er das Spielzeug haben kann, wenn das Kind damit fertig ist.
Aber ich sehe Sie schon den Kopf schütteln, und Sie haben recht: Das sind wohl eher konventionelle Vorschläge, die man in Büchern findet, die auch dem Baden mit Bobby Cars wenig aufgeschlossen gegenüberstehen.
Raffiniertere Methoden der Konfliktbewältigung wären daher: Dennis bittet das Kind, ihm das Spielzeug zu geben. Er kann dieser Bitte mit Sätzen wie »Sonst beiße ich dir die Nase ab« zusätzlich Gewicht verleihen, sollte sich dabei aber außerhalb der Hörweite der Erzieherinnen befinden. Oder: Er bittet die Erzieherin um das Spielzeug mit dem Hinweis, das andere Kind habe es ihm weggenommen. Oder: Er ergattert das begehrte Spielzeug durch Bestechung. Hier bietet es sich an, dem Kind jeden Morgen die Hosentaschen mit Gummibärchen zu befüllen.
In Dennis’ Alter greift das Prinzip »Lernen durch Imitation«, also seien Sie dem Kind einfach ein leuchtendes Vorbild, hinterhältig, raffiniert und manipulativ, dann wird er das Beißen nicht mehr nötig haben.
Vielleicht findet Dennis ja auch Gefallen an einem unserer Selbstverteidigungskurse für schüchterne Kinder: Für »Wir basteln einen Molotowcocktail für den Kindergarten« und »Würgen, richtig gemacht« sind noch Plätze frei.
Ich hoffe, Ihnen ein wenig weitergeholfen zu haben und grüße aus dem Untergrund
Ihre Constanze Ba – äh
Die Patin
* * * THE SECRET OF KINDERERZIEHUNG – endlich entschlüsselt:
Man kann Kinder überhaupt nicht erziehen, sie machen einem sowieso alles nach.
28. September
In meiner Aufgabe als neue Obermami der Mütter-Society möchte ich euch heute mitteilen, dass wir in dieser Woche drei Neubewerbungen vorliegen haben. Eine davon haben Frauke und ich sofort abgelehnt. Es handelt sich um Elke Lehmann, und ich denke, wir haben da in eurem Sinne gehandelt, denn niemand hier will wohl Mitglieder, die a) ihrer Tochter eine Schultüte GEKAUFT haben, b) Nutella aufs Schulbrot schmieren und c) einen scheußlichen Nagelpilz haben und trotzdem Sandalen tragen.
Die anderen beiden Bewerbungen möchten wir hiermit zur Diskussion stellen: Die erste Bewerberin ist Sibylle Hittler vom Maklerbüro Hittler und Kamps, die erst im Sommer mit ihrer Familie in die Siedlung gezogen ist. Auf Frauke und mich macht sie einen sehr vernünftigen ersten Eindruck. Die zweite Bewerberin ist Carola Heidkamp, die Mami von Dennis und Lukas, die einige von euch sicher noch aus der Herr Nilsson-Gruppe kennen. Lukas ist der, der Sophie letztes Jahr so übel mit der Bastelschere attackiert hat, was eure Entscheidung aber keinesfalls beeinflussen sollte.
Frauke und ich warten gespannt auf eure Rückmeldungen.
Falls jemand an unserem Haus vorbeigekommen ist und sich gewundert hat, dass man wieder durch unsere Fenster schauen kann: Das ist das Werk von Dascha, der neuen russischen Putzfrau. Der Nachname ist unaussprechbar, aber diese Frau putzt, als würde sie dafür bezahlt. Wird sie natürlich auch, aber der Stundenlohn ist für deutsche Verhältnisse ein echter Witz. Ich versuche, Jürgi zu überreden, sie öfter kommen zu lassen, denn sie putzt das Klo auch an Stellen, wo es noch nie geputzt wurde. Und sie ist so dankbar. Ihr hättet ihre Freudentränen sehen sollen, als ich ihr ein paar von Sophies zu klein gewordenen Sachen geschenkt habe und den Dampfkochtopf mit dem defekten Ventil.
Bin bester Stimmung: Beryl hat heute Nacht zehn Stunden am Stück geschlafen, wodurch ich heute automatisch fünf Jahre jünger aussehe.
Ausgeschlafene Grüße von
Sonja
28. September
Da bin ich aber echt supi froh, dass ihr Elke Lehmann abgelehnt habt. Sie ist Patientin bei meinem Männe und uns immer noch das Geld für zwei Kronen und ein Bleaching schuldig. Wir haben sogar das Inkasso-Unternehmen eingeschaltet. Es wäre furchtbar, wenn ich ihr hier in der Mütter-Society gegenübertreten müsste und sie mich mit den unbezahlten Kronen dreist angrinsen würde. Aber natürlich ist das alles top secret, ich weiß gerade nicht, ob solche Sachen nicht unter die zahnärztliche Schweigepflicht fallen. Der Nagelpilz ist mir noch nie aufgefallen, ist ja eklig!
Zur Aufnahme von Carola Heidkamp: Ihr Dennis hat meinen Timmi schon elfmal gebissen, davon zweimal so, dass es geblutet hat. Einmal hat dieses Monster sogar ein Loch in Timmis Esprit-T-Shirt gebissen. Die Mutter meinte daraufhin nur, das wäre mit Toff-Tog-Klamotten niemals passiert. Ihr Mann kommt da offenbar zum Einkaufspreis dran, und sie bildet sich wer weiß was darauf ein. Ich habe ihr gesagt, dass mein Mann Zahnarzt ist und dass wir uns alles zum Ladenpreis leisten könnten, da war sie dann still. Sibylle Hittler kenne ich leider nicht. Ich schaue aber mal in unserer Patientenkartei nach, denn wie mein Männe immer sagt: Den Charakter eines Menschen kannst du am besten an seinen Zähnen erkennen.
Sonja, du Glückliche! Zehn Stunden am Stück! Mein Jimmi muss in der Nacht zweimal gestillt und jedes Mal mindestens eine halbe Stunde herumgeschleppt werden, weshalb ich auch leider genauso alt aussehe, wie ich bin. Mein Männe sagt zwar immer, ich sähe aus wie das blühende Leben und dass Frauen, die ihre Kinder so jung bekommen wie ich, sich auch wieder vollkommen davon erholen, bevor sie dreißig sind, aber ich fand mich ohne die Augenringe hübscher.
Wahrscheinlich schläft deine Beryl durch, weil du zufütterst, Sonja. Das hält einfach länger vor als Muttermilch. Aber dafür wirst du dann später auch jede Menge Nachteile in Kauf nehmen müssen. Erst kürzlich habe ich wieder gelesen, dass Kinder, die in den ersten sechs Monaten nicht voll gestillt werden, häufiger eine Lese- und Rechtschreibschwäche entwickeln als vollgestillte Kinder.
Mami Ellen
P. S. Vielleicht möchte sich deine russische Putzfrau auch bei uns noch etwas dazuverdienen, Sonja. Frag sie bitte doch mal.
28. September
Ich trete ganz energisch für die Aufnahme von Elke Lehmann ein! Habt ihr vergessen, dass wir in unserer Satzung ausdrücklich stehen haben, dass wir uns gegenseitig unterstützen und gemeinnützig tätig sein wollen? Was läge da näher, als jemandem wie Elke Lehmann dabei zu helfen, eine gute Mutter zu werden, damit sie wenigstens beim nächsten Kind in der Lage ist, eine anständige Schultüte zu basteln? Sicher gibt es auch ein Mittel gegen Nagelpilz, das wir ihr empfehlen können. Ich schaue gleich mal bei Maria Treben nach.
Mami Gitti
P. S. Bei Haushaltswaren Moser im Rosenkäferweg ist Ausverkauf wegen Geschäftsaufgabe. Ich habe dort einige meiner selbstgetöpferten Aschenbecher und sehr schöne Patchwork-Topflappen in Kommission. Die gibt es jetzt für die Hälfte. Sie eignen sich sehr gut als Weihnachtsgeschenke, das nur so als Tipp.
28. September
Wenn die von der Krankenkasse wollen, dass ich entspannt auf dem Sofa liege und mich und das Ungeborene schone, dann dürfen sie mir aber nicht solche lahmarschigen Pfeifen vorbeischicken, die zu blöd sind, die Spülmaschine einzuräumen, und ausflippen, wenn ein übermütiger Dreijähriger sie gegen das Schienbein tritt. Ich kann sicher nicht ruhig dasitzen und zugucken, wie eine Fremde mit schmuddeligen Händen das Mittagessen für meine Kinder kocht.
Die Krankenkasse hat leider wenig Verständnis für meine Probleme, sie meinen, ich wäre die erste Patientin, die innerhalb einer Woche drei Haushaltshilfen verschlissen hätte. Ich habe gesagt, die Patienten, die diese sogenannten Haushaltshilfen klaglos hinnähmen, müssten schon im Koma liegen.
Meine Nerven sind ohnehin zum Zerreißen gespannt, weil Laura-Kristin täglich weinend aus dem Internat anruft und uns mit Heimwehbriefen bombardiert. Angeblich kriegt sie vor Kummer keinen Bissen runter, und Jan ist schon so weit, sie wieder nach Hause zu holen. Aber erstens zahlen wir ein Schweinegeld für dieses Schulhalbjahr, egal, ob wir sie wieder nach Hause holen oder nicht, und zweitens wird sie so auf jeden Fall endlich ihren Babyspeck los. Ich würde mir ewig Vorwürfe machen, wenn ich ihr diese einmalige Chance nähme.
Aber genug gejammert. Obwohl ich auch aus den genannten Gründen gegen die Aufnahme von Elke Lehmann bin (Gitti: Gegen Nagelpilz hilft gar nichts, wenn man ihn einmal hat, hat man ihn für immer!), muss ich Gitti in einem Punkt recht geben: In letzter Zeit haben wir von der Mütter-Society unseren Fokus zu wenig auf die gemeinnützigen Projekte gelegt.