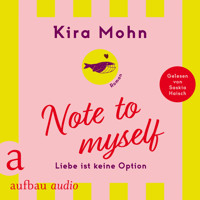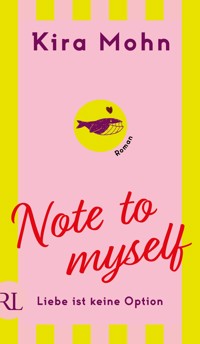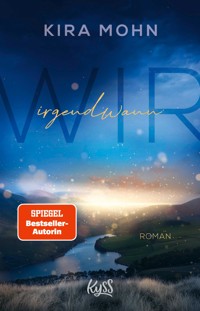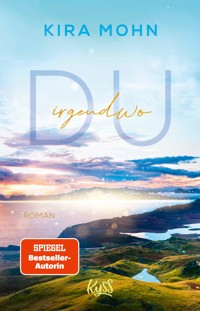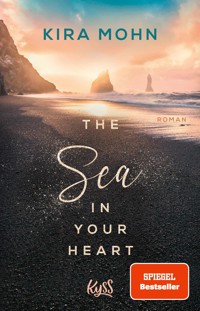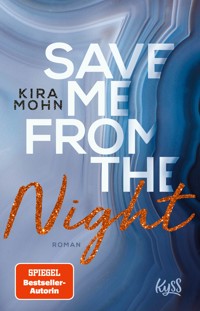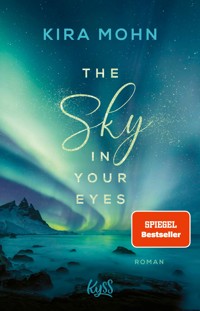9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid.
Die sechsundzwanzigjährige Jule flüchtet sich nach einem heftigen Streit mit ihrem Freund zu ihren Eltern. Niemals hätte geschehen dürfen, was geschehen ist. In dem Haus am Dorfrand will sie jetzt bleiben und in Ruhe entscheiden, wie es weitergehen soll. Doch dann ereilt die Nachricht vom Tod ihrer Großmutter die Familie, und Jule stutzt. Warum hat ihre Mutter nie von der Großmutter oder der eigenen Kindheit erzählt? Als sie gemeinsam das Haus der Großmutter aufräumen, findet Jule Hinweise auf lang zurückliegende Ereignisse, die bis in die Gegenwart hinein ihre zerstörerische Macht entfalten.
Es wird Zeit, dass die Heilung beginnt – für alle Frauen der Familie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ihr persönliches Leseexemplar
Über Ihre Meinung freuen wir uns sehr.
Bitte schreiben Sie uns an leseexemplar@harpercollins.de Mit der Zitierung Ihrer Meinung erklären Sie sich einverstanden. Herzlichen Dank!
Unverkäufliches Leseexemplar erscheint am 20. August 2024 ISBN 9783749907618
Wir bitten Sie, Rezensionen nicht vor dem 20. August 2024 zu veröffentlichen.
Originalausgabe
© 2024 für die deutschsprachige Ausgabe
by HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg
Covergestaltung von FAVORITBÜRO, München
Coverabbildung von Joan Thewsey / Bridgeman Images
E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN E-Book 9783749907618
www.harpercollins.de
Widmung
Für das Kind, das ich einmal war. Und für meine Mutter.
Zitat
Humpty Dumpty saß auf der Lauer. Humpty Dumpty fiel von der Mauer. Und auch der König mit all seinen Mannen brachte Humpty Dumpty nicht wieder zusammen.
Britischer Kinderreim
Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid.
1.
In der Dämmerung verliert die winterblasse Umgebung den letzten Rest an Farbe. Die vereinzelten Bäume, deren kahle Äste wirken, als habe jemand mit einem Strohhalm Tinte über die Wolkendecke geblasen, beginnen mit der Umgebung zu verschmelzen. Mir ist kalt, obwohl ich den Temperaturregler im Wagen bis zum Anschlag hochgedreht habe. Auf der Suche nach einer bequemeren Position strecke ich die Wirbelsäule durch, und das dumpfe Pulsieren über meinem Hüftknochen verstärkt sich. Das gibt einen blauen Fleck. Meine Mutter hat das früher gesagt, wenn ich beim Herumtoben mal wieder zu wild gewesen bin. Das gibt einen blauen Fleck. Der Satz steht für Waghalsigkeit und Übermut, für Sprünge von der vierten, fünften, sechsten Stufe, und jetzt steht er auch noch für etwas anderes.
Die Straße ist trocken, und ich drücke das Gaspedal hinunter. Meine Eltern warten vermutlich schon, zumindest mein Vater, der sich schnell Sorgen macht. Ich hätte nicht so lange an dieser Raststätte auf die Sträucher vor der Motorhaube starren sollen, einen Becher mit Kaffee in der Hand und das Handy auf dem Beifahrersitz.
Es tut mir leid.
Es tut mir wirklich leid.
Ruf mich an, bitte.
Zwischen den Wolkenfetzen taucht gelegentlich der Mond auf, sein Lichtkranz bildet einen schwachen Ring in der sich herabsenkenden Dunkelheit. Er erinnert mich an die Nachtwanderungen mit meinem Vater. Wenn ich müde wurde, hat er mich nach Hause getragen und dabei Geschichten erzählt, vom Mondmädchen und dem Sonnendrachen, die einfach unzertrennlich waren, bis ich unser Gartentor quietschen hörte. Der Sonnendrache war eifersüchtig gewesen, als das Mondmädchen immer mehr Zeit mit dem Jupiterwind verbrachte, und die Nächte wurden hell, weil er sie immerzu beobachtete. Aber er hatte zumindest einen Grund gehabt, denn sie hatte ihn über diese Liebe fast vergessen. Jasper dagegen …
Ich wünschte, es würde nicht so wehtun, an ihn zu denken.
Es ist noch keine zwei Stunden her, da haben wir zusammen Kaffee getrunken. Völlig aus der Luft heraus hat er wissen wollen, wer außer mir letzte Woche länger in der Agentur geblieben ist, und dieses Mal bin ich explodiert. Seine ewigen Unterstellungen machen mich krank.
Ursprünglich wollten wir uns heute eine Ausstellung in der Kunsthalle ansehen, stattdessen statte ich jetzt meinen Eltern einen äußerst spontanen Besuch ab.
Kurz habe ich darüber nachgedacht, zu meiner Freundin Theresa zu fahren, doch dazu hätten wir uns in den letzten Monaten häufiger mal sehen sollen. Ich weiß nicht einmal mehr, wann wir zuletzt telefoniert haben, und auf meiner Mailbox befinden sich noch immer zwei unbeantwortete Sprachnachrichten von ihr. Ich bin einfach zu oft in der Agentur, zu oft und zu lang. Aber an jedem, der es nicht ist, ziehen die interessanten Projekte nun mal vorbei.
Davon abgesehen mag Jasper Theresa nicht besonders, auch das ist ein Grund, weshalb unsere Treffen seltener geworden sind. Worum ist es bei unseren letzten Gesprächen überhaupt gegangen?
Ich habe keine Ahnung, wie es in Theresas Leben aktuell aussieht, und deshalb will ich sie mit meinem nicht überfallen.
Vielleicht rufe ich sie an. Später, wenn ich alles ein wenig sortiert habe. Aber zunächst einmal brauche ich Luft. Jaspers Misstrauen ist ein fortwährender Würgegriff, und das, was heute geschehen ist … Ich muss nachdenken.
***
Das Haus meiner Eltern liegt in einer ruhigen Straße am Dorfrand. Im Sommer steht der Mais auf den Äckern meterhoch, jetzt jedoch beleuchtet die letzte Laterne nur Stoppeln, die aus der Erde ragen. In einigen Fenstern der Nachbarhäuser schimmert noch die Weihnachtsbeleuchtung, es ist ein friedlicher Anblick.
Nachdem ich ausgestiegen bin, werfe ich mir den Mantel über die Schultern und bleibe einige Sekunden lang stehen. Irgendetwas werde ich meinen Eltern gleich erzählen müssen, doch um darüber zu reden, was mich hierhertreibt, fühle ich mich noch nicht bereit. Mir selbst dabei zuhören, wie ich ausspreche, was heute passiert ist? Danke, nein.
Ich komme also einfach mal wieder vorbei? Ein plötzlicher Anfall von Heimweh? Das werden sie mir niemals glauben, doch sie werden auch nicht nachhaken. So sind sie nicht, weder mein vorsichtiger Vater noch meine zurückhaltende Mutter.
Vermutlich sitzen sie gerade beim Abendessen. Zumindest hoffe ich, dass sie damit nicht auf mich warten. Ich drücke den Klingelknopf und öffne das Gartentor. Sekunden später leuchten die Glaseinsätze der Haustür auf, dann steht mein Vater vor mir und breitet die Arme aus.
»Jule!« Sein Geruch ist tröstlich. »Schön, dass du endlich da bist. Wir haben uns zu lange nicht gesehen.«
Etwas in der Art sagt er immer zur Begrüßung, doch diesmal liegt mein letzter Besuch wirklich eine Weile zurück, und schuldbewusst erwidere ich den Druck seiner Umarmung. Theresa ist nicht die Einzige, die ich vernachlässigt habe. Nicht einmal zu Weihnachten bin ich hier gewesen, dabei nehme ich mir ständig vor, häufiger zu meinen Eltern zu fahren. Mein Vater ist über sechzig, wer kann schon sagen, wie viel Zeit wir noch haben?
»Wir haben uns schon gefragt, wo du bleibst.« Er schiebt mich von sich, um mich anzusehen. »Wie geht es dir?«
»Gut. Ganz gut. Ich habe auf einer Raststätte noch einen Kaffee getrunken und nicht mehr auf die Zeit geachtet, tut mir leid.«
Er lässt mich vorgehen. Vor der Tür zum Esszimmer steht meine Mutter.
»Jule.« Ihre Berührung ist federleicht, wie immer, was mich umgekehrt zeit meines Lebens dazu bewogen hat, sie umso stärker festhalten zu wollen. »Wir sind gerade mit dem Abendessen fertig geworden. Möchtest du noch etwas?«
»Vielleicht ein wenig. Großen Hunger habe ich nicht.« Eigentlich überhaupt keinen, doch etwas zu essen erscheint mir unauffälliger. Normaler. »Ich bringe nur gerade die Sachen in mein Zimmer.«
Das Bett ist bereits bezogen, und ich stelle die Tasche davor ab, mustere für einen Moment die Lichterkette am Kopfende, die sich zwischen mehreren angepinnten Skizzen entlangschlängelt. Skizzen von Augen, von Händen, Linien, die sich zu einem Gesicht verbinden. Meine Mutter hat meine Zeichnungen nie heruntergenommen, nur ein zusätzliches Regal in mein ehemaliges Zimmer gestellt, in dem sich hauptsächlich Belegexemplare ihrer Bücher befinden. Ansonsten ist alles so, wie ich es hinterlassen habe. Der Kleiderschrank mit seinen quietschenden Schiebetüren, der auf antik getrimmte Schreibtisch und der Spiegel neben dem Fenster, der vielleicht wirklich antik ist. Ich habe ihn vom Trödelmarkt am Mainufer nach Hause geschleppt, damals hatte ich in Frankfurt gerade mit meiner Ausbildung zur Grafikerin begonnen. Ich war mit einigen Freundinnen dort, zu denen ich keinen Kontakt mehr habe, und wir sind mit großer Wahrscheinlichkeit allen Leuten im Zug mit unseren Spieglein-Sprüchen auf die Nerven gegangen.
Spieglein, Spieglein, wer wird mein Prinz?
Der Spiegel hat mir damals nicht verraten, dass man um manche Prinzen besser einen Bogen macht.
Jetzt zeigt er mir das Bild einer Frau, die blonden Haare zu einem unordentlichen Knoten zusammengesteckt, mit schmalem Gesicht und einem bitteren Zug um die Mundwinkel. Als mein Telefon klingelt, schalte ich es aus, ohne auch nur einen Blick auf das Display zu werfen.
***
Im Esszimmer stehen ein mit Suppe gefüllter Teller und ein Glas Wasser auf dem Tisch. Meine Eltern sehen mir entgegen, und jetzt scheinen sie doch noch auf mich zu warten.
»Möchtest du Brot?«, fragt mein Vater, während in seinen Augen ein aufforderndes Also? zu lesen steht. Also? Was gibt es? Musst du gerettet werden?
»Danke.« Ich nehme mir eine Scheibe und setze mich auf meinen Platz.
Mein Vater ist jederzeit bereit, mich zu retten. Früher war das der Grund vieler Diskussionen zwischen ihm und meiner Mutter, die der Ansicht ist, jeder solle in der Lage sein, seine Probleme selbst zu lösen. Als ich eine Zeit lang jeden Morgen mit Bauchschmerzen zur Schule gegangen bin, weil der Mathelehrer mich zuverlässig an die Tafel holte, und ich bereits schweißfeuchte Hände bekam, wenn ich ihn nur durch den Gang laufen sah, hat sie mich genötigt, ihn darauf anzusprechen, statt ein Elterngespräch einzufordern, wie mein Vater es vorschlug. Er setzte sich jedoch durch, als ein Junge aus unserer Straße sich eine Weile wie ein Grenzbeamter aufführte und mir den direkten Weg von der Schule nach Hause verweigerte. Eines Nachmittags erklärte mein Vater ihm in deutlichen Worten, was er von seinem Verhalten hielt, und danach existierte die unsichtbare Linie von der einen zur anderen Straßenseite nicht mehr.
Meine Eltern diskutieren über solche Dinge, doch sie streiten nicht. Sie streiten nie, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern.
Ich stippe Brot in die Suppe und bin mir dabei überdeutlich des Schweigens am Tisch bewusst.
Endlich räuspert sich mein Vater. »Und? Wie läuft es denn so auf der Arbeit?«
»Großartig.«
Danke, Papa. In der Werbeagentur läuft alles nach Plan, immerhin eine Sache in meinem Leben, die ich noch im Griff habe. Ich erzähle vom letzten Projekt, von dem Lob, das ich dafür erhalten habe, und davon, dass vor einigen Tagen von einem besonderen Kunden die Rede gewesen ist, ohne dass ein Name gefallen wäre.
»Vielleicht sind es Dromer & Lindbergh. Falls ja, wäre es fantastisch, wenn sie mich für ihr Team auswählen würden.«
»Was machen die?«, will meine Mutter wissen.
»Sie vermitteln Immobilien. Und sie sind sehr offen für neue Ideen. Außerdem haben sie ein riesiges Budget.«
»Hört sich an, als könne man sich dort richtig austoben«, wirft mein Vater ein.
»Mit Sicherheit.« Ich erwidere sein Lächeln. »Es klingt natürlich auch nach jeder Menge Überstunden, aber das wäre es wert.«
Jasper dürfte das anders sehen. Und was sagt es über mich aus, dass ich ihm sicherheitshalber noch nichts davon gesagt habe?
»Wie geht es dir sonst?«
Es ist eine harmlose Frage, die mein Vater da stellt, die natürliche Fortführung unseres Gesprächs, doch mir wird klar, dass er zu keiner Sekunde damit aufgehört hat, auf den eigentlichen Grund meines Besuchs zu warten.
»Mir geht’s gut, wirklich. Im Moment ist alles etwas stressig, aber über Ostern wollen wir vielleicht nach Paris.«
»Paris. Seid ihr da nicht gerade erst gewesen?«, fragt meine Mutter.
»Ja, letztes Jahr – nein, mittlerweile schon vorletztes Jahr.«
»Paris im Frühling.« Mit einem Seufzen beugt mein Vater sich vor, um Wasser nachzuschenken. »Das sollten wir auch mal wieder machen, oder, Anna?«
»Du darfst mich jederzeit entführen.« Meine Mutter lacht und wendet sich dann wieder zu mir. »Du bist also hierhergekommen, weil es bei euch gerade etwas stressig ist?« Natürlich legt sie den Finger in die Wunde. Dafür hat sie ein Gespür.
»Nein, ich wollte euch einfach mal wieder besuchen.« Ich bemühe mich um einen gleichmütigen Ton. Bevor ich darüber rede, weshalb ich mich heute ins Auto gesetzt habe, muss ich wenigstens eine Nacht darüber schlafen. Überprüfen, wie groß der blaue Fleck wohl werden wird.
»Wann willst du wieder fahren?«
»Mal sehen. Ich bin noch nicht sicher.«
»Du kannst hierbleiben, solange du willst, das weißt du.« Sie steht auf und greift nach meinem leeren Teller. »Nimm dir alle Zeit, die du brauchst.«
»Je länger, je lieber«, fügt mein Vater hinzu und drückt meine Hand.
Hier ist ein sicherer Ort. Es gibt einen Teil in mir, der sich dafür schämt, ihn zu brauchen, doch es gibt auch einen anderen Teil. Einen, der noch immer zusammengekrümmt auf dem Boden liegt.
Später sitzen wir im Wohnzimmer und sehen fern. Auf dem Tisch stehen Paprikachips und gesalzene Erdnüsse, über die ich mich fast im Alleingang hermache, während in der Samstagabendshow eine Frau fünf von hundert verschiedenen Sorten Katzennassfutter am Geruch erkennt. Es fühlt sich an wie eine Reise in die Vergangenheit, und nur der Flachbildschirm statt des Röhrenfernsehers stört diese Illusion.
Erst als ich im Bett liege, schalte ich das Handy wieder ein. Drei neue Nachrichten, zwei verpasste Anrufe.
Jule, ich weiß nicht, was da über mich gekommen ist. Bitte ruf an. Bitte. Es tut mir so leid. Es tut mir leid. Ich bin ein verdammter Idiot, aber ich liebe dich.
Vergeblich versuche ich diese verquere Sehnsucht zurückzudrängen, die bei Jaspers Worten in mir aufsteigt. Jede andere Frau würde alles einfach löschen, nur mein erbärmliches Herz klopft schneller, während ich lese. Es kommt selten vor, dass Jasper sich so demütig zeigt, eigentlich nie. Diese Seite an ihm ist neu.
Ich rolle mich zusammen.
Die Seite, die er am Vormittag von sich gezeigt hat, allerdings auch.
***
Am nächsten Morgen blinzele ich das Handy auf dem Kopfkissen an, bevor ich es auf den Nachtschrank lege. Ich habe von Jasper geträumt, es war gleichzeitig ein Traum und eine Erinnerung. Wir beide unter dem Eiffelturm, er hält mich in seinen Armen. Du machst mich zu einem besseren Menschen. Es ist ein Urlaub gefüllt mit besonderen Momenten gewesen, ein Urlaub, in dem wir viel gelacht und uns fast genauso oft geliebt haben.
Ich strecke mich, bis meine Fußsohlen die Wand berühren. Wärme strahlt davon ab, wie immer um diese Jahreszeit, der Kaminschacht verläuft dahinter. Ein paar Augenblicke lang hänge ich dem Traum noch hinterher, dann schlage ich die Decke zurück.
Eigentlich habe ich das Frühstück vorbereiten wollen, doch als ich die Tür zum Esszimmer öffne, erfüllt bereits der Duft von Kaffee und frischen Brötchen den Raum.
»Guten Morgen.« Meine Mutter sieht aus der Küche heraus. »Wie hast du geschlafen?«
»Prima.«
Es geht mir heute besser als gestern, nur die Hüfte schmerzt noch, aber das war ja zu erwarten. Ich öffne den Kühlschrank, um Marmelade und Margarine herauszunehmen.
»Jule, hör mal, ich wollte dich noch mal fragen … Ist irgendwas mit Jasper?« Meine Mutter schaltet die Kaffeemaschine aus.
Ich zögere. »Was soll denn sein?«
Sie lehnt sich gegen die Arbeitsplatte und mustert mich ganz offen. »Hattet ihr Streit?«
Meinen schauspielerischen Fähigkeiten sind offenbar Grenzen gesetzt.
»Nein, ich sagte doch – es ist alles in Ordnung. Er hat viel Stress, ich auch … Ich dachte einfach, etwas Abstand sei eine gute Idee.« Ohne sie anzusehen, schraube ich die Thermoskanne auf, um Kaffee einzufüllen. »Mach dir keine Gedanken, okay?«
Es ist mir noch nie gelungen, irgendetwas lange vor meiner Mutter zu verbergen, doch noch wäre es zu früh. Weil die Konsequenzen nicht abzusehen sind, sobald im Raum steht, was gestern geschehen ist. Für meine Mutter würde alles völlig klar erscheinen. Doch das ist es nun mal nicht.
»Du kannst mit mir reden.«
»Ich weiß. Aber im Moment ist das eine Sache, die betrifft einfach nur Jasper und mich.«
Zu spät wird mir bewusst, dass es keine gute Idee gewesen ist, irgendeine Sache zu erwähnen. In Erwartung eines neuerlichen Vorstoßes hole ich Luft, suche bereits nach einer Antwort, doch zu meiner Überraschung nickt meine Mutter nur.
»Wie du meinst.« Im Vorübergehen streicht sie mir über den Rücken. »Ich bin sicher, du tust das Richtige.«
Ich wünschte, ich könnte ihre Zuversicht teilen.
***
Beim Frühstück unterhalten wir uns über die Wetten des vergangenen Abends und darüber, was man Walter, einem der Nachbarn, zu seiner Geburtstagsfeier mitbringen könnte.
»Ein gutes Buch passt immer«, sagt meine Mutter.
Mein Vater gibt Himbeerkonfitüre auf seine Brötchenhälfte. »Das Einzige, was Walter liest, ist die Fernsehzeitung. Ich wäre eher für einen Whisky und Schnapspralinen.«
»Er trinkt so schon zu viel.« Ein unmerkliches Hochziehen der Brauen begleitet ihre Worte. »Vielleicht ein Obstkorb?«
»Anna. Ein Obstkorb. Ich bitte dich.«
»Jetzt erzähl mir nicht, dass Walter auch kein Obst isst.« Das Telefon auf der Kommode läutet, und meine Mutter schiebt den Stuhl zurück. »Etwas Exotisches wäre doch nett. Papaya, Ananas, Mango.«
Sie nimmt das Telefon von der Station und dreht sich damit ein Stück zur Seite. »Anna Brunner, hallo?«
Mein Vater trinkt einen Schluck Kaffee, dann grinst er mich an. »Kirschschnaps und Erdbeertorte würde Walter vielleicht als Obstkorb durchgehen lassen. Obwohl ich glaube …«
Sein Lächeln verschwindet. Noch bevor ich realisiere, dass etwas passiert ist, etwas, das meine Mutter in dieser Sekunde dazu bringt, sich mit weißem Gesicht schwer auf der Kommode abzustützen, springt er auf.
»Verstehe«, sagt sie. »Verstehe. Nein … nein, natürlich nicht. Sicher. Ich kümmere mich darum, danke.« Eine kurze Pause. »Ja. Auf Wiederhören.«
Sie hält das Telefon in der Hand, als wüsste sie nicht, was sie als Nächstes damit tun soll. In ihrem Gesicht arbeitet es. Als wolle etwas hervorbrechen, etwas Verborgenes, das die Gelassenheit sprengt, mit der sie der Welt normalerweise begegnet.
»Was ist passiert?« Ich stehe ebenfalls auf.
»Anna?« Behutsam berührt mein Vater meine Mutter an der Schulter.
Das Telefon fällt zu Boden, und ich zucke zusammen.
»Anna, was ist denn?«
»Meine Mutter ist gestorben.«
Gestorben. Ihre Mutter. Ich klammere mich an der Tischkante fest, weil ich das Gefühl habe zu schwanken. Nicht, weil meine Großmutter gestorben ist. Ich kenne meine Großmutter gar nicht. Sondern weil meine Mutter so aussieht, als werde sie gleich zusammenbrechen. Habe ich sie jemals so gesehen?
Meine Mutter ist die Ruhe selbst, sie steht über den Dingen, immer. Doch jetzt scheinen nur die Arme meines Vaters zu verhindern, dass sie auseinanderbricht.
Ich trete einen Schritt auf die beiden zu. »Kann ich … Kann ich irgendetwas tun?«
»Gib uns ein paar Minuten, ja?« Mein Vater findet die Zeit, mir zuzunicken.
Einen Moment noch zögere ich, dann öffne ich die Esszimmertür. Benommen stehe ich für einige Augenblicke in der Diele, bevor ich meinen Mantel vom Garderobenhaken nehme.
Kann ich vielleicht einmal nach Hause kommen, und es ist aufgeräumt?
2.
Das Unterholz war durchwirkt von Spinnweben, und wo die Sonnenstrahlen ihren Weg bis zum Boden fanden, leuchtete das zarte Gespinst im lichtgrünen Schimmer. In den Wipfeln zwitscherten Vögel, ein fortwährender Kanon, dessen Verstummen ihnen die Ankunft derer verriet, auf die sie warteten. Stille senkte sich dann auf sie, dicht und drückend wie eine schwere Decke.
Schweißtropfen kitzelten Majas Wangen, doch sie widerstand der Versuchung, sie fortzuwischen. Den würzigen Duft von Blättern und Harz in der Nase, konzentrierte sie sich darauf, jedes noch so unauffällige Geräusch wahrzunehmen.
Ein Mistkäfer krabbelte über den umgestürzten Baum, hinter dem sie sich verbargen. Sein Halsschild schillerte blauviolett, umhüllte ihn wie das Tuch, das ihre Mutter morgens trug, wenn das Haus noch kalt war, während er sich mit seinen gezahnten Beinchen in der moosbewachsenen Rinde verhakte. Vielleicht war er ein Späher. Am liebsten hätte sie Anna auf ihn aufmerksam gemacht, wagte es jedoch nicht. Sie waren so dicht dran, so dicht … heute. Heute war der Tag.
Ihr Blick huschte zu ihrer Schwester, die bewegungslos auf dem Waldboden kauerte, angespannt, einen Punkt fixierend, der hinter dem Baumstamm lag, irgendwo zwischen dunkler Erde und verschattetem Grün. Der Käfer wanderte weiter, nutzte jedes seiner sechs Beine, um Zentimeter für Zentimeter höher zu kriechen. Dann hatte er den Stammrücken erreicht und seine Deckflügel hoben sich. Maja hielt den Atem an, als die zerknitterten Flügelchen darunter sich entfalteten. Einen Augenblick lang war sie sicher, dass er vorausgeschickt worden war, dass er zu ihnen gehörte, weil er sie direkt anzusehen schien – doch jetzt stemmte der Käfer die Vorderbeine zu weit hoch, verlor das Gleichgewicht und kugelte zu Boden. Für einige Sekunden zappelte er auf dem Rücken, bevor es ihm gelang, sich umzudrehen. Seine Fühler betasteten die trockene Erde, als suche er seine verlorene Würde, dann verschwand er in der Mulde unter dem Stamm. Vermutlich gehörte er doch nicht zu ihren Spähern.
Unvermittelt packte Anna sie am Handgelenk. Sie kommen, sagten ihre Augen. Die Vögel hatten in ihrem Konzert innegehalten, eine Brise streifte durch das Laub und ließ die Spinnennetze erzittern.
Sie nutzten die unsichtbaren Fäden, um Stoffe daraus zu weben. So stand es in einer der Geschichten, die Anna bisweilen aus der Schulbibliothek mitbrachte und Maja abends vorlas. Deshalb hatten sie sich hier versteckt, hier, wo die Sträucher unförmigen Kokons glichen, in denen seltsame Wesen heranwuchsen.
»Da. Siehst du sie?«, wisperte Anna.
Maja folgte ihrem Blick. Ein Gleißen zwischen den Baumstämmen, in dem die Blätter übernatürlich grün erschienen, die Strahlen der Sonne wie ein Portal in die heimliche Welt. Maja hörte ihr Lachen, noch ehe sie hinter den Bäumen hervortraten, größer, als sie es erwartet hatte, und so schön, dass sie blinzeln musste. Von königlichem Wuchs, die Haare wie Seide, so hatte Anna es vorgelesen, und alles stimmte. Ihre Bewegungen waren ein verzauberter Tanz, und dort, wo ihr Schein die Rinde erstrahlen ließ, eine blasse Hand einen Zweig beiseiteschob, schienen die Bäume zu seufzen. Im Vorübergehen streiften sie die empfindlichen Fäden von den Ranken, deren Enden hinter ihnen schwebten, als würden sie unter Wasser dahingleiten, und sie unterhielten sich dabei; Worte wie raschelndes Gras, wie der Flügelschlag einer Singdrossel. Maja hing an ihren Lippen und wünschte sich, sie könnte sie verstehen.
»Sie haben uns entdeckt.« Der Druck von Annas Fingern um Majas Gelenk verstärkte sich. »Die da vorne schaut uns direkt an.«
Ein Kribbeln durchlief Majas Körper, als sie den Blick der Waldfee wie ein Streicheln auf der Haut spürte. Unwillkürlich hob sie die Hand, ein hilfloser Gruß, ein nicht zu Ende geführtes Winken. Die Fee lächelte.
»Sieh ihr nicht in die Augen! Sonst musst du ihr folgen.«
Maja richtete sich auf. Sie würde mit dieser Lichtgestalt gehen, ganz egal, wohin sie sie führen mochte. Das Lächeln der Fee senkte sich in ihre Seele, ihre Augen waren so dunkel und tief wie der Waldsee, und die silbrigen Haare, die ihr Gesicht umwehten, ließen sie noch schwärzer wirken.
»Maja!«, zischte Anna. »Nicht hinsehen! Es ist gefährlich!«
»Aber sie sind so schön«, hauchte Maja.
Ihre Schwester umschlang sie mit beiden Armen, und Maja stemmte sich dagegen, wehrte sich gegen die Umklammerung.
Auch die anderen Feen blickten mittlerweile in ihre Richtung und beugten die Köpfe zueinander, jedes gesprochene Wort wie sanfte Regentropfen, die nie den Boden erreichten, sondern vom Blätterdach aufgefangen wurden.
»Lass mich«, murmelte Maja. »Lass mich los!«
»Nein, auf keinen Fall – sie bringen dich fort, und du kehrst nie zu mir zurück.«
Die Fee neigte den Kopf, eine einladende Geste, der Maja nur zu gern Folge geleistet hätte. Ihre Hände würden geschmeidig sein und kühl, glatt wie Glas, und wenn sie sie einmal ergriffen hätte, würde sie nie wieder loslassen. Nie wieder loslassen wollen.
»Maja, schau mich an. Du musst dich auf mich konzentrieren, sonst bist du für immer verloren!«
»Aber …«
Maja vergaß, was sie hatte sagen wollen, als Anna plötzlich auf die Uhr sah. Ach, nein.
»Verdammt, es ist schon so spät – wir müssen zurück.«
»Müssen wir wirklich? Es ist doch noch hell.«
»Es ist schon halb sieben.«
Über den umgestürzten Stamm hinweg warf Maja einen Blick auf die spinnwebverhangenen Büsche. Die Waldfeen waren fort. Als hätte es sie nie gegeben.
Anna griff nach ihrer Hand. »Komm schon, Maja, sonst gibt’s nur wieder Ärger. Wir können später noch ein bisschen lesen, okay?«
Seufzend ließ Maja sich von ihrer Schwester mitziehen. Zu Hause warteten Schulaufgaben auf sie, von denen Anna gegenüber ihrer Mutter behauptet hatte, sie hätten sie schon erledigt. Dezimalzahlen und Brüche. So langweilig. Erst danach wäre vielleicht noch ein wenig Zeit für das Buch, das Anna aus der Bibliothek mitgebracht hatte. Und davor lauerte noch das Abendessen. Um sieben aßen sie immer zusammen. Mama, Papa, Anna, Maja. Es klang eigentlich schön.
Hinter Anna her hastete sie über federnde Erde, stolperte über Wurzeln, fing sich jedoch jedes Mal rechtzeitig, den Blick auf die langen, blonden Haare ihrer Schwester gerichtet. Nur mit halbem Ohr hörte sie auf das, was Anna erzählte, irgendetwas über eine Lehrerin an ihrer Schule. Anna ging in die zehnte Klasse des Gymnasiums und war ein heller Kopf, wie ihr Vater manchmal sagte. Maja dagegen hatte es nicht aufs Gymnasium geschafft. Sie war in der sechsten Klasse der Gesamtschule, doch schlimm daran war nur, dass sie Anna in den Pausen zwischen den Schulstunden nicht sehen konnte. Ansonsten machte es ihr nichts aus, kein heller Kopf zu sein. Außerdem mochte sie es, wenn man sie für jünger hielt, als sie tatsächlich war.
Jeden Morgen fuhr Anna mit dem Bus in die Stadt, während Maja nur ins Dorf laufen musste, und jeden Morgen hatte Maja Angst, Anna könne etwas passieren. Der Bus könnte umkippen, von der Straße abkommen, in die Luft gesprengt werden. Ihre Mutter hatte es in der Zeitung gelesen, manche Menschen taten so etwas. Einen ganzen Bus in die Luft sprengen und alle Kinder, die sich darin befanden. Der Gedanke, Anna könnte in einem solchen Bus sitzen, machte Maja zu schaffen.
»Maja! Komm, schneller!«
Sie hatte gar nicht bemerkt, dass sie langsamer geworden war, doch jetzt beeilte Maja sich wieder, mit Anna mitzuhalten. Am liebsten wäre ihr, es würde nie auch nur der kleinste Abstand zwischen ihr und Anna bestehen.
***
Der Tisch war schon gedeckt, als sie zu Hause ankamen. Normalerweise war das ihre Aufgabe.
Ihre Mutter sah aus der Küche, um sich zu vergewissern, dass sie es waren. »Wascht euch die Hände.«
Sie liefen ins Bad, Schulter an Schulter, ein ewiger Wettstreit, obwohl Anna jedes Mal, wenn sie verlor, erklärte, es sei nicht wichtig, wer zuerst die Seife in den Händen hielt. Heute sagte sie es nicht, denn sie erwischte das Seifenstück knapp unter Majas Fingerspitzen. Maja bespritzte sie mit Wasser.
»Hey!«, schrie Anna und spritzte zurück, nicht etwa so, dass man es sah. Nur gerade so viel, dass beide lachten, bevor Maja hinter Anna her ins Esszimmer lief und sich dort an den Tisch setzte, während Anna der Mutter half, die Schüsseln aus der Küche hereinzutragen. »Es gibt Kartoffelbrei.«
Kartoffelbrei. Dann hatte ihre Mutter bestimmt auch Schnitzel gemacht. Maja mochte Schnitzel, obwohl sie sich seit einiger Zeit ein bisschen dafür schämte. Seit Anna beschlossen hatte, kein Fleisch mehr zu essen, um genau zu sein. Maja wusste mittlerweile, dass die Tiere, die auf ihrem Teller landeten, furchtbar leiden mussten und ein schreckliches Leben hatten, bevor sie geschlachtet wurden, und das tat ihr auch leid. Auf ihr Lieblingsessen verzichten wollte sie deshalb trotzdem nicht.
Das Geräusch eines sich drehenden Schlüssels in der Haustür ließ Anna noch einmal aufspringen, um das Bier aus dem Kühlschrank zu holen.
»Anna, nimm das auch gleich mit!«, hörte Maja ihre Mutter sagen, und zusammen mit Anna, die mit dem Bier und einer Schüssel Salat aus der Küche kam, betrat ihr Vater das Zimmer.
Meistens brummte er nur einen halbverständlichen Gruß, bevor er sich ans Kopfende des Tisches setzte. Manchmal hatte er auch gute Laune, dann lächelte er breit und rief »Gud’n Aamd«, wie die Mainzelmännchen im Fernsehen. Heute jedoch ließ er sich nur mit einem Ächzen auf seinen Stuhl sinken. Maja warf einen schnellen Blick zu ihrem Wasserglas. Gut. Es stand weit genug von ihr entfernt, um es nicht versehentlich mit dem Ellbogen umzustoßen.
»Hallo«, sagte ihre Mutter, stellte den Teller mit den Schnitzeln in die Mitte und begann, das Essen zu verteilen, bevor sie sich am anderen Ende niederließ. Anna und Maja saßen einander gegenüber zwischen ihren Eltern, und als Anna ihr jetzt die Zunge rausstreckte, nur ganz kurz, fast so, als sei es nicht passiert, senkte Maja rasch den Kopf, um nicht lachen zu müssen.
Auf ihrem Teller lag das panierte Schnitzel zur Hälfte im Kartoffelbrei, Erbsen und orangefarbene Möhrchen häuften sich daneben. Maja mochte am liebsten die ganz kleinen, die man als Ganzes in den Mund stecken und am Gaumen mit der Zunge zerdrücken konnte.
Ein paar Minuten lang war nichts weiter zu hören als gelegentliches Klirren, wenn Gabelzinken gegen Keramik stießen, und das Ticken der alten Drehpendeluhr, die auf der Anrichte stand.
Es war ein interessanter Gedanke, nur einen einzigen Satz vom sicheren Tod entfernt zu sein. Maja beobachtete ihren Vater aus dem Augenwinkel, wie er sein Fleisch schnitt, Kartoffelbrei auf die Gabel schob und gelegentlich mit Bier nachspülte. Es brauchte nicht einmal einen ganzen Satz – ein Wort würde ausreichen.
Depp.
Vollidiot.
Arschloch.
So bezeichnete ihr Vater seinen Chef. Natürlich nur zu Hause.
Doch würde Maja ihn jetzt ansehen und »Arschloch« sagen, laut und deutlich »Arschloch« sagen, würde er sie am Arm packen, und niemand würde ihr dann noch helfen können. Spannend. Dass wenige Buchstaben, nur eine einzige Sekunde, ihr Leben einfach so auslöschen konnten.
»Seit heute lesen wir die Schachnovelle, aber in der anderen Klasse lesen sie der kleine Prinz«, durchbrach Anna die Stille.
Maja wusste nicht, wie sie es schaffte, nicht an dem Schweigen zu ersticken. Anna war die helle Schwester, die luftige, die leichte. Sie war die, die redete und lachte und immer noch mehr redete, während Maja dunkel war, zurückhaltend und stumm. Anna war immer so gewesen, und Maja beneidete und liebte sie dafür. Schon früher hatte Anna sofort geschrien, wenn es mal wieder so weit war. Geschrien und gebrüllt wie am Spieß, oft schon, bevor er überhaupt angefangen hatte, während alles in Maja schwer und traurig wurde, sobald sie erkannte, dass ihr ein Fehler unterlaufen war. Maja weinte nach innen, und dann schrie Anna auch für sie, damit es schneller vorbei war.
Nach dem Essen räumten sie den Tisch ab. Und obwohl ihr Vater noch im Esszimmer saß, weil er sich ein zweites Bier geholt hatte, wurde es Maja mit jedem Glas und jedem Messer leichter ums Herz. Sie beeilten sich, über die Treppe nach oben zu kommen, und weil Anna Maja mit Mathe half, blieb nach dem Zähneputzen noch genug Zeit, um das Buch hervorzuholen, aus dem Anna gerade vorlas.
Maja konnte selbst lesen, natürlich konnte sie das, und sie las auch viel, dicke Bücher, von denen ihre Mutter sagte, dass sie die Geschichten darin doch noch gar nicht verstand. Aber es war schön, mit geschlossenen Augen Annas Stimme zu lauschen und sich dabei alles vorzustellen.
Die Waldfeen lebten im Verborgenen, gleichzeitig in der wirklichen und in der heimlichen Welt. Normalerweise begegnete man ihnen nie. Man musste wissen, an welchen Plätzen sie sich trafen. Anna und sie hatten lange danach gesucht, und heute war das erste Mal gewesen, dass sie mehr von ihnen gesehen hatten als nur silbrige Spuren am Waldboden.
Ihre Mutter öffnete die Zimmertür. »Licht aus jetzt.«
Sie beugte sich erst zu Anna, dann zu Maja hinunter, um sie auf die Stirn zu küssen und ihnen eine gute Nacht zu wünschen. Maja schlang die Arme um ihren Hals, schnupperte den Duft nach Rosen, nur kurz, denn lange hielt ihre Mutter das nicht aus, dann ließ sie sich die dünne Decke bis unters Kinn ziehen. »Schlaf gut, mein Schatz. Träum was Schönes.«
Nachdem die Tür sich wieder geschlossen hatte, warteten sie eine Weile.
»Anna?«, hauchte Maja, als sie es nicht mehr aushielt. »Bist du noch wach?«
»Na klar.« Auf der anderen Seite des Zimmers leuchtete es unter Annas Decke auf. Sie hatten es ausprobiert: Der Schein der Taschenlampe reichte nicht bis unter den Türspalt durch. Maja krabbelte aus ihrem Bett und huschte zu ihrer Schwester, schmiegte sich an ihren Körper, während Anna versuchte, eine Position zu finden, in der Majas Kopf nicht im Weg war, sodass sie weiter vorlesen konnte.
»Die Menschen fürchteten die Waldfeen, denn sie holten ihre Kinder und machten sie zu einem der ihren.«
Ob sie wohl schon zu alt war, um noch von den Waldfeen geholt zu werden? Vermutlich. Wahrscheinlich holten sie nur Babys. Einen Augenblick lang wünschte Maja sich aus allertiefstem Herzen, die Feen hätten sie geholt, als sie noch ganz klein gewesen waren, sie und Anna, dann dachte sie an ihre Mutter und verwarf diesen Wunsch wieder. Früher hatte ihre Mutter ihnen vorgelesen, bevor sie zu müde dafür wurde.
»Du schläfst.«
Ein Schubser im Rücken ließ Maja die Augen aufreißen.
»Ich schlaf nicht!«
»Doch, du schläfst. Rüber in dein Bett, los.«
»Ich war die ganze Zeit wach.«
»Und dabei hast du geschnarcht.« Anna grinste im Schein der Taschenlampe. »Morgen geht’s weiter.«
Gähnend tapste Maja auf bloßen Füßen über die Dielenbohlen, kuschelte sich unter ihre Decke und tastete nach Bär.
»Anna?«
»Ja?«
»Was hast du zuletzt vorgelesen?«
»Vom Mittsommertanz. Zur Sommersonnenwende.«
Maja durchforstete ihr Gedächtnis. »Liest du das morgen noch mal?«
»Klar. Schlaf jetzt.«
Sommersonnenwende. Das war ein schönes Wort. Maja flüsterte es einige Male. »Sommersonnenwende. Sssommersssonnennwende.«
»Maja, sei leise. So kann ich nicht schlafen.«
Maja beschränkte sich darauf, das schöne Wort nur noch zu denken. Morgen würde sie es in ihr Buch schreiben, in das Tagebuch mit den Kaninchen darauf. Sie besaß dieses Buch schon lange, doch erst vor einigen Monaten hatte sie damit begonnen, Dinge hineinzuschreiben. Besondere Gedanken. Erlebnisse, an die sie sich für immer erinnern wollte. Und eben schöne Worte. Dafür gab es eine eigene Seite. Besonders viele waren es bisher nicht. Zimt. Mucksmäuschenstill. Sternschnuppe. Blümchen.
***
Maja fuhr hoch und wusste im selben Moment, wodurch sie wach geworden war. Bär in die Achselhöhle geklemmt, glitt sie aus ihrem Bett. Anna hatte schon ihre Decke angehoben. Dann lagen sie da, lautlos. Nicht einmal ihr Atem war zu hören.
Ein dumpfes Geräusch drang aus dem Zimmer nebenan, als sei etwas zu Boden gefallen. Ein schwerer Sack, gefüllt mit Rinde und Kieseln. Die Waldfeen ließen so etwas zurück, wenn sie ein Kind holten. Manchmal war auch Gold darin.
Noch einmal dieses Geräusch, gefolgt von einem Klagelaut, bei dem Maja nach Annas Hand tastete, obwohl er sofort wieder verstummte.
Wie eine Mutter, die entdeckt hatte, dass ihr Baby verschwunden war. So würde es klingen. Vielleicht. Doch im Schlafzimmer der Eltern gab es längst kein Baby mehr. Früher hatte Maja dort gelegen, in einem weißen Gitterbett, und vor ihr irgendwann Anna. Inzwischen stand das Gitterbett auf dem Dachboden.
Etwas schrammte über den Holzboden, und in der Stille, die folgte, fand Maja Zeit zu bemerken, wie kalt Annas Hand war, kälter noch als ihre. Dann kam das Quietschen. Es quietschte und quietschte, und es würde eine ganze Weile quietschen, so als spränge Maja auf ihrem Bett herum, was sie nicht mehr tat, seit ihr Vater ihr klargemacht hatte, dass man das nicht durfte.
Anna zerquetschte beinahe ihre Finger. Plötzlich ließ sie los und zog die Decke über ihre Köpfe. Das Quietschen war dadurch leiser, nicht ganz verschwunden, aber nicht mehr so roh. So verboten.
Anna drückte Maja an sich, als sei sie eine Puppe, Majas Rücken gegen Annas Brust, und Maja umklammerte Annas Arm und schloss die Augen.
Du bist nicht mehr die Frau, die ich mal geheiratet habe.
3.
Große Schritte. Ich mache große Schritte, die Schultern hochgezogen, die Hände in den Manteltaschen. Mein Ziel ist der dicke Baum auf dem Schwarzbachdamm, ein uralter Bergahorn, den man vom Wohnzimmer meiner Eltern aus inmitten der Felder sehen kann. Als Kinder sind wir dort Schlitten gefahren.
Der Wind reißt mir ständig die Kapuze hinunter, und irgendwann gebe ich es auf, sie zurückzuzerren. Bei diesem Wetter sind nicht einmal die hartgesottenen Sonntagsspaziergänger unterwegs. Verlassen liegt der Weg vor mir, große Steinplatten, eine an die andere gesetzt, mit gefrorener Erde und Mist verdreckt. Jeder Schritt ist mit einem Stechen in der Hüfte verbunden, doch der Gedanke an Jasper wird in diesem Moment von anderen überlagert.
Meine Großmutter ist also gestorben. Es gibt nicht viel, was ich über sie weiß. Zu Weihnachten hat sie Grußkarten in einem Umschlag geschickt, und an meinem Geburtstag ebenfalls, nur für mich allein. Früher waren es zwanzig Mark, später lag jedes Mal ein Zwanzigeuroschein dabei, und ich habe Dankeskarten geschrieben. Ich glaube, einige Male habe ich vorgeschlagen, die fremde Oma zu besuchen. Doch irgendetwas hat immer dagegengesprochen, und so immens hoch war mein Interesse dann offenbar doch nicht gewesen. Und jetzt ist sie tot.
Ich bin nie auf die Idee gekommen, meine Mutter könnte ein engeres Verhältnis zu ihr gehabt haben. Sie existierte einfach. Irgendwo. Eine Karte von Oma. Das war sie. Mehr nicht. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, ob es vielleicht mal einen Streit gegeben haben könnte oder ob man sich einfach schleichend voneinander entfernt hat. So etwas passiert. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass Eltern und ihre Kinder sich auseinanderleben.
Und doch hat die Nachricht am Telefon meine Mutter erschüttert, ach was, erschüttert, es hat ihr den Boden unter den Füßen weggezogen. So aufgelöst wie vorhin, als sie vom Tod meiner Großmutter erfuhr, habe ich sie noch nie gesehen.
Ich muss so dreizehn, vierzehn gewesen sein, als ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass meine Mutter etwas vor mir verbarg. Manchmal schien sie weit weg zu sein mit ihren Gedanken, starrte vor sich hin und fuhr zusammen, wenn man sie ansprach. Und manchmal war da plötzlich eine strenge Distanz, die ich mir nicht erklären konnte.
Damals habe ich das der Tatsache zugeschrieben, dass sie eben erwachsen war, ansonsten hatte ich genug mit mir selbst zu tun. Obwohl ich diese Kluft bei meinem Vater nie gespürt habe, habe ich sie bei meiner Mutter einfach akzeptiert, sogar bewundert. Es war dieses Beherrschte, dieses Undurchdringliche, das sie an sich hatte, wenn die Verkäuferin im Laden unhöflich zu ihr war oder wenn sie mit ihrem Lektor diskutierte. Bei den Sachbüchern, die sie schreibt, lässt sie sich nur von wenigen reinreden. Das macht sie zu einer schwierigen Autorin, wie sie selbst zugibt, aber es macht sie auch zu einer Frau, die man ernst nimmt. Deren Rat man sucht. In deren Nähe ich mich sicher gefühlt habe.
Auch das ist ein Grund, warum ich gestern zu meinen Eltern gefahren bin. Die Ruhe meiner Mutter hat mir immer Kraft gegeben. Ich habe mich nie gefragt, ob es in ihr vielleicht manchmal ganz anders aussieht. Bis heute.
Die Wurzeln des Bergahorns wühlen sich auf einer kleinen Anhöhe ins Erdreich. Teilweise liegen sie frei, und ich steige darüber hinweg bis zum steinernen Jesuskreuz.
Von hier aus kann man den Damm entlanglaufen, der durch die Felder zu der Straße führt, auf der man über den Schwarzbach hinweg den kleinen See erreicht. Als ich jünger war, bin ich dort oft mit meinen Eltern gewesen und habe Steine ins Wasser geworfen. Heute jedoch schlage ich am Ende des Dammpfads den Weg nach Hause ein, mit dem Gedanken im Kopf, dass das, was meine Mutter stets für sich behielt, mit dem zusammenhängen muss, was heute passiert ist.
***
Mein Vater hat sich zurück an den Tisch gesetzt, auf dem noch die Reste des Frühstücks stehen. Er ist beunruhigt, das ist nicht zu übersehen, auch wenn er lächelt, als ich das Zimmer betrete. Meine Mutter, die mit dem Telefon in der Hand auf und ab geht, nickt mir nur kurz zu, bevor sie sich wieder abwendet.
»Nein, ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Es gibt nichts, was ich behalten wollen würde.«
Ich ziehe mir einen Stuhl heran. Sie will nichts behalten? Geht es um den Nachlass meiner Großmutter?
»Mit wem telefoniert sie?«, frage ich.
»Mit dem Anwalt.«
»Mit einem Anwalt? Welchem Anwalt? An einem Sonntag?«
Mein Vater bedeutet mir mit einer Geste, leise zu sein.
»Wenn Sie sich darum kümmern würden, wäre ich Ihnen dankbar«, sagt meine Mutter gerade. »Natürlich, Sie können sich jederzeit melden. Auf Wiederhören.«
Nur ein kurzes Ausatmen verrät ihre Anspannung, als sie sich umdreht. »Die Beerdigung ist in zwei Wochen. Ich soll eine Urne aussuchen. Ich weiß jetzt auch, welches Bestattungsinstitut sich darum kümmert. Am besten, ich sehe mir nachher gleich mal deren Homepage an.«
Sie beginnt, den Tisch abzuräumen, was mir unpassend erscheint, trotzdem stehe ich auf, um zu helfen.
»Willst du hinfahren?«, frage ich, als ich die Marmelade in den Kühlschrank stelle.
»Nein.« Meine Mutter stellt klappernd die Teller in die Spülmaschine. »Das lässt sich alles auch von hier aus organisieren.«
Sie klingt sachlich, fast schon abweisend, und ich werfe meinem Vater durch die geöffnete Tür zum Esszimmer einen Blick zu. Was genau läuft hier gerade? Ist das Selbstschutz, oder was?
»Wie ist es eigentlich passiert?«
Weil meine Mutter mich nur fragend ansieht, füge ich hinzu: »Wie ist meine Großmutter gestorben?«
»Ein Aneurysma im Bauchraum. Es wurde zu spät erkannt.«
»Das tut mir so leid.«
»Es ist traurig«, bestätigt meine Mutter, als ginge es um etwas ganz Alltägliches.
»Was ist mit meinem Großvater? Sie war doch verheiratet, oder? Lebt er noch?«
»Nein. Er ist schon vor Jahren gestorben.«
»Dann war sie ganz allein, als sie starb?«
Das ist eine taktlose Frage, und ich würde sie gern zurücknehmen, doch meine Mutter scheint davon nicht übermäßig getroffen.
»Ich weiß es nicht, Jule. Ich nehme an, sie hatte Freundinnen.« Sie schließt die Klappe der Spülmaschine. »Bestimmt war sie nicht allein. Wischst du noch mal über den Tisch? Ich bin im Büro.«
Das Zimmer, das meine Eltern als Büro bezeichnen, liegt im Keller. Für mich ist es seit jeher mit den Worten Bitte nicht stören verknüpft.
Meine Mutter verlässt die Küche, und ich bleibe mit dem Gefühl zurück, etwas Entscheidendes verpasst zu haben.
»Es nimmt sie ziemlich mit«, sagt mein Vater.
Normalerweise hat er sonntags nach dem Frühstück immer etwas zu tun, er verschwindet in seiner Werkstatt oder kümmert sich um den Garten. Jetzt jedoch sitzt er noch immer im Esszimmer am Tisch und wirkt, als habe jemand ihn dort vergessen.
Ich schüttele den Kopf und setze mich zu ihm. »Vorhin sah es so aus, aber inzwischen kommt es mir so vor, als sei für sie überhaupt nichts passiert. Wie schafft sie es, alles wieder einfach zur Seite zu schieben? Ich meine – ihre Mutter ist gestorben!«
Er hebt beide Hände und lässt sie wieder sinken. »Du kennst sie doch.«
Kenne ich meine Mutter? Keine Ahnung. Im Moment bin ich mir da nicht so sicher.
»Ich würde gern etwas tun, um ihr zu helfen«, murmele ich.
»Lass es sie einfach auf ihre Art regeln«, erwidert er.
»Wieso hatten wir eigentlich keinen Kontakt zu ihr? Zu meiner Großmutter, meine ich.«
Mein Vater schweigt einen spürbaren Moment, bevor er eine Antwort formuliert. »Das ist eine Sache, über die sollte wohl deine Mutter selbst mit dir reden.«
»Also ist es ein Geheimnis?«
Es ist wohl normal, dass man als Kind Erwachsenendinge vorenthalten bekommt. Mittlerweile allerdings bin ich sechsundzwanzig und hatte erwartet, mein Vater würde offen mit mir reden.
»Es ist eine Sache, die ich nicht über den Kopf deiner Mutter hinweg mit dir besprechen möchte«, stellt er jedoch klar. »Vielleicht wird sie dir irgendwann davon erzählen. Im Moment halte ich es allerdings für keinen guten Zeitpunkt, sie danach zu fragen.« Er legt seine Hand über meine. »Ich sehe mal nach ihr.«
Sobald die Tür sich hinter ihm geschlossen hat, stehe ich auf. Ich trete ans Fenster. Die Gardine riecht nach Wäschestärke und vergangenen Zeiten. Von hier aus kann man in den Garten der Nachbarn sehen.
Ein Streit. Es muss ein Streit gewesen sein. Eine Auseinandersetzung zwischen meiner Großmutter und meiner Mutter, so heftig, dass etwas zerbrochen ist. Bereut meine Mutter, dass es nun keine Aussprache, keine Versöhnung mehr geben kann? Ist das der Grund für diese Verzweiflung, die so plötzlich aus ihr herausgebrochen ist?
Trotz ihrer Zurückhaltung hat meine Mutter immer großen Wert auf Offenheit gelegt, jedenfalls sobald es mich betraf. Dinge, die man ständig beiseiteschiebt, wachsen und mutieren und werden zu Monstern.
Ich mustere das Telefon auf der Kommode, das da so unschuldig steht, als habe es am Vormittag nicht alles aus den Fugen gerissen, daneben ein Hochzeitsfoto meiner Eltern. Meine Mutter ganz in Weiß, blond und mit einem so strahlenden Lächeln, wie man es selten an ihr sieht, und mein Vater, ein großer, gut aussehender Mann mit dunklen Haaren und Tränen in den Augen. Ich liebe dieses Bild.
Ein lang zurückliegender Bruch, ein nie bezwungenes Monster. Ein Familiengeheimnis. Je länger ich darüber nachdenke, desto größer wird mein Bedürfnis, mit jemandem darüber zu reden, und ich halte mein Smartphone schon in der Hand, als mir klar wird, dass ich Jasper nicht anrufen kann.
Ich lege das Handy auf den Tisch und gehe ins Wohnzimmer.
Es beginnt zu klingeln, als habe Jasper gespürt, dass ich gerade an ihn gedacht habe. Mit Sicherheit ist er es. Ich ignoriere das Geräusch, bis es endlich abbricht, und dabei sehe ich mich selbst auf dem Boden liegen, Jasper über mich gebeugt.
Kurz schließe ich die Augen, dann schalte ich den Fernseher ein. Eine junge Frau hat einen Bauwagen ausgebaut und führt die Kamera stolz hindurch. Ich höre zu, wie sie etwas über ihren Kohleofen erzählt, und frage mich, wie meine Großmutter gewohnt hat. Alles ist möglich, ein Bauwagen genauso wie eine Sozialwohnung in Berlin-Marzahn oder eine Stadtvilla in München Grünwald. Ich weiß fast nichts über sie, weder über ihr Leben noch über ihren Tod.
Vor etwas über einem Jahr war mein Vater in der Klinik. Nur ein Routineeingriff, Gallensteine. Am nächsten Abend hat er sich melden wollen, stattdessen kam ein Anruf meiner Mutter. Komplikationen bei der Narkose.
Jasper ist gefahren und hat dabei versucht, mir Mut zuzusprechen, während ich mich auf das kribbelnde Gefühl in Armen und Beinen fokussierte, um die Angst im Zaum zu halten, mein Vater könne sterben, ohne dass ich ihn vorher noch mal gesehen hätte.
Meine Mutter wird nur noch rechtzeitig zu einer Beerdigung kommen. Und obwohl ich sie noch nie so außer sich wie am Vormittag erlebt habe, scheint sie jetzt so ruhig und gelassen wie immer zu sein. Was verbirgt sich dahinter?
Meine Eltern haben sich auf einem Nick-Cave-Konzert in der Hugenottenhalle kennengelernt. Sie küssten sich zum ersten Mal zu The Weeping Song, und zwei Jahre später kam ich zur Welt. Doch alles, was vor diesem Moment liegt, an dem mein Vater sich zu meiner Mutter durchgeboxt hat, liegt für mich im Dunkeln.
Das Handy klingelt schon wieder.
»Jule?« Mein Vater steckt den Kopf zur Tür herein. »Es ist Jasper.« Er hält mir das Telefon entgegen.
»Hab ich mir gedacht.«
»Willst du nicht rangehen?«
»Nein.«
Das Klingeln verstummt, und ich warte auf das unvermeidliche Warum.
»Was schaust du dir da an?«, fragt er und legt das Telefon auf den Wohnzimmertisch.
»Weiß ich nicht genau. Minimalistisches Leben in einem Bauwagen.«
Er setzt sich neben mich. Gemeinsam verfolgen wir den Bericht über ein Paar, das seit acht Jahren in einem Van umherreist, und danach die Geschichte eines Aussteigers, der in den Höhlen von La Gomera lebt. Während der sich anschließenden Dokumentation über Bären kommt meine Mutter herein.
»Was macht ihr?«
Mein Vater legt einen Arm um meine Schultern. »Quality time vor dem Fernseher.«
Meine Mutter wirft einen kurzen Blick auf den Bildschirm, wo eine Bärin ihre Jungen gerade zum ersten Mal aus der Höhle führt, in der sie geboren wurden.
»Ich kümmere mich ums Abendessen.«
»Lass das doch, wir könnten auch was bestellen.«
»Nein, ist schon gut, ich mach schon. Bleibt ihr ruhig sitzen«, fügt sie hinzu, als mein Vater Anstalten macht aufzustehen. »Mir ist gerade nicht nach reden.«
»Dann reden wir eben nicht«, erwidert er und erhebt sich.
Ich schalte den Fernseher aus.
***
Es gibt Nudelauflauf. Stille hängt über dem Tisch, bis mein Vater sich schließlich auf seinem Stuhl zurücklehnt. »Du willst ihr Haus also wirklich verkaufen?«, fragt er, als führe er eine Unterhaltung fort.
Meine Mutter sieht nicht vom Teller auf. »Was soll ich sonst damit anfangen?«
»Willst du nicht wenigstens vorher noch einmal alles durchgehen? Vielleicht gibt es doch Dinge, die du behalten möchtest.«
»Ich habe all die Jahre nichts vermisst und gehe nicht davon aus, dass sich das plötzlich ändern wird.«
Ich lasse die Gabel sinken. »Aber das kannst du doch nicht ernst meinen. In diesem Haus liegen bestimmt jede Menge Erinnerungen. Was soll damit passieren?«
»Ich bin mir noch nicht sicher.« Meine Mutter nimmt sich noch etwas von dem Auflauf. »Es gibt Entrümpelungsunternehmen.«
»Entrümpelungsunternehmen? Du willst alles einfach entsorgen?«
»Es muss ja nicht unbedingt heute entschieden werden«, kommt mein Vater der Antwort meiner Mutter zuvor. »Es bleibt noch genügend Zeit, über alles nachzudenken – du solltest mit dem Verkauf nur nichts überstürzen.«
»Also, ich würde es zumindest gern mal sehen. Das Haus.« Das ist mir herausgerutscht, doch es stimmt. »Warum fahren wir nicht zusammen hin und gehen alles in Ruhe durch?«
»Weil es dafür keinen Grund gibt«, erwidert meine Mutter. »Ihr Anwalt sagte, die ganze Sache sei schon entschieden, und zwar seit Jahren. Das Haus wird an die Gemeinde verkauft – meine Mutter selbst hat das offenbar so bestimmt, damit habe ich gar nichts zu tun.«
»Doch nicht mit all den persönlichen Dingen, die sich darin befinden, oder?«
Ich registriere den warnenden Blick meines Vaters durchaus, doch das hier ist keine Frage nach längst zurückliegenden Konflikten – ich will einfach nur etwas über meine Großmutter und meine Mutter erfahren, was soll daran verkehrt sein?
»Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es dort irgendetwas gibt, das ich gern behalten würde.« Freundlich und klar. Meine Mutter hat mit der Diskussion bereits abgeschlossen.
»Was ist mit Fotos? Vielleicht gibt es auch Briefe oder Tagebücher oder …«
»Jule«, unterbricht mich mein Vater. »Lass es gut sein.«
Er sagt es sanft, will mich nicht vor den Kopf stoßen. Dennoch fühle ich mich bevormundet.
»Was spricht denn dagegen, zumindest mal hinzufahren?«
»Um ehrlich zu sein, begreife ich nicht, wieso dir das so wichtig ist.« Er runzelt die Stirn. »Du hast sie nicht einmal gekannt.«
Das stimmt. Doch sogar als mein Vater in der Klinik lag, ist meine Mutter nicht so aufgewühlt gewesen wie heute Vormittag. Und jetzt sitzt sie beim Abendessen und verhält sich so verdammt normal – es muss einen Grund dafür geben.
»Vielleicht möchte ich genau deshalb mehr über sie erfahren«, beharre ich und schiebe meinen Teller ein Stück zurück. »Weil ich sie nicht gekannt habe. Immerhin war sie meine Großmutter.«
»Und sie war die Mutter deiner Mutter, und wenn …«
»Jule hat vielleicht recht.«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: