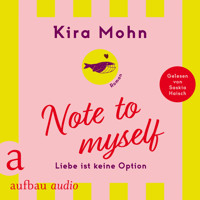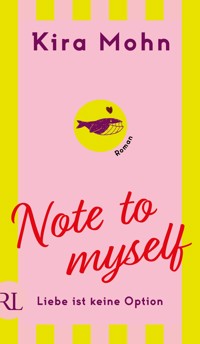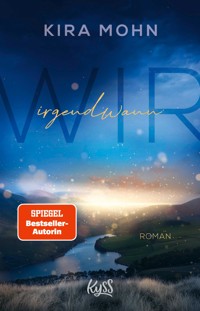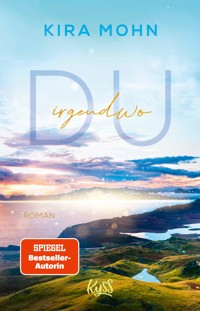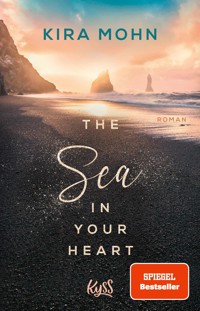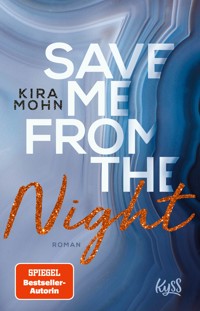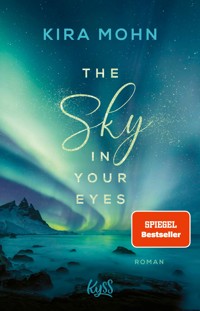9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Leuchtturm-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Der Beginn einer einzigartigen Romance-Trilogie über drei junge Frauen, einen Leuchtturm und die große Liebe – für alle Fans von Mona Kasten, Laura Kneidl und Colleen Hoover Auszeit! Diese Überschrift schreit Liv geradezu an, als sie deprimiert Stellenanzeigen durchforstet. Nach dem Journalistik-Studium wollte sie eigentlich durchstarten, aber ein verpatztes Interview hat sie gerade den ersten Job gekostet. Da hört sich die Anzeige, in der für sechs Monate ein Housesitter für einen Leuchtturm auf einer kleinen Insel vor der irischen Küste gesucht wird, wie ein Traum an. Eine Auszeit ist genau das, was sie jetzt braucht. Sie bewirbt sich, und nur wenige Wochen später steht Liv vor ihrem neuen Zuhause. Und zwar zusammen mit einem gutaussehenden Iren, der ihr Herz erst zum Klopfen, dann zum Überlaufen und schließlich zum Zerbrechen bringt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Kira Mohn
Show me the Stars
Roman
Über dieses Buch
Auszeit! Diese Überschrift schreit Liv geradezu an, als sie deprimiert Stellenanzeigen durchforstet. Die 22-Jährige steht eigentlich erst am Anfang ihrer Karriere als Journalistin, aber ein verpatztes Interview hat sie gerade den Job gekostet. Da hört sich die Anzeige, in der für sechs Monate ein Housesitter für einen Leuchtturm in Irland gesucht wird, wie ein Traum an. Eine Auszeit ist genau das, was sie braucht. Zeit, um den Kopf frei zu kriegen, um wieder zu sich selbst zu finden. Sie bewirbt sich, und nur wenige Wochen später steht Liv vor ihrem neuen Zuhause. Und zwar zusammen mit einem gutaussehenden Iren, der ihr Herz erst zum Klopfen, dann zum Überlaufen und schließlich zum Zerbrechen bringt …
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg, August 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Matt Porteous/gettyimages
ISBN 978-3-644-40572-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Want to rewrite the story of my life,
only broken pencils, torn papers around.
1
An fast jedem Schreibtisch in dem offenen Großraumbüro der Globus-Redaktion wenden sich mir die Gesichter zu, als ich an diesem Vormittag beschwingt die Tür zu Jan Brehmers Besprechungsraum hinter mir schließe.
So wie mich alle angucken, hat er die frohe Botschaft über mein Interview offensichtlich schon in der Redaktion verkündet, doch die Euphorie meines Redaktionsleiters teilt nicht jeder: Einem Großteil der Belegschaft ist deutlich griesgrämige Skepsis anzusehen.
Ausgerechnet mir, der noch nie in den Fokus des allgemeinen Interesses geratenen Liv Baumgardt, soll es gelungen sein, an Kristina Atkins heranzukommen? Diese irre Schauspielerin, Exkinderstar, die sich seit Jahren in einer Villa am Strand von Santa Monica verkriecht, mit niemandem mehr spricht und mit Reportern erst recht nicht? Das will keinem in den Kopf.
Ginge es um einen Christian Atkins, würde es in der Gerüchteküche sicher demnächst überkochen. Aber nachdem ich Kristina Atkins im Austausch für ein Interview kaum mit Nacktbildern von mir bestochen haben kann, werden hoffentlich keine allzu haarsträubenden Behauptungen die Runde machen.
Ich habe das fertige Interview erst heute Morgen an Jan Brehmer geschickt. Er hat mich sofort in die Redaktion gebeten. Zum Glück nicht, um mich zurechtzuweisen, weil ich ihm bisher nichts davon erzählt hatte – ich wollte erst sicher sein, dass es mit dem Interview auch wirklich klappt –, sondern um meine Eigeninitiative als freie Mitarbeiterin zu loben, ein paar Textänderungen zu besprechen und mir die weiteren Maßnahmen zu erläutern, die in erster Linie auf Vorabwerbung abzielen. Jetzt schwebe ich förmlich zwischen den Schreibtischreihen hindurch.
Klaus Maaßen tritt mir in den Weg. «Herzlichen Glückwunsch.» Nach beinahe zwanzig Jahren beim Globus ist Maaßen ein Urgestein in der Redaktion und der Mensch mit dem falschesten Lächeln dieser Erde. «Wer hätte gedacht, dass ein junges Ding wie Sie bereits über solche Kontakte verfügt?»
«Ach, Kristina und ich haben uns nur zufällig auf einer Party getroffen», erwidere ich leichthin. «Bei einem meiner Wochenendtrips. Was junge Dinger eben so tun.» Ich schicke ein kurzes Lachen hinterher und achte sorgfältig darauf, daraus kein Grinsen entstehen zu lassen.
Klaus Maaßen reckt einen unsicheren Daumen nach oben und wendet sich ab, um seine Verwirrung zu verbergen.
Es ist weiß Gott nicht das erste Mal, dass er oder einer seiner alteingesessenen Kollegen mich mehr oder minder subtil auf meine mangelnde Erfahrung hinweisen. Erfolge in dieser Größenordnung stehen den jüngsten Mitarbeitern nicht zu, und wenn es sich auch noch um eine freie Mitarbeiterin handelt – eine, die froh sein muss über jeden Schnipsel Tratsch und Klatsch, den sie im Unterhaltungsressort veröffentlichen darf –, schon gleich gar nicht.
«Liv!» Dana winkt mit beiden Armen, und ich mache einen Schwenk zu ihrem heutigen Arbeitsplatz, froh, endlich jemanden ehrlich anstrahlen zu können. Dana ist Volontärin beim Globus. Sie hat keinen eigenen Schreibtisch, deshalb steht ihr Notebook im Moment vor dem Rechner einer Kollegin, die sich für diese Woche krankgemeldet hat. Ebenso wie ich arbeitet Dana auf eine feste Redakteursstelle hin, doch obwohl ich mein Journalismus-Studium in Rekordzeit und mit guten Noten abgeschlossen habe, ist sie mir ein Stück voraus, was dieses Ziel betrifft. In ihrem zweiten Jahr beim Globus hat sie bereits mehrere Ressorts durchlaufen, im Kulturressort arbeitet sie nun auf eigenen Wunsch. Ich dagegen bin nach dem Studium eher zufällig hier gelandet – um beim Globus arbeiten zu dürfen, hätte ich sogar die Rezepte-Ecke übernommen, gäbe es eine. Wobei Rezepte vielleicht sogar interessanter wären als die kurzen Promi-News, die ich derzeit für die Online-Ausgabe schreibe. Doch jetzt, nach meinem Interview mit Kristina Atkins, kann ich vielleicht darauf hoffen, in Zukunft über gehaltvollere Themen berichten zu dürfen.
«Und? Was hat Brehmer gesagt?», will Dana wissen. «Heute Morgen hat er in der Redaktionssitzung von deiner Heldentat erzählt. Er tat ganz cool, aber ich wette, ihm ist einer abgegangen vor Glück.»
Zufrieden lehne ich mich an die Schreibtischkante. «Das Interview hat ihm sehr gut gefallen.»
«Natürlich hat es ihm gefallen! Das ist ein Riesending.» Dana streckt den Rücken durch, bevor sie sich gegen die rotgepolsterte Lehne des Drehstuhls sinken lässt. «Ein Interview mit Kristina Atkins, dem abgewrackten Kinderstar. In dem sie auch noch über Privates spricht und nicht nur über ihre albernen Teenie-Filmchen.»
«Ich mochte Und irgendwo ich.»
Mit einer beiläufigen Geste tut Dana meine Bemerkung ab. «Schickst du’s mir nach dem Überarbeiten zu? Ich übernehme das Korrektorat für dich. Und hast du jetzt noch Zeit? Wir könnten zusammen mittagessen.»
Eigentlich hatte ich vor, mir zu Hause eine Fertigpizza in den Ofen zu schieben und beim Essen erst das Interview zu überarbeiten und anschließend die nächsten Promi-News zu schreiben, die daneben nicht untergehen dürfen. Aber nachdem mir nach Feiern zumute ist und Danas Mittagspause ohnehin nur eine Stunde dauert, sitzen wir kurz darauf vor zwei Tellern im überfüllten Friedhelms, einem angesagten Hamburger Mittagscafé in der Nähe, und bemühen uns, einander über klapperndem Besteck und den Gesprächen an den anderen Tischen hinweg zu verstehen.
«Ich würde diese Info auf keinen Fall draußen lassen.» Gerade hat Dana ihre Spaghetti unter einem Berg Parmesan begraben. «Du solltest die Gerüchte zumindest anreißen.»
Eigentlich würde ich lieber von jedem Detail meines Gesprächs mit Jan Brehmer erzählen, doch sie ist viel interessierter daran, mehr über mein Interview mit Kristina zu erfahren.
«Ich habe es Kristina versprochen, Dana. Sie will nicht, dass es öffentlich breitgetreten wird.»
«Warum hat sie dann überhaupt darüber geredet?»
«Das hat sich einfach so ergeben.»
Dana weiß nicht, dass ich Kristina Atkins jahrelang Fanbriefe geschrieben habe, nachdem ich sie in der Serie Lilly & Snowflake zum ersten Mal gesehen hatte. Damals wohnte ich noch nicht bei meinen Großeltern, sondern zog mit meiner Mutter, die im diplomatischen Dienst arbeitet, alle paar Jahre um – Kristina auf Englisch schreiben zu können, war wenigstens ein Vorteil unseres unsteten Diplomatenlebens. Sydney, New York, Kopenhagen – von den meisten Ländern habe ich nicht mehr im Kopf behalten als ein paar Namen und Gesichter aus den jeweiligen Internationalen Schulen und vereinzelte Erinnerungen an die Kindermädchen, die meine Mutter für mich einstellte, bis ich in die vierte Klasse kam. Vater unbekannt. Meine Mutter redet nie über ihn.
Ich war damals zehn oder elf, Kristina nur wenig älter. Wegen ihr wollte ich reiten, obwohl Pferde mir aufgrund ihrer Größe nicht geheuer waren, wegen ihr weigerte ich mich, mit Zöpfen in die Schule zu gehen, und wegen ihr wollte ich mir sogar meine dunkelbraunen Haare blond färben.
Unmöglich zu zählen, wie viele Briefe Kristina Atkins von mir erhalten hat. Ein einziges Mal erhielt ich eine Antwort, eine Autogrammkarte mit einigen unverbindlichen Zeilen. Ich führte mich auf, als habe mir der süßeste Junge der Schule einen Liebesbrief geschrieben.
Es dauerte lang, bis sich meine Bewunderung für Kristina auf ein normales Maß einpendelte, und kurz nachdem das passierte – ich muss etwa fünfzehn gewesen sein –, verschwand sie weitestgehend von der Bildfläche. Was man noch von ihr hörte, betraf Drogen, Alkohol und Nervenzusammenbrüche, und als ich irgendwann las, sie sei in einer Klinik, setzte ich mich hin und schrieb einen Brief an die letzte Fanadresse, die ich von ihr besaß.
Zu behaupten, sie habe sich gefreut, von mir zu hören, wäre wohl übertrieben, doch sie erinnerte sich an mich – wie hätte sie auch das Mädchen vergessen können, das ihr einmal eine türgroße Collage aus Pferdebildern geschickt hatte, jedes einzelne davon so weiß wie Snowflake?
Dieses Mal erhielt ich keine Autogrammkarte, sondern einen Brief. Er war nicht wirklich persönlich, doch wir blieben lose in Kontakt. Oft vergingen Wochen oder sogar Monate, bis Kristina mir antwortete, und sie erzählte nur sehr wenig über sich. Stattdessen stellte sie mir viele Fragen, die ich gewissenhaft beantwortete. Vielleicht war ich für sie so etwas wie ihre Verbindung zur normalen Welt, weshalb sie den Kontakt nie ganz abbrechen ließ. Aber aus welchem Grund auch immer, als ich sie vor ein paar Wochen fragte, ob sie mir ein Interview für den Globus geben würde, willigte sie tatsächlich ein. Auf gar keinen Fall würde ich jetzt ihr Vertrauen missbrauchen und aus einigen ihrer Bemerkungen irgendwelche reißerische Geschichten zusammenschreiben. Davon hätte ich Dana überhaupt nichts erzählen sollen.
«Wenn sie nicht wollen würde, dass du darüber schreibst, hätte sie diesen Typen gar nicht erwähnt, Liv. Das ist großartige Publicity für sie, für so was interessiert sich jeder. Leibwächter vergeht sich an Kinderstar!»
«So war es doch gar nicht. Die beiden waren zusammen.»
«Er war acht Jahre älter als sie. Wäre das aufgeflogen, säße er jetzt im Knast.»
Ich schüttele den Kopf. «Sie war fast achtzehn, als das zwischen ihnen begann. Und jetzt lass es gut sein, ja?»
«Und warum willst du nichts über ihre Wahnvorstellungen schreiben?»
«Weil sie das nicht möchte.»
«Na und?»
«Dana!»
Dana wickelt seelenruhig Spaghetti auf die Gabel. Ein paar Nudeln lösen sich wieder, als sie damit auf mich zeigt, Soße landet auf der Tischplatte. «Entspann dich, Liv», erwidert sie friedfertig. «Du musst echt noch einiges lernen. So kommst du nicht weit.»
Mein Magen zieht sich unangenehm zusammen, während ich den Blick auf meine Pizza richte und mich frage, ob sie recht hat. Natürlich will ich vorankommen. Aber nicht so. Nicht, indem ich mich wie ein Trüffelschwein durch das Privatleben anderer Menschen wühle, auf der Suche nach etwas, das sich publicitygenerierend unters Volk werfen ließe. Jan Brehmer zumindest schien nichts zu vermissen. Stattdessen will er das Interview noch in die Dezemberausgabe packen, er will dafür Werbung schalten, und er hat bei unserer Verabschiedung etwas gesagt, das mein Herz höherschlagen ließ: «Klaus Maaßen wird zum Ende des Jahres beim Globus aufhören, wissen Sie das bereits? Wir werden seine Arbeit, auch für die anderen Ressorts, neu verteilen müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch etwas für Sie dabei wäre, was meinen Sie?»
Allein beim Gedanken daran muss ich schon wieder lächeln.
«Was sagt Brehmer denn zu den Schaf-Ladys, über die du schreiben willst?», unterbricht Dana meine Gedanken.
Woher weiß Dana denn ... ach richtig, ich hatte ihr ja von den beiden älteren Damen erzählt, die sich über eine Zeitungsannonce fanden, mittlerweile auf einem Hof in der Nähe von Winsen leben und dort Schafe halten.
«Ich habe ihn noch nicht darauf angesprochen.»
«Aber das wolltest du doch?»
«Ich dachte, ich mache das nach der Veröffentlichung des Atkins-Interviews.»
Dana wirft mit einem Schulterzucken die Serviette auf ihren Teller. «Meine Meinung dazu kennst du.»
Da Dana mit ihrer Meinung normalerweise nie länger als maximal vier Sekunden hinter dem Berg hält, kenne ich sie natürlich: Sie findet ein Porträt über alte Frauen und Schafe sterbenslangweilig.
«Darf ich Ihnen noch etwas bringen?» Die Kellnerin ist an den Tisch getreten, um die Teller abzuräumen, und hat dabei Danas leeres Wasserglas entdeckt.
«Nein, ich möchte zahlen.» Dana bückt sich nach ihrer Tasche. «Ich muss zurück. Wann schickst du mir das Interview?»
«Heute Abend. Es sind nur noch ein paar Kleinigkeiten zu ändern.»
«Alles klar. Ich lese es Korrektur und leite es dann zur Freigabe direkt an Kristina Atkins’ Management weiter, in Ordnung?»
«Wenn dir nichts Größeres auffällt, gern. Brehmer hat es eilig damit.»
«Klar hat er es eilig damit. In ein paar Stunden wird es online groß angekündigt», erwidert Dana mit einem Grinsen. «Kommst du diese Woche noch mal in die Redaktion?»
«Nein, vorerst ist alles geklärt.»
«Na dann – überleg dir schon mal ein paar Fragen für deine Schaf-Ladys. Garantiert lässt Brehmer dich demnächst da ran.» Sie schlingt sich ihren extralangen Schal um den Hals, bis kaum noch ihre Nase zu sehen ist, und greift nach ihrer Tasche. «Wir hören uns.»
Den Nachmittag verbringe ich an Harvey. Harvey ist mein Schreibtisch, ein antikes Ungetüm aus Wurzelholz. Hätten sich die Platte und die Füße nicht abschrauben lassen – kein Mensch hätte das Ding jemals durch die Tür meiner winzigen Mietwohnung gebracht.
Eigentlich ist Harvey für Häuser mit Flügeltüren und Salons bestimmt, aber bereits in seinem vorherigen Zuhause musste er darauf verzichten. Zuletzt stand er im Arbeitszimmer meines Opas, von ihm erhielt Harvey auch seinen Namen. Schon bevor ich zu meinen Großeltern zog, war ich oft damit beschäftigt gewesen, die Schubladen und Klappen von Harvey zu inspizieren und mit den Füllfederhaltern, die ich fand, kurze Geschichten auf dem schönen Briefpapier meines Opas zu verfassen. Im Gegensatz zu meiner Mutter, die diese Papierverschwendung sicher unterbunden hätte – meine Angewohnheit, vor mich hin zu träumen und dabei Geschichten zu schreiben, hat sie schon immer genervt –, fanden meine Großeltern nichts dabei. An Harvey beschloss ich erstmals, mit dem Schreiben mein Geld zu verdienen, Opa nannte das «eine ehrenvolle Aufgabe». Meine Mutter fand die Idee natürlich absurd, doch sie war ja weit weg und Opa zu begeistert, als dass sie sie mir hätte ausreden können.
Zu Beginn meines Studiums hat Opa mir Harvey geschenkt, das war zu der Zeit, als meine Oma starb, und als wir zwei Jahre später beide aus dem alten Haus zogen, fand er auch neue Besitzer für viele weitere seiner Möbel, darunter für einen Ohrenbackensessel namens Fred und für Fleur, die französische Kommode. Letztere hätte ich liebend gern ebenfalls übernommen, aber Opa, ein leidenschaftlicher Briefeschreiber, bot Fleur einer Postbeamtin namens Cornelia an, die sich sehr über dieses Geschenk freute. In meinem winzigen Ein-Zimmer-Apartment wäre ohnehin kein Platz mehr für Fleur gewesen. Neben Harvey müssen sogar die Billy-Regale den Bauch einziehen.
Sobald er die ihm wichtigsten Dinge gut untergebracht wusste, verkaufte und spendete Opa den Rest, um nach Cheddar in die englische Grafschaft Somerset zu seinem ältesten Brieffreund Ernest Ford zu ziehen. Die beiden Männer schrieben sich bereits seit über dreißig Jahren und hatten sich einige Male gegenseitig besucht, trotzdem beeindruckt mich Opas Entschluss noch heute. Einfach so etwas völlig Neues zu beginnen ... irgendwie macht mich das immer ein bisschen stolz auf ihn.
Wir schreiben uns mindestens zwei- oder dreimal pro Monat. In seinen Briefen berichtet Opa von den Wanderungen, die er mit Ernest unternimmt, und dass sie abends am Kamin sitzen und über das Leben reden. Während ich diese Briefe lese, streichele ich Harvey, und danach seufze ich meistens, bevor ich mich wieder den drängendsten Fragen in meinem eigenen Leben widme, zum Beispiel ob diese eine Schauspielerin jetzt eine Brustvergrößerung nach ihrer Nasen-OP hat vornehmen lassen oder nicht. Nicht im Traum käme ich auf die Idee, solche Details in den Antworten an meinen Opa zu erwähnen, seinen Fragen nach meiner Arbeit weiche ich meistens lieber aus. Im Gegensatz zu meiner Mutter, die ihre Verachtung darüber kaum verbirgt, hat er zwar keine Probleme mit den Promischnipseln, aber ich mag das Bild von mir als ernsthafter Journalistin. Jetzt muss es nur noch Wirklichkeit werden, und das Interview mit Kristina ist der erste Schritt.
Nachdem ich es noch einmal gelesen habe, gönne ich mir eine Pause, um Kaffee zu machen, verbrauche dafür die letzte Milch und beschließe, im nahe gelegenen Supermarkt sofort Nachschub zu besorgen. Kein Leben morgens vor acht Uhr ohne Kaffee.
Auf dem Rückweg begegnet mir im Treppenhaus eine der beiden Studentinnen, die unter mir wohnen. Gerade ist sie dabei, einen Zettel über die Briefkästen im Flur zu kleben.
«Hey!» Sie strahlt mich an. «Kann sein, dass es heute Abend ein bisschen lauter wird. Ich feiere in meinen Geburtstag rein.»
«Alles klar, kein Problem», erwidere ich im Vorbeigehen.
«Wenn du willst, komm einfach auch. Du wirst ohnehin die Musik hören, da kannst du dir auch gern ein Bier dazu nehmen.»
Überrascht bleibe ich stehen. «Das ist nett, vielen Dank.» Im Geiste gehe ich die Dinge durch, die heute noch erledigt werden müssen. «Ich hab noch ein bisschen was zu tun, aber vielleicht schaff ich’s trotzdem.»
«Würde mich freuen. Dann vielleicht bis später.» Sie wendet sich der Haustür zu.
«Okay. Viel Spaß auf jeden Fall!», rufe ich ihr hinterher, bevor ich die Treppen in den dritten Stock hinaufsteige. Eine Party. Ich war schon hundert Jahre auf keiner Party mehr. Das letzte Mal ... das muss meine Abifeier gewesen sein. An der Uni gab es immer eine Seminararbeit, die erledigt werden musste, oder eine Klausur, für die ich den Stoff wiederholen wollte, sodass ich einfach keine Zeit für Partys hatte. Mir die Zeit auch nicht nehmen wollte. Stattdessen trieb mich immer der Gedanke vorwärts, möglichst schnell bei einem angesehenen Magazin Fuß fassen zu müssen, irgendwo eine Stelle zu ergattern, mit der ich meiner Mutter beweisen konnte, dass das Journalismus-Studium keine idiotische Idee war und ich durchaus in der Lage bin, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Mittlerweile habe ich es fast aufgegeben. Keine Ahnung, warum sie einfach alles an meinem Leben zu hassen scheint, ich versuche jedenfalls nicht mehr so oft, es für sie zu ändern. Wann war in ihren Augen schon mal irgendwas von dem, was mir wichtig ist, gut genug? Eben.
Nach dem zweiten Kaffee überarbeite ich die paar Punkte des Interviews, die ich mit Brehmer besprochen habe. Es ist ein tolles Interview, ein wirklich schönes Porträt, und wenn mein Chef tatsächlich mit dem Gedanken spielen sollte, mich aus der Promiecke rauszuholen, dann muss ihn dieser Text einfach überzeugen. Kristina ist nämlich die einzige Person von Bedeutung, die ich kenne. Sollte dieser Trumpf ohne jeden Effekt verpuffen, werde ich mich in naher Zukunft kaum von den Popstars und Königshäusern dieser Erde fortbewegen dürfen.
Als ich jede Änderung gefühlte hundertmal überprüft habe – ich kann das Interview inzwischen fast auswendig aufsagen –, leite ich den Text an Dana weiter und wende mich meinen Promis zu. Königin Sylvia hat vier Kilo abgenommen. Vielleicht ist sie auch magersüchtig. Wüsste nicht, was mich mehr interessieren könnte.
Gelangweilt tippe ich einige Zeilen, dann öffne ich spontan ein zweites Dokument und beginne einen neuen Artikel.
Auf einem frisch renovierten Hof in der Nähe von Winsen leben zwei tatkräftige Frauen, zusammen mit sehr vielen Schafen. Und wer glaubt, Annemarie Lerch (58) und Sarah Tindemann (61) hätten bei der Renovierung ihres Anwesens auf Handwerker zurückgreifen müssen, begeht gleich den ersten Fehler, nämlich diese beiden Damen zu unterschätzen ...
Ich habe mich mit Annemarie und Sarah schon zweimal getroffen. Wenn ich mal so alt bin, werde ich hoffentlich auch noch über so viel Energie verfügen wie die beiden, die ihr Leben noch einmal völlig umgekrempelt haben. Ohne «Ehemänner, die attraktive, jüngere Kolleginnen auf ihren Schreibtischen vögeln», wie Annemarie bei meinem letzten Besuch trocken angemerkt hat. Schade, dass Brehmer dieses Zitat vermutlich nicht durchgehen lässt, wenn er sich denn überhaupt für den Artikel erwärmt. Annemarie zumindest hätte nichts dagegen, sich derart verewigt zu sehen. «Das kannst du ruhig genau so schreiben. Und schreib auch dazu, es war doch kein Versehen, dass sein Smartphone auf dem Cerankochfeld lag.»
Bei dieser Erinnerung muss ich lächeln. Vielleicht wird Brehmer die Idee ja doch mögen. Wie könnte man diesen beiden älteren Damen widerstehen?
Es ist Viertel nach neun, gerade habe ich noch einen schnellen Blick auf das korrigierte Interview geworfen, das Dana mir zur Info zurückgeschickt hat, bevor ich den Rechner herunterfahre. Meine Augen fühlen sich trocken an vom fortwährenden Starren auf den Monitor, und mit einem unbehaglichen Gefühl im Magen stelle ich fest, dass es finster im Zimmer geworden ist. Ich beeile mich, die Deckenlampe anzuknipsen, bevor das Licht des Monitors erlischt. Dunkelheit und ich, wir sind keine Freunde.
Aus der Wohnung unter mir dröhnt Musik, einige Minuten lang mustere ich mein aufgeräumtes Zimmer, die praktischen weißen Bücherregale, die ordentlich glattgestrichene Tagesdecke, unter der sich gepunktete Bettwäsche verbirgt, und den Lesesessel, den ich mir hätte sparen können. Entweder sitze ich an Harvey, oder ich liege in meinem namenlosen Bett, und zwar allein. Immer.
Auf dem Weg in die Küche knipse ich auch die Lampe in der Diele an und stehe anschließend eine Weile vor dem geöffneten Kühlschrank. Kühlschrankmeditiation, hat mein Opa diese Angewohnheit genannt. Als mein Starren leider nicht dazu führt, dass sich eine fertige Mahlzeit vor meinen Augen materialisiert, nehme ich aus der Gemüseschublade eine gummiartige Möhre. Wenig enthusiastisch wedele ich damit hin und her.
Auch in der Küche ist die Partymusik noch zu hören. Kurz entschlossen werfe ich die Mohrrübe zurück und marschiere ins Bad. Statt als Nächstes Meghan Markle zu ihrem gelungenen Outfit zu gratulieren, werde ich jetzt runtergehen. Einfach, um mal hallo zu sagen. Ich kenne keinen einzigen meiner Nachbarn etwas näher – das wird sich jetzt ändern.
Wimperntusche, Kajal, die langen Locken über Kopf bürsten. Das weite Shirt zur engen Jeans dürfte okay sein.
Während ich noch überlege, wo ich mein Handy zuletzt gesehen habe, beginnt es zu klingeln. Es liegt auf Harvey, wo auch sonst, und nachdem ich auf das Display geblickt habe, lasse ich mich auf den Schreibtischstuhl sinken. Meine Mutter. Sind denn schon wieder die üblichen vier Wochen zwischen ihren Anrufen um?
«Liv? Hallo. Passt es dir gerade?»
«Ja, sicher.»
Mit diesen Worten beginnen die meisten unserer Gespräche. Passt es dir? Natürlich. Und wie geht es dir? Gut, und dir? Darauf folgt in der Regel ein mehrere Minuten andauernder Monolog über all die Dinge, die dafür sorgen, dass man als Mitarbeiterin im diplomatischen Dienst kaum eine freie Minute hat, bevor sie mich fragt, wie es Opa gehe und dass sie sich freue, mal wieder mit mir geplaudert zu haben. Diesmal jedoch unterbreche ich den gewohnten Ablauf, bevor sie das Ende des Telefonats einleiten kann. Das, was ich ihr jetzt erzählen werde, müsste ihr doch eigentlich gefallen.
«Ich habe übrigens ein Interview mit Kristina Atkins geführt.»
«Mit wem?»
«Kristina Atkins, weißt du noch? Die Schauspielerin? Die ich früher so mochte? Aus der Pferde-Serie?» Als meine Mutter nicht gleich antwortet, setze ich hinzu: «Sie lebt jetzt in Santa Monica und gibt eigentlich keine Interviews mehr, aber mit mir hat sie geredet.»
«Das ist sehr schön, Liv», erwidert meine Mutter. «Wie geht es Opa?»
«Dem geht’s prima. Aber verstehst du, was das bedeutet? Dieses Interview? Es ist etwas Besonderes, keiner hätte damit gerechnet, dass ausgerechnet ich ...»
«Wie ist dir das gelungen?»
«Bitte?»
«Wie ist es dir gelungen, in die Privatsphäre dieser Schauspielerin einzudringen?»
«Ich bin nicht in ihre Privatsphäre eingedrungen. Ich habe sie einfach gefragt, ob sie mir ein Interview geben würde, und sie hat zugestimmt.» Das Schweigen am anderen Ende macht mich nervös. «Es ist wirklich gut geworden, sehr gut. Es wird schon im Dezember erscheinen, in der Printausgabe, und Herr Brehmer geht sogar davon aus, dass es die Auflage in die Höhe treibt.»
«Herr Brehmer?»
«Mein Redaktionsleiter.»
Abermals vergehen einige Sekunden, und ich beginne damit, meinen Daumennagel gegen Harveys harte Kante zu drücken.
«Liv, was soll ich dazu sagen? Das freut mich natürlich für dich.» Die Worte sind hohl, durchlöchert von der Geringschätzung, mit der sie sie ausgesprochen hat. «Ich muss jetzt leider ...»
«Dadurch komme ich endlich von den Promi-News weg!»
«Du schreibst immer noch diese Klatschnachrichten?» Jetzt trieft ihre Stimme mal wieder vor Verachtung, und ich bereue den letzten Satz augenblicklich.
«Ja, aber das ist es doch. Nach diesem Interview werde ich mit Sicherheit andere Themen bearbeiten dürfen.»
«Na, dann hätte es ja immerhin etwas Gutes, das Privatleben einer Schauspielerin vor der Welt auszubreiten, nicht wahr?», ätzt meine Mutter. «Herzlichen Glückwunsch.»
Ihre Verabschiedung fällt kühl aus. Die Zähne zusammengebissen, lege ich das Telefon auf den Schreibtisch zurück. Jetzt weiß ich wieder, wieso ich es aufgegeben habe, um die Anerkennung meiner Mutter zu betteln. Es ist so sinnlos.
Keine Ahnung, wie lange ich einfach ins Leere starre, aber als endlich die Partymusik wieder zu mir durchdringt, bringe ich mit einem Tastendruck den Monitor des Rechners zum Leuchten. Ich werde jetzt nicht nachlassen, nicht gerade jetzt. Stattdessen werde ich noch heute den Artikel über Annemarie und Sarah fertig schreiben und ihn morgen Brehmer präsentieren. Er wird ihn lieben. Er muss. Ich kann mehr, als nur Unterhaltungstratsch zusammenzufassen. Das Interview mit Kristina ist mein Türöffner – und diese Chance darf ich nicht vergehen lassen. Sobald ich den nächsten Schritt getan habe, ist für irgendwelche Partys immer noch Zeit.
2
Um Viertel nach sechs klingelt der Wecker. Draußen ist es noch so finster, dass ich die Lampen, die ich nachts immer brennen lasse, erst gar nicht ausschalte. Zusammen mit dem ersten Kaffee sitze ich kurz darauf am Rechner, um meine monatliche Kolumne für eine Apothekenzeitschrift anzugehen, die ich bis Montag abgeben muss. Bevor ich damit beginne, schicke ich noch schnell meinen Annemarie-&-Sarah-Artikel an Jan Brehmer, dann schließe ich das Mailprogramm und öffne ein neues, blütenweißes Dokument für fünfundsiebzig bis achtzig Zeilen Hypochondergejammer. Der eingebildete Kranke kommt bei der Apothekenzeitschriften-Klientel gut an, und solange niemand erfährt, dass eine Zweiundzwanzigjährige hinter Heribert Baldauf steht, der sich diesen Monat in Rekordgeschwindigkeit von vagen Kopfschmerzen hin zu einem Hirntumor fabuliert, kann ich damit vermutlich weitermachen. Auch kein Job, an dem mein Herz hängt. Genau genommen bin ich mir nicht mal sicher, was ich schlimmer finde: Hypochonder oder Promis.
Kurz nach elf summt das Handy, und als ich sehe, wer es ist, reiße ich es erfreut an mich. Brehmer. Wenn er so schnell anruft, kann er meine Idee eigentlich nur gut finden. «Hallo?»
«Hätten Sie wohl die Güte, umgehend in die Redaktion zu kommen?»
«Jetzt? Sicher, ich ... worum geht es?»
«Gut. Bis gleich.» Mit diesen Worten legt er auf.
Was war das denn? Verwirrt starre ich aufs Handy. Brehmer hat sich ... sauer angehört. Ganz eindeutig nicht so, als wolle er mir zu meinem guten Gespür für interessante Artikel gratulieren. Vielleicht findet er Schafe genau so langweilig wie Dana? Aber deswegen muss er mich doch nicht in die Redaktion zitieren. Was zum Teufel ist bloß los?
Mit klopfendem Herzen fahre ich den Rechner herunter, versenke das Smartphone in der Tasche, schlüpfe in eine Regenjacke und ziehe mir eine Mütze über die Ohren. Jetzt noch Handschuhe – der Winter hat noch nicht einmal begonnen, aber Hamburg duckt sich bereits Mitte Oktober unter graupeligem Schneeregen –, dann werfe ich die Wohnungstür hinter mir zu und haste die Treppen hinunter.
Geht es vielleicht um das Interview mit Kristina? Hat Brehmer es sich im Laufe des Vormittags noch mal durchgelesen, habe ich etwas übersehen?
Sosehr ich auch grübele, mir fällt nichts ein, das so dramatisch sein könnte, mich umgehend einzubestellen, statt es einfach anzumarkern und mir noch einmal zum Überarbeiten zu schicken.
Beim Betreten der Redaktion schaue ich mich nach Dana um, während ich versuche, meine wirren Haare mit den Fingern zu ordnen. Sie sitzt am selben Schreibtisch wie gestern, und als sie meinen Blick auffängt, hebt sie überrascht die Augenbrauen. Bevor ich mich dem stelle, was Brehmer zu sagen hat, laufe ich zu ihrem Platz – vielleicht weiß sie ja mehr als ich.
«Was machst du denn hier?», fragt Dana. «Ich dachte, du wolltest diese Woche nicht noch mal reinschauen?»
«Brehmer hat angerufen», erkläre ich halblaut. «Er wollte, dass ich sofort komme, und irgendwie klang er nicht besonders freundlich.» Unbehaglich mustere ich die Tür am Ende des Großraumbüros und ignoriere dabei einige in meine Richtung geworfene Blicke. «Hast du vielleicht eine Ahnung, was er will?»
Dana schüttelt den Kopf. Jetzt sieht sie neugierig aus. «Dir noch einmal gratulieren? Für die zu erwartende Auflagensteigerung?»
«Ich hab doch gesagt, er klang eher unzufrieden.» Ich umklammere den Schulterriemen meiner Tasche fester. «Na ja, gleich werde ich es wissen.»
«Ist sicher ganz harmlos.»
Nervös erwidere ich ihr Lächeln und durchquere dann das Büro, um an Brehmers Tür zu klopfen.
«Bitte?» Jan Brehmer sieht auf, als ich den Kopf in sein Zimmer stecke, und lehnt sich in seinem wuchtigen schwarzen Bürostuhl zurück. «Na, da haben Sie sich ja beeilt.»
Er mustert mich wie eine Kakerlake, die gerade eiligst aus der Kanalisation herangekrochen gekommen ist, und es fällt mir schwer, mein Lächeln aufrechtzuerhalten.
«Setzen Sie sich.» Mit einem Räuspern wendet er sich von seinem Rechner ab und dreht sich so, dass er mich über seine verschränkten Finger hinweg ansehen kann. Unsicher lasse ich mich auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch nieder. So angespannt war ich nicht mal vor einigen Monaten, als ich auf ebendiesem Stuhl saß, um mich als freie Mitarbeiterin vorzustellen.
«Das Interview mit Kristina Atkins», beginnt Brehmer, und ich beiße die Zähne zusammen. Es geht also tatsächlich darum. Klar. Worum auch sonst? Warum ich Königin Sylvia doch keine Magersucht angedichtet habe, wird er wohl kaum persönlich mit mir besprechen wollen. «Das Interview mit Kristina Atkins war ein von Ihnen eigeninitiativ erarbeitetes Projekt. Ich kann Ihnen daher nicht wirklich vorwerfen, Sie hätten einen wichtigen Job vermasselt.»
Vermasselt? Wieso denn vermasselt?
«Nichtsdestotrotz hätte ich von Ihnen erwartet, sich Hilfe bei einem erfahreneren Kollegen zu suchen, wenn Sie sich mit einer Aufgabe wie dieser überfordert sehen.»
Ich hätte mir Hilfe suchen sollen? Aber ...
«Nachdem ich das Interview gestern gelesen habe, wurde es online bereits für die nächste Printausgabe angekündigt. Ich denke, das habe ich Ihnen gesagt?»
«Ja, Sie haben ...», beginne ich verwirrt, komme jedoch nicht allzu weit.
«Dann können Sie sich vielleicht vorstellen, dass es für ein Magazin mit unserem hervorragenden Ruf einen beträchtlichen Image-Schaden nach sich zieht, wenn ein bereits angekündigter Artikel nicht erscheint? Zumal ein Artikel in dieser Größenordnung?»
«Aber wieso ...?»
«Ich gebe zu, dass mir beim Lesen des Interviews nichts aufgefallen ist, das Kristina Atkins dazu veranlasst haben könnte, ihre Zustimmung zu einer Veröffentlichung zurückzuziehen, aber vielleicht war ich da voreilig. Nein, mit Sicherheit war ich das. Sie sind sehr jung und noch nicht sehr vertraut mit den Abläufen in einer großen Redaktion ...»
«Würden Sie mir jetzt bitte erst einmal sagen, wo genau das Problem liegt?», platze ich heraus. Es ist vermutlich nicht die beste Idee, Brehmer zu unterbrechen, aber ich verstehe einfach nicht, was hier gerade passiert. «Kristina Atkins will nicht, dass das Interview erscheint? Warum nicht?»
Ein paar Sekunden lang starrt Brehmer mich an, vermutlich, um mir wortlos mitzuteilen, wie sehr ihm mein Verhalten missfällt. Dann greift er nach dem obersten Zettel des Papierstapels, der sich am Rande seines Schreibtischs türmt, und hält ihn mir unter die Nase. Es sind nur einige wenige englische Zeilen, und ich habe sie schnell gelesen.
Kristina Atkins untersagt den Abdruck des Interviews, welches sie am 8. Oktober mit Liv Baumgardt telefonisch geführt hat, da Sinnzusammenhänge entstellt und Aussagen aus dem Kontext gerissen worden sind. Besonderen Wert legt sie darauf festzustellen, dass sie von dem Zerrbild der Wirklichkeit, das dieses Interview darstellt, in höchstem Maße enttäuscht ist.
Als ich den Kopf wieder hebe, spießt Brehmer mich noch immer mit Blicken auf. In diesem Moment kann ich nur nach Luft schnappen. Das darf doch nicht wahr sein.
«Das kam heute Vormittag per Mail von ihrem Management. Ich dachte nicht, mich mit Ihnen über die Methoden einer sorgfältigen Transkription und Zusammenfassung unterhalten zu müssen.»
«Das müssen Sie auch nicht!», widerspreche ich vehement. Meine Stimme ist zu laut, das höre ich selbst, doch ich kann nichts dagegen tun. Wie konnte das passieren? «Es ist ... ich denke ...»
Bereut Kristina, mit mir gesprochen zu haben? Hat sie das Gefühl, sie habe zu viel über sich verraten? Aber ich habe mich strikt an ihre Vorgaben gehalten, ich habe nichts ...
«Frau Baumgardt?» Erschrocken stelle ich fest, dass Brehmer weitergesprochen hat und ich kein einziges Wort davon mitbekommen habe. «Sind Sie noch anwesend?»
«Ich ... Entschuldigung. Ich habe gerade darüber nachgedacht, wieso ...»
«Darum geht es. Finden Sie heraus, was genau einer Veröffentlichung des Interviews im Wege steht, und beheben Sie das.» Er beugt sich vor, und ich bemühe mich, seinem Blick nicht auszuweichen. «Kontaktieren Sie Ms. Atkins’ Management oder an wen auch immer Sie sich gewendet haben, um das Interview zu bekommen. Und bedenken Sie bitte, dass es in diesem besonderen Fall nicht darum geht, irgendwelche haarsträubenden Details ans Licht zu zerren. Ms. Atkins hat trotz des großen öffentlichen Interesses an ihrer Person so lange mit niemandem mehr gesprochen ...»
«Wo lesen Sie denn bitte haarsträubende Details aus dem Interview heraus?» Verflucht, das war schon wieder zu laut. Und außerdem habe ich ihn zum zweiten Mal unterbrochen. «Ms. Aktins war sehr klar darin, was sie veröffentlicht sehen wollte und was nicht», fahre ich mit mühsam beherrschter Stimme fort, doch es ist bereits zu spät.
«Ich war nicht dabei. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo Sie übers Ziel hinausgeschossen sind», knurrt mir mein Chef zwischen zusammengepressten Zähnen entgegen. «Aber so was schreibt niemand ohne Grund.» Er atmet einmal tief durch, bevor er in weniger scharfem Ton weiterspricht. «Schicken Sie mir den Mitschnitt des Gesprächs, dann sehen wir weiter.»
Ich zucke zusammen. Oh verdammt. «Ich habe nur Notizen gemacht.»
Aufseufzend lehnt er sich zurück, noch bevor ich den Satz beendet habe. Inzwischen scheint er mehr resigniert als wütend zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das besser ist. «Wieso das denn?»
«Sie wollte keine Aufnahme.»
«Sie hätten zu Ihrer Absicherung darauf bestehen können! Das wäre auch im Interesse von Ms. Atkins gewesen.» Er reibt sich übers Gesicht, doch als er mich wieder ansieht, ist seine Stimme eiskalt, und ich schlucke gleich zweimal hintereinander. «Wie auch immer Sie es bewerkstelligen – sorgen Sie dafür, dass das Interview wie angekündigt in der Dezemberausgabe erscheinen kann. Sie haben bis morgen Vormittag Zeit.»
«Diese dämliche Kuh!», faucht Dana. So stinkwütend habe ich sie selten erlebt. «Die denkt auch, nur weil sie mal für einen Oscar nominiert gewesen ist, kann sie sich alles erlauben! Du solltest ihr schreiben, dass sie mit ihrem Rückzieher deine Karriere gefährdet! Was denkt die sich eigentlich dabei?» Scharf schnippt sie mit den Fingern, um die Kellnerin im Friedhelms auf uns aufmerksam zu machen. Es ist dieselbe wie gestern, und mit unbewegtem Gesicht nimmt sie unsere heutige Bestellung entgegen. Pasta, ergänzt durch Gin Tonic. Den habe ich jetzt wirklich nötig.
Eigentlich war mir nicht danach, essen zu gehen, doch Dana ließ nach einem Blick in mein Gesicht keine Widerworte zu, und letztlich war es sicher klüger, ihr hier von dem ganzen Ärger zu erzählen statt im Büro, wo es um uns herum garantiert sehr, sehr leise geworden wäre.
Danas Empörung tröstet mich jedoch nur bedingt. Meine einzige Trumpfkarte hat sich in eine miese Karo-Sieben verwandelt, und nichts von dem, was Dana sagt, kann daran etwas ändern.
«Das Interview ist wirklich großartig, Liv», fährt Dana in mein Schweigen hinein fort. «Es gibt überhaupt nichts daran auszusetzen.»
«Irgendwie muss ich Kristina erreichen», murmele ich. «Das gibt’s doch alles gar nicht.»
«Wenn du willst, übernehme ich das Gespräch mit ihrem Management für dich. So down, wie du bist.»
Geknickt schiebe ich mein Glas von links nach rechts. «Danke für das Angebot, aber diesen Rückzieher sollen die mir gefälligst selbst erklären. So plötzlich und ohne jede Vorwarnung.»
Dana nickt bekräftigend. «Das ist echt unmöglich. Wie stehst du jetzt da? Es tut mir echt so leid. Dabei warst du so stolz darauf.»
Das war ich. Sehr stolz sogar. Auch wenn Dana der Ansicht war, ich hätte nicht alles aus diesem Interview herausgeholt. «Vielleicht ist ja alles nur ein Missverständnis?», überlege ich laut. Irgendein Typ quetscht sich an unserem Tisch vorbei und streckt mir dabei seinen Hintern ins Gesicht. Ich bewahre mein Glas vor dem Umstürzen und lehne mich zurück. «Vielleicht hat Kristina irgendetwas falsch verstanden? Vielleicht wurde etwas falsch übersetzt? Du hast ihr das Interview doch genau so weitergeleitet, wie ich es dir geschickt habe, oder?»
«Na klar! Du hast meine Mail mit der korrigierten Fassung doch bekommen. Ich habe nur ein paar fakultative Kommata und ein paar Formatierungen geändert. Ich hätte zwar die ganzen interessanten Details auf keinen Fall draußen gelassen, aber das war ja deine Sache.» Dana schüttelt den Kopf. «Ich denke, sie hat einfach Muffensausen gekriegt. Offenbar kam der Schritt an die Öffentlichkeit doch zu früh.»
«Ja, vielleicht», erwidere ich ohne Überzeugung. Ich verstehe es einfach nicht. Wenn es darum ginge, hätten wir das Interview auch kürzen können. Oder sie hätte schlicht gesagt, dass sie ihre Meinung geändert hat. Aber in der E-Mail von ihrem Management stand, Kristina hielte das Interview für ein Zerrbild der Wirklichkeit. Ich bin ziemlich sicher, dass mein Interview das nicht war.
«Vielleicht war sie einfach noch nicht so weit und bereut das Interview inzwischen. Oder ihre Wahnvorstellungen sind doch heftiger als gedacht.» Dana greift nach meiner Hand. «Wäre jedenfalls gut möglich. Trotzdem war es natürlich nicht in Ordnung, dich so auflaufen zu lassen.»
Das stimmt allerdings. Die Kellnerin tritt mit unserem Essen an den Tisch, und ich entziehe Dana die Hand, um nach meiner Gabel zu greifen. Es interessiert mich wirklich, was Kristina zu alldem zu sagen hat.
Nichts. Kristina Atkins, Bewahrerin unzähliger Liv-Baumgardt-Briefe, sagt zu der ganzen Geschichte einfach – nichts.
Mein Wecker war heute Morgen kaum aus, da habe ich schon zum Handy gegriffen und mein Mailpostfach kontrolliert. Aber auch kein «Bitte, bitte, bitte»-Denken, bis die Seite fertiggeladen hatte, konnte irgendetwas an der Tatsache ändern, dass sich unter Werbemist und SPAM keine einzige Nachricht von Kristina befand.
Verdammt! Wieso tut sie das?
Ich besitze keinerlei Möglichkeit, sie direkt zu kontaktieren, außer über ihre Mailadresse. Ihr Management hat mir gestern schon klipp und klar erklärt, dass sie das Thema als erledigt betrachten und ich sie nicht weiter belästigen möge. Trotzdem verbringe ich den Morgen damit, noch drei weitere E-Mails zu schreiben und zwischendurch wie eine Irre durch die Wohnung zu tigern. Als ich schließlich geschlagen die Telefonnummer von Jan Brehmer anwähle, weiß ich nicht, was ich noch tun soll. Seit gestern habe ich Kristina sieben Nachrichten geschickt, auf die sie allesamt nicht reagiert hat. Ich war freundlich. Ich war höflich. Ich war verzweifelt. Ich habe das korrigierte Interview, das Dana mir weitergeleitet hat, noch einmal durchgelesen, es mit meinen Notizen verglichen, den gesamten Text übersetzt und Kristina im Anschluss alles noch einmal geschickt, mit der Bitte, mir mitzuteilen, was ihr nicht gefallen habe – doch jede Reaktion blieb aus.
Brehmer dagegen reagiert sofort. «Frau Baumgardt. Ich hoffe, Sie haben eine erfreuliche Botschaft für mich.»
Er klingt so frisch, energiegeladen und ausgeschlafen, dass ich froh bin, ihm in dieser Sekunde nicht gegenüberzusitzen.
Im Laufe des Vormittags habe ich nicht nur Mails ins Nirwana versendet, sondern auch viel zu viel Kaffee getrunken. Jetzt sitze ich mit manisch wippendem Fuß an Harvey, den Blick auf mein geöffnetes Mailpostfach gerichtet.
«Frau Baumgardt? Haben Sie mit Ms. Atkins gesprochen?»
«Nein, ich ...» Angestrengt unterdrücke ich ein nervöses Lachen. «Leider hat sie auf all meine Kontaktversuche nicht geantwortet.»
Am anderen Ende bleibt es still, und mit jeder Sekunde, die vergeht, verkrampft sich mein Magen mehr. Das alles ist nicht gut. Gar nicht gut.
«Nun», hebt Jan Brehmer endlich an. «Dazu gibt es jetzt leider nicht viel zu sagen. Ich habe die Vorabwerbung auf unserer Homepage bereits gestern herausnehmen lassen. Jetzt muss ich die Verlagsleitung informieren.» Er macht eine Pause, die die Worte zu Stahlspitzen werden lassen. «Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.» Es klickt, bevor ich mich auch nur von ihm verabschieden kann.
Er wünscht mir noch einen schönen Tag. Genauso gut hätte er mir auch noch ein schönes Leben wünschen können.
Grob reibe ich mir mit dem Arm über die brennenden Augen. Tja. Das war’s dann wohl. Immerhin habe ich meiner Mutter gegenüber nicht gelogen, als ich zu ihr sagte, ich würde demnächst diese bescheuerten Promikurzmeldungen abgeben. Dass ich dann aber so gut wie arbeitslos sein werde ... das erzähle ich ihr für Erste besser nicht. Ich habe ihren vorwurfsvoll-selbstgerechten Ton auch so schon im Ohr. Ich hab’s dir doch gesagt. Deine Schreiberei bringt nichts.
Egal. Tief durchatmen.
Mit geschlossenen Augen atme ich ein paarmal bewusst ein und aus.
Es ist ein Rückschlag, mehr nicht. Daraus werde ich jetzt kein Drama machen. Auch wenn die Arbeit beim Globus etwa zwei Drittel meiner Einnahmen ausgemacht hat. Wenn die wegfällt, ist mein einziger regelmäßiger Auftrag die Kolumne für die Apothekenzeitschrift. Das Honorar dafür reicht aber nicht mal annähernd für die Miete meiner Wohnung, und spätestens im Dezember werden meine kümmerlichen Ersparnisse aufgebraucht sein. Wie soll ich denn so schnell an neue Aufträge kommen? Unwahrscheinlich, dass Jan Brehmer mir ein Empfehlungsschreiben mitgeben wird.
Trotzdem gibt es Schlimmeres. Ich bin zwar quasi arbeits- und demnächst obdachlos, aber immerhin gesund, worüber sollte ich also heulen?
Ich zögere einen Moment, weil wir außerhalb der Arbeit eigentlich nicht so viel miteinander zu tun haben, doch dann wähle ich Danas Nummer. Es klingelt viermal, bevor sie rangeht. «Liv? Hi. Alles okay bei dir? Hast du Kristina Atkins erreicht?»
«Nein.» Verdammt. Meine Augen brennen immer noch, dabei habe ich doch gerade festgestellt, dass es nichts zu heulen gibt. «Ich hab ihr unendlich viele Mails geschrieben, aber sie hat einfach nicht darauf geantwortet.»
«Kannst du sie nicht anrufen?»
«Sie hat für das Interview mit unterdrückter Nummer angerufen.»
«Ach so ...» Im Hintergrund sind Stimmen zu hören, jemand lacht. «Was sagt Brehmer dazu?»
«Na ja, was wohl.» Mein Versuch, unbeschwert zu klingen, misslingt mir gründlich. «Dass er es bereut, mich jemals kennengelernt zu haben, so ungefähr.»
«Ach, Liv. So ein Mist.»
Schweigen breitet sich zwischen uns aus, unterbrochen irgendwann durch ein schnelles «Leg’s einfach dahin, ich seh’s mir gleich an» von Danas Seite.
«Du bist beschäftigt», stelle ich fest.
«Sorry, ja, aber ich melde mich später noch mal bei dir, okay? Dann können wir in Ruhe reden», erwidert Dana, und ihre Stimme klingt mitleidig. «Es tut mir echt leid, Liv. Brehmer kommt vielleicht auch wieder runter.»
Sekunden später lege ich das Smartphone behutsam auf die Schreibtischplatte. Mir ist übel. Müde betrachte ich die Unterlagen auf meinem Schreibtisch.
Klug wäre wohl, jetzt einfach etwas Produktives zu tun. Mich mit neuen, überzeugenden Ideen bei Zeitungen und Zeitschriften bewerben. Vielleicht biete ich meinen Bericht über Annemarie und Sarah einfach einer anderen Zeitschrift an? Ich meine, alte Frauen und Schafe, das ist doch ...
Ich glaube, ich brauche jetzt erst mal einen Gin Tonic.
Ein paar Stunden später würde ich zwar nicht behaupten, es ginge mir wirklich besser, aber immerhin habe ich irgendwann den Laptop angeschaltet. Daneben steht ein Glas mit Gin, das Tonic Water ist mir schon vor einer ganzen Weile ausgegangen.
Was hat es mir eigentlich gebracht, dieses beschissene, überflüssige, dämliche Studium in Rekordzeit heruntergerissen zu haben? Frustriert mustere ich die Liste mit Kontaktdaten von festangestellten Journalisten, mit denen ich bereits zu tun hatte. Eine zweite Liste mit namhaften Zeitungen und Magazinen, zu denen ich noch keinen Kontakt hatte, habe ich ebenfalls angelegt. Die erste ist erbärmlich kurz, während die zweite immer weiter wächst.
Ich habe mich so ins Zeug gelegt, habe mich um nichts anderes gekümmert als um meine Seminare und Hausarbeiten. Ich habe jedes Praktikum mitgenommen, das ich kriegen konnte, habe nächtelang durchgearbeitet, um möglichst viele Pflichtkurse in einem Semester unterzubringen, und wo hat mich das hingebracht? In die Promiecke des Globus und von dort aufs Abstellgleis. Mit zweiundzwanzig. Ausgebremst, gegen die Wand gefahren, den ersten wirklich wichtigen Job – wie sagte Brehmer es doch so deutlich? – vermasselt. Versiebt. In den Sand gesetzt. Und ich weiß nicht mal, woran es gelegen hat, verflucht!
Seit geraumer Zeit unterdrücke ich das Bedürfnis, Kristina noch eine Mail zu schreiben, in der ich ihr sage, was ich von ihr halte. Meine Pferdecollage sollte ich zurückfordern und all meine Briefe. Unsere Beziehung ist beendet.
Auf dem Weg zur Toilette halte ich mich erst an Harvey, dann am Türrahmen fest. Mittlerweile ist es dunkel geworden, und ich brauche mehrere Anläufe, um Küche, Diele und schließlich das Badezimmer zu erleuchten. Miese kleine, schwankende Lichtschalter.
Dana hat sich auch nicht mehr gemeldet, dabei ist es schon ... ist es schon fast sieben. Sie sitzt bestimmt noch in der Redaktion fest, trotzdem hätte sie ja zwischendurch mal anrufen können. Immerhin bin ich ihre einzige Freundin, und mir geht es verdammt noch mal dreckig.
Moment mal, nein, das ist falsch. Sie ist meine einzige Freundin. Das ist wohl etwas anderes. Vielleicht ist sie nicht mal eine richtige Freundin. Mehr eine Arbeitskollegin, mit der ich mich hin und wieder zum Essen treffe, und wenn das zukünftig nicht mehr stattfindet ...
Beim Weg zurück an meinen Schreibtisch stoße ich mir die Zehen an der Türschwelle, und mit einem Aufschrei hüpfe ich durch den Raum, knalle mit der Hüfte gegen eine von Harveys spitzen Ecken und stolpere beim Versuch, mich hinzusetzen, fast über den Stuhl.
Oh Gott, geht’s mir schlecht. Und keinen interessiert das. Was, wenn ich mir eben nicht die Hüfte gestoßen, sondern den Schädel an der Schreibtischplatte einschlagen hätte? Wetten, das würde ewig niemand mitbekommen? Wem sollte das schon auffallen? Mit meiner Mutter ist erst in ungefähr vier Wochen wieder zu rechnen, Opa würde ein oder zwei ausbleibende Briefe vermutlich auf die Post schieben, und beim Globus würde mich auch niemand mehr vermissen. Mir bleibt nur noch Heribert Baldauf, der Hypochonder, und ich glaube, den lasse ich in meiner nächsten Kolumne an gebrochenen Zehen sterben. Blutvergiftung oder so was.
Zählt es als Selbstmordgedanke, wenn man sein literarisches Alter Ego umbringen will? Irgendwie kommt mir das bedenklich vor. Ich sollte mich besser wieder meiner Zukunftsplanung widmen. Die zweite Liste ist noch nicht annähernd vollständig.
Mein Blick schweift zum leuchtenden Monitor.
Oder vielleicht ...
Ich gebe ‹Stellenangebote› in die Suchmaschine ein. Wieso nicht? Mal gucken, ob irgendetwas dabei ist, das ich übergangsweise tun könnte, an irgendeiner Kasse sitzen oder so. Um demnächst nicht unter irgendeiner Brücke sitzen zu müssen.
Elektronikerin, medizinische Fachangestellte, Mitarbeiter im Außendienst. Projektleiter und Teamassistenten, an die Anforderungen gestellt werden, die ich dank meines Gin-umwaberten Hirns nicht mal aussprechen kann. Ein Citrix-Administrator? Was um alles in der Welt ist das denn? Durchführung von 2nd-Level-Tätigkeiten im Rahmen des Entstörprozesses und der Problembearbeitung – bitte was? Mit Sicherheit wird aus mir keine Citrix-Administratorin.
Warum steht hier nirgendwo ‹Job für unfähige, frustrierte Anfang Zwanzigjährige. Besondere Kenntnisse nicht erforderlich, kaum vorhandenes Selbstvertrauen von Vorteil›?
Ich scrolle und scrolle, über Business Teamleiter und Softwareentwickler, Volljuristen, Bankkauffrauen und Sales Consultants. Mein Leben unter der Brücke wird schön. Ich werde Blumen pflanzen.
AUSZEIT!
Hastig scrolle ich zurück. Auszeit? Jemand sucht eine Auszeit? Zwischen den Stellenangeboten? Ich klicke auf die Anzeige.
AUSZEIT!
Housesitter für mindestens sechs Monate gesucht, möglichst ab sofort. Kost und Logis frei, großzügiges Taschengeld. Ideal für eine Person, die keine Probleme damit hat, für die Dauer des Aufenthalts weitestgehend vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen zu sein.
Konzentriert lese ich die Anzeige gleich dreimal hintereinander. Sie ist bereits über eine Woche alt, aber diese Zeilen sind so wenig aussagekräftig, dass sich vielleicht nicht viele Leute beworben haben? Ich meine, wer will schon ganz realistisch für mindestens sechs Monate aus seinem bisherigen Leben aussteigen?
Sechs Monate.
Ein Stift rollt über die Schreibtischkante, als ich mich nach der Ginflasche strecke, um ein winziges Schlückchen nachzuschenken.
Bestimmt steht dieses Haus am Ende der Welt, irgendwo, wo niemand hinwill. Sonst wäre die Anzeige sicherlich mit mehr Details gespickt. Vielleicht ist das Haus auch gar kein Haus, sondern ... sondern ein Baumhaus im Regenwald, irgendwo in dreißig Metern Höhe. Oder eine Höhle.
Eine Höhle wäre schlecht.
Es sei denn, es handelt sich um eine ausgebaute Höhle mit Lichtschaltern. Und Whirlpool. Darüber ließe sich doch bestimmt ein spannender Artikel schreiben. ‹Wie ich sechs Monate in einer Luxus-Höhle am Ende der Welt lebte.›
Eine Weile denke ich darüber nach, bevor ich den Kopf schüttele und schnell wieder damit aufhöre, weil mir dadurch schwummerig wird. Besser keine Höhle.
Mein Blick fällt wieder auf die Anzeige. Auszeit.
Die Zeit anhalten, innehalten, nachdenken. Vielleicht kämen mir am Ende der Welt ja neue Ideen. Je länger ich diesen Gedanken hin und her drehe, desto besser gefällt er mir.
Meine Wohnung ließe sich bestimmt untervermieten. Es wäre eine Atempause. Ich könnte in dieser Zeit nach neuen Aufträgen suchen. Und Probleme damit, vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen zu sein, habe ich überhaupt keine. Ich besitze kein gesellschaftliches Leben.
Bei dieser Tatsache angekommen, setze ich mich so aufrecht hin, wie es mir aktuell möglich ist.
Natürlich hat sich niemand auf diese kleine, unscheinbare Anzeige hin gemeldet, weil die nämlich für mich geschrieben wurde, für die kleine, unscheinbare Liv Baumgardt, wohnhaft in Hamburg-Ottensen. Sie wurde für mich geschrieben, um mich davor zu bewahren, von meinen Katzen angefressen zu werden, sollte ich in meiner Wohnung sterben.
Während ich noch mit der Frage kämpfe, ob es trauriger ist, von seinen Katzen angefressen zu werden oder nicht einmal Katzen zu besitzen, die einen anfressen würden, führe ich den Mauszeiger zu dem Wort ‹Kontakt› unter der Anzeige. Anschließend brüte ich mehrere Minuten lang über eine geeignete Anrede.
Sehr geehrter Anzeigenersteller/Sehr geehrte Anzeigenerstellerin.
Das liest sich jetzt irgendwie minder eloquent, aber vielleicht verdeutlicht es sehr schön, dass ich für ein gesellschaftsloses Leben geschaffen bin.
Mit Interesse habe ich Ihre Anzeige gelesen und würde mich sehr gern um die Stelle als Housesitterin irgendwo im Nirgendwo bewerben.
Moment, stand in der Anzeige ‹Irgendwo im Nirgendwo›? Egal, es wird schon passen.
Ich würde mich freuen, wenn Sie noch niemanden gefunden hätten, dem stärker danach ist, ab morgen sechs Monate lang im australischen Dschungel zu leben.
Irgendetwas habe ich da, glaube ich, durcheinandergebracht, aber was soll’s.
Falls Sie doch bereits jemanden gefunden haben, werde ich demnächst mein Quartier unter einer hübschen Hamburger Brücke beziehen und lade Sie sehr herzlich ein, mich dort zu besuchen.
Bisschen Druck machen. Kann nicht schaden. Ob ich zusätzlich erwähnen sollte, dass ich eventuell sogar von Katzen angefressen werde?
Noch ein Schlückchen. Wie voll war diese Ginflasche eigentlich?
Die Katzen lasse ich weg, man muss es ja nicht übertreiben. Stattdessen füge ich meine Kontaktdaten hinzu, setze einen freundlichen Gruß unter alles und klicke auf Senden.
So. Damit wäre mein Leben dann wohl gerettet. Zumindest für die nächsten sechs Monate.
Ungelenk erhebe ich mich, um eine Tasche zu packen. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe, geht es ja morgen schon los.
Irritierenderweise scheint der Boden meinen Füßen entgegenzukommen. Taumelnd schleppe ich mich durchs Zimmer, betrachte eine Weile meine Sporttasche, die in gefühlt acht Metern Höhe oben auf dem Kleiderschrank liegt, und setze mich dann sehr behutsam auf das Bett. Es scheint sachte vor- und zurückzuschwingen. Mir wird schwindelig. Und auch ein bisschen übel.
Vielleicht ... kümmere ich mich einfach morgen um alles Weitere. Reicht ja sicher, wenn ich mittags losfahre.
3
Das Licht der Deckenlampe fräst sich durch meine geschlossenen Augenlider. Stöhnend rolle ich mich auf den Bauch und presse das Gesicht ins Kissen, in dem Versuch, den pochenden Schmerz in meinem Schädel zum Verstummen zu bringen.
Die Ereignisse des vergangenen Tages erreichen mein Hirn nur in einzelnen Fragmenten.
Oh Gott.
Kristinas Rückzieher. Das Gespräch mit Jan Brehmer. Gin Tonic. Gin ohne Tonic.
Mühsam setze ich mich auf und sehe mich mit halb zusammengekniffenen Augen um. Immerhin scheint es mir gelungen zu sein, mich nicht in irgendeine Ecke zu übergeben.
Mit einem Ächzen schiebe ich vorsichtig die Beine über die Bettkante. Einen Filmriss hatte ich bisher nur ein einziges Mal im Leben, auf einem Musikfestival. Damals bin ich in einer Klinik aufgewacht, die Roadies hatten mich – eine kaum noch ansprechbare Minderjährige – ohne viel Federlesens von den Sanis abtransportieren lassen.
Insofern sollte ich jetzt vermutlich dankbar sein, ohne Zeugen in Richtung Bad schwanken zu dürfen, statt in die besorgten Augen meines Opas blicken zu müssen.
Vielleicht wird mir dieser Blick aber noch zuteil, wenn ich ihn demnächst fragen muss, ob ich zu ihm und Ernest ziehen darf. Ausgehend von meinem aktuellen Kontostand, kann ich noch die Miete für November bezahlen. Und genug Essen, um nicht zu verhungern, müsste auch noch drin sein. Aber das war’s dann auch. Wenn ich innerhalb des nächsten Monats keine größeren Aufträge auftue, wird es eng. Und nur im allergrößten Notfall werde ich meine Mutter um Hilfe bitten, vielleicht nicht einmal dann.
Im Bad spritze ich mir jede Menge kaltes Wasser ins Gesicht, bevor ich aus den zerknitterten Klamotten steige und mich unter die Dusche stelle.
Zwanzig Minuten später fühle ich mich fast menschlich. Die feuchten Haare zu einem unordentlichen Knoten gewickelt und in mein Lieblingssweatshirt gehüllt, schlurfe ich in die Küche, um die Kaffeemaschine anzuwerfen. Keine Neuordnung des eigenen Lebens ohne Kaffee.
Während die Maschine vor sich hin röchelt, suche ich nach dem Handy und finde es auf Harvey. Es versetzt mir einen Stich zu sehen, dass Dana sich nicht mehr gemeldet hat. Klar, wir telefonieren nicht täglich miteinander, aber irgendwie bin ich doch davon ausgegangen, dass sie mich an einem Tag wie gestern nicht vergessen würde.
Mit immer noch pulsierendem Schädel setze ich mich an den Schreibtisch, klappe den Laptop auf und überprüfe meine Mails. Vielleicht hat Kristina ja doch ...? Aber nein.
Gibt bestimmt Leute, die sich mit traurigen Tatsachen sehr viel schneller abfinden als ich.
Ein Tastendruck öffnet die erste meiner beiden Redaktionslisten. Okay, da stehen sie alle und warten. Warten auf zündende Ideen, innovative Vorschläge, spannende Artikel.
Noch einmal stehe ich auf, weil mittlerweile der Kaffee durchgelaufen ist. Ich gieße mir eine erste Tasse ein, gebe warme Milch dazu, setze mich damit zurück an Harvey – und beginne zu brüten.
Gegen halb drei habe ich ein Dokument mit elf Ideen. Elf potenzielle Aufträge, mehrere davon ließen sich zu einer Serie ausbauen. Ich sortiere sie unter die passenden Ansprechpartner und beginne, Begleitschreiben aufzusetzen. Textproben und eine Kurzvita für die Redaktionen, mit denen ich noch nie etwas zu tun hatte, also für die meisten. Meiner Apothekenzeitschrift biete ich einen Beitrag über die positiven Aspekte veganer Ernährung an. Ich selbst bin Vegetarierin, aber damit kann heutzutage keiner mehr punkten, viel zu unspektakulär.
Um sechs habe ich alle meine Ideen in die Welt gejagt, die meisten an gleich mehrere Redaktionen, und einigermaßen zufrieden recke ich seufzend die Arme in Richtung Decke. Seht alle her, Liv Baumgardt, erwachsen, souverän und wieder Herrin ihres Lebens.
Gerade überlege ich, ob ich zur Feier des Tages mal wieder kochen sollte, vielleicht sogar vegan, der Recherche wegen, da summt mein Handy. Dana, denke ich, und habe das Gespräch bereits angenommen, bevor mein Hirn die Information verarbeitet hat, dass eine unbekannte Nummer auf dem Display steht. Mein Herz beginnt schneller zu schlagen. Vielleicht schon eine erste Reaktion auf meine Mail-Armada?
«Guten Tag, Max Wedekind mein Name. Spreche ich mit Liv Baumgardt, deren künftiger Wohnsitz sich unter einer von Hamburgs Brücken befinden wird, sollte dem nicht schnellstens entgegengewirkt werden?»
Mir verschlägt es für mehrere Sekunden die Sprache. «Verzeihung ...?», erwidere ich schwach. Ein paar Erinnerungsfetzen der letzten Nacht drängeln sich bereitwillig in das schwarze Loch des Entsetzens, das sich in mir auftut. Ach du Scheiße.
«Ich sitze gerade vor Ihrem Schreiben, mit dem Sie sich auf meine Anzeige hin als Housesitterin bewerben. Sie sind doch Liv Baumgardt, oder?»
«Ja», bringe ich mit zu hoher Stimme heraus und räuspere mich schnell. Oh Gott, wie peinlich. In fliegender Hast gleiten meine Finger über die Tastatur, auf der Suche nach der Mail, die ich offenbar vergangene Nacht an den eindeutig amüsiert klingenden Herrn am anderen Ende der Leitung geschickt habe.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte, lass nicht alles von dem stimmen, was sich mir gerade auf einer mit Scheinwerfern bestrahlten Bühne inmitten meines Hirns präsentiert.
Australischer Dschungel, lese ich und das mit den Brücken. Herrgott, ich kann wohl froh sein, nicht auch noch die leichenfressenden Katzen hinzugefügt zu haben.
«Besteht denn tatsächlich Interesse an dieser Aufgabe?»
Herr Wedekind hat eine tiefe Stimme, er spricht langsam und mit leicht norddeutschem Akzent. Und er ist sehr geduldig, davon ausgehend, wie unbeirrt er die Sekunden verstreichen lässt, in denen ich nach einer Antwort suche.
«Sicher», bringe ich schließlich heraus, obwohl ich in diesem Moment alles andere als sicher bin. «Es wäre ...»
Was genau wäre es denn? Mir eine Freude? Sehr aufregend? Ausgesprochen bescheuert?
«Dann schlage ich vor, dass wir uns persönlich treffen, um einen Eindruck voneinander zu gewinnen und eventuell die genauen Details zu besprechen», füllt Herr Wedekind die sich schon wieder ausdehnende Gesprächspause. «Wann würde es Ihnen denn passen?»
«Also ...» Nett von Herrn Wedekind, dass er trotz des Eindrucks, den ich gerade am Telefon abgebe, mehr von mir hören will. «Ich könnte es noch diese Woche einrichten.»
«Dann vielleicht gleich morgen Nachmittag? Fünfzehn Uhr?»
Zwei Minuten später habe ich Herrn Wedekinds Adresse auf der Schreibtischunterlage notiert und lege das Smartphone daneben.
Verrückt.
Das ist absolut verrückt.
Warum habe ich einem Treffen zugestimmt? Auf keinen Fall werde ich sechs Monate am Arsch der Welt verbringen, sei es in Australien oder sonst wo. Ich sollte jetzt gleich zurückrufen und dem freundlichen Herrn Wedekind genau das erklären.
Stattdessen stehe ich auf und gehe in die Küche, um mal wieder vor der geöffneten Kühlschranktür nachzudenken.
Wie sähe so etwas wohl im Lebenslauf aus? Wie die Flucht einer Sozialphobikerin?
Gleichmäßig brummt der Kühlschrank vor sich hin, während mein Blick über Margarine, Milch und ein angebrochenes Plastikschälchen Hummus schweift. Ich hätte Lust auf Sushi, aber das kann ich mir nicht mehr leisten. Lieber Nudeln kochen und das Hummus aufbrauchen.
Vielleicht sähe es so aus, als hätte ich die Arbeit beim Globus unterbrochen, um ... um ... irgendwie neue Erfahrungen zu sammeln. Neue Eindrücke. Den eigenen Horizont erweitern. Gibt es nicht sogar Seminare in Klöstern für gestresste Manager? Wo alle sitzen und schweigen, monatelang? Okay, mit Anfang zwanzig falle ich wohl nicht unter die Kategorie ‹gestresste Managerin›, aber es könnte aufgeschlossen wirken. Mutig. Bereit, festgefahrene Pfade zu verlassen. Ich schmeiße die Kühlschranktür zu und setze Nudelwasser auf.
Letzten Endes bedeutet ein Treffen mit Herrn Wedekind noch überhaupt nichts. Damit unterschreibe ich ja nicht gleich einen Vertrag. Gut möglich, dass ich nicht einmal seinen Vorstellungen entspreche – es schadet also nicht, mir das morgen einmal anzuhören.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: