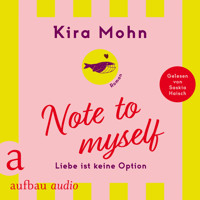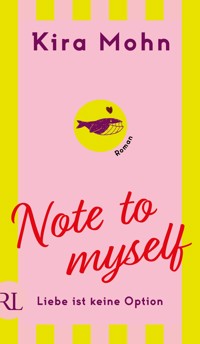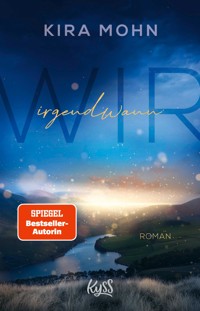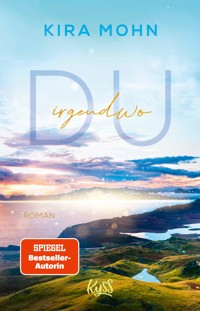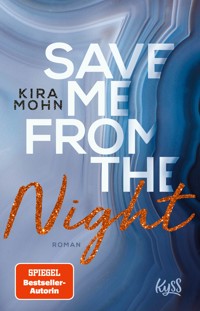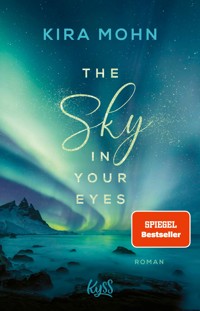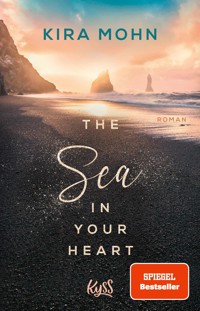
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Island-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein Herz wie das Meer: stürmisch, wild und frei. Lilja lebt für das Meer. Sie verbringt den Großteil ihres Arbeitstages auf dem Atlantik, um bei Whalewatching-Touren nach den sanften Riesen Ausschau zu halten. Privat engagiert sie sich in einer Umweltorganisation für den Schutz der Ozeane und nimmt an Protestaktionen gegen den Walfang teil. Dementsprechend wenig Zeit hat sie für Männer. Eine Beziehung steht definitiv nicht auf Liljas Prioritätenliste – bis sie im Licht von Islands Mitternachtssonne einen Mann kennenlernt, dessen Lächeln einfach unwiderstehlich ist. Sie verbringt eine magische Nacht mit ihm. Doch was Lilja nicht weiß: Jules ist jemand, auf den sie sich nie hätte einlassen dürfen … Mitternachtssonne und Vulkanstrände. Band 2 der Island-Reihe, das Sommerbuch. Unabhängig lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Kira Mohn
The Sea in your Heart
Roman
Über dieses Buch
Ein Herz wie das Meer: stürmisch, wild und frei.
Lilja lebt für das Meer. Sie verbringt den Großteil ihres Arbeitstages auf dem Atlantik, um bei Whalewatching-Touren nach den sanften Riesen Ausschau zu halten. Privat engagiert sie sich in einer Umweltorganisation für den Schutz der Ozeane und nimmt an Protestaktionen gegen den Walfang teil. Dementsprechend wenig Zeit hat sie für Männer. Eine Beziehung steht definitiv nicht auf Liljas Prioritätenliste – bis sie im Licht von Islands Mitternachtssonne einen Mann kennenlernt, dessen Lächeln einfach unwiderstehlich ist. Sie verbringt eine magische Nacht mit ihm. Doch was Lilja nicht weiß: Jules ist jemand, auf den sie sich nie hätte einlassen dürfen …
Eine Liebe wie Feuer und Wasser.
Der Abschluss der zweibändigen Island-Reihe. Unabhängig lesbar.
Dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Wenn du dich darüber informieren möchtest, findest du auf unserer Homepage unter www.endlichkyss.de/theseainyourheart eine Content-Note.
Vita
Kira Mohn hat schon die unterschiedlichsten Dinge in ihrem Leben getan. Sie gründete eine Musikfachzeitschrift, studierte Pädagogik, lebte eine Zeit lang in New York, veröffentlichte Bücher in Eigenregie unter dem Namen Kira Minttu und hob zusammen mit vier Freundinnen das Autorinnen-Label Ink Rebels aus der Taufe. Mit der Leuchtturm-Trilogie erschien sie erstmals bei KYSS, mit der Kanada-Reihe gelang ihr der Einstieg auf die Spiegel-Bestsellerliste. In ihren neuen Büchern «The Sky in your Eyes» und «The Sea in your Heart» entführt sie ihre Leser*innen nun in die beindruckende Landschaft Islands. Kira wohnt mit ihrer Familie in München, ist auf Instagram aktiv und tauscht sich dort gern mit Leser*innen aus.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-01029-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«If the oceans die, we die.»
Captain Paul Watson
Für meine unerschrockene, mutige Tochter.
Durch dich wird die Welt ein kleines bisschen besser.
Kapitel 1
Das Wasser ist schwarz, und es weht kaum ein Wind. Weiße Gischt schäumt vor dem Bug unseres Schiffes auf, es riecht nach Salz und Weite und Leben. So würde ich den Duft des Meeres immer beschreiben, aber vor allem an einem Tag wie heute, an dem es darum geht, das Leben zu beschützen.
«Sie sind direkt vor ihnen! Ihr müsst näher ran!» Haukurs Stimme tönt kratzig aus dem Funkgerät.
Elvar hält den Blick über das Steuerrad hinweg starr geradeaus gerichtet. «Wie weit sind sie noch entfernt?»
«Wir kommen zu spät!»
Wir alle hören es aus Haukurs verzerrter Stimme heraus. Wut. Verzweiflung. Angst.
«Flieg über die Harpunen», ordnet Elvar an und überlässt Ari das Steuer. «Du musst alles filmen, hörst du, alles! Und geh so weit runter, wie du kannst, vielleicht hält sie das auf, weil sie kein Bildmaterial liefern wollen.»
Wir kommen zu spät.
Die Free Warrior zerschneidet die Wellen, so schnell sie eben kann, doch wir kommen zu spät. Der Umriss des Walfängers ist noch viel zu weit entfernt, Haukur in seinem Hubschrauber nur ein kleiner Punkt am bewölkten Himmel. Mein Blick fliegt zu Elvar, der angestrengt aus dem Fenster starrt, ein großer Mann mit einem struppigen weißen Bart. Wenn er lächelt, sieht er aus wie einer der Jólasveinar, der Weihnachtsgesellen, doch in diesem Moment ist sein Gesicht so angespannt wie das jedes anderen hier auf der Brücke. Aris Mund ist nur ein schmaler Strich, Sóley wickelt nervös das Ende ihres langen, dunklen Zopfs wieder und wieder um den Finger, während Marcel mit seinen hochgezogenen Schultern wirkt, als wolle er am liebsten losrennen – nur wohin?
Wir können nichts tun. Wir kommen zu spät.
Jetzt sehen wir die Wale. Es sind Minkwale, und ich möchte ihnen zurufen, dass sie abtauchen sollen, so tief es eben geht, doch sie tun das, was sie immer tun. Sie flüchten dicht unter der Wasseroberfläche, viel zu gestresst, um ausreichend Sauerstoff zu tanken. Immer wieder sind ihre glatten Rücken zu sehen.
«Sie zielen auf den direkt vor ihnen!»
Haukur schreit uns an, weil er nichts anderes tun kann, und am liebsten möchte ich mitschreien.
Die Aufbauten des Walfangschiffs sind schwarz, der Teil, der im Wasser liegt, dunkelrot. Als würden sie bereits mit ihren Farben ausdrücken wollen, wofür sie stehen. Für Blut und Tod.
Gestalten sind auf dem Deck zu erkennen, zwei sind ganz vorn, dort, wo die Harpune ist. Und bei der Harpune bleiben sie, obwohl Haukur sie umkreist und wir uns ihnen nähern – so quälend langsam, als sei das alles hier nur ein Albtraum.
Es ist auch ein Albtraum. Aber einer, aus dem ich nicht rechtzeitig erwachen werde.
Eine Explosion lässt mich zusammenzucken, ein krachender Knall, lauter als der Motor unseres Schiffes und die Rotoren des Hubschraubers, und dann ist da nur noch mein Herzschlag, der in meinem Kopf dröhnt. Denn der Wal stirbt lautlos.
Die Leine, die vom Schiff hinunter zum schäumenden Wasser führt, spannt sich, und die Gischt färbt sich rot.
Oh nein. Nein.
«Sie haben ihn getroffen.»
Der Wal bäumt sich auf, dreht sich zur Seite. Die anderen Wale werden langsamer, schwimmen näher zu ihrem verletzten Gefährten. Sie helfen einander. Immer. Und die Walfänger wissen das.
«Jetzt haben sie ein Gewehr am Bug.»
Ein weiterer Knall, nicht ganz so laut diesmal, und der Wal am Ende der Harpunenleine hört auf zu kämpfen.
«Oh mein Gott.»
Wer hat das gesagt? Haukur? Sóley? Ich?
«Film das, Haukur.» Elvars Stimme, gleichzeitig brüchig und doch fest. «Film das. Alles. Das ist eine absichtliche Provokation, ihre Antwort auf unsere Anwesenheit. Und wenn wir daraus noch irgendetwas machen wollen, brauchen wir Aufnahmen.»
Sie haben noch nie vor unseren Augen einen Wal getötet. Noch nie. Normalerweise versuchen sie, uns abzuschütteln, um ohne Störung ihrer grausamen Arbeit nachzugehen, doch heute haben sie offenbar beschlossen, ihre Taktik zu ändern. Es ist ein Schlag ins Gesicht. Ein erhobener Mittelfinger in unsere Richtung.
«Wir haben sie im Stich gelassen», flüstere ich und fühle, wie sich Sóleys Finger um meine schließen.
«Jetzt sind sie zu weit gegangen.» Elvar hält das Funkgerät fest umklammert, seine Knöchel sind so weiß wie seine Haare und sein Bart. «Diesen Wal werden sie nicht auch noch feiern.»
«Was hast du vor?»
In Aris Tonfall schwingt etwas mit, das ich auch auf jedem Gesicht um mich herum erkenne. Ich spüre es selbst: Ich will etwas tun. Irgendetwas. Ich kann nicht nur zuschauen, wie diese Mörder die Harpunen auf den nächsten Wal richten.
«Wir vermasseln diesen Bastarden ihre Party.»
Sie haben damit begonnen, den Wal hochzuziehen, Männer mit roten Helmen, die einfach so tun, als seien wir nicht da. Dabei brechen sie das Gesetz, auch wenn sie behaupten, dass es für sie nicht gilt.
«Direkt auf sie zuhalten! Bug zum Wal!»
«Okay.»
Ich sehe Ari das Steuer umklammern und nicke. Sie haben den Wal getötet, aber sie werden nicht auch noch daran verdienen, indem wir zulassen, dass sie ihn zu ihrem Verarbeitungsschiff bringen, in dieses schwimmende Schlachthaus. Und wir werden ihnen nicht die Zeit geben, auch noch einen seiner Gefährten zu töten. Ganz einfach.
Unser Schiff ist kleiner und sehr viel älter als das der Walfänger. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei diesem Manöver weit schlimmere Schäden davontragen als sie, ist groß – und trotzdem: Sie werden diesen Wal dem Meer zurückgeben. Wir werden sie dazu zwingen. Und auch wenn ich weiß, dass unsere Aktion waghalsig und vielleicht sogar irrsinnig ist – ich will es tun. Denn während sie sich mit uns auseinandersetzen müssen, können die anderen Wale fliehen.
Ich habe Elvar kennengelernt, als er bei einer Veranstaltung der Organisation Wild & Free über Walfang und die Überfischung der Meere gesprochen hat, und jedes seiner Worte hat sich direkt in mein Herz gebrannt. Unmittelbar nachdem er die Bühne verlassen hatte, habe ich mich zu ihm durchgekämpft.
«Ich will bei euch mitmachen», habe ich gesagt und mich bemüht, seinem prüfenden Blick standzuhalten. Ich wollte, dass er spürt, was er in mir ausgelöst hat, und dass ich jedes Wort absolut ernst meinte. In diesem Moment hätte ich, ohne zu zögern, mit ihm das nächste Schiff bestiegen.
«Wenn du bereit bist, dein Leben für das eines Wals zu riskieren, dann melde dich an», war seine Antwort gewesen.
Während Elvar jetzt das Steuer wieder übernimmt und Ari dem Rest der Crew von der Brücke aus Kommandos zuruft, während alle hektisch auf ihre Posten rennen oder sich einfach nur irgendwo festhalten, habe ich das Gefühl, dieser Moment könnte heute gekommen sein.
Trotzdem habe ich keine Angst. Dazu bin ich viel zu sehr geflutet von Adrenalin.
«Passt auf, die Wasserwerfer!», ruft Marcel.
«Scheiß auf die Wasserwerfer», erwidert Elvar.
In der nächsten Sekunde ducke ich mich automatisch vor einer Fontäne, die so hart auf die Scheiben der Brücke trifft, dass ich erwarte, sie jeden Moment bersten zu sehen.
«Marcel! Nimm die Kamera hoch!»
Plötzlich ist eine Stimme aus der Funkanlage zu hören. «Ihr seid zu nah an unserem Schiff. Dreht ab. Ich wiederhole: Dreht ab.»
«Ihr seid zu nah an den Walen», erwidert Elvar.
Ich sehe hinüber zu Marcel, der sich bemüht, mit seiner Kamera alles gleichzeitig einzufangen, und dann zurück zum Walfänger. RESEARCH steht fett in weißen Großbuchstaben auf der Metallwand direkt über den Männern, die noch immer dabei sind, den Wal zu vertäuen, dessen Schwanzflosse mittlerweile bis hinauf zur Reling reicht. Eben hat er noch gelebt. Eben ist er noch durchs Wasser geglitten. Minkwale sind neugierig, beinahe zutraulich, und seit die Walfänger sich auf sie konzentrieren, weil sie die Großwale beinahe ausgerottet haben, wird ihnen genau das zum Verhängnis.
Ich starre den Wal an, während der rotschwarze Rumpf vor uns an Höhe gewinnt.
«Festhalten!», ruft Elvar, und ein Knirschen ist zu hören, das mir bis in die Knochen fährt. Elvar hat im letzten Moment abgedreht, und wir erwischen das andere Schiff schräg, schrammen mit einem grässlichen Schleifen an ihm vorbei, den toten Wal vor uns herschiebend. Um dessen Schwanzflosse ist noch immer das Seil geschlungen, das sich nun wieder abrollt.
«Kappt das Tau! Kappt das Tau!», brüllt Elvar, und ich stürze nach draußen. Wie? Wie bekomme ich das Ding gekappt?
Sóley ist direkt hinter mir, und als ich mich zu ihr umdrehe, spiegelt ihr Gesicht das, was ich fühle – blankes Entsetzen.
«Er wird zerreißen, Lilja!», schreit Sóley. «Der Wal wird gleich zerreißen! Oh Gott!»
Ein Beil! Ich brauche ein Beil.
Die Wasserwerfer im Blick, haste ich über das schwankende Deck bis hin zu einer Klappe, in der Werkzeug aufbewahrt wird. Meine Ohren würden sich am liebsten von selbst versiegeln, weil dieses Kreischen von Metall auf Metall nicht auszuhalten ist. Marcel überholt mich, und nur ein paar Augenblicke später bearbeiten sowohl er als auch ich das straff gezogene Seil mit Hieben, bis die steifen Fasern endlich auseinanderplatzen.
«Verflucht!» Marcel greift sich an den Kopf. Etwas prallt direkt neben mir vom Boden ab und rollt über die schrägen Planken bis zur Wand der Brücke.
Eine Schraubenmutter.
Sie bewerfen uns.
Vermutlich sollten wir dankbar sein, dass sie nicht schießen.
Unser Boot, das bisher durch das andere Schiff nach Steuerbord gedrückt wurde, neigt sich plötzlich zur anderen Seite, weil Elvar uns jetzt wieder von dem Walfänger wegbringt, und ich pralle mit der Schulter heftig gegen die Reling. Über Marcels Gesicht läuft Blut.
«Achtung!», rufe ich, ohne meine eigene Stimme zu hören. «Deckung!»
Das Dröhnen der Wasserwerfer und das Gebrüll von Menschen, die Schiffsmotoren und über allem der Hubschrauber lassen plötzlich ein absurdes Gefühl in mir aufsteigen. Als sei ich unverwundbar und absolut nichts könne mir zustoßen, während ich neben Sóley Schutz hinter der Reling suche.
Das unwirkliche Gefühl hält an, bis Marcel neben mir zusammensackt. Sein Blut vermischt sich mit dem Sprühregen der Wasserwerfer. Scheiße.
«Marcel!» Ich umfasse seinen Arm. «Bist du okay?»
Er schüttelt den Kopf, doch ich kann nicht sagen, ob das eine Antwort auf meine Frage ist oder ob er nur versucht, die Benommenheit loszuwerden. Ich weiß nicht mal, ob er mich überhaupt gehört hat.
«Wir haben’s gleich geschafft!», rede ich trotzdem weiter, brülle Marcel meine Worte entgegen. «Gleich ist es vorbei, okay?»
Er nickt. Gott sei Dank.
Das Geschrei wird leiser, das Prasseln der Wasserwerfer verstummt abrupt, als wir deren Radius verlassen. Sekunden später wage ich es, einen Blick über die Reling zu werfen.
«Ich glaube, sie folgen uns nicht», sagt Sóley.
Nein, es sieht so aus, als seien sie damit beschäftigt, die Schäden zu begutachten, die unser Schiff an ihrem Rumpf hinterlassen hat. Kratzer und Dellen überziehen das Metall, und unsere Free Warrior wird mit Sicherheit nicht besser aussehen.
Elvar beschreibt einen großen Bogen, und einen Moment lang befürchte ich, er werde gleich noch einmal auf das verfluchte Walfangschiff zuhalten, doch dann wird mir klar, dass er nur in Sichtweite bleiben will. Falls sie vorhaben, trotz allem weiterzujagen.
Ein Ächzen neben mir lenkt meine Aufmerksamkeit zurück zu Marcel. Das Blut läuft inzwischen über den Kragen seiner orangefarbenen Jacke.
«Verdammt, Marcel», sagt Sóley. «Wo bist du verletzt?»
Marcel streift sich die schwarze Mütze vom Kopf. Zwischen seinen dunklen Haaren ist die Platzwunde deutlich zu erkennen.
«Kannst du aufstehen?», frage ich und versuche, ihn zu stützen, als er sich schwankend erhebt. Sóley tritt an seine andere Seite. Das Schlingern des Schiffs macht es nicht besser.
«Geht schon», erwidert er. «Wie sieht es aus?»
«Nicht schlimm», behaupte ich. «Du bist ein bisschen blass. Wie fühlst du dich?»
«Ging mir schon mal besser.» Marcel wirft einen Blick auf seine blutverschmierten Finger. «Wenigstens ging es nicht ins Auge.»
Als er jetzt grinst, grinsen Sóley und ich zurück, auch wenn ich befürchte, dass seine Wunde genäht werden muss. Gemeinsam schaffen wir ihn die steile Treppe hinunter zu der Kajüte, die er sich mit Ari und noch zwei anderen teilt.
«Ich suche nach Linda», sage ich, nachdem Marcel auf seiner Matratze sitzt. «Die sollte sich das besser mal ansehen. Sóley, bleibst du hier?»
«Klar.»
«Entspannt euch, mir geht’s gut», erwidert Marcel, bevor er sich plötzlich an den Streben des Stockbetts festhält und Sóley ihn an der Schulter packt.
«Am besten, Linda bringt eine Schüssel mit», erkläre ich beim Verlassen des winzigen Raums. «Falls du kotzen musst. Das könnte eine Gehirnerschütterung sein.»
«Du bist so mitfühlend!», ruft Marcel mir hinterher.
«Eine Schüssel und einen Keks!», gebe ich zurück, aber danach muss ich erst mal tief durchatmen. Wir alle geben uns locker und unbeschwert, aber Marcels Wunde sieht nicht gut aus, und der Tod des Wals geht jedem von uns nahe.
Direkt nachdem ich die Schiffsärztin informiert habe, mache ich mich auf den Weg zurück zur Brücke. In den winzigen Kajüten ist es eng genug, und sollte Linda Unterstützung brauchen, macht Sóley das bestimmt gern. Sie steht auf Marcel, seit er vor sechs Tagen an Bord gekommen ist. Hoffentlich hat es ihn nicht zu übel erwischt, sonst muss er seinen Aufenthalt bei uns gleich wieder beenden.
Ich bekomme gerade noch mit, wie Elvar Haukur zurückbeordert, bevor er sich zu mir umdreht. «Alles okay mit Marcel?»
«Ich glaube schon. Linda ist bei ihm», erwidere ich. «Was machen sie?» Ich deute auf den Walfänger in der Ferne.
«Bisher nichts.» Elvar steht da und blickt durch sein Fernglas. «Die Wale sind weg. Wenn sie weiterfahren, folgen wir ihnen.»
Gut so. Wir setzen uns an ihre Fersen, stören und behindern sie, wo wir nur können, ohne Menschenleben zu gefährden. Jeder Wal, der durch uns am Leben bleibt, trägt dazu bei, seine Population stabil zu halten, während gleichzeitig diese ganze elende Vernichtungsjagd ein winziges bisschen unrentabler wird.
Hoffentlich fahren die Drecksäcke in dieser Saison die deprimierendsten Zahlen ihres Lebens ein, und sollte das nicht ausreichen, sind wir auch nächstes Jahr wieder da. Aufgeben ist keine Option.
Draußen sind Ari und ein paar andere damit beschäftigt, sich einen Überblick zu verschaffen, was die Schäden an der Free Warrior betrifft, und ich beobachte sie dabei, während ich mich gegen die Wand lehne. Jetzt wo das Adrenalin nachlässt, beginnen meine Beine leicht zu zittern.
Gestern haben Delfine unser Schiff fast eine Stunde lang begleitet. Als wüssten sie, dass wir auch für sie kämpfen. Sóley und ich standen zusammen mit Marcel und jedem, der gerade Zeit hatte, an der Reling und versanken im Anblick des tiefen, satten Blau des Meeres. Immer wieder schossen die Delfine aus dem Wasser heraus, in eleganten Sprüngen, pfeilschnell und so unglaublich lebensfroh.
Ich habe schon viele Diskussionen darüber geführt, wie naiv und sogar anmaßend es sei, Tiere zu vermenschlichen, ihnen Emotionen zuzuschreiben, über die sie angeblich gar nicht verfügen, und besonders in solchen Momenten erscheint mir das einfach nur absurd.
Ich bin zweiundzwanzig Jahre alt, mit Sicherheit gibt es eine Million Erfahrungen, die ich erst noch machen muss, aber wenn ich mittlerweile von einem überzeugt bin, dann davon: Tiere empfinden Freude und Glück genauso wie Leid und Trauer. Ja, Trauer. Nicht nur Schmerz.
Und deshalb bin ich froh um alles, das ich dazu beitragen kann, ihnen das Leben zu ermöglichen, das sie verdienen. Frei. Friedlich. Ungestört.
Ari stößt die Tür zur Brücke auf. Obwohl er nur zwei Jahre älter ist als ich, ist er Elvars Erster Offizier und einer der wenigen, die nicht ehrenamtlich an Bord sind, sondern hauptberuflich für Wild & Free arbeiten. «Die Schäden sind nur oberflächlich. Ich denke, wir sind voll einsatzfähig.»
«Gut.» Elvar hat das Fernglas sinken lassen und mustert das Radar. «Sieht so aus, als fahren sie weiter.»
«Dann hinterher», sage ich und erwidere das Lächeln, das Ari mir zuwirft.
«Wie geht’s Marcel?», will er wissen. «Er hat was abgekriegt, oder?»
«Ja, ziemlich heftig sogar. Platzwunde am Kopf.»
Elvar schaut sich zu mir um. «Lilja, klärst du bitte, ob Marcel an Bord bleiben kann?»
«Okay.»
Ari folgt mir, als ich mich auf den Weg zurück zu Marcels Kajüte mache.
«Mit dir ist alles in Ordnung?», fragt er und wischt sich ein paar nasse Strähnen aus der Stirn. Er ist einen halben Kopf größer als ich, mit schulterlangen, dunklen Haaren, die er meistens zurückbindet, und mehreren Tätowierungen auf den Armen, die seine Liebe zum Ozean widerspiegeln. Die älteste ist eine Walfluke in einem Kreis, das Logo von Wild & Free.
«Ja, mich haben sie zum Glück nicht erwischt.»
«Ich meine, wegen des Wals.»
Ein Schatten legt sich über mich. Unmittelbar vor dem Niedergang, der unter Deck führt, bleibe ich stehen.
«Ich hab gehört, was du vorhin gesagt hast.» Ari berührt meinen Arm. «Wir lassen sie nicht im Stich. Das ist genau das, was wir nicht tun, okay? Wir können nur nicht überall sein. Leider.»
Ich sehe in sein ernstes Gesicht. «Okay», erwidere ich und bin dankbar für den kurzen Druck seiner Hand, bevor er loslässt. Eine tröstende Geste, durch die ich spüre, dass ich nicht alleine bin. «Danke.»
Ari nickt. Dann öffnet er den Mund, doch bevor er dazu kommt, noch etwas zu sagen, wird er durch Sóley unterbrochen, die in diesem Moment die steilen Stufen hochsteigt.
«Linda sagt, Marcel ist okay», teilt sie uns mit. «Sie hat die Wunde getackert.»
Ich verziehe das Gesicht. «Wer von euch hat die Schüssel gebraucht? Marcel oder du?»
«Keiner. Marcel war ein Held, und ich hab nicht hingeguckt. Sagt ihr Elvar Bescheid?»
«Klar, mache ich. Deswegen war ich gerade auf dem Weg zu euch. Geh ruhig wieder zurück zu deinem Helden.»
«Hatte ich vor.» Sóley lächelt zuckersüß. «Sind wir schon wieder auf Kurs?»
«Ja, es geht weiter.»
«Diese Drecksbande.»
Mit diesen Worten taucht Sóley wieder ab, und ich drehe mich zu Ari um. «Wenigstens eine gute Nachricht.» Wenn wir wegen Marcel hätten umdrehen müssen, wäre das ein noch viel schwärzerer Tag für uns gewesen als ohnehin schon. «Ich sag’s Elvar. Was machst du?»
«Sobald Haukur gelandet ist, helfe ich ihm beim Sichten der Aufnahmen.»
«Hoffentlich hat er gute Bilder.»
«Garantiert. Ganz umsonst ist dieser Wal nicht gestorben. Ich wette, Haukur hat auch gefilmt, wie wir ihnen den Wal wieder abgenommen haben.»
Bilder des toten Wals tauchen in meinem Kopf auf und wie ich wieder und wieder mit dem Beil auf das steinharte Tau einhacke.
«Hunters will be hunted», sagt Ari und lächelt ein grimmiges Lächeln.
Er hebt eine Hand, und im Vorübergehen schlage ich ein.
Kapitel 2
Im beschaulichen Bárafjörður herrscht mittägliche Ruhe. Ich habe es mir in meiner Pause zwischen der Vormittags- und der Nachmittagstour in der Sonne auf einem der aufgeschütteten Felsen der Mole bequem gemacht, die den kleinen Hafen vor den Wellen des Atlantiks abschirmen. Die Touristen, die in den Cafés in der Sonne sitzen oder die Anschlagtafeln von Jökullstour studieren, sind hier nicht mehr zu hören, und ich genieße die Ruhe, die nur vom Geschrei der Möwen und den anbrandenden Wellen durchbrochen wird. Seit fast zwei Jahren arbeite ich von Februar bis Oktober für den Whalewatching-Veranstalter Jökullstour als Spotterin, um mir die Touren mit Elvar auf der Free Warrior überhaupt leisten zu können.
Es ist ein Job, dem einige Leute von Wild & Free eher skeptisch gegenüberstehen. Auch Elvar ist davon nicht begeistert. Seiner Meinung nach sollte man die Ozeane einfach in Ruhe lassen. Doch er gibt zumindest zu, dass die Walbeobachtung zu einem allgemeinen Umdenken beigetragen hat. Menschen, die Tiere zu lieben beginnen, sind eher bereit, sich für ihren Schutz und den ihres Lebensraums einzusetzen.
Vor wenigen Minuten habe ich meinem Bruder Jón geschrieben, um ihm viel Glück für seine Ausstellung zu wünschen, die morgen beginnt, und während ich jetzt mein Mittagessen auspacke, klingelt das Telefon.
«Elvar hat eine Klage am Hals», eröffnet Sóley mir ohne lange Vorrede.
«Mal wieder?», sage ich.
Jemand wie Elvar wird ständig verklagt. Wild & Free ist keine Organisation, die sich auf Infoveranstaltungen und Petitionen verlässt, Wild & Free handelt, und genau deshalb liebe ich sie.
«Diesmal scheint es was Größeres zu werden. Erinnerst du dich an den Walfänger, den wir vor einigen Wochen gerammt haben?»
Gerade wollte ich in mein Sandwich beißen, jetzt halte ich inne. «Klar.»
Wie könnte ich diesen Tag vergessen? Der Tag, an dem vor meinen Augen der erste und glücklicherweise bisher einzige Wal getötet wurde.
«Der war offenbar im Auftrag eines japanischen Konzerns unterwegs.»
«Eines japanischen Konzerns? Aber das war doch ein isländisches Schiff.»
«Ja, aber das Unternehmen, für das sie arbeiten, heißt Nakamura Sakana.»
«Nie gehört.»
«Ich hab’s gegoogelt. Die gehören zu den zwanzig japanischen Konzernen mit dem höchsten Umsatz. Und die haben Elvar jetzt auf Schadensersatz verklagt, weil sie das Schiff angeblich abwracken mussten.»
«Blödsinn. Die Free Warrior hat danach eindeutig schlimmer ausgesehen.»
«Ich sag dir nur, was ich weiß.»
«Und woher weißt du das?»
«Von Marcel.»
Marcel. Der gut aussehende Franzose. Mittlerweile ist er wieder in Lyon, aber Sóley und er sind noch immer locker in Kontakt.
«Woher weiß ausgerechnet Marcel das?» Jetzt beiße ich doch in mein Brot. Sonst stehe ich nachher mit knurrendem Magen am Bug.
«Keine Ahnung, das habe ich ihn nicht gefragt. Von Ari vielleicht, der weiß doch immer alles.»
«Und was wollen sie? Nakamura Dings, meine ich. Ups, Mist.»
Irgendwie scheine ich nicht in der Lage zu sein, ein Sandwich zu essen, ohne dass die Hälfte des Belags runterrutscht.
«Knapp achthundert Millionen Kronen. Und am liebsten würden sie Elvar wohl im Gefängnis sehen.»
Ich atme scharf ein und verschlucke mich im nächsten Moment an einem Stück Tomate. Es dauert ein paar Sekunden, bis ich den Hustenanfall wieder unter Kontrolle habe.
«Was? Wie viel wollen die?»
«Achthundert Millionen. Schadensersatz für das Schiff und den Fangverlust und Schmerzensgeld, weil sich ein paar der Männer an Bord bei der Aktion verletzt hätten.»
«Die behaupten, dass sich jemand verletzt hat? Wobei denn? Hat sich einer den Arm ausgekugelt, während sie uns beworfen haben? Sind die völlig irre?»
«Ich würde mal sagen, die wollen uns plattmachen. So richtig.»
«Da wären sie nicht die Ersten. Schaffen sie nicht. Die sind im Unrecht.» Angewidert mustere ich mein Mittagessen und bin drauf und dran, alles den Möwen hinzuwerfen, weil mir danach ist, etwas durch die Gegend zu schleudern. Wie ich Menschen verabscheue, die so durch und durch skrupellos sind. «Was sagt Elvar dazu?»
«Keine Ahnung. Mehr wusste Marcel nicht.»
«Damit kommen die niemals durch. Denk an Hello Fish. Die haben’s auch versucht, und letzten Endes mussten sie sogar zahlen.»
Damals haben wir fast zweihundert Kilometer an Treibnetzen zerstört und wurden prompt von dem Fischereiunternehmen, dem die Dinger gehörten, verklagt.
«Wir haben gewonnen, weil die Netze verbotenerweise länger als zweieinhalb Kilometer waren. Und außerdem ist Hello Fish mit diesem japanischen Gigantenkonzern nicht wirklich vergleichbar.»
«Elvar kriegt das schon hin.» Meine Zuversicht ist mehr gespielt als echt, aber ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Achthundert Millionen Kronen. Scheiße, das ist mehr, als wir jemals an Spenden zusammenbekämen. «Wie lang musst du heute arbeiten? Wollen wir uns später noch im Vigdís treffen?»
Sóley arbeitet im Miðnætursól. Das Hotel gehört ihren Eltern, die noch immer hoffen, dass Sóley es zusammen mit Emil, ihrem älteren Bruder, irgendwann übernimmt. Mit Wild & Free und allem, was damit zusammenhängt, können weder ihre Mutter noch ihr Vater etwas anfangen. Ginge es nach ihnen, würde Sóley eine Ausbildung zur Hotelfachfrau beginnen, und obwohl Sóley im Hotel fast schon Vollzeit mitarbeitet, hat sie es bisher nicht fertiggebracht, ihren Eltern klipp und klar zu sagen, dass sie andere Pläne für ihr Leben hat. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie noch nicht so genau weiß, wie diese Pläne überhaupt aussehen.
«Ich muss bis sechs an der Rezeption sitzen, danach gern.»
«Dann sagen wir sieben Uhr?»
«Perfekt.»
Während ich eine halbe Stunde später über die zerklüfteten, algenbewachsenen Felsen zurück zu den Anlegern balanciere, denke ich über die Schadensersatzklage nach, und das Ganze beschäftigt mich immer noch, als kurz darauf fast zwanzig Touristen die Emilía besteigen, weil sie auf eine Begegnung mit einem Wal hoffen.
«Hi, Lilja.» Theodór, der die Emilía steuert, hat die Tür zur Brücke geöffnet und winkt mich zu sich. «Zwei Buckelwale haben sich anscheinend blicken lassen, eins von den anderen Schiffen hat sie entdeckt. Halte mal nach denen Ausschau.»
Fürs Erste schiebe ich Walfänger und potenzielle Gerichtsverhandlungen beiseite. «Alles klar.»
Heute Vormittag haben wir jede Menge Delfine gesehen und außerdem eine kleine Gruppe Zwergwale, die sich ziemlich nah an unser Schiff herangetraut haben. Wie ihr Name schon sagt, sind sie nicht die größten, aber auch sieben oder acht Meter können beeindruckend sein, wenn die Tiere sich unmittelbar neben dem Boot an die Wasseroberfläche treiben lassen – es gibt jetzt bestimmt tausend Fotos mehr von ihnen, und alle Leute auf dem Schiff waren hochzufrieden. Aber vor allem für die Kinder an Bord hätte ich mir gewünscht, dass sich einer der Zwergwale mal etwas weiter aus dem Wasser traut. Wenn die Leute einen springenden Wal erlebt haben – ganz egal, was für einen –, gehen sie im Anschluss alle völlig beseelt wieder an Land. Und keiner wird danach eines der wenigen isländischen Restaurants aufsuchen, in denen noch Walfleisch angeboten wird. Pleite sollen die alle gehen.
Unmittelbar nachdem wir abgelegt haben, mache ich es mir auf meinem Posten am Bug des Schiffes bequem und suche die Umgebung mit einem Fernglas nach irgendetwas ab, dass auf Wale oder Delfine hindeutet. Der Himmel ist klar und die Sicht wunderbar – wenn sich dort draußen irgendwo Wale herumtreiben, werde ich sie finden.
«Darf ich da auch mal durchgucken?»
Ein rothaariges Mädchen mit wassergrünen Augen ist neben mir aufgetaucht, vielleicht sieben oder acht Jahre alt. Bereitwillig reiche ich ihr mein Fernglas, ohne den Befestigungsriemen loszulassen, während sie es sich vor die Augen hält.
«Boah.» Sie schwenkt vom Wasser hin zu den Leuten, die an der Reling stehen oder auf den Bänken in der Mitte des Decks sitzen. «Alles ist ganz groß!»
Ihre Bewegungen sind ein wenig zu schnell, und ich lege eine Hand auf ihre Schulter. Dann beuge ich mich hinunter, um ihr zu zeigen, wie sie das Fernglas einstellen kann.
«Wo sind die Wale?», will sie wissen.
«Wir suchen sie gerade», erwidere ich.
«Aber wie finden wir sie? Die schwimmen doch ganz tief im Wasser, oder?»
«Wir sehen sie, wenn sie auftauchen, weil sie Luft holen müssen.»
Die Kleine lässt das Fernglas sinken, um mich anzustarren. «Können Wale nicht unter Wasser atmen?»
Ich schüttele den Kopf. «Sie sind Säugetiere, sie müssen genauso atmen wie wir. Sie können nur sehr, sehr lange die Luft anhalten. Aber irgendwann müssen sie wieder auftauchen.»
Diese Aussage bringt sie dazu, die Umgebung wieder mit dem Fernglas abzusuchen. «Ich sehe aber keinen Wal.»
«Wir sind ja auch noch nicht lange unterwegs», sage ich lachend. «Aber wir finden bestimmt welche.»
Die meisten Kinder würden mir jetzt das Fernglas zurückgeben und vermutlich ihre Eltern nerven, bis es ihrer Meinung nach endlich was zu gucken gibt. Von der bloßen Aussicht auf den Berg Kirkjufell, der auf seiner Halbinsel in den Fjord hineinragt, sind sie selten beeindruckt. Dieses kleine Mädchen jedoch bringt offensichtlich mehr Geduld mit. Während es weiterhin mit dem Fernglas die Wasseroberfläche absucht, halte ich nach umherkreisenden Vögeln Ausschau, die auf Fischschwärme hinweisen könnten, hinter denen häufig Delfine herjagen, oder nach dem Blas eines Wals.
«Ich will einen Blauwal sehen», teilt die Kleine mir mit, ohne das Fernglas zu senken. «Meine Mama sagt, ein Blauwal ist das größte Tier auf der ganzen Welt.»
«Das stimmt», bestätige ich.
«Ist ein Blauwal größer als unser Schiff?»
«Die meisten schon.»
«Warum sehe ich ihn dann nicht?»
«Na ja … entweder ist keiner da, oder er taucht gerade.»
«Vielleicht sehe ich gleich seine Dusche.»
«Was?»
Das Mädchen blickt todernst zu mir auf, und ich unterdrücke ein Lachen.
«Seine Dusche. Auf seinem Kopf.»
«Du meinst das, was aussieht wie eine Wasserfontäne? Wir nennen das Blas. Eigentlich ist das nur die Luft, die der Wal auspustet, wenn er auftaucht. Dabei wird auch immer Wasser mit in die Luft geschleudert.»
«Papa hat gesagt, der Wal hat eine Dusche auf dem Kopf.»
Jetzt muss ich doch grinsen. «Der Wal schwimmt die ganze Zeit im Wasser – der muss bestimmt nicht duschen, wenn er auftaucht.»
Jetzt lächelt das Mädchen ein wenig verlegen. «Stimmt. Hier.»
Sie reicht mir mein Fernglas und trollt sich, vermutlich, um ihrem Papa ein paar wesentliche Dinge über Wale zu erklären. Noch immer grinsend hebe ich das Fernglas vor die Augen. Eine Dusche auf dem Kopf. Tja. Wenn der Papa nie Zeit zum Erklären hatte, wird das jetzt seine Tochter für ihn übernehmen.
Als ich weiße Schaumkappen bemerke, die immer wieder an der gleichen Stelle auftauchen, bin ich schon zweimal vorsichtig gefragt worden, ob es heute vielleicht keine Wale zu sehen gäbe. Das hier könnten zumindest Delfine sein. Meine Vermutung wird im nächsten Moment durch Lichtreflexe bestätigt, die von der glatten Haut der Tiere hervorgerufen werden, und ich greife nach meinem Funkgerät. Kurz darauf steuert Theodór langsam von der Seite auf die Stelle zu, und als wir uns auf etwa hundert Meter genähert haben, schaltet er den Motor aus.
Es sind tatsächlich Delfine, und zwar viele, mindestens dreißig. Wie erhofft, nähern sie sich uns nach einer Weile ganz von selbst. Smartphones und Kameras werden in die Höhe gehalten, während die neugierigen Tiere ein ums andere Mal die Wasseroberfläche durchbrechen, um mit eleganten Rollbewegungen wieder abzutauchen. Über den Vorderflossen und um die Finne herum ist ihre graue Haut heller, und wenn sie dicht unter der Wasseroberfläche schwimmen, scheinen sie an diesen Stellen zu leuchten.
«Vorsicht.» Ich berühre den Rücken eines Mannes, der sich so weit über die Reling beugt, dass ich mir Sorgen mache, er könne das Gleichgewicht verlieren. «Bitte nicht die Arme nach den Delfinen ausstrecken. Sie lächeln zwar, aber es sind immer noch Raubtiere.»
«Entschuldigung.» Er strahlt mich an. «Ich habe so etwas noch nie gesehen, es ist so … so …»
«Es ist wundervoll!», ruft die Frau neben ihm. «Sie sind so wunderschön!»
Das sind sie wirklich. Geschmeidig tauchen sie unter dem Boot hindurch, und weil sie jetzt offenbar beschlossen haben, uns in ihr Spiel einzubeziehen, schießt der erste von ihnen aus dem Wasser heraus. Tropfen glitzern in der Sonne, bevor er mit einem Klatschen wieder inmitten der Wellen landet.
«Hast du das gesehen?»
«Oh mein Gott!»
Weitere Delfine springen nur wenige Meter vom Boot entfernt in die Luft, und weil es eben Delfine sind, sehen sie dabei so aus, als wollten sie uns zurufen: «Hey, kommt ins Wasser! Es ist toll heute!»
Ich habe so etwas schon oft erlebt, doch ich werde nie müde, ihnen dabei zuzusehen. Als ich zum allerersten Mal im offenen Meer auf Delfine gestoßen bin, ging es mir wie der Frau mit der hellblauen Mütze, die sich in diesem Moment mit dem Ärmel die Tränen aus den Augen wischt, und ich erinnere mich daran, wie ich mich damals gefühlt habe. Beschenkt. Geehrt. Ein wenig demütig.
Deshalb weiß ich auch, was in den Leuten vorgeht, als die Tiere schließlich abtauchen und erst ein ganzes Stück von uns entfernt vereinzelt noch einige Male zu sehen sind, bevor sie endgültig verschwinden.
«Fahren wir ihnen nach?», will die Frau mit der hellblauen Mütze wissen.
Ich schüttele den Kopf. «Wenn wir sie verfolgen, fühlen sie sich bedrängt, und so etwas wollen wir vermeiden. Aber unsere Tour ist ja noch nicht zu Ende.»
«Ich habe noch nie so etwas Schönes gesehen. Das war wie ein Wunder.»
Für einen Moment legt sie mir ihre Hand auf den Unterarm, und ich erwidere ihr Lächeln, bevor ich von Neuem die Umgebung absuche.
«Kommt jetzt ein Blauwal?»
Ich lasse das Fernglas sinken. Das rothaarige Mädchen von vorhin.
«Auf jeden Fall suchen wir Wale. Dass wir Blauwale finden, kann ich dir leider nicht versprechen.»
Ehrlicherweise ist es sogar ziemlich unwahrscheinlich. Es kann eine ganze Saison vergehen, ohne dass irgendjemand in der Gegend einen Blauwal zu Gesicht bekommt. Ich selbst habe bisher nur ein einziges Mal einen Blauwal beobachtet, und das war nicht auf der Emilía, sondern auf der Free Warrior.
«Ich will unbedingt einen Blauwal sehen! Ich habe meinem Papa gesagt, dass die keine Duschen auf dem Kopf haben.»
Letzteres sagt sie so geringschätzig, dass ich in mich hineingrinse. Tja, Papa. Erzähl deiner Tochter nicht so einen Blödsinn, dann hält sie dich auch nicht für dumm.
«Sieht ein Blauwal aus wie eine Insel?»
«Nein, eher wie ein sehr langes U-Boot.»
Das Mädchen nickt und starrt neben mir über die Reling hinaus auf die Wellen, und das tut sie beinahe zehn Minuten lang, ohne noch etwas zu sagen.
Dann entdecke ich aus den Augenwinkeln heraus den Blas. Ein Blauwal ist das mit Sicherheit nicht, dazu ist die Fontäne nicht hoch genug, aber vielleicht haben wir gerade die Buckelwale gefunden. Angestrengt suche ich mit dem Fernglas die Stelle ab, an der ich die Wasserwolke habe aufsteigen sehen.
Da! Noch einmal.
Seltsam niedrig. Ein Jungtier vielleicht?
Übers Funkgerät gebe ich Theodór die Richtung durch, bevor ich das Fernglas wieder aufnehme.
«Hast du einen Wal gefunden?» Neben mir hüpft das rothaarige Mädchen auf und ab.
«Ich denke schon.»
«Einen Blauwal?»
«Nein, ein Blauwal ist das nicht, aber …»
Da ist der Blas wieder. Das gibt’s doch nicht. Wenn es das ist, wofür ich es halte, dann wäre das auch mein erstes Mal.
«Was für ein Wal ist es? Ein großer?»
«Ich glaube, es ist ein ziemlich großer.» Ich werfe dem Mädchen ein schnelles Lächeln zu. «Drück uns die Daumen, dass er nicht abtaucht, bevor wir ihn sehen können.»
«Okay!»
Der Blas ist niedrig, aber nicht weil es an Kraft fehlt. Er ist nur schräg. Auf den ersten Blick war das nicht zu erkennen, aber jetzt – es gibt nur eine einzige Walart, die einen schrägen Blas hat, und das ist …
«Ein Pottwal», murmele ich, während ich spüren kann, wie mein Herzschlag sich verdoppelt.
«Ist ein Pottwal groß?», höre ich die helle Stimme neben mir.
«Riesig. Es gibt nur zwei Wale, die noch größer sind, und wenn das ein Männchen ist, dann ist er vielleicht genauso lang wie unser Schiff.»
«Kann ich ihn sehen?»
Ich halte dem Mädchen das Fernglas hin und korrigiere vorsichtig die Richtung. Mittlerweile ist der dunkle Schemen im Wasser auch mit dem bloßen Auge zu erkennen.
«Meine Damen und Herren – sie haben unfassbares Glück! Schräg vorne rechts befindet sich der erste gesichtete Pottwal dieser Saison!» Sogar Theodór klingt euphorisch.
«Emmy?», ruft jemand.
Im nächsten Moment hält das Mädchen mir mein Fernglas entgegen und rennt auf einen großen, dunkelhaarigen Mann zu, der es auf den Arm nimmt. «Es ist ein Pottwal, Papa!»
Aus dem aufgeregten Murmeln wird erwartungsvolle Stille, während Theodór sich so behutsam wie möglich dem riesigen Tier von der Seite nähert, das scheinbar reglos dicht unter der Wasseroberfläche treibt. Er legt Pausen ein, um den Wal nicht zu erschrecken, von dem immer mal wieder ein Teil des lang gezogenen Körpers samt seiner hügelartigen Rückenflosse zwischen den Wellen auftaucht. Doch erst als der gewaltige Kopf kurz erscheint, dessen fast schon quadratische Form einfach unverkennbar ist, bin ich mir sicher.
Ein Pottwal!
Ich taste nach dem Smartphone in einer der Reißverschlusstaschen meiner Jacke. Den muss ich unbedingt Sóley zeigen!
Es scheint ein Einzelgänger zu sein, was bedeutet, dass es beinahe sicher ein Männchen ist. Und er ist wirklich riesig. Obwohl er noch immer ein gutes Stück von unserem Schiff entfernt schwimmt, weigert mein Hirn sich, die schiere Größe dieses Wals zu erfassen. Man könnte von seiner Schwanzflosse bis hin zu seinem Kopf einen kleinen Spaziergang machen. Seine furchige Haut ist dunkel, und mir bleibt fast das Herz stehen, als er jetzt leicht zur Seite kippt.
«Er sieht uns an!», ruft jemand aufgeregt, übertönt damit die bewundernden und ehrfürchtigen Laute, die die Menschen an Bord von sich geben.
Ich kann nicht anders, als zuzustimmen. Der Wal mustert uns, schätzt ab, ob wir eine Gefahr für ihn sind. Noch ist er zu weit weg, als dass ich seine Augen erkennen könnte, aber er nimmt uns wahr, da bin ich ganz sicher.
Wir tun dir nix. Wir wollen nur ein bisschen bei dir sein, ist das okay?
Ich kann die Faszination mancher Taucher verstehen, die wie im Rausch davon erzählen, wenn sie einem Wal im Meer begegnet sind. Am liebsten möchte ich ihn berühren, meine Hand auf seine runzlige, vernarbte Haut legen. Als ich klein war, habe ich mir gewünscht, mit Tieren sprechen zu können … eigentlich wünsche ich mir das immer noch.
Jetzt kommt Bewegung in den Riesen. Er schwimmt näher, und die Zeit friert ein.
Als er plötzlich abermals Luft ausstößt und eine Wasserfontäne schräg nach oben schießt, schreien einige Leute auf. Nicht weil sie erschrecken, sondern weil sie einfach hingerissen sind.
Ich kann meinen Blick nicht von diesem gewaltigen Tier abwenden, am liebsten möchte ich sogar das Blinzeln einstellen. Man könnte meinen, dass uns nichts verbindet, doch das stimmt nicht. Wir sind beide Kreaturen dieses Planeten, und wir brauchen einander. Der Ozean muss für uns beide ein sicherer Ort sein. Denn ohne das Leben im Meer sterben wir alle. Das sagt Elvar immer.
In meinem Kopf höre ich plötzlich wieder den Knall der Harpune, sehe, wie das Wasser sich rot färbt, und als habe diese Erinnerung den Frieden gestört, richtet der Wal vor uns sich auf und taucht dann langsam hinab in die Tiefe. Ein paar Sekunden lang ist nichts mehr zu sehen außer weißer Gischt, dann durchbricht die breite Schwanzflosse für einige Sekunden noch einmal die Oberfläche, und erst jetzt fällt mir ein, dass ich für Sóley noch kein Foto habe!
Zu spät. Ich werde Theodór fragen müssen, der mit Sicherheit Bilder für unsere Webseite gemacht hat.
Genau wie die Frau mit der blauen Mütze vorhin fahre ich mir mit dem Arm über die Augen.
Danke für diesen Tag. Danke für diesen Moment.
Keine Ahnung, bei wem ich mich bedanke – ich habe einfach das Bedürfnis, es zu tun.
Niemals werde ich verstehen, wie Menschen die Arglosigkeit dieser Tiere ausnutzen, wie sie sie jagen und töten können, um ihr Fleisch zu verkaufen, um Profit aus ihren Körpern zu schlagen. Und ich werde niemals aufhören, gegen solche Menschen zu kämpfen.
«Warum weinst du?» Das rothaarige Mädchen steht wieder neben mir.
«Weil ich so glücklich bin, dass es diesen Wal gibt», sage ich und bemühe mich um ein Lächeln. «Und weil ich ihn beschützen will.»
«Ich will ihn auch beschützen.»
«Dann wirst du das bestimmt tun, wenn du groß bist.»
«Nein, ich will ihn jetzt schon beschützen.» Das Mädchen legt einen Unterarm auf die Reling und stützt das Kinn darauf. «Ich glaube, ich kann das.»
«Okay. Beschützen wir ihn gemeinsam.»
Wir stehen nebeneinander und blicken aufs Wasser, und ich fühle mich seltsam getröstet, weil es ein kleines rothaariges Mädchen gibt, das vielleicht später einmal dieselben Ziele verfolgen wird wie ich.
Kapitel 3
Das Vigdís ist eine verschlafene Kneipe, in der sich außerhalb der Sommermonate fast ausschließlich Bárafjörður trifft. Während der Hochsaison allerdings ist es dort voller, und es gibt ein Wochenende im Juni, wenn es einen Ausläufer des Secret Solstice Festivals aus Reykjavík hierher verschlägt, in der das Vigdís zuverlässig aus allen Nähten platzt. In Bárafjörður leben nur knapp viertausend Menschen, aber in ein paar Wochen werden zwei Tage lang etwa tausend Menschen mehr ihre Zelte in der Umgebung aufschlagen, die wenigen Läden leer kaufen und das Vigdís explodieren lassen. Saga, der die Kneipe gehört, leiht sich dann immer von sämtlichen Freunden und Nachbarn Stühle und Tische aus, um vor dem Laden, so weit es ihr eben gestattet ist, noch Leute zu bewirten. Andri, seines Zeichens Gesetzeshüter in Bárafjörður, blickt großherzig darüber hinweg, dass Saga sich dabei nicht immer an die ihr auferlegten Begrenzungen hält. Solange sich niemand beschwert, stört es ihn nicht, und wer sollte sich beschweren? An diesen zwei Tagen schenkt Saga jedem Einwohner kostenlos ein Bier aus.
Sóley ist schon da, als ich um kurz nach sieben das Vigdís betrete, und unterhält sich mit Tómas, der in Bjarkis Autowerkstatt arbeitet.
«Hi, ihr zwei.» Ich rücke mir einen der dunklen Holzstühle zurecht. «Tómas, wie geht’s?»
Tómas ist Sóleys bester Freund, die beiden kennen sich schon ewig, und – wenn ich Sóleys Erzählungen richtig interpretiere – genauso lange stehen sie immer wieder kurz davor, etwas miteinander anzufangen. Aber erst war Tómas in ein anderes Mädchen verliebt, dann war Sóley mit jemandem zusammen. Tómas hat von irgendeiner Jóhanna seinen ersten Zungenkuss bekommen und ausgerechnet Sóley brühwarm davon erzählt, und Sóley hat Monate später dann – vermutlich aus purem Trotz – Tómas abgewiesen, als der sich endlich ein Herz fasste und sie um ein Date gebeten hat. Nur Freunde also, und beide beteuern, auch nichts anderes zu wollen.
Tómas fährt sich durch seine immer etwas verwuschelt aussehenden blonden Haare und lehnt sich auf seinem Stuhl zurück. «Alles okay, derzeit ist nicht viel los», beantwortet er meine Frage. «Und bei dir?»
«Wir haben heute einen Pottwal gesichtet!»
Tómas findet diese Nachricht nicht halb so spektakulär wie ich, aber immerhin Sóley teilt meine Begeisterung.
«Einen Pottwal? Oh Gott, ich will auch mal einen Pottwal sehen! Hast du Fotos gemacht?»
«Theodór hat welche», erwidere ich. «Es war so unfassbar großartig – ich hab’s leider total vergessen.»
«Wie nah kam der Wal ran?»
Während ich Sóley minutiös von meiner heutigen Begegnung berichte, nippt Tómas hin und wieder an seinem Bier und verfolgt meine Schwärmerei mit einem eindeutig amüsierten Ausdruck im Gesicht.
«Hat er dir seine Nummer gegeben?», wirft er ein, als ich gerade dabei bin, Sóley den Blick zu beschreiben, mit dem der Wal das Boot gemustert hat.
«Er hatte schon eine Freundin, aber soll ich ihn fragen, ob er ein paar Tipps für dich hat, wenn ich ihn das nächste Mal sehe?»
Dass Tómas seit über einem Jahr solo ist, liegt nicht daran, dass keine Frau Interesse an ihm hätte, aber es ist trotzdem ein Punkt, auf den er ungern angesprochen wird. Und sobald er aufhört, sich ständig darüber lustig zu machen, dass ich angeblich für Wale mehr übrig habe als für Typen, werde ich ihn umgekehrt auch nicht mehr damit aufziehen. Seinen pikierten Gesichtsausdruck erwidere ich mit einem breiten Grinsen. Sicherheitshalber beschließt er, unser Geplänkel nicht auszuweiten.
«Klingt auf jeden Fall so, als wären heute alle zufrieden gewesen.»
«Davon gehe ich aus. Es war wirklich ein perfekter Tag – abgesehen von der Sache mit Elvar.» Ich verziehe das Gesicht.
«Was ist denn mit ihm?», will Tómas wissen.
«Er hat mal wieder eine Klage am Hals», sagt Sóley.
«Worum geht es diesmal?»
«Irgendein japanischer Großkonzern, der ungestört weiter Wale abschlachten will», erwidere ich, bevor Sóley antworten kann. «Im Namen der Wissenschaft, versteht sich. Als wäre nicht allen völlig klar, dass die nur hinter den Walen her sind, weil sie sie verkaufen – nachdem ein Mensch im weißen Kittel einmal gemütlich an den toten Walen vorbeispaziert ist.»
«Es ist so eine verlogene Sauerei», murmelt Sóley.
«Allerdings.» Ich stehe auf. «Wetten, die wissenschaftliche Untersuchung beschränkt sich darauf, irgendwo ein Kreuzchen unter den Punkt tot zu setzen? Ich hol mir mal was zu trinken.»
Als ich mit einem Drink zurückkomme, versucht Sóley gerade einmal mehr, Tómas davon zu überzeugen, bei einer der Aktionen von Wild & Free mitzumachen.
«Für mich ist das einfach nichts, Sóley», erklärt Tómas genervt. «Ich sehe es ja genau wie du, aber deshalb muss ich mich doch nicht gleich vor die Harpunen werfen.»
Sóley verdreht die Augen. «Das verlangt doch keiner.»