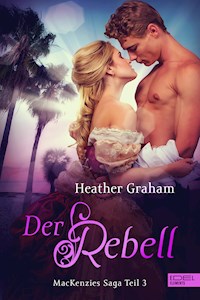10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Wikinger-Trilogie: Drei historische Liebesromane der Bestseller-Autorin Heather Graham in einem eBook!
ROMAN 1: DIE NORMANNENBRAUT
Prinz Olaf von Norwegen, Herr der Wölfe, landet mit seinem Drachenboot auf der Smaragdinsel, um dort ein großes Königsreich zu errichten. Prinzessin Erin, die schöne Tochter des irischen Hochkönigs, schwört dem legendären Normannen Rache, weil er Tod und Zerstörung in ihr Heimatland gebracht hat. Doch die Invasion der kriegerischen Dänen vereint Iren und Wikinger - und die Heirat von Erin und Olaf soll die neue Allianz besiegeln. Werden die beiden ihre Abneigung besiegen und zueinander finden? Oder zerstört ihr Hass jegliche Pläne?
ROMAN 2: DIE GEFANGENE DES WIKINGERS
Rhiannon, die Nichte des Königs, ist verzweifelt: Um den Waffenstillstand zwischen den feindlichen Lagern zu besiegeln, wird sie an den Wikinger Eric verschachert. Als der kampferprobte Krieger die wilde Schönheit sieht, ahnt er sofort, dass sie die Herausforderung seines Lebens wird und dass er zum ersten Mal Gefahr läuft, einen Kampf zu verlieren ...
ROMAN 3: DER HERR DER WÖLFE
Irland und Frankreich im 9. Jahrhundert. Dänische Eroberer sind in die Heimat der Gräfin Melisande eingefallen. Bei ihrer Rückkehr nach Frankreich findet die schöne Aristokratin ihr Schloss in den Händen der dänischen Armee. Mit ihren violetten Augen und dem leuchtend schwarzen Haar ist sie eine Herausforderung für jeden Krieger. Aber nur einer kann ihr Herz erobern: der Wikinger Conar, der Herr der Wölfe ...
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1499
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum
beHEARTBEAT Digitale Originalausgabe »be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Artem Furman | Ulrike Haberkorn | Allies Interactive | Digiselector | Artem Furman | Michael Rosskothen |Oxana Gracheva E-Book-Erstellung: readbox GmbH, Dortmund ISBN 978-3-7325-7315-8 www.be-ebooks.deHeather Graham
Die Normannenbraut - Die Gefangene des Wikingers - Der Herr der Wölfe
Über diese eBox
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Gebet
PROLOG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ANMERKUNG DER AUTORIN
Über dieses Buch
Prinz Olaf von Norwegen, Herr der Wölfe, ist mit seinem Drachenboot gelandet, um auf der Smaragdinsel ein großes Königsreich zu errichten. Prinzessin Erin, die schöne Tochter des irischen Hochkönigs, schwört dem legendären Normannen Rache, weil er Tod und Zerstörung in ihr Heimatland gebracht hat. Doch die Invasion der kriegerischen Dänen vereint Iren und Wikinger – und die Heirat von Erin und Olaf soll die neue Allianz besiegeln. Werden die beiden ihre Abneigung besiegen und zueinander finden? Oder zerstört ihr Hass die jegliche Pläne?
Über die Autorin
Heather Graham wurde 1953 im Dade County in Florida geboren. Ihre Reisen durch Afrika, Asien und Europa inspirierten sie dazu, Schriftstellerin zu werden. Ihr erster Roman wurde 1982 veröffentlicht, seitdem hat sie etwa 150 Romane geschrieben, die in über 20 Sprachen übersetzt wurden. Heather Grahams Titel stehen regelmäßig auf den US-amerikanischen Bestsellerlisten.
Heather Graham
Die Normannenbraut
Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Eva Malsch
beHEARTBEAT
Digitale Originalausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1985 by Heather Graham.
Titel der Originalausgabe: Golden Surrender
Für die Deutsche Erstausgabe:
Copyright © 1994 by Wilhelm Heyne Verlag, Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, Köln
Projektmanagement: Esther Madaler
Umschlaggestaltung: Christin Wilhelm, www.grafic4u.de unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Artem Furman | Ulrike Haberkorn | Allies Interactive | Digiselector
E-Book-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar
ISBN 978-3-7325-3668-9
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
O Herr, bewahre uns vor dem Zorn des Nordländers!
Gebet aus dem achten Jahrhundert
PROLOG
IRLAND, A. D. 848
Aus den kalten, feindseligen Nebelschwaden des Nordens kamen seine schmalen Großboote, seine »Drachenschiffe«, die furchterregenden Seeschlangen glichen. Mit ihren breiten roten und weißen Segeln glitten sie über die Wellen und steuerten die smaragdgrüne Küste von Eire an.
Seine Männer waren furchtlos und schrecklich. Mit wildem Geheul sprangen sie von ihren Schiffen an Land, schwenkten ihre Schwerter, Äxte und Speere. Sie glaubten nicht an den Gott der Christenheit, kannten keine Moral, keine Skrupel. Doch ihr Anführer Olaf der Weiße, ein norwegischer Prinz – weit und breit als Herr der Wölfe bekannt –, war anders.
Mit seinem schimmernden goldblonden Haar und seiner sehnigen, muskulösen Kraft überragte er seine Landsleute, die ihm voller Bewunderung und Respekt gehorchten. Trotz seiner barbarischen Erziehung hatte er seinen geistigen Horizont schon bald erweitert. Er war nicht gekommen, um dieses Land zu verwüsten, sondern um hier sein Königreich zu errichten.
Während sein Drachenschiff ihn zur irischen Küste brachte, leuchteten seine stahlblauen Augen, denn sie erkannten die wilde Schönheit dieses zerklüfteten Landes. Er wusste, dass er hierher gesegelt war, um für immer zu bleiben.
Die Geschichten, die während seiner Kindheit ins Haus seines Vaters in Norwegen gedrungen waren, hatten ihn viel gelehrt. Und als sein Blick über das zerfurchte Land schweifte, wusste er, dass er es unter seine Fittiche nehmen und nähren musste wie ein kleines Kind. Er würde die Abteien und Klöster nicht entweihen, aber die Mönche und Priester zwingen, ihm Unterricht zu erteilen, damit er die schwierige Literatur der Iren besser verstehen lernte – die Kultur dieses unbezwingbaren Volks, das immer wieder überfallen, aber noch nie erobert worden war. Aye, er würde diese Menschen kennenlernen und dadurch Erfolge erzielen, wo andere versagt hatten.
An all diese Dinge dachte er angesichts der Küste, die Hände in die Hüften gestemmt. Irland ... Diese Insel gehörte ihm – oder er ihr. Das spürte er in seinem Blut wie die Wirkung eines berauschenden Mets. Diesem Land werde ich meinen Stempel aufdrücken, beschloss er und warf lachend die Mähne mit dem goldenen Haar in den Nacken. Funkelnd spiegelte sich die Morgensonne in seinen blauen Augen. Aye, hier in Irland erwartete ihn sein Schicksal. Nach diesem Land sehnte er sich, und der Wunsch, es zu besitzen, durchströmte ihn so heiß wie eine Fieberkrankheit. Auf sein Herz übte es eine ebenso starke Anziehungskraft aus wie ein verführerisches Mädchen.
Er drehte sich zu seinen Männer um und grinste breit. »Irland!« Hoch schwang er sein Schwert empor, seine Stimme übertönte den heulenden Wind. »Wir reiten landeinwärts, und auf dieser grünen Insel werden wir Wurzeln schlagen. Ein Königreich erwartet uns!«
Ohrenbetäubendes Jubelgeschrei dankte seinen Worten.
Der Herr der Wölfe war in Irland eingetroffen – unwiderruflich.
1
A. D. 852
Durch ein Fenster im Grianan, dem Sonnenhaus der Frauen, starrte Erin mac Aed auf die anmutigen Holzgebäude und die sanft geschwungenen Hänge von Tara, der alten und traditionsreichen Heimat des Ard-Righ, des hohen irischen Königs.
Erst vor Kurzem war die Versammlung im großen Sitzungssaal beendet worden, und ihr Vater hatte die Mutter aus dem Grianan rufen lassen. Seither hielt Erin Wache am Fenster, denn sie musste dringend mit ihrem Vater sprechen. Ungeduldig kaute sie an der Unterlippe, während sie auf die Rückkehr der Eltern von ihrem Spaziergang wartete. Das üppige Gras leuchtete smaragdgrün, in der Ferne funkelte ein schmaler Bach saphirblau. Gänse wanderten am Ufer entlang, Rinder und Pferde grasten träge auf den Hügeln.
Aber heute hatte Erin keinen Blick für die friedliche Schönheit, die sich vor ihr ausbreitete. Sie betrachtete die Wiesen und den Himmel und glaubte, die Welt würde sich um sie drehen. Sie konnte ihren Erinnerungen nicht entfliehen. Visionen aus der Vergangenheit überlagerten die Gegenwart. Die Bilder von Feuer, Blut und donnernden Hufen ließen sich nicht verdrängen, obwohl sie heftig blinzelte.
Nebel schien das goldene Nachmittagslicht zu verdunkeln, und sie sah sich selbst viel zu deutlich, wie sie vor zwei Jahren mit ihrer Tante, Bridget von Clonntairth, im Garten gesessen hatte. Die süße, schöne Bridget lachte so fröhlich, aber dann wurde Alarm geschlagen, und sie zwang Erin zu flüchten. Das Mädchen drehte sich um und sah, wie die Tante ihren kleinen Dolch mit dem perlenbesetzten Griff tief ins eigene Herz bohrte, von wilder Angst vor den heranrückenden Nordländern getrieben. Schrille Schreckensrufe hatten sich in den grausigen Lärm der trommelnden Pferdehufe gemischt, als die Norweger über Clonntairth hergefallen waren, das Königreich des Onkels.
Immer noch hatte Erin das Gefühl, das Kriegsgeschrei der Feinde zu hören, die wilde Klage des unvorbereiteten Irlands, das Feuer zu riechen, die bebende Erde zu spüren ...
Sie holte tief Atem, versuchte die bösen Erinnerungen zu bannen, und dann sah sie die Eltern endlich aus dem Wäldchen am Bach zurückkehren. Unruhig hatte sie dagesessen, seit Maeve gerufen worden war, die Augen unverwandt auf die Bäume gerichtet. Ihre Finger schlangen Knoten in die Fäden des Kleids, das sie gerade flickte. In den zwei Jahren nach dem Fall von Clonntairth hatte sie versucht, ihr altes Leben weiterzuführen, ihre Position als Prinzessin von Tara zu genießen, Vater und Mutter vorzugaukeln, sie hätte jenen Schreckenstag vergessen. Doch das konnte sie nicht.
Wie sie wusste, trafen sich an diesem Tag die Prinzen und Könige Irlands, um ihren Standort im bevorstehenden Kampf zwischen den Dänen und den Norwegern zu erörtern. Und wenn sie die Dänen hasste, so verachtete sie die Norweger, vor allem Olaf den Weißen.
Allein schon der Gedanke an seinen Namen erfüllte sie mit heißem Zorn und jagte ein wildes Zittern durch ihren Körper. Nun wollte sie endlich erfahren, ob die irischen Herrscher beschlossen hatten, Stellung zu beziehen. Wenn ja, so hoffte sie inständig, man hätte nicht entschieden, die Norweger wären das kleinere der beiden Übel.
»Wenn du auf deine Stiche achten würdest, Schwester«, unterbrach Gwynn ungehalten Erins Überlegungen, »wären sie klein und regelmäßig. Du solltest dich endlich vom Fenster entfernen. Es ziemt sich nicht für eine Prinzessin, wie eine neugierige Bäuerin hinauszustarren.«
Erin wandte sich zu ihrer älteren Schwester und seufzte gottergeben. Schon den ganzen Tag nörgelte Gwynn an ihr herum, aber Erin nahm ihr das nicht übel, denn sie wusste, wie unglücklich die junge Frau war.
Natürlich war Gwynns Ehe aus dynastischen Gründen geschlossen worden, aber der junge König von Antrim hatte das Herz seiner Braut schon lange vor der Hochzeit gewonnen. Zu spät erkannte sie, dass die Ritterlichkeit ihres Mannes nicht über den Traualtar hinausreichte. Jetzt, da seine Frau, seit fünf Monaten schwanger, im Elternhaus lebte, übte der hübsche, wortgewandte, verführerische Heith seine Anziehungskraft offenbar auf andere Frauen aus. Aber sie wagte es nicht, sich bei ihrem Vater zu beschweren. Aed würde sie wegen ihrer Eifersucht schelten oder – noch schlimmer – sein jähzorniges Temperament, das er meistens zu zügeln wusste, gegen den Schwiegersohn ins Feld führen.
»Du hast recht«, gab Erin mit sanfter Stimme zu. »Wenn ich nähe, muss ich versuchen, meine Gedanken im Zaum zu halten.«
Sie lächelte ihre Schwester an und spürte den tiefen Kummer, der das heitere Mädchen in eine schwermütige Frau verwandelt hatte. »Aber du warst immer die Tüchtigste von uns allen. Weißt du noch, wie Mutter angesichts unserer Stiche zu verzweifeln pflegte und deine immer lobte?«
Unsicher erwiderte Gwynn das Lächeln, und ihr wurde bewusst, dass sie diese freundlichen Worte eigentlich gar nicht verdiente, nachdem sie ihre Schwester den ganzen Tag schikaniert hatte. »Tut mir leid, Erin. Heute bin ich einfach unerträglich.«
Erin verließ ihren Platz am Fenster, ging zu ihr und kniete vor ihr nieder. Sie legte den Kopf auf Gwynns Knie, dann schaute sie ihr in die Augen. »Das verzeihe ich dir nur zu gern, denn ich weiß, wie sehr dir das Baby zu schaffen macht.«
»Süße Erin«, flüsterte Gwynn, und ihr Blick verschleierte sich. Trotz der Schwangerschaft war sie immer noch eine hübsche Frau. Ihrem Gesicht fehlte die Vollkommenheit, die ihre jüngste Schwester auszeichnete, aber zahlreiche Fürsten aus allen Landesteilen hatten sie umworben. Und deshalb fand sie ihr jetziges Schicksal umso bitterer.
Plötzlich lachte sie ihre Lieblingsschwester verlegen an. »Um Himmels willen, steh auf! Ich führe mich wie eine ekelhafte Hexe auf, und du redest mir auch noch gut zu. Wie wir alle wissen, ist es nicht das Baby, das mich quält und vor der Zeit altern lässt, sondern mein nichtswürdiger Ehemann.«
»Gwynn!«, mahnte Bride, die älteste Schwester, in scharfem Ton – eine Matrone von dreieinhalb Jahrzehnten und Mutter erwachsener Söhne. »So darfst du nicht über deinen Mann sprechen. Er ist dein Herr, und du musst ihm Ehrerbietung zeigen.«
»Ehrerbietung!« Verächtlich rümpfte Gwynn die Nase. »Wäre ich einigermaßen bei Verstand, würde ich einen Brehon aufsuchen und eine Trennung verlangen. Den Gesetzen zufolge könnte ich behalten, was mir gehört, und das müsste meinen edlen Gemahl empfindlich treffen. Dann würde er die Hälfte des Vermögens verlieren, das er an den Spieltischen zu verschleudern pflegt.«
»Gwynn ...« Diesmal klang der Tadel mild. Bede hatte das Wort ergriffen, die unscheinbarste der Schwestern, mit mausbraunem Haar und schmalem Gesicht. Nur die schönen smaragdgrünen Augen teilte sie mit den anderen. Trotzdem war sie stets die glücklichste gewesen, denn sie fand auch an den kleinsten Dingen Freude. Von Geburt an der Kirche versprochen genoss sie vollkommene Zufriedenheit. Mit zwölf war sie ihrem Orden beigetreten und kam nur zu besonderen Gelegenheiten nach Hause. Anlässlich der Sitzung hatte der Vater die Anwesenheit seiner ganzen Familie gewünscht, und das Wort des Ard-Righ galt als Gesetz. »Solltest du dich tatsächlich von deinem Mann trennen, würdest du es bereuen«, fuhr die Nonne fort, »denn du liebst ihn noch immer. Nach der Geburt des Babys wird sich vielleicht alles zum Guten wenden. Vergiss deinen Stolz nicht, Schwesterherz, und bedenk, dass die Zeit deine Freundin sein kann. Wenn die jugendlichen Stürme verebbt sind, wirst du wie eh und je Heiths Frau sein – und die Mutter seiner Erben.«
Immer noch zu Gwynns Füßen blickte Erin in Bedes sanftes Gesicht und bewunderte wieder einmal die Einfühlsamkeit der jungen Frau, die trotz des Klosterlebens keineswegs unwissend und weltfremd war, sondern einen bemerkenswerten gesunden Menschenverstand besaß.
Gwynn seufzte. »Ich muss dir beipflichten, Bede. Niemals werde ich ihn verlassen, denn ich bin dumm genug, ihn zu lieben. Ich sehne mich nach ihm, nehme dankbar die kleinen Zeichen seiner Zuneigung entgegen, schluchze und schreie, wann immer ich neue Beweise für seine Untreue erhalte. Vielleicht wird es mir nach der Niederkunft tatsächlich gelingen, sein Herz zurückzuerobern.« Sie wandte sich wieder zu ihrer jüngsten Schwester. »Wahrscheinlich hab ich dich heute nur deshalb geärgert, weil ich dich um den weisen Entschluss beneide, nie zu heiraten – dich niemals wie eine Närrin zu verlieben. Du solltest dein Herz dem Allmächtigen weihen so wie Bede. Aber wenn du dich nicht dazu durchringen kannst, lass es nicht von einem Sterblichen zertreten ...«
»Was für einen Unsinn redest du!«, fiel Bride ihr spöttisch ins Wort. »Sie ist schon über das heiratsfähige Alter hinaus. Soll sie vielleicht weiterhin das Schwert schwingen und mit unseren Brüdern fechten, bis alle Leute hören, wie unweiblich sie sich benimmt und an ihr verzweifeln? Sie ist eine Tochter von Aed Finnlaith und hat die Pflicht zu heiraten, so wie es auch wir taten, um unsere Bündnisse zu festigen und die Kronen unseres Vaters und unserer Brüder zu sichern.«
»Bride, lass das Mädchen in Ruhe ...«, begann Bede.
»Nein, das werde ich nicht! Vater nimmt viel zu viel Rücksicht auf ihre Gefühle. Aber Clonntairth war nun mal eine Tatsache des Lebens, und Erin muss darüber hinwegkommen.«
Als Clonntairth erwähnt wurde, erinnerte sich Erin plötzlich, wie ungeduldig sie auf die Rückkehr ihrer Eltern gewartet hatte. Sie musste sich beeilen, sonst würde sie den Vater nicht mehr erreichen, ehe er von den Dienstboten sein Bad vorbereiten ließ, und dann würde sie ihn erst spätabends sprechen können. Sie sprang auf und wusste, ihre unziemliche Hast würde Bride veranlassen, die Mutter eindringlich zu warnen.
Aber die älteste Schwester würde nicht mehr lange bleiben, sondern nach dem Ende der Versammlung mit ihrem Mann und den Söhnen in ihre eigene Provinz zurückreisen.
»Entschuldigt mich, Schwestern.« Ehe Erin aus dem Grianan floh, lächelte sie den anderen Damen zu, die beisammensaßen, nähten und sich unterhielten. Vor dem Haus hörte sie, wie ihr Vater mit der Mutter die Mahlzeit besprach, die an diesem Abend aufgetischt werden sollte.
Erin wollte ihre Mutter nicht sehen, denn deren trauriger Blick würde nur neue Schuldgefühle in ihr wecken. Sie bezweifelte, dass sie jemals so viel Güte und Freundlichkeit aufbringen würde wie Maeve, und lächelte wehmütig.
Mit Recht war sie stolz auf ihre Eltern. Aed Finnlaith, der hohe König von Eire, herrschte über mehrere irische Könige von niedrigerem Rang, die ständig miteinander stritten. Als ein großartiger Krieger schweißte er sie zusammen, wie es keinem anderen hohen König vor ihm gelungen war. Trotzdem war er stets ein liebevoller Vater und Ehemann gewesen. Wenn ihn Sorgen plagten, so wie an diesem Tag, suchte er die Gesellschaft seiner Maeve, die ihn mit ihrem sanften Gelächter und Geschichten über Konkurrenzkämpfe im Grianan aufheiterte.
Um nicht den beiden Eltern zu begegnen, lief Erin hinter das Sonnenhaus und wartete neben einem knorrigen alten Baum. Hier musste der Vater vorbeigehen, um seine schöne Residenz zu erreichen. Während sie wartete, biss sie sich auf die Lippen. Jedes einzelne Wort würde sie sorgfältig wählen müssen, denn er durfte nicht merken, dass heiße Rachsucht ihr Herz erfüllte.
Ein Rascheln im Gras warnte sie vor der Ankunft des Ard-Righ.
Lächelnd ging sie ihm entgegen. »Vater!«
Aed hob den rothaarigen Kopf mit den grauen Strähnen und erwiderte das Lächeln. »Wie nett von dir, den Kummer eines müden alten Mannes zu lindern, meine liebe Tochter. Was führt dich zu mir?«
Sie umarmten sich, und Erin erklärte: »Ich möchte dich ein Stück begleiten, Vater.«
Zweifelnd hob er die Brauen, während sie weitergingen. »Willst du mich nicht eher mit Fragen bestürmen?«
»Ich wüsste gern, wie sich der Rat entschieden hat«, gestand sie.
Aed musterte sie nachdenklich. Das jüngste seiner zehn Kinder war eine außergewöhnliche Schönheit. Erins Augen spiegelten die grüne Schönheit und die Stärke ihres Heimatlandes wider. Ihr ebenholzschwarzes Haar schimmerte unter der Sonne, umrahmte ein feingezeichnetes Gesicht mit zarter, rosiger Haut. Aber nicht nur ihr Aussehen erfüllte den Vater mit Stolz, sondern auch ihre Klugheit. Sie verstand sehr viel von Politik, war belesener als ihre Brüder und hatte eine wundervolle Handschrift. Außerdem besaß sie eine ebenso melodische Stimme wie Bede, deren Begabung für das Harfenspiel sie noch übertraf.
Und sie verstand, das Schwert zu schwingen. Obwohl sich Aeds Söhne darüber beschwerten, ließ er sie von den besten Lehrern in der Fechtkunst unterrichten. Die Klage der jungen Männer brachte er mit der Ermahnung zum Schweigen, noch härter an sich zu arbeiten. Wenn ihre Schwester sie in die Knie zwingen konnte – wie sollten sie dann gegen die Norweger bestehen?
Aber Erins Frage bewog Aed, die Stirn zu runzeln. Aufmerksam beobachtete er sie, seit sie nach dem Überfall der Wikinger auf Clonntairth mit ihrem halb wahnsinnigen Vetter Gregory heimgekehrt war.
Die Norweger hatten Clonntairth völlig zerstört und seine Bewohner versklavt. Erin und Gregory waren durch Schutt und Asche gekrochen und durch alte unterirdische Gänge entkommen. Aed hatte seinen Neffen zu den Mönchen nach Armagh geschickt. Dank ihrer inneren Kraft erholte sich seine Tochter allmählich von dem schlimmen Erlebnis, doch sie nährte immer noch ihren Hass gegen die Feinde.
Aed war ein kluger Mann und wusste, dass der Hass zu Verzweiflungstaten führen konnte. Ein solches Gefühl vergaß man nicht so leicht, durfte es aber nicht fördern und niemals leidenschaftlich handeln, ohne den Verstand einzusetzen, sonst begab man sich in große Gefahr.
Vergeblich hatte er versucht, seiner Tochter dies alles klarzumachen. Dass ihr abgrundtiefer Hass persönliche Züge zu tragen schien, überraschte und verwirrte ihn. Bridget war von eigener Hand gestorben, ihr Mann Brian auf dem Schlachtfeld gefallen. Den Angriff hatten die Truppen Olafs des Weißen ausgeführt, eines seltsam barmherzigen Mannes, trotz seines furchterregenden Erbes. Er gestattete seinen Männern nicht, Frauen und Kinder zu töten, untersagte jeden sinnlosen Mord an einem Krieger. Die Besiegten wurden versklavt. Doch das entsprach dem Lauf der Welt, und nicht alle Sklaven führten ein elendes Leben. Angeblich bekamen die Vasallen des norwegischen Wolfs ein besseres Essen als so manche Prinzen und wurden während des Winters in warme Wolle gekleidet.
Aed zuckte seufzend die Achseln. »Wir wollen die Dänen unterstützen, da sie geschworen haben, zum Heiligen Patrick zu beten und uns große Reichtümer zu seinen Ehren in Aussicht zu stellen. Über diesen Beschluss bin ich froh, denn ich glaube, sie werden siegen. Sie sind jetzt in sich geeint und deshalb stärker als zuvor.«
Lächelnd senkte Erin den Blick, aber nicht, bevor der Vater die Freude in ihren Augen gesehen hatte. Mit scharfer Stimme warnte er: »Du solltest dieser Entscheidung keine allzu große Bedeutung beimessen. Wir selbst werden keine Waffen für die Dänen erheben. All diese Wikinger sind mörderische Barbaren, ganz gleich, welchen Mantel sie tragen. Außerdem glaube ich, dass einige irische Stämme trotz des heutigen Beschlusses auf der anderen Seite kämpfen werden. Ich würde es begrüßen, die Norweger fallen zu sehen, aber wir werden nur von einem Habichtsnest ins nächste geraten. Der Wikinger wird hier bleiben, und ich achte nicht auf seine Herkunft. In den nächsten Jahren müssen wir uns alle Männer genau ansehen und sorgfältig abwägen, wer unser Feind ist und wer nicht.«
Erin nickte, obwohl sie sich im Augenblick nicht besonders für die klugen Worte ihres Vaters interessierte. Sie wandte sich ab, denn sie wollte verhindern, dass er ihre Gedanken las. An den Wikinger-Wolf erinnerte sie sich genauso deutlich wie an das Gemetzel in Clonntairth ...
Nach jener Schlacht war sie mit Gregory auf einen Hügel oberhalb der Stadt geflohen. Um nicht zu schreien, presste sie eine Hand auf den Mund, denn sie hatte beobachtet, wie Lady Moira, die Frau eines Kriegers im Heer Onkel Brians, mehrmals vergewaltigt worden war. Und dann hatte sie ihn heranreiten sehen, einen Sonnengott auf einem mitternachtsschwarzen Streitross, größer als seine Männer. Mit durchdringender Stimme gebot er ihnen Einhalt und tadelte sie, weil sie die Frau so grausam behandelten. Was würden ihnen halbtote Sklaven nützen, fragte er. Oh Gott, wie Erin ihn gehasst hatte ...
Sie verstand die Gedankengänge ihres Vaters. Nein, der norwegische Wolf hatte weder ihre Tante ermordet noch die arme Moira vergewaltigt. Aber nun herrschte er über Clonntairth, dessen Bewohner in der Sklaverei dieser heidnischen Barbaren lebten.
An jenem Tag hatte sich Erin feierlich geschworen, ihren Onkel, ihre Tante und Moira zu rächen. Und nun hoffte sie, der Wolf würde den Tod erleiden und seine Wölfin versklavt werden – eine schöne blonde Frau, die an seiner Seite geritten war, ein blutiges Schwert in der Hand. Er hatte sie angesehen und gelächelt, einen fast menschlichen Ausdruck in eisblauen Augen.
Menschlich! Erin betrachtete den Wolf von Norwegen, Olaf den Weißen, als wilden Barbaren, als Tier. Aber nun stand es fest. Wenn die Iren und die Dänen gemeinsam gegen die Norweger kämpften, würde er wahrscheinlich sterben.
Sie versuchte den erregten Klang ihrer Stimme zu dämpfen. »Wie Fennen mac Cormac mir erzählte, sollen sich die Heere am Carlingford-See versammeln. Er erwähnte auch, du würdest hinreiten, um die Schlacht zu verfolgen. Darf ich dich begleiten, Vater?«
»Und warum? Eine blutrünstige Frau missfällt Gott und allen Männern. Ich müsste dich zu Bede schicken, damit sie deine Seele läutert.«
»Du verabscheust diese Heiden doch auch«, protestierte sie. »Und ich hörte dich über sie fluchen. Ich frage mich, warum du dich nicht von deinem Hass leiten ließest, um Rache ...«
»Genug, meine Tochter!«, fiel Aed ihr ins Wort. »Ich bin der Ard-Righ, der König vieler Könige, und ich kann meine Männer nicht in ein sinnloses Gemetzel führen, um meinen persönlichen Hass zu befriedigen. Der Tod deines Onkels tut mir immer noch in der Seele weh, und ich werde aufatmen, wenn ich die Norweger auf dem Schlachtfeld fallen sehe. Aber die Dänen sollen ausführen, was ich nicht vermag.«
»Das verstehe ich Vater. Doch ich würde aus anderen Gründen gern mit dir reiten.«
»Oh? Und die wären?«
Es widerstrebte ihr, ihn zu belügen. Andererseits würde sie niemals erklären können, welches Grauen sie in Clonntairth empfunden hatte. Mein ist die Rache, sagte der Herr laut dem Heiligen Patrick. Und der Mensch durfte nicht Vergeltung üben. Aber Erins Herz schrie nach Rache. Lächelnd hob sie den Kopf. »Ich will kein Blut sehen, Vater. Es geht um ...« Sie machte eine Pause und errötete ein wenig. »... um Fennen mac Cormac. Ich glaube, er will mich umwerben. Noch weiß ich nicht, was ich davon halten soll, aber wenn ich eine Zeit lang in seiner Nähe wäre ...«
Interessiert hob Aed die Brauen. »Fennen mac Cormac? Ein guter Mann und ein wackerer Kämpfer, der allerdings eher mit seinem Verstand denkt als mit seinen Fäusten. Ich freue mich, meine Tochter.«
»Dann darf ich dich also begleiten?«
»Ich weiß nicht recht, Erin. Es könnte gefährlich sein. Wir müssen eine Abordnung entsenden, um zu erfahren, wem der Sieg winkt. Aber während ein Waffenstillstand für die Sicherheit der Männer sorgen würde ...«
»Vater!«, unterbrach sie ihn. Jetzt durfte sie nicht lockerlassen, nachdem ihn ihre Zuneigung zu dem jungen König Fennen wohlwollend gestimmt hatte. »Der alte Druide Mergwin besitzt eine Hütte in der Nähe des Carlingford-Sees. Dort wäre ich sicher, während du die Dänen triffst.«
Aed zuckte die Schultern. Er war Christ, hegte aber keinen Groll gegen die vereinzelten Druiden, die immer noch dem alten Glauben anhingen. Und er mochte Mergwin, dem er Erin schon oft anvertraut hatte. In der Hütte, von dichtem Wald umgeben, würde ihr nichts zustoßen. Doch er wollte den Wunsch seiner Tochter nicht sofort erfüllen. Erst einmal sollte sie gründlich über weibliche Tugenden wie Pflichtbewusstsein und Gehorsam nachdenken. »Ich werde mit deiner Mutter darüber reden und dir morgen meine Entscheidung mitteilen. Heute Abend darfst du an der Seite des jungen Königs speisen, der dein Wohlgefallen erregt hat, und danach unterhalte dich mit deiner Schwester Bede, die einen guten Einfluss auf dich ausübt.«
Ergeben neigte sie den Kopf und verbarg ihre Freude, denn sie wusste bereits, dass sie gesiegt hatte. »Ja, Vater.« Sie ließ sich auf die Stirn küssen, dann sah sie ihm nach, als er davonging.
2
In wallender weißer Robe, mit feurigen Augen, bot der Druide Mergwin einen eindrucksvollen Anblick. Sein langes Haar verschmolz mit dem dichten grauen Bart, der bis zu den Knien reichte. Angeblich war er der Sohn einer Druidenpriesterin und eines norwegischen Runenmeisters, der um die Jahrhundertwende mit den ersten Wikingern nach Irland gekommen war, um die Insel zu überfallen.
Mergwin sprach nie über seine Herkunft, aber welche Geheimnisse seine Vergangenheit auch immer bergen mochten – niemand zweifelte an seinem umfassenden Wissen und seinen magischen Kräften, die er vermutlich zweierlei Gottheiten verdankte. In seiner Hütte brannte ein bläuliches Feuer. Darüber hing ein Kessel, und darin braute er Getränke, die verschiedenen Zwecken dienten. So manches Mädchen kniete an kirchlichen Feiertagen in der Kapelle, rannte dann zu dem alten Druiden und ließ sich einen Liebestrank geben, um einen Krieger zu betören.
Viele Leute bekreuzigten sich und riefen die Jungfrau Maria an, wenn sie an seiner Behausung im Wald vorbeigingen, denn sie hielten ihn für verrückt. Andere erklärten, er sei ein böser Zauberer, gegen den man unerbittlich vorgehen müsse. Aber sie verstummten, sobald sie ein Blick aus seinen zwingenden Augen traf. Und so lebte er unbehelligt in seiner Einsamkeit und hieß alle willkommen, die ihn aufsuchten.
Er liebte und achtete Aed Finnlaith. In Ard-Righ von Tara erkannte er einen gerechten, ungewöhnlichen Mann, der Verhandlungen unter seinen ständig streitenden Unterkönigen allen sinnlosen Kämpfen vorzog. Auch der jüngsten Prinzessin galt Mergwins Liebe. Der Vater hatte Erin schon als Kind zu ihm gebracht. Die Mönche und Priester mochten sie mit der Lehre Christi vertraut machen, aber von dem alten Druiden erfuhr sie alles über ihre eigene Seele und die Erde ringsum. Er hatte ihr Ehrfurcht vor Tieren und Pflanzen beigebracht und sie gelehrt, die Zeichen des Himmels zu lesen, Sonnenschein oder Gewitter vorauszusagen, welche Kräuter gewisse Krankheiten heilten oder Schmerzen linderten.
An diesem Tag ritt sie mit dem König von Connaught, Fennen mac Cormac, zu ihm. Irgendetwas bedrückte Mergwin, während er ihr entgegenging. Ein Schatten schien die Sonne zu verdunkeln. Er beobachtete, wie der junge Mann die Prinzessin vom Pferd hob, und es sah so aus, als würde Fennen jenen Schatten werfen.
Aber Erin lachte fröhlich. Offenbar genoss sie die Gesellschaft ihres hübschen Begleiters, und Mergwin schalt sich einen dummen alten Mann. Mac Cormac war ein allseits geachteter, kluger, gütiger König, ein passender Ehemann für Aeds Tochter. Ich muss die Zeichen von Neuem lesen, beschloss der Druide.
»Erin mac Aed! Fennen mac Cormac!«, rief er und verneigte sich. »Seid gegrüßt! Was führt Euch hierher?« Das wusste er natürlich. Das ganze Land wusste, dass sich die Streitkräfte der Wikinger bei Carlingford Lough versammeln würden. Er spürte bereits das Beben der Erde, und der Wind hatte ihm flüsternd vom Blut erzählt, das den Boden tränken würde.
»Eine Schlacht«, antwortete Fennen und riss seinen Blick nur kurz von der Prinzessin los, um den Druiden anzuschauen. »Ich reite als Gesandter mit dem Ard-Righ. Wir werden die Kämpfe verfolgen und dann von den dänischen Siegern Gold und Silber für den Heiligen Patrick entgegennehmen.«
Mergwin nickte dem jungen König zu, den er für einen Narren hielt. Die Dänen und Norweger hatten das Land gleichermaßen verwüstet und würden es wieder tun. Der irische Gesandte konnte von Glück reden, wenn er am Leben blieb.
»Aed Finnlaith, Maelsechlainn und ich selbst werden den Schatz in Empfang nehmen und dann hierher zurückkehren, um meine Lady Erin abzuholen. Gebt inzwischen gut auf sie Acht, Alter.«
Mergwin versteifte sich. Dazu brauchte er von diesem jungen Emporkömmling nicht eigens aufgefordert zu werden. Kühl erwiderte er: »Bei mir ist es der Tochter von Aed Finnlaith stets wohl ergangen.«
Doch Fennen schien Mergwins Tonfall nicht zu bemerken, er hatte nur Augen für Erin. Am letzten Abend, im Sitzungssaal, war er niemals allein mit ihr gewesen. Bedrückt hatte er beobachtet, wie all die Herren, die jungen und alten gleichermaßen, von der Prinzessin verzaubert worden waren. »Lasst mich noch eine Weile mit der Lady allein, Druide, dann übergebe ich sie Eurer Obhut.«
Der alte Mann entfernte sich nur um wenige Schritte, und Fennen reichte Erin die Hand. »Gehen wir ein Stück in den Wald«, bat er. Sie hob die Brauen, und als sie Mergwin einen vielsagenden Blick zuwarf, musste er lächeln. Er kannte sie so gut. Und warum sollte ihr der hübsche, kräftig gebaute junge Mann nicht gefallen? Aber eins wusste der Druide – mochte sie auch mit einem Verehrer in den Wald wandern und ihren ganzen Charme spielen lassen, niemals würde sie ihm etwas Unziemliches erlauben oder irgendetwas versprechen.
Während der König die Prinzessin zwischen den Bäumen auf einem schmalen Weg dahinführte, verfluchte er den Ard-Righ. Jetzt zählte sie zwanzig Jahre, und er liebte sie schon lange. Ihre Schwestern waren bereits mit sechzehn verheiratet worden, aber Aed hatte Fennens Werbung um Erin nie unterstützt und allen immer nur erklärt, seine jüngste Tochter würde er erst dann verehelichen, wenn er die Neigung ihres Herzens kannte.
Doch mac Cormac, dem so viele Frauen zu Füßen lagen, wünschte sich keine andere als die schöne Erin. Sicher, sie war ein sehr lebhaftes Mädchen, das in der Ehe gezähmt werden musste, und genau das wollte er tun, natürlich sanft und liebevoll.
Auch sie dachte an eine mögliche Hochzeit, aber als sie den eindringlichen Blick seiner dunklen Augen erwiderte, musste sie sich zu einem Lächeln zwingen. Sie mochte ihn, aber seit dem Grauen von Clonntairth schätzte sie ihre Freiheit über alles. Leise seufzte sie. Eines Tages würde sie heiraten müssen, doch vorerst war es ihr viel wichtiger, die Norweger besiegt zu sehen.
»Oh Erin, warum bereitet es Euch so großes Vergnügen, mich zu quälen?«
Verwirrt schaute sie Fennen an, las die heiße Liebe in seinem Gesicht und verspürte heftige Gewissensbisse. »Ich möchte Euch wirklich nicht wehtun.«
»Dann verlobt Euch mit mir. Wir sprechen mit Eurem Vater und ...«
»Fennen, bitte! Ihr bedeutet mir sehr viel, aber ich ersuche Euch, mich nicht zu drängen. Gebt mir Zeit, Euch besser kennen- und lieben zu lernen.«
Wie lange sollte er noch warten? Plötzlich nahm er sie ungeduldig in die Arme. »Gewährt mir wenigstens einen Kuss als Verheißung meines künftigen Glücks.«
»Also gut – einen Kuss«, stimmte sie zu. Sein Verlangen faszinierte sie und schmeichelte ihr.
Ehrerbietig berührte er Erins Lippen mit seinen, streichelte ihren Rücken, und seine andere Hand umfasste ihren Nacken. Sie fand es angenehm, seine starken Arme zu spüren, auch der Kuss gefiel ihr, obwohl er nicht die freudige Erregung in ihr weckte, die sie erwartet hatte. Fennens Zungenspitze glitt über ihren geschlossenen Mund und versuchte ihn behutsam zu öffnen. Neugierig gab sie nach, und seine Zunge spielte mit ihrer. Auch das erschien ihr nicht unangenehm.
Doch dann presste er sie fest an sich, und da wurde sie von Panik ergriffen. Visionen von jener Vergewaltigung von Lady Moira in den Händen der Norweger tauchten vor Erins geistigem Auge auf, und sie glaubte, wieder das verzweifelte Geschrei zu hören. Mit aller Kraft schlug sie ins Gesicht ihres Verehrers. »Ihr spracht von einem Kuss, Mylord von Connaught! Aber nun missbraucht Ihr meine Zustimmung, nachdem mein Vater mich Euch anvertraut hat.«
Wütend rieb er sich die Wange, dann erkannte er, dass er zu weit gegangen war. »Verzeiht mir, Mylady«, entschuldigte er sich mit einer Demut, die er keineswegs empfand. Eines Tages würde er Erin nicht mehr loslassen müssen und ihr alle Freuden der Liebe beibringen. In ihrem Kuss hatte er eine schlummernde Sinnlichkeit gespürt, die ihr selbst noch nicht bewusst war. Nun fand er Trost in der Gewissheit, dass sich seine Geduld lohnen würde.
»Oh Fennen, es tut auch mir leid.« Wieder empfand sie Schuldgefühle. Sie hatte seine Zärtlichkeiten genossen – bis sie an die Norweger erinnert worden war. Zu ihrer Erleichterung erwiderte er ihr Lächeln, und sie freute sich an der Macht, die sie über diesen hübschen, vielbegehrten Krieger ausübte. »Jetzt müsst Ihr mich zu Mergwin zurückbringen und dann sehen, welches Schicksal die Wikinger in der Schlacht erleiden. Vater glaubt ganz fest an eine norwegische Niederlage.«
Er nickte. Respektvoll nahm er ihren Arm und führte sie zur Hütte zurück. »Die Dänen sind stark, und sie haben uns große Reichtümer versprochen.«
Der Druide stand vor seiner Tür. »Das Tageslicht schwindet rasch dahin, König von Connaught«, betonte er.
Aber Fennen beachtete ihn nicht. »Passt gut auf Euch auf, meine Prinzessin. Bald sehen wir uns wieder.«
»Gott mit Euch, Mylord.« Anmutig knickste sie und lächelte sittsam, als er einen Kuss auf ihre Lippen hauchte.
Nur Mergwin sah das mutwillige Funkeln in ihren Augen hinter den halbgesenkten Wimpern und hätte beinahe gelacht. Glaubt bloß nicht, Ihr hättet Erin schon erobert, junger Herr, dachte er. Fennen legte ihm ein kostbares besticktes Tuch in die Hand, ein Geschenk von Lady Maeve und Aed, dann schwang er sich in prahlerischer Haltung auf sein Streitross.
Erin winkte ihm nach, als er zwischen den Bäumen davonritt, dann wandte sie sich lächelnd zu Mergwin. »Nun, wie denkt Ihr über Fennen? Ist er nicht ein Angeber wie die meisten Männer?«
Belustigt hob der Druide die Brauen. »Ihr verspottet den König von Connaught? Und ich dachte, Ihr hättet mir Euren Verlobten gebracht.«
Seufzend ging sie in die Hütte, und er folgte ihr. »Nein, Mergwin, ich verspotte ihn nicht. Er ist ein guter Mann und ein gerechter König, nur – ich weiß es einfach nicht. Wahrscheinlich liegt es an mir. Ich enttäusche meine Eltern und ärgere meine Schwester, aber ich verspüre nicht die geringste Neigung zu heiraten.«
»Vielleicht möchtet Ihr einem Orden beitreten so wie Eure Schwester Bede«, schlug er boshaft vor.
»Oh nein!« Lachend wandte sie sich zu ihrem alten Freund und Mentor. »Ich kann Bedes Gott nicht so blindlings lieben ...«
»Oder den Hass in Eurem Herzen löschen«, unterbrach er sie leise.
Bedrückt zuckte sie die Achseln und ging zum Feuer, um ihre Hände zu wärmen. »Ich sah eine Stadt in Schutt und Asche fallen. Mein Vetter verlor den Verstand, die Leichen meines Onkels und meiner Tante wurden den Geiern zum Fraß vorgeworfen – und bis jetzt nicht gerächt. Wundert es Euch, dass mein Hass mich Tag und Nacht begleitet?«
Mergwin setzte sich an seinen Tisch und griff nach dem Mörser, in dem er eine Wurzelmischung zerstieß. »Euer Vater konnte Clonntairth nicht rächen, Erin. Die zerstrittenen irischen Könige bekämpften einander, und die Norweger waren damals sehr mächtig, und das sind sie auch jetzt. Aeds Sorge muss vor allem dem Schutz Taras und der Brehon-Gesetze gelten. Er darf den Regierungssitz keinem Angriff ausliefern – obwohl er allen Grund hätte, Rache zu üben. Sein Bruder fiel im Kampf gegen die Dänen, sein Vater wurde von einem irischen König ermordet. Aber soll er sich rächen und den Zusammenbruch der ohnehin geringfügigen zentralisierten Ordnung in Kauf nehmen?«
»Und was soll ich tun? Fennen mac Cormac heiraten, eine fügsame Ehefrau werden und wegschauen, wenn mein Land verwüstet wird?«
Ihr werdet Cormacs Sohn nicht heiraten, dachte Mergwin, doch das sprach er nicht aus. Er neigte sich wieder über seine Wurzeln. »Nun, Ihr könntet es schlimmer treffen.«
»Oder besser!«
Eigentlich müsste ich sie vor der dunklen Aura warnen, die den König umgibt, überlegte Mergwin. Sie bedeutet Leid oder Schmerzen – aber für wen? Für Fennen oder die Prinzessin, die er begehrt?
Leidenschaftlich fügte Erin hinzu: »Ich kann nicht heiraten und Kinder gebären und zusehen, wie die Männer ihren Geschäften nachgehen, während die Wikinger meine Provinz zerstören!«
Mergwin schaute in die funkelnden smaragdgrünen Augen. »Die Wikinger werden auch noch zur Zeit Eurer Kinder und Kindeskinder hier herkommen.«
»Und wir sitzen untätig da wie Opferlämmer? Werden die großen Könige der Provinzen wie Mylord Fennen sich auf die Seite der Schlächter stellen?«
»Es wird nicht nur Schlachten geben«, erwiderte er emotionslos. »Ebenso wenig werden die Eindringlinge zuletzt lachen.« Erin holte tief Atem. Auf dem Tisch lag ein Beutel aus feinem Rehleder. Darin steckten Mergwins Runen, schön gemeißelte steinerne Schriftzeichen.
Impulsiv packte sie den Beutel und schüttelte ihn vor der Nase des Druiden. »Werft die Runen für mich! Ihr müsst mir mein Schicksal weissagen!«
»Nein!«, protestierte er mit scharfer Stimme.
Sie kniete vor ihm nieder, doch in dieser Geste lag keine Demut. Stolz hob sie das Kinn. »Dann will ich’s selber tun. Gestern Abend, an der Tafel, erzählte der neue Dichter meines Vaters die Geschichte von Maelsechlainns Tochter. Zusammen mit fünfzehn anderen Mädchen stellte sie dem Norweger Turgeis eine Falle und erstach ihn. Eine Frau befreite die Iren von einem Heiden, Mergwin! Und als die Wikinger Clonntairth einnahmen, sah ich eine Kriegerin an ihrer Seite kämpfen. Genau das, mein lieber Druide, beabsichtige auch ich. Vielleicht werden die Eindringlinge unser Land noch jahrzehntelang verheeren, aber ich werde etwas dagegen unternehmen. Und wenn ich sterbe, wird der Feind neben mir sterben. Mit diesem Schicksal kann ich leben.«
»Törichtes Mädchen!« Mergwin stand auf, und seine blitzenden Augen verengten sich. »Wollt Ihr das Herz Eures Vaters brechen und Eure Mutter zur Verzweiflung treiben?«
»Viele Männer fallen im Kampf. Und ich kann das Schwert besser schwingen als die meisten. Mit jedem Tag wächst der Zorn meiner Brüder, weil ich sie übertrumpfe ...«
»Halt!« Er hob die Hände, die weiten Ärmel seiner Robe flatterten hinter ihm. »Ich werde die Runen für Euch lesen, Erin, und dann werdet Ihr sehen, dass solche Träume nur alberne Fantasiegebilde sind.«
Leise lachte sie, und er las tiefe Zuneigung in ihren Augen, aber auch Triumph, weil sie ihr Ziel erreicht hatte. »Oh, danke, Mergwin!«
»Hoffentlich zeigen Euch die Runen eine achtbare Ehefrau und Mutter zahlreicher Kinder, die pflichtbewusst die Wünsche ihres Gemahls erfüllt«, murmelte er.
Wenig später saßen sie sich am Tisch gegenüber. Draußen brach die Dunkelheit herein, nur das Feuer und eine kostbare Kerze spendeten Licht.
Mergwin breitete ein Leinentuch aus und warf die Runen darauf, so dass die Schriftzeichen nach unten gekehrt waren. »Nun müsst Ihr drei berühren, Erin.«
Sie gehorchte, und er drehte das erste Zeichen um. Thurisaz, der Stein des Tors. Ihm zufolge sollte Erin sich still verhalten, die Welt ringsum aufmerksam beobachten und nicht ungestüm vorwärts stürmen. Wortlos drehte er den zweiten Stein um. Hagalez, der Künder schlimmer Tragödien und heftigen Aufruhrs, ein Götterstein. Ein Schicksal, das der Mensch nicht abwenden konnte, einer gewaltigen Meereswelle gleich, wie der endlose Strom der Eindringlinge ... Immer noch schweigend, betrachtete der alte Druide den dritten Stein, eine leere Rune.
Sein Blick verdüsterte sich, und eine böse Ahnung stieg in Erin auf. »Sagt mir, was Ihr seht, Mergwin!«
Darüber wollte er nicht sprechen. Die leere Rune war unfassbar, für die Wikinger die Rune Odins. Sie konnte den Tod bedeuten, aber auch einen Anfang, eine Wiedergeburt. Da sie auf Hagalez gefolgt war, wies sie auf gefährliche Hindernisse hin, die vor Erin emporragen würden. Sie musste die Veränderung hinnehmen, die auf sie zukam. Dann würde sie lange leben und mit der Zeit auch ihr Glück finden. Doch der Weg zu diesem Ziel war beschwerlich.
Konzentriert schloss er die Augen. Seine Finger liebkosten die kühlen Steine, und er vertiefte sich in die Symbole. Er sah Erin in einer Rüstung, so wie sie es angedroht hatte, fühlte den Schmerz der Strafe, der sie erwartete. Ein Mann würde diese Strafe vollziehen, aber nicht Fennen. Ein golden glänzender Mann, von Licht umhüllt, mächtig und gefährlich, jedoch nicht von einer bösen Aura umgeben. Er strahlte entschlossene Kraft aus. Die Runen schienen zu flüstern, Erins Lebensweg würde seinen unwiderruflich kreuzen. In Gedanken hörte Mergwin einen Wolf heulen. Eine hoch erhobene Standarte trug das Bild des Tieres – eine Wikingerstandarte.
»Mergwin!«, drängte Erin, und er öffnete die Augen.
»Ich sehe genau das, was Aeds Tochter zukommt. Ihr werdet vielen Kindern das Leben schenken und alt werden.«
»Ihr belügt mich, Druide!«, beschuldigte sie ihn erbost.
Mergwin erhob sich. »Nein. Ich bin ein müder Greis, der jetzt essen und schlafen gehen wird.« Ungeduldig packte er die Steine in den Rehlederbeutel.
Zögernd stand auch Erin auf, dann lächelte sie und folgte ihm zum Feuer. Sein schroffer Tonfall tat ihrer Zuneigung keinen Abbruch. »Ein Greis? Wenn Ihr alle Bäume dieses Waldes überlebt habt, werdet ihr noch immer nicht alt sein. Oh, dieser Eintopf, der offenbar schon den ganzen Tag hier brodelt, duftet köstlich. Wir wollen essen, dann erzähle ich Euch die neuesten Klatschgeschichten aus Tara.« Sie nahm den Deckel vom Kessel, ergriff den Schöpflöffel und füllte zwei hölzerne Schüsseln. »In meiner Satteltasche habe ich eine gute Flasche Wein aus dem Elsass. Die kaufte ich einem Händler ab, der meiner Mutter Seidenstoffe brachte. Vielleicht bekommen wir einen Schwips, Mergwin.«
Er stellte seine Schüssel auf den Tisch. »Ich gewiss nicht, sonst entlockt Ihr mir Worte, die ich für mich behalten möchte.«
Ihre Augen verdunkelten sich, dann entgegnete sie würdevoll: »Es liegt keineswegs in meiner Absicht, Euch zu überlisten, Druide.« Sie wandte sich zur Tür, um zu ihrem Pferd hinauszugehen und den Wein zu holen. Doch sie drehte sich noch einmal um. »Was Eure Runen sagen, kümmert mich nicht, Druide, denn ich werde mein Schicksal selbst in die Hand nehmen.«
3
Die Hände in die Hüften gestemmt, stand er im Dämmerlicht neben der knorrigen Esche. Sein roter Mantel, mit dem Wolfskopf geschmückt, umwehte ihn, der Wind blies ihm das blonde Haar in die Stirn. Er blickte auf Carlingford Lough hinab. Am anderen Ufer des Sees lagerten die Dänen. Tausende versammelten sich in dieser Nacht, denn bei Tagesanbruch würde die Schlacht beginnen.
Olaf fröstelte ein wenig. Die Feinde waren geschickt und klug. Die Rüstung, die er ebenso wie einige irische Könige trug, verdankte er der erfinderischen Fertigkeit der Dänen, und gegen ihre List würde er am Morgen kämpfen.
Aber er, ein norwegischer Prinz, suchte mehr als Schlachten und Kriegsbeute. Schon während seiner Kindheit hatte er in kalten Nächten zu Füßen der Geschichtenerzähler von Irland geträumt. Als jüngerer Sohn konnte er die Königswürde des Vaters nicht erben, er musste sein Schicksal selbst bestimmen. Er dachte an seinen Onkel Turgeis, der einst einen Großteil dieser smaragdgrünen Insel beherrscht hatte, vom Fluss Liffey bis Dubhlain – entschlossen, ein heidnisches Reich zu errichten. Doch das irische Volk hielt an seinem eigenen Gott fest.
Ich will dieses Land erobern und dann mit den Menschen hier zusammenleben, nahm sich Olaf vor. Ihn kümmerte es nicht, welchem Gott sie huldigten. Vor seinem geistigen Auge sah er ein großartiges neues Volk, das die Kraft und die architektonischen Talente der Wikinger und die wundervollen sozialen Gesetze und das Wissen der Iren in sich vereinte. Nur der Norweger, der ein Ire wird, kann überleben.
Er seufzte. Törichte Gedanken für einen Krieger, dem der Untergang drohte ...
Im Augenblick vermochte er gar nichts zu erobern. Er war nur einer von vielen Feldherrn, die das norwegische Heer bei Tagesanbruch in die Schlacht führen würden. Aber er sehnte sich nach einem eigenen Königreich – hier in Irland.
Eine Hand legte sich auf seine Schulter. Er zuckte nicht zusammen, griff auch nicht nach seinem Schwert, denn er kannte diese Berührung. Langsam drehte er sich zu seiner süßen Grenilde um, einer hochgewachsenen, mutigen Frau, die wie ein Mann in den Kampf zu ziehen pflegte. Ihre einzigartige Schönheit hielt sein Herz und seine Seele gefangen.
Sie hob die goldblonden Brauen. »Willst du nicht zu mir ins Bett kommen, mein Wolf? Ich möchte dich morgen nicht vom Pferd fallen sehen, müde nach einer schlaflosen Nacht.«
Belustigt zog er sie an sich. »Du willst, dass ich schlafe, meine teure Barbarin? Oder hast du was anderes im Sinn?«
Ihr Lächeln bezauberte ihn wie so oft. Er war ihr begegnet, als sie eine andere Wikingertruppe bei einem Angriff auf ein Dorf angeführt und seine eigene getroffen hatte. Nach dem Sieg waren sie aufeinander zugaloppiert, hatten lachend die Schwerter gesenkt. Seither ritten sie zusammen, ein Liebes- und Abenteurerpaar. Sie hatte schon andere Männer gekannt, und in ihren Adern floss kein königliches Blut. Aber während andere Krieger Prinzessinnen heirateten, die daheim ein behütetes Leben führten, hatte er Grenilde zu seiner Lebensgefährtin erkoren, die alles mit ihm teilte. Neben ihrer Schönheit und Klugheit verblassten andere Frauen.
Sie hatte ihn von dem Verlangen befreit, bei seinen Überfällen Wehrlose zu vergewaltigen. Eine schreiende Frau reizte ihn nicht mehr, seit er Nacht für Nacht dieses göttliche Geschöpf in den Armen hielt. Seinen Männern konnte er die Frauen nicht verwehren, die als Teil der Beute galten. Aber er hatte gewisse Regeln eingeführt, und nun blieben manche Wikinger mit ihren Irinnen zusammen, sahen keine Sklavinnen in ihnen, sondern beinahe Ehefrauen.
Olaf küsste Grenilde, die willig die Lippen öffnete. Und während ihre Zungen ein zärtliches Duell ausfochten, wuchs seine Begierde. »Gehen wir ins Bett«, flüsterte er.
In seinem Zelt zog sie ihm den Mantel aus, das Kettenhemd, den Gürtel, die Tunika, die hohen Gamaschen aus rauem Leder. Die sichtliche Freude, die ihr diese Tätigkeit bereitete, brachte sein Blut noch mehr in Wallung.
Als er nackt vor ihr stand, liebkoste ihr Blick seinen kraftvollen Körper. Ihre Atemzüge beschleunigten sich, sie trat näher, und ihre Zungenspitze berührte eine Narbe an seiner bronzebraunen, goldblond behaarten Brust. Da riss er ihr ungeduldig die Tunika vom Leib, presste sie an sich und sank mit ihr aufs Lager. Hungrig betrachtete er die milchweißen Brüste, die aufgerichteten rosigen Spitzen, die von ihrer wilden Sehnsucht zeugten. Ihre Lippen fanden sich wieder, dann bedeckte er Grenildes ganzen Körper mit glühenden Küssen, genoss ihr halb ersticktes, flehendes Stöhnen, das ihm süße Qualen versprach.
Während sie sich vereinten, verschlossen seine heißen Lippen erneut ihren Mund, und er schlang die Finger in ihr zerzaustes goldenes Haar. Sie war stark, seine geliebte Wikingerin, und doch von betörender Weiblichkeit. Hemmungslos erwiderte sie seine Leidenschaft, schlang die Beine um seine Hüften, unterwarf sich bereitwillig seiner größeren Kraft.
Später lag er neben Grenilde und streichelte ihren erhitzten Körper. Wie schön und vollkommen sie war – und wie viel sie ihm bedeutete, seine unersättliche Geliebte und furchtlose Kämpferin ...
Eng aneinandergeschmiegt schliefen sie ein.
Im Dunkel seines Traums sah er Schlangen auf sich zukommen, die geifernden Köpfe hoch erhoben. Mit seinem Schwert versuchte er sie abzuwehren, aber immer mehr krochen heran, und hinter ihnen erklangen grausige Schreie ... Schweißgebadet erwachte er und bebte am ganzen Körper. Wie gehetzt schaute er sich um, aber kein Feind war in sein Zelt eingedrungen. Nur Grenilde lag neben ihm auf den Felldecken. Bestürzt richtete sie sich auf. »Was hast du, mein Liebster? Der Wolf, der in keiner Schlacht mit der Wimper zuckt, zittert wegen eines Alptraums? Erzähl mir davon, und ich werde alle bösen Schatten verjagen.«
Er starrte in ihre saphirblauen Augen, die im bleichen Mondlicht glänzten, und das Fieber seiner Angst ergriff ihn erneut. »Morgen darfst du nicht in die Schlacht ziehen.«
Empört erwiderte sie seinen Blick. »Ich weiß besser zu kämpfen als die meisten deiner Männer«, fauchte sie verächtlich. »Und ich bin meine eigene Herrin. Ich werde das Schwert schwingen, wann immer es mir beliebt.«
»Du bist nicht deine eigene Herrin«, widersprach er wütend, »sondern meine Gefährtin, und du wirst tun, was ich dir sage!«
Grenilde zögerte, verwundert über den unvernünftigen Zorn, der in seinen Augen funkelte. Sollte sie ihn daran erinnern, dass sie die Achtung seiner Krieger errungen hatte, obwohl sie nur eine Frau war? Nein, besser nicht. Sie liebte ihn, und so beschloss sie, vorerst nachzugeben und dann zu tun, was sie wollte. Zärtlich drückte sie sich an ihn. »Was immer du wünschst, mein Wolf«, murmelte sie gähnend. Sie legte einen Arm über seine Brust, und bald darauf stellte sie sich schlafend.
Doch sie blieb noch lange wach, während er in einen tiefen Schlaf der Erschöpfung fiel, und betete zum guten Gott Thor, er möge ihren Liebsten am Morgen beschützen.
Die Schlacht von Carlingford Lough war die blutigste, die jemals auf dem smaragdgrünen Feld stattgefunden hatte. Am Nachmittag, inmitten zahlloser Leichen, erkannte Olaf seine Niederlage.
Blut befleckte seinen ganzen Körper, mischte sich mit dem Schweiß, der in seine Augen rann und seinen Blick verschleierte. Einmal war er nur vom grausigen Schrei eines Angreifers vor dem sicheren Tod gerettet worden.
Seinen Arm, mit dem Gewicht des Schwerts vertraut, drohte bleierne Müdigkeit zu lähmen, und sein Geist rebellierte, obwohl er an ein solches Gemetzel gewöhnt war. Ihm graute vor dem Geruch des Todes, der ihn umgab. Auf dem ganzen Schlachtfeld lagen gefallene Norwegerkönige und -prinzen. Noch wusste er nicht, dass er zu den wenigen königlichen Hoheiten und Truppenführern zählte, die den Kampf überstanden hatten. Nur eins wusste er – wenn norwegisches Leben gerettet werden sollte, mussten sich seine Krieger zurückziehen. Es würde kein geordneter Rückzug sein. Die Überlebenden würden fliehen und sich irgendwo verstecken, bis sie sich erneut versammeln konnten.
Er hob die Hände, gab das Zeichen zum Rückzug. Nun besetzten die Dänen Dubhlain. Aber er würde Rache üben.
Blitzschnell wich er einer dänischen Streitaxt aus, und die massive Waffe grub sich in die Erde. Er nutzte die Gunst des Augenblicks, streckte den Feind nieder, dann schaute er sich um und sah seine restlichen Krieger zwischen den Bäumen verschwinden.
Während er das Schlachtfeld zu überqueren begann und ebenfalls das Wäldchen ansteuerte, entdeckte er Grenilde, immer noch mitten im Kampfgetümmel. Anmutig tänzelte sie umher, das Schwert erhoben, und wehrte ihre Gegner ab. Heller Zorn erfasste ihn, denn sie hatte seinen Befehl missachtet. Doch dann stieg Furcht in ihm auf, und er dachte an seinen Traum von den Dänen in Schlangengestalt.
Er rief nach ihr, und ihre blauen Augen begegneten seinem Blick. Dann rannte sie in seine Richtung, blieb kurz stehen, lief weiter, musste noch einmal innehalten, um sich gegen das erhobene Schwert eines riesigen Mannes zu verteidigen.
Wieder stürmte sie zu dem Wäldchen, verfolgt von Dänen, die Streitäxte, Speere, Ketten und Schwerter schwenkten.
Olaf eilte ihnen entgegen und schrie Grenilde zu, sie solle sich hinter ihm verschanzen. Zu zweit mussten sie es mit zehn Gegnern aufnehmen, aber einer nach dem anderen fiel.
»Lauf, Grenilde!«, brüllte er und stürzte sich auf den letzten seiner Feinde. Das Blut, das aus einem Kratzer am Arm quoll und über seine gepanzerte Brust rann, nahm er kaum wahr – auch nicht die Schwäche in seinem Bein, die von einer tiefen, klaffenden Schnittwunde im Oberschenkel herrührte. Jetzt durfte er sich nicht von Müdigkeit und Schmerz übermannen lassen. Er musste kämpfen wie ein Dämon und alles außer seinem Überlebenswillen vergessen.
Nachdem er den letzten Angreifer niedergestreckt hatte, verließ er das Schlachtfeld, rannte zwischen die Bäume und rief Grenildes Namen, bis sie antwortete. Er folgte dem Klang ihrer Stimme, und da fand er sie. Sie lag auf Moos und welken Blättern, schöner denn je. Den Schmutz, das Blut und den Schweiß auf ihren Wangen sah er nicht, nur die wundervollen saphirblauen Augen. Sie drückten alles aus, was sie für ihn empfand, dann legte sich ein Schleier darüber, und sie stieß einen gellenden Schmerzensschrei aus – einen Todesschrei.
Er kniete neben ihr nieder. »Nein!«, stieß er hervor, drehte ihren Körper herum und suchte nach der Wunde. Als er die Arme um sie schlang, spürte er ihr warmes Blut. Sie war am Rücken verwundet worden, und während er sie verzweifelt an sich presste, fühlte er, wie langsam das Leben aus ihrem Körper wich. Mit letzter Kraft versuchte sie sich an ihm festzuhalten. »Mein Liebster«, wisperte sie.
Von namenlosem Schmerz ergriffen strich er ihr das zerzauste Haar aus der Stirn und küsste ihre Lippen. »Bis in alle Ewigkeit werde ich dich lieben«, schwor er, und sein Atem mischte sich mit ihrem, der allmählich erlosch. »Du darfst mich nicht verlassen.«
Obwohl Blut aus ihrem Mund quoll, brachte sie irgendwie ein Lächeln zustande, dann wurde sie von heftigem Husten geschüttelt.
»Stirb nicht!«, flehte er. »Bitte, stirb nicht ...«
»Nimm mich ganz fest in die Arme ...«, würgte sie hervor. »Deine Wärme – straft die Kälte des Todes Lügen. Halt mich ... Mein Liebster ... Ich friere ... Mir ist so kalt – wie in den eisigen Stürmen unserer Heimat ...« Und dann brach die flüsternde Stimme.
Ganz fest drückte er die Tote an seine Brust, wiegte sie hin und her, sprach leise auf sie ein, als wäre sie ein schlafendes Kind. Die Sonne war untergegangen, als er Grenilde endlich zu Boden gleiten ließ. Zitternd stand er vor ihr, warf den blonden Kopf in den Nacken und schrie seine Verzweiflung zum Himmel hinauf. Sogar die tapfersten Dänen, die seine Klage hörten, erschauerten und beteten zu ihren Göttern. Nur zu gut kannten sie das mächtige Geheul des Wolfs, und es jagte ihnen Angst und Schrecken ein.
Aed Finnlaith stand auf einem Hügel oberhalb des Sees und betrachtete das blutige Schlachtfeld. In den Gestalten, die zwischen den Leichen umhergingen, erkannte er ausnahmslos Dänen. Ob es an ihrer Überzahl und ihrem strategischen Talent lag oder ob der Heilige Patrick ihre heidnischen Gebete erhört hatte, würde er niemals erfahren. Jedenfalls trugen sie den Sieg davon. Dubhlain, jahrelang in norwegischer Hand, gehörte jetzt den Dänen.
Aed kniete nieder, schloss die Augen und betete stumm. Die gefallenen Krieger, die das Schlachtfeld übersäten, waren seine Feinde, aber er fand keine Freude am ungeheuren Tribut, den der Tod gefordert hatte. Lass es zu Ende gehen, Allmächtiger, flehte er stumm. Lass die Dänen diese Stadt regieren und ihre Mauern bauen, halte sie von Überfällen auf weitere Landesteile ab, lass uns in Frieden leben ...
Doch er ahnte, dass sein Gebet kein Gehör finden würde.
»Vater!«
Eine Hand berührte seine Schulter, und er wandte sich zu seinem Sohn Niall von Ulster, einem kraftvollen, dreißigjährigen hübschen Riesen, dessen ernste grüne Augen die vom Vater geerbte Klugheit widerspiegelten.
»Fennen und Maelsechlainn erwarten uns, Vater. Wir müssen hinabreiten und von den Dänen den Tribut für den Schrein des Heiligen Patrick entgegennehmen.«
Der Ard-Righ nickte, erhob sich und zuckte ein wenig zusammen, als seine Gelenke knackten. In Nialls Gegenwart störte ihn das nicht, denn sein Sohn zeigte kein Verlangen, die Krone noch zu Lebzeiten des Vaters an sich zu reißen. Manchmal bezweifelte Aed, dass Niall überhaupt die Position des hohen Königs anstrebte. Dieser Titel war nicht erblich, sondern wurde zwischen mehreren mächtigen königlichen Stämmen weitergegeben. In Ulster musste der junge Mann seine eigenen Schwierigkeiten bewältigen, die ständige Bedrohung durch die Wikinger.
Doch es gab genug andere Männer, die einen unvorsichtigen König stürzen konnten, und ein Mann in Aeds Lage durfte keine Schwäche zeigen. Er griff nach den Zügeln seines Pferds und stieg auf, mit geschmeidigen Bewegungen, die seine schmerzenden Knochen Lügen straften. »Wir reiten zu den Dänen!«, rief er seinem Sohn zu.
Die Trompeten des Ard-Righ erklangen, und die Iren rückten vor. Die Dämmerung brach herein, während sie den Hang hinabritten. Und als sie sich zwischen den Gefallenen einen Weg zum Zelt Friggid des Krummbeinigen bahnten, des dänischen Heerführers, loderten bereits mehrere Feuer im hastig aufgeschlagenen Lager. Ringsum grinsten triumphierende Dänen und beobachteten die Iren. Ihre verschlagenen Blicke ließen Aed erschauern, denn sie warnten ihn vor einem Waffenstillstand, der nur zu leicht gebrochen werden konnte.
Trotzdem trat er Friggid furchtlos entgegen. Der temperamentvolle rothaarige Anführer herrschte gerade seine Männer an: »Findet ihn! Der Wolf muss sterben!« Dann bezwang er seinen Zorn und wandte sich dem irischen König zu. »Ein wahres Gemetzel, Ard-Righ.«
Aed lächelte grimmig. Der mörderische Däne hatte Angst, ein ganz bestimmter Norweger könnte überleben – der Wolf.
Die ganze Nacht verbrachte Olaf an Grenildes Seite. Am Morgen war er ein ruhiger, veränderter Mann, entschlossener denn je. Die Wunde an seinem Schenkel eiterte, doch er achtete nicht darauf. Er hob die Tote auf seine Arme und ging auf die Suche nach Wasser. Heiß brannte die Sonne herab, doch er verlangsamte seine Schritte nicht. Zu Mittag erreichte er einen Bach, in dem er seine Liebste badete. Ehrfürchtig strich er über ihr seidiges Haar, die glatte kühle Haut.
Aus Zweigen und Blättern errichtete er eine Bahre, bettete sie darauf und legte ihr Schwert zwischen ihre Hände. Ringsum stapelte er Brennholz aufeinander, so hoch wie möglich, damit ihre Reise nach Walhall erleichtert wurde. Der Wind würde sie emportragen, und dann würde sie neben dem Kriegsgott Odin sitzen und das Leben einer Prinzessin führen, das ihr auf Erden nicht vergönnt gewesen war.
Ein letztes Mal küsste Olaf die kalten Lippen.
Er suchte und fand einen Flintstein, entzündete einen Funken und hielt eine Fackel an das Brennholz. Bald schlugen helle Flammen aus der Bahre. Während die Sonne unterging, stand er am Ufer des Bachs und beobachtete das Feuer. Seine Augen nahmen einen harten Ausdruck an. Jetzt schrie er nicht mehr seine Klage zum Himmel hinauf. Sie war ein Teil von ihm geworden, ein Teil seines Herzens.
Am nächsten Morgen konnte er kaum stehen. Seine Wunden hatten ihn geschwächt. Er kniete nieder, beugte sich zum Bach hinab, trank durstig, dann wusch er den Eiter von seinem Schenkel. Der Schmerz brannte so heftig wie Grenildes Totenfeuer am vergangenen Abend.
Er bemühte sich, die Wunde zu reinigen, aber die Müdigkeit überwältigte ihn, und er brach zusammen. Halb im Wasser blieb er liegen, das Gesicht im Schlamm vergraben, das goldene Haar schmutzig und verfilzt. Doch die sanften Wellen reichten nicht bis zu seinem Mund und seiner Nase. Der Wolf war gefallen, aber er atmete immer noch.
4
Auf Zehenspitzen schlich Erin in der Hütte umher und zog sich lautlos an. Sie schlüpfte in eine kurze wollene Tunika und dicke Ledergamaschen, dann schlang sie einen Gürtel aus ziseliertem Gold um ihre Taille. Vielleicht lag ein beschwerlicher Ritt vor ihr, und dabei wollte sie nicht von Frauenkleidung behindert werden. Sie nahm ihren tannengrünen Umhang vom Haken neben der Tür und legte ihn um die Schultern. Als sie den schweren Holzriegel berührte, verstummte Mergwins Schnarchen.
»Wohin geht Ihr, Erin?«
»Nur zum Bach«, antwortete sie und lächelte ihn unschuldig an.
»Heute solltet Ihr nicht ausreiten. Im ganzen Wald lauert Gefahr.«
»Ich nehme mein Schwert mit.« Mutwillig fügte sie hinzu: »Und was kann mir schon zustoßen? Ihr sagtet doch, ich würde im Kreis meiner zahlreichen Kinder alt werden.« Rasch schloss sie die Tür hinter sich und lachte, als sie den Druiden leise fluchen hörte. Er würde sich keine ernsthaften Sorgen machen, denn er wusste, wie gut sie den Wald kannte. Und vor Kriegern, die sich vom Hauptschauplatz des Kampfes entfernten, würde sie sich in Acht nehmen, auf die Stimmen des Windes und der Erde lauschen, so wie Mergwin es ihr beigebracht hatte.
Jedenfalls musste sie das Schlachtfeld aufsuchen, alles mit eigenen Augen sehen.