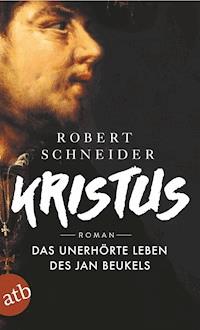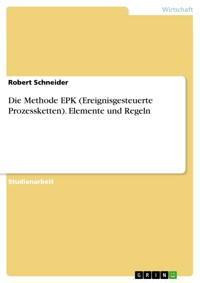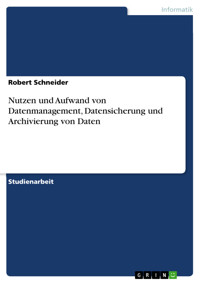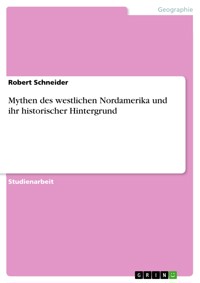Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Das Mysterium der Musik.
Am Heiligabend des Jahres 1992 entdeckt der Naumburger Organist Jakob Kemper im morschen Gehäuse der Kirchenorgel ein unbekanntes Oratorium von Johann Sebastian Bach: ein Jahrhundertfund, der sein Leben völlig aus der Bahn wirft. Je genauer der eigenbrötlerische Musikforscher und Organist die Melodien analysiert, desto Unerklärlicheres trägt sich zu. Bald ahnt er, dass die Partitur ein Geheimnis birgt: Sie ist nicht allein Musik, sondern vermag Erinnerungen an Vergangenes, Verdrängtes und Zukünftiges zu beschwören. Bach schien am Ende seines Lebens eine Art kosmisches Gesetz entdeckt zu haben, an dem die Seele des Menschen gesunden kann - oder in die tiefste Verzweiflung stürzen.
Noch hält Kemper seinen Fund geheim. Doch dann treffen vier Experten der Bachgesellschaft ein - sie überwachen die Restaurierung der Orgel, auf der Bach selbst einmal gespielt hat - und die Geschichte nimmt einen rasanten Lauf …
Robert Schneider, der mit "Schlafes Bruder" einen Welterfolg erzielte, eröffnet uns in diesem Roman durch seinen liebenswürdig verschrobenen Helden einen erstaunlichen Blick auf die Macht der Musik und nicht zuletzt auf den großen Meister Bach selbst.
"Robert Schneider bleibt ein Stilmagier." Die Welt.
"Ein literarisches Glanzstück." W. A. Z.
"Entwaffnender Humor, bissige Ironie und ein verblüffender Sinn für Situationskomik." DeutschlandRadio Kultur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über Robert Schneider
Robert Schneider, geboren 1961, lebt als freier Schriftsteller in Meschach, einem Bergdorf im vorarlbergischen Rheintal. Sein Debütroman »Schlafes Bruder« wurde zum Welterfolg (Übersetzungen in 32 Sprachen). Zuletzt erschienen die Romane »Schatten« (2003), »Kristus« (2004) und »Die Offenbarung« (2007).
Informationen zum Buch
Das Mysterium der Musik.
Am Heiligabend des Jahres 1992 entdeckt der Naumburger Organist Jakob Kemper im morschen Gehäuse der Kirchenorgel ein unbekanntes Oratorium von Johann Sebastian Bach: ein Jahrhundertfund, der sein Leben völlig aus der Bahn wirft. Je genauer der eigenbrötlerische Musikforscher und Organist die Melodien analysiert, desto Unerklärlicheres trägt sich zu. Bald ahnt er, dass die Partitur ein Geheimnis birgt: Sie ist nicht allein Musik, sondern vermag Erinnerungen an Vergangenes, Verdrängtes und Zukünftiges zu beschwören. Bach schien am Ende seines Lebens eine Art kosmisches Gesetz entdeckt zu haben, an dem die Seele des Menschen gesunden kann – oder in die tiefste Verzweiflung stürzen. Noch hält Kemper seinen Fund geheim. Doch dann treffen vier Experten der Bachgesellschaft ein – sie überwachen die Restaurierung der Orgel, auf der Bach selbst einmal gespielt hat – und die Geschichte nimmt einen rasanten Lauf …
Robert Schneider, der mit »Schlafes Bruder« einen Welterfolg erzielte, eröffnet uns in diesem Roman durch seinen liebenswürdig verschrobenen Helden einen erstaunlichen Blick auf die Macht der Musik und nicht zuletzt auf den großen Meister Bach selbst.
»Robert Schneider bleibt ein Stilmagier.« Die Welt.
»Ein literarisches Glanzstück.« W. A. Z.
»Entwaffnender Humor, bissige Ironie und ein verblüffender Sinn für Situationskomik.« DeutschlandRadio Kultur
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Robert Schneider
Die Offenbarung
Inhaltsübersicht
Über Robert Schneider
Informationen zum Buch
Newsletter
Buch lesen
Impressum
Für Efraim,der mich bewahrt.
Eine einzige Kränkung sei sein Leben gewesen, eine ins Monumentale getriebene Demütigung. Eine private wie berufliche Katastrophe. Rückschläge, Enttäuschungen und Ablehnung, seit er denken könne. Die Chronik eines fortlaufenden Scheiterns, das Tagebuch eines vergeblichen Tuns. Ein perfides Verbrechen an seiner Befähigung, Ausdruck einer nicht zu überbietenden Ignoranz gegenüber seiner Arbeit. Ein von jeher kalkuliertes und immerwährendes Niederhalten seiner Person, wie dieser Brief – was heißt Brief! –, dieser Wisch aufs Neue beweise.
Das Wort Hoffnung kenne er nur noch vom Hörensagen. Begriffe wie Freude und Glück seien ausschließlich in seinem passiven Wortschatz existent. Was er jemals angefasst, daran habe er sich augenblicklich die Finger verbrannt. Was er je gewünscht oder ersehnt habe, sei ihm versagt geblieben. Und habe er den Mut aufgebracht, etwas zu riskieren, oder gar sich selbst – oft genug sei das vorgekommen, oft genug –, sei er auf dem Fuß dafür bestraft worden. Seine wissenschaftlichen Erkenntnisse wären nicht einmal eine Marginalie im Naumburger Tagblatt wert. In ihm dürfe Leo einen Mann vor sich sehen, dem alles misslungen sei. Einem verzweifelten Menschen müsse Leo in die Augen blicken, von dem nichts bleiben werde, nicht einmal sein Name. Das sei leider die Wahrheit, und die Wahrheit tue bekanntlich weh. Ihm FURCHTBAR!
Ein Brief sei das nicht. Ein Bubenstück sei das, der helle Affront. Wo bleibe das kollegiale akademische Miteinander? Wo die Fairness? Wo der Anstand, wenigstens die Kinderstube? Seien die Herren Professoren der Bachgesellschaft in Leipzig etwa schon genauso verkommen wie die Zotenreißer im Fernsehen? Er sei erschüttert, sprachlos. Sprachlos sei er. Ihm fehlten die Worte.
Aber was rege er sich noch auf? Es sei ohnehin alles vorbestimmt gewesen. Einem fahrlässigen Gedanken Gottes sei seine Existenz anzulasten. Eine andere Erklärung finde er nicht für sein verpfuschtes Leben. Das sage er als Protestant, nicht als Wissenschaftler. Als Wissenschaftler müsste er nämlich seinen Vater anklagen, weil der seinen Sexualtrieb nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft partout nicht hatte beherrschen können. Seinen Vater klage er nicht an. Das Leben sei schließlich mehr als Trieb. Das Leben sei metaphysisch, und eben das mache es so unerträglich. Er klage Gott selbst an, jedenfalls den Gedanken, aus dem ein so unerhebliches Menschsein überhaupt erst hatte erwachsen können. Er habe es nicht einmal zu einer Akte bei der Staatssicherheit gebracht. Nicht einmal das! Er habe um Akteneinsicht nachgesucht. Diese Mühe habe er sich angetan, aber nichts sei gefunden worden, rein gar nichts. So belanglos müsse seine Biographie gewesen sein, dass sich nicht einmal die Stasi für ihn interessiert habe.
Verdammt, das sei kein Brief, ein Lumpenstück sei das, jawohl, geschätzter Professor, Doktor, Doktor hatse, Hans-Georg Sperling, Harvard und Leipzig, nach Diktat verreist!
Doch was helfe es, sich derart aufzuregen? Er sei sowieso eine gebrochene Existenz, und das mit gerade mal fünfundvierzig Jahren, sozusagen im besten Mannesalter. Wenn er es von Grund auf bedenke, habe das ganze Elend mit dem Geburtsdatum angefangen. Wie könne man ein Kind nur so fürs Leben zeichnen, indem man es Heiligabend zur Welt bringe! Er halte seine Mutter in Ehren. Das tue er. Sie sei ein schweigsamer, stets alles erduldender, wenn auch mutloser Mensch gewesen. Aber rechtschaffen. Der Vorwurf gelte dem da oben, nicht der Mutter. Geboren am Heiligabend! Im Schatten des Allerhöchsten! Nicht einmal ein persönliches Fest! Die Verwandtschaft im Haus, aber nicht seinetwegen. Das präge ein Kind. Psychologisch gesehen, ganz allgemein. Das müsse ein Kind doch als Ausdruck tiefsten Ungewolltseins empfinden. Aber Weihnachten sei nur der erste Beweis dafür, dass er auf dieser Welt immer ein Schattendasein geführt habe, dass …
»Jakob …«
»Fall mir nicht ins Wort, Leo, und setz dich ordentlich hin! Vor Bach sitzt man aufrecht am Klavier!«
»Stimmt es, dass die Ossis dauernd rumjammern?«
»Wer sagt das?«
»Die im Fernsehen.«
»Ich kann dieses Klischee nicht mehr hören!«
»Was ist ein Klischee?«
»Ein Klischee ist eine Dummheit des Westens!«
»Bist du auch dumm?«
»Bitte?«
»Weil du dauernd rumjammerst.«
»Leo, du bist noch zu jung, um erahnen zu können, dass das Leben eine bloße Abfolge von unerträglichen Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen, Wochen, Monaten, Jahren und Jahrzehnten ist. Dass einem das Leben ausschließlich Ohrfeigen bereithält … Ein Brief ist das nicht, Sie … Sie Professor-hatse-Schwachkopf-nach-Diktat-verreist! Eine ungeheure Schweinerei ist das! Jawohl!«
Der Musikforscher Jakob Kemper aus Naumburg an der Saale zerknüllte den Brief, der ihn so aus der Haut hatte fahren lassen. Er ging zu dem hitzeglühenden Kohleofen, öffnete das Türchen und zielte. Das Schreiben, das ihn so empört hatte, verfehlte sein Ziel. Kemper bückte sich, ächzte, hob das Papierknäuel auf und wollte noch einmal werfen. Doch er ließ den Arm sinken, schloss die Ofentür, ging zum Klavier zurück, beugte sich darüber, zog das Knäuel mit spitzen Fingern auseinander, strich den Brief glatt und las ihn zum wiederholten Mal still für sich, wobei er die Lippen verächtlich schürzte.
»Sehr geehrter Herr Kemper, haben Sie meinen höflichen Dank für Ihr Schreiben, das ich Ihnen erst heute beantworten kann, da mich das Diktat eines erbarmungslosen akademischen Kalenders für mehrere Monate in die Staaten geführt hat. Ich will Ihnen aber umso ausführlicher antworten, weil es heutzutage immer seltener geschieht, dass ein Brief handgeschrieben daherkommt, noch dazu mit dieser kalligraphischen Attitüde.
Die Bachgesellschaft erachtet es als Ehre, dass Sie im Zuge der geplanten Restaurierung der Orgel zu St. Wenzel Ihr Fachwissen zur Verfügung stellen möchten, zumal ich davon ausgehen will, dass niemand über eine profundere Kenntnis dieses berühmten Instruments verfügt als Sie, lese ich doch in Ihrem Brief, dass Sie nun schon seit siebenundzwanzig Jahren – immer unentgeltlich – das Organistenamt versehen.
Bedauerlicherweise muss ich Ihnen mitteilen, dass die Gesellschaft bereits einen internationalen Stab von Wissenschaftlern, Restaurateuren, Organologen und sonstigen Sachverständigen ersten Ranges gebildet hat, welche Persönlichkeiten alles in ihrer Macht Stehende daransetzen werden, um das Instrument wieder jenem Klang zuzuführen, den Johann Sebastian Bach gehört haben muss, als er die Orgel 1746 gemeinsam mit Gottfried Silbermann abgenommen hat.
Damit Sie ersehen können, mit welcher Ernsthaftigkeit die Gesellschaft das Naumburger Projekt ins Werk gesetzt hat, will ich Ihnen nur zwei Namen aus der oben erwähnten Kommission nennen. Trotz mancher Schwierigkeiten ist es uns geglückt, den weltberühmten Organisten Frits van Hulle aus den Niederlanden einerseits sowie Herrn Prof. Yoshiba Koyatake aus New York andererseits hinzuzuziehen. Letzterer ist Ihnen sicherlich durch seine bahnbrechende Studie zur Datierung der bachschen Originalhandschriften anhand der Wasserzeichen ein Begriff. Beide Persönlichkeiten haben sich einverstanden gezeigt, gemeinsam mit meinem Assistenten Dr. Albert Zinser und natürlich meiner Wenigkeit entscheidende Phasen der Orgelrestauration vor Ort zu überwachen.
Womit ich nun zur Beantwortung Ihrer Bitte komme: Die Bachgesellschaft kann Ihrem Wunsch leider nicht entsprechen, an dem Projekt – in welcher Weise auch immer – mitzuwirken, so sehr ich persönlich das begrüßen würde. Aber Persönliches muss in Anbetracht der Bedeutung dieser Aufgabe, eines der großartigsten Barockinstrumente Deutschlands wieder zum Leben zu erwecken, hintangestellt bleiben.
Gestatten Sie mir noch eine letzte, quasi private Bemerkung: Für die Auswahl des wissenschaftlichen Gremiums zählte für die Gesellschaft ausschließlich die fachliche Reputation und nicht etwa, wie Sie versucht sind in Ihrem Brief zu suggerieren, Empfindlichkeiten des Miteinanders zwischen Ost und West. Ganz im Gegenteil! Zu viele Jahre hat die Bachforschung auf ihre Kollegen in der ehemaligen DDR verzichten müssen, und bei diesem konkreten Vorhaben ist nur zufällig kein Wissenschaftler aus dem Osten beteiligt. Es wird mir dennoch eine Ehre sein, Sie in Naumburg kennenzulernen.
Mit vorzüglicher Hochachtung, Prof. Dr. Dr. h. c. Hans-Georg Sperling, Harvard und Leipzig, nach Diktat verreist.
P. S.: Ihren Aufsatz Naumburg und die Musikerfamilie Bach schicke ich Ihnen in der Anlage zurück. Ich sehe mich außerstande, etwas dazu zu sagen.«
Mit hochroten Wangen starrte Kemper auf den Brief. Die langen, feingliedrigen Finger zitterten. Die Tränen schossen ihm in die Augen. Obwohl er Leo den Rücken zukehrte, merkte es der Junge sofort.
»Warum weinst du?«
»Wäre der Alte doch nie aus der Gefangenschaft zurückgekehrt! Hätte ich beim Autounfall in Weißenfels doch nur am Steuer gesessen anstatt im Fond! Wäre ich damals nur vom Dach der Wenzelskirche gestürzt, anstatt an der Traufe hängen zu bleiben!«
»Dann wärst du jetzt aber tot.«
»Ach was! In einem Jahr hättest du mich schon vergessen. Und bald wüsstest du nicht mehr, dass es mich überhaupt gegeben hat. Aber das schwöre ich: Der Schuft, der diesen Dreck geschrieben hat, wird meine Orgel nicht anrühren! Dafür werde ich sorgen! Mit diesem Brief hat er sich disqualifiziert! Der Großkopf hat nämlich nicht den blassesten Schimmer. Ich habe seine Bücher gelesen, und zwar von vorn bis hinten. Hypothetisches Zeug, Leo. Dürftige Analysen. Historisch fragwürdig. Selbstverliebt ohne Ende. Eine Stilblüte nach der andern. Schwülstig. Adjektiv um Adjektiv. Stilistisch überhaupt das Letzte! Aber so einer hockt natürlich obenan in der Bachgesellschaft, kassiert fette Diäten und verschleudert das Geld der Steuerzahler. Ein Wichtigtuer ist das, der den Kopf überm Hut trägt, ein hundsgemeiner …«
»Wieso hast du ihm geschrieben, wenn du ihn scheiße findest?«
»Du sollst mir nicht ins Wort fallen!«
»Ich hätte dem Sackarsch bestimmt keinen Brief geschrieben.«
»Könntest du dich etwas gewählter ausdrücken? Du bist nicht zu Hause bei unserem Alten!«
»Mannoh, du bist heute echt scheiße.«
»Schluss, ja? Und schau in die Noten! … Also: Noch mal von vorn. Achte auf die Sechzehntelpause. Drei, vier, eins …«
»Jakob?«
»Was ist denn?«
»Du-u. Erzählst du mir eine Geschichte?«
»Spiel jetzt!«
Mit der Frage, weshalb er jemandem schreibe, den er nicht leiden könne, hatte der aufgeweckte Junge einen heiklen Punkt berührt. In der Tat grämte es Kemper, an die Bachgesellschaft herangetreten zu sein, obendrein mit einem so eilfertigen, geradezu knechtischen Bittbrief. Schon für die Anrede »Sehr geschätzter, verehrter und hochbewunderter Herr Professor Sperling« hätte er sich ohrfeigen können, weil er in Wahrheit genau das Gegenteil über Sperling dachte. Auch der Satz »Ich bin ein langjähriger und inniger Bewunderer Ihrer epochalen Bach-Biographie« kam keineswegs von Herzen, war Jakob doch von der Mittelmäßigkeit dieses Buches überzeugt. Wie der gesamte Brief, wenn er ihn nüchtern betrachtete, von Lobhudelei nur so strotzte. Kemper biss sich auf die Lippen. Weil es ihn fröstelte, nahm er die Kohlenzange und warf noch zwei Briketts in den Ofen, obwohl das Rohr vor Hitze ohnehin glühte.
Er schlurfte zum Fenster, durch dessen Ritzen ein kalter Luftzug hereindrang, und blickte in den sich eindunkelnden Nachmittag und hinüber zur Südfassade der Wenzelskirche. Es hatte zu schneien begonnen. Die hilflosen Versuche Leos, die C-Dur-Invention zu meistern, verfolgte er mit schwindender Aufmerksamkeit. Wie sich das holprige Klimpern unsicher von Takt zu Takt mogelte und stets an derselben Stelle steckenblieb, erreichte ihn nur noch von fern. Als der Junge schließlich resigniert die Hände von den Tasten nahm, merkte es Kemper nicht. Zu sehr war er ins Grübeln verfallen. Er stand am Fenster und schaute in das Schneetreiben. Reglos stand er da, mit leicht gekrümmtem Rücken.
Nur ein paar Straßen von hier entfernt, war er 1947 als zweiter Sohn des Bürstenmachers Walter Kemper und dessen erster Frau Kriemhild in der Salzstraße Nr. 12 zur Welt gekommen. Der ältere Bruder Karl starb, als Jakob sechs Jahre alt war. Es hieß, er sei erstickt. In der Familie wurde darüber kaum einmal gesprochen.
Jakob war ein kränkliches Kind gewesen, das immerzu fror und hustete und beim Sprechen manchmal heftig mit der Zunge schnalzte, wenn es erregt oder aufgewühlt war. Deshalb entstand der Verdacht auf Epilepsie. Fallsucht, wie es der steinalte Hausarzt der Kempers damals nannte. Der Verdacht erhärtete sich nicht.
Im Musikunterricht war Jakob der unbestrittene Primus, während er sich im Rechnen immer vertat, weshalb ihn der Mathematiklehrer »Kemper, der Stümper« nannte. Das Wortspiel hielt sich hartnäckig, selbst später, als schon niemand mehr wusste, wer es geprägt hatte – außer Jakob, natürlich.
Weil das Land Bauern und Arbeiter brauchte und er selbst einen Nachfolger, nahm Vater Kemper den Sohn zu sich in die Lehre. Das war eine schwierige Zeit für Jakob. Anstatt tagein, tagaus auf dem Schemel zu hocken, an der Hechel Ross-, Wildschwein- oder Ziegenhaar zu sortieren und mit heißem Pech einzukleben, wollte er Tonkünstler werden, ein Komponist ersten Ranges. Nichts weniger.
Jakob nämlich hatte ein Erweckungserlebnis gehabt, und zwar im Naumburger Dom, wo er Zeuge eines legendären Konzerts geworden war. Der Dresdner Kreuzchor hatte eine Abendmusik unter seinem ebenso berühmten wie gefürchteten Leiter Rudolf Mauersberger veranstaltet, der dabei seinen Chorzyklus Dresden aufführte, in Erinnerung an die Bombennacht vom 13. Februar 1945. Die scharfen, aufschreienden Dissonanzen, die herbe Chromatik, die düstere Stimmung des ganzen Werks, das alles prägte sich Jakob unauslöschlich ein, und als der Dirigent den Taktstock senkte und im Dom eine bedrückende Stille entstand, ehe der Applaus zögerlich heranrollte, hatte der Junge die Gewissheit, ein Wunder erlebt zu haben. Der Puls hämmerte in den Schläfen, die Lippen waren ihm ausgetrocknet. Er musste Professor Mauersberger von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen, um ihm zu sagen, und sei es unter heftigem Zungenschnalzen, dass dieser ihm das Leben gerettet habe. Jetzt wisse er, wohin es in Zukunft mit ihm gehe.
Also wartete er an einem Seitentürchen. Als die Kruzianer tatsächlich, einer nach dem andern, durch die schmale Sandsteinlaibung schlüpften, war er schockiert über das Gelächter und die derben Sprüche, die die Chorsänger von sich gaben, wo sie noch vor wenigen Minuten mit betroffenem Gesicht Schmerz, Trauer und Resignation besungen hatten. Wie konnte das sein?, dachte Jakob. Man kann sich doch nicht so verstellen. Lange darüber grübeln konnte er jedoch nicht, denn plötzlich, fast wie der Teufel aus der Kiste, stand Mauersberger vor ihm. Er trug eine große, schwarz eingebundene Partitur bei sich.
»Herr Professor Mauersberger«, sagte Jakob deutlich und ohne zu schnalzen, »Sie haben mir das Leben gerettet!«
Der Dirigent sah ihn mit seinen stechenden Augen gequält an. Es schien Jakob, als laste ein ungeheurer, ja unmenschlicher Druck auf diesem Mann, was keineswegs verwunderte, stand er doch vor einem Genie, dessen Kopf vor lauter Gedanken sicherlich fast zu zerplatzen drohte.
»Ich muss austreten«, sagte Mauersberger und rannte an Jakob vorbei.
Das war die Begegnung mit dem großen Mauersberger. Immerhin hinterließ das Zusammentreffen einen so elementaren Eindruck, dass Jakob von heute auf morgen die väterliche Werkbank mit der Orgelbank vertauschen wollte, freilich gegen den Willen des Vaters und dessen Überzeugung. Für Kemper senior, der erst vor kurzem seine sozialistische Überzeugung durch eine Mitgliedschaft in der National-Demokratischen Partei Deutschlands unter Beweis gestellt hatte, war die Kirchenmusik Ausdruck eines dekadenten feudalistischen Systems, das nunmehr überwunden war. Und es schmerzte ihn, dass ausgerechnet sein Sohn Symptome zeigte, wieder in die alte Barbarei zu fallen, wie er sich ausdrückte. Das musste er verhindern. Die Mutter, unpolitisch, wie sie war, schwieg dazu.
Ganz so radikal, wie er es sich wünschte, vollzog sich die Wandlung des Sohnes allerdings nicht. Obwohl sich Jakob anfänglich tapfer gegen den Vater auflehnte, hatte der Alte die triftigeren Argumente – finanzielle –, und so blieb Jakob vorläufig bei dem Handwerk der Pinsel- und Bürstenbinderei, brachte es sogar bis zum Meisterbrief.
Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, Privatunterricht bei Friedhelm Wölfer, dem damaligen Organisten von St. Wenzel zu nehmen. Wölfer, ein dicklicher, unruhiger, aber sehr wohlmeinender Mann, unterwies den gerade Pubertierenden in den Grundlagen des Tonsatzes, des Kontrapunkts sowie des Orgelspiels, wobei er im Unterricht recht merkwürdige Methoden anwandte. Wölfer glaubte, dass man mittels Musik die Schwerkraft überwinden könne. Er befasste sich neben dem Organistendienst intensiv mit Kosmonautik. Um jedoch zu verstehen, was Schwerkraft überhaupt bedeutete, musste Jakob wochenlang auf der schmalen Emporenbrüstung hin und her balancieren. Auf diese drastische Weise suchte ihm Wölfer das bachsche Wort von der Gravität verständlich zu machen. Wenn nicht alles auf festen, sicheren Füßen stehe, tauge die ganze Musik nichts. Habe man das begriffen, folge schließlich die nächste Stufe – die Schwerelosigkeit.
Ein anderes Mal band er einen Ziegelstein auf Jakobs Handrücken. Der Schüler sollte sich einbilden, dass die Finger trotz dieser Beschwernis leicht und flink übers Manual flögen. Den Kontrapunkt, die freie Bewegung der Stimmen zu- und gegeneinander, lehrte ihn Wölfer auf eine abermals unkonventionelle Weise. Er schleifte den Jungen mit zu seinen Stammtischbrüdern in den Alten Krug. Dort drückte er ihm Papier und Bleistift in die Hand. Wenn die Grölerei am lautesten war, musste der Schüler alles notieren, was er von dem Gesagten im Kopf behalten konnte, und der jeweiligen, beträchtlich weintrunkenen Person zuordnen. Der Lehrer nannte das den »lebendigen Kontrapunkt«. So habe auch der junge Bach das Komponieren erlernt, in einem Haus, in dem es nur so von Kindern, Schülern, Basen und Oheimen gewimmelt habe.
Unglücklicherweise durfte sich Jakob nicht lange an den Lehrmethoden Wölfers erfreuen, denn eines Tages verschwand dieser spurlos aus der Stadt. Es ging das Gerücht, der Wenzels-Organist sei wegen versuchter Republikflucht nach Bautzen ins Gefängnis anstatt in den Westen gewandert. Was auch immer der Grund für sein jähes Verschwinden gewesen sein mochte – einer der Stammtischbrüder verbreitete, er hätte den Genossen in ein Ufo steigen und mit Rauch und Rumor in den nächtlichen Himmel entschweben sehen –, Wölfer kehrte nie wieder nach Naumburg zurück.
Dessen ungeachtet bildete sich Jakob unermüdlich fort, las und studierte, was ihm musiktheoretisch in die Finger fiel, übte fleißig Orgel und Klavier. Tagsüber fertigte er Bürsten, nachts wurde er »rückfällig« und zeigte die fiebrigen Symptome der »Barbarei«. Er begann, Kirchenmusik zu komponieren.
Von der Lehrzeit bei Wölfer blieb ihm das Folgende: ein Wollschal, weil er auf der Empore immer fror, die Verehrung für Bach, eine Ahnung von Schwerelosigkeit und Tschaikowskys Flügel, wobei nie bewiesen werden konnte, ob das klapprige, schwer zu stimmende Instrument wirklich von Tschaikowsky selbst gespielt worden war. Ein Großonkel aus Weißenfels, der Jakob das Instrument geschenkt hatte, behauptete es steif und fest. Es gebe sogar eine Fotografie, auf welcher der »scheniale Russe« mit Zylinder an genau diesem Klavier sitze.
Jakob wuchs zu einem langaufgeschossenen jungen Mann heran. Schön war er nicht mit seinem blassen Teint, dem kärglichen Bartwuchs, der zu kurzen Nase und der bereits beginnenden Stirnglatze. Außerdem machte er stets einen Buckel, weil es ihm unangenehm war, ja sogar peinlich, die meisten um Kopfeslänge zu überragen, und das verlieh ihm ungewollt eine devote Haltung. Dafür hatte er eine sanfte, wohlklingende und durchaus männliche Stimme. Den Grundwehrdienst wollte er glatt verweigern. Es sei ihm unmöglich, eine Waffe zu tragen, und zwar aus religiösen Gründen, sagte er, um seinen Vater zu provozieren. Er wollte sich stattdessen als Bausoldat melden und wäre sogar bereit gewesen, die Repressalien zu erdulden, die ein solch unsozialistisches Verhalten nach sich gezogen hätte, doch der Vater meinte, dass man nur beim Kommiss zum Mann würde, er selbst hätte erst beim Barras wahre Kameradschaft kennengelernt, und hatte wiederum die triftigeren Argumente. Ausgemergelt, mit einer Lungenentzündung und zeitweise taub auf einem Ohr, kehrte Jakob schließlich nach achtzehn Monaten Hölle zurück ins Leben und zu seinem Klavier.
In jener Zeit lernte er Eva Ücker kennen, die wirklich eine Eva war: schön, prall, verführerisch, aufrichtig in der Sünde, ungenau mit der Wahrheit und leider amusisch von den Locken bis zu den Zehen. Begegnet waren sie einander in seines Vaters Laden, und Jakob war es irgendwie gelungen, das Mädchen auf die Empore der Wenzelskirche zu locken, wo er es mit seinem Fantasieren auf der Orgel beeindruckte, wenn auch nicht nachhaltig, denn zum Bund fürs Leben reichte es nicht. Es reichte grade mal zu einem nachmittäglichen Spaziergang im Bürgergarten. Dort saßen sie einsilbig beieinander – er noch immer schwerhörig und dürr –, blickten über die vieltürmige Domstadt und hinein in das liebliche Tal von Saale und Unstrut. Er küsste sie, weil es ihn just anwehte, und sie lachte. Tags darauf weigerte sie sich, ihn jemals wieder zu sehen. Der Kuss sei passabel gewesen, nur etwas zu feucht. Er solle sich keine Hoffnungen machen.
Da war es schon zu spät. Er hatte sich in das eindrucksvoll geformte Mädchen verliebt. Vier Jahre lang liebte er Eva still und unglücklich, selbst dann noch, als sie die größte sportliche Hoffnung Naumburgs heiratete, den Brustschwimmer und Lagenspezialisten Max Frank, der sogar an den Olympischen Spielen teilnahm und Silber holte.
Während der eine zum Ruhm der DDR schwamm, tauchte der andere unter und komponierte zu Ehren des Allerhöchsten, an den er nicht wirklich glaubte, es sei denn durch die Musik Johann Sebastian Bachs.
Ein Opus schuf er, nur für Eva, ein gewaltiges noch dazu. Es handelte sich um das offizielle Kw 1 (Kemperwerk eins), die doppelchörige Motette Ei, wie vergnügt ist mir mein Sterbekasten nach einem pietistischen Text, den schon Bach vertont hatte. Das Hauptthema des von Todessehnsucht angeschwungenen Stücks setzte sich aus den Noten e-f-a zusammen, und nur ein einfältiges Gemüt hätte diese Widmung nicht verstanden. Eva verstand sie nicht. Sie lachte, und das kreischend, als sie eines Morgens die Partitur auf ihrer Türschwelle liegen sah und mit schlafverklebten Äuglein das Deckblatt las.
Jakob weinte oft in jener Zeit, schmachtete seiner unerwiderten Liebe nach und blieb Haut und Knochen. Immerhin verbesserte sich sein Gehör. Aber es sollten Jahre, sogar Jahrzehnte hingehen, bis er sich ein zweites Mal an eine Frau verlor. Er blieb allein mit sich und seiner Kunst.
Das Komponieren von geistlicher Musik hatte ihm Eva gründlich verleidet. Den Werken des einstmals so bewunderten Professors Mauersberger stand er inzwischen skeptisch, ja schließlich ablehnend gegenüber. Er machte daraus keinen Hehl, dass Mauersberger in seinen Augen ein musikalisch unbedeutender Geist gewesen sei, der ihn geblendet habe. Völlig überschätzt. Jugendsünden.
Die Idole hießen jetzt Schönberg, Eisler und Dessau. Im Selbststudium brachte er sich die Zwölftontechnik Arnold Schönbergs bei. Sein politisches Bewusstsein für die Rolle der Arbeiterklasse verdankte er dem unermüdlichen Einwirken seines Vaters. In ausufernden Tischreden predigte der Alte über die Errungenschaften des Sozialismus, auch wenn er es nur schwer verwinden konnte, dass man ihm als Gewerbetreibenden mit Misstrauen begegnete, ständig Steine in den Weg legte, Steuern aufbrummte, die ihm kaum das Schwarze unterm Nagel ließen, und ihn, was die Versorgung mit Pech und Rosshaar anlangte, benachteiligte. Nicht einmal in die SED hatte man ihn aufgenommen, es hieß, er sei ein kleinbürgerliches Element. Dieser Verdacht musste schon allein deswegen zerstreut werden, weil er seinen Betrieb trotz seines Bewusstseins keineswegs einer Produktionsgenossenschaft überantworten wollte. Nun, das alles wären Kinderkrankheiten, das deutsche Bewusstsein für Werte würde sich auch im Sozialismus durchsetzen. Jakob solle gefälligst etwas Nützliches zum Wohl der Volksgemeinschaft leisten und seine Arbeitsproduktivität drastisch steigern. Schließlich seien Bürsten selbst bei Adolf als kriegswichtig eingestuft worden, und heutzutage müsse man ja den Klassenfeind schlagen.
Jakob nickte. Die Mutter schwieg. Auch zur kalt gewordenen Suppe.
Eingeschüchtert von des Vaters Reden, machte sich Jakob auf seine Weise an die Steigerung der Arbeitsproduktivität. Er komponierte sein Kw 2, eine füllig orchestrierte Sinfonie mit abschließendem Massengesang. Als die Partitur vollendet war, gab er ihr den Namen Sinfonie der Arbeitermütter.
Nun hatte der junge, aufstrebende Komponist natürlich ein lebhaftes Interesse daran, seine Sinfonie herzuzeigen. Er träumte sogar von einer Uraufführung bei einem Festakt des Zentralkomitees, vielleicht sogar in Anwesenheit des Ersten Sekretärs der SED Walter Ulbricht. Damals griff er noch nach den Sternen. Wie sehr er sich vergriffen hatte, wurde ihm ein Jahr später postwendend mitgeteilt.
Um die Sache geschickt anzugehen, hatte er dem Komponisten Paul Dessau eine Abschrift der Partitur zukommen lassen, allerdings mit dem Vermerk »Porto zahlt Empfänger«. Dem Packen beigelegt war ein langes, salbungsvolles Schreiben, das die Verdienste Dessaus über den grünen Klee lobte. (Kemper sah sich beim Verfassen des Briefs schon vom Genossen Ulbricht umarmt und mit dem Nationalpreis I. Klasse ausgezeichnet.) An einem nasskalten Novembermorgen brachte der Postbote ein unhandliches Paket: die Partitur. Mit zittrigen Fingern und heftigem Zungenschnalzen schnürte Kemper das Paket auf, löste das Packpapier. Eine Karte kam zum Vorschein. Darauf bedankte sich Paul Dessau in zackiger Schrift für die Ehre, das Porto der Sinfonie der Arbeitermütter bezahlt haben zu dürfen. Sich zu dem Werk selbst zu äußern, sei ihm aus Gründen der Höflichkeit ganz und gar unmöglich. Er bitte den Genossen um Nachsicht.
Noch am selben Novembertag raffte Kemper alle seine Kompositionen zusammen und trug sie in den Wald bei Buchholz, um sie zu verbrennen. Dort gab es eine Lichtung, auf der sein so früh verstorbener Bruder Karl, über den in der Familie nie geredet wurde, und er in den Sommerferien viele Nachmittage verbracht hatten.
Der am Boden zerstörte Komponist zündete das Notenpapier an, doch es war feucht geworden. Die Flammen züngelten nur schwach. Es machte ihm den Eindruck, als ekelte sich sogar das Feuer vor seinem musikalischen Schaffen. Von dieser Stunde an setzte er keinen Takt mehr aufs Papier. Die Sache mit dem Komponieren war ihm ohnehin seit geraumer Zeit wie eine Sackgasse erschienen. Wozu noch Musik schreiben im zwanzigsten Jahrhundert? Wo Bach im achtzehnten schon alles ausgedrückt hatte, und zwar unübertrefflich und gültig für alle Ewigkeit. Mozart, Beethoven, Schubert und alle späteren Meister wiederholten doch nur das längst Erdachte, fand er.
Als er von Buchholz auf der Jenaer Straße nach Naumburg zurücktrottete, trug er sich außer mit Selbstmordgedanken mit einem weiteren Plan: Dirigent wollte er werden, ein charismatischer Bach-Dirigent. Nichts weniger.
Er war jetzt etwa Mitte zwanzig. Die Selbstmordgedanken ließ er fallen, jene ans Dirigieren nicht, womit er auf seine bislang wohl größte Niederlage zusteuerte, die sich obendrein vor den Augen und Ohren der Naumburger Öffentlichkeit zutrug.
Weil zum einen das Musikleben der Stadt darniederlag, sich zum anderen die Wenzelskirche in einem beklagenswerten baulichen Zustand befand – er selbst war auf das steile Dach geklettert, um es zu reparieren, war ausgerutscht, an einer Traufe hängengeblieben und musste von der Feuerwehr in einer spektakulären Aktion gerettet werden –, weil es also auf die berühmte Orgel regnete, gründete er vollmundig das Collegium Musicum Naumburgiensis. Das war Anfang der siebziger Jahre. Das Collegium wollte es sich zur Aufgabe machen, in regelmäßigen Abständen Bachs Kantaten, Passionen und Oratorien aufzuführen. Den Erlös aus den Konzerten dachte Kemper in die Sanierung des Daches zu investieren. Die Idee fand vorsichtigen Anklang bei den Genossen. Das Naumburger Tagblatt zollte Vorschusslorbeeren, ohne Kemper namentlich zu erwähnen. Der Vater war außer sich. Die Mutter schwieg dazu.
Einen Hang zum Monumentalen hatte Kemper schon immer in sich gefühlt, eine Vorliebe zur großen Form, zur theatralischen Geste, und so setzte er auf den Programmzettel des Eröffnungskonzerts kein geringeres Werk als die Matthäuspassion.
Die Aufführung war auf den Karfreitag anberaumt, und schon Monate vorher sah man Kemper in Einzelproben teils mit den Solisten, teils mit Chor, teils mit Orchester an dem gewaltigen Werk arbeiten und feilen. Er schwitzte und weinte. Letzteres vor Wut und nicht etwa aus Ergriffenheit. Der aufstrebende Dirigent wollte eine gültige, Maßstäbe setzende und über die DDR weit hinausreichende Interpretation der Passion schaffen. Er unterzog sich sogar der Mühe, die Stimmen der Partitur selbst auszuschreiben, und musste dabei einigermaßen erfinderisch sein, weil Papier im Allgemeinen, Notenpapier im Speziellen in jenen Tagen nicht eben leicht zu beschaffen war.
Größtes Kopfzerbrechen bereitete ihm die Partie des Evangelisten, genauer der Sänger der Partie des Evangelisten. Herr Zotsch hatte einen hohen, angenehm temperierten Tenor mit guter Intonationsfähigkeit, konnte allerdings keine Noten lesen. Also musste ihm Kemper die gesamte Partie vorsingen und mit ihm auswendig lernen. Das war noch nicht das Problem. Die Schwierigkeit war außermusikalischer Natur. Herr Zotsch war ein Trinker. Obwohl ihm die Aufgabe, den Evangelisten zu geben, wieder einen Sinn in diesem »Scheißleben und Ganovenstaat« aufgezeigt habe, so Zotsch wörtlich, und obwohl er bei seiner Ehre das Versprechen abgab, während der gesamten Probenzeit nicht einen Tropfen zu trinken, erlitt er mehr als einen Rückfall.
Leider auch am Tag der Aufführung. Da wurde es in seinem Kopf dunkel, und zwar nicht erst bei der Stelle Und von der sechsten Stunde war eine Finsternis über das ganze Land, sondern weit früher, eigentlich schon am Beginn des Passionsgeschehens. (Einige Wochen nach dem verunglückten Konzert machte Frau Zotsch Kemper die bittersten Vorwürfe, ihren Mann so jämmerlich vorgeführt und dem Gelächter preisgegeben zu haben. Er hätte die moralische Verpflichtung spüren müssen, den ganzen Scheißdreck abzubrechen.)
Nachdem also endlich der Tag der Aufführung gekommen war und Maestro Kemper den Taktstock gehoben hatte – Kriemhild hatte ihrem Sohn eigens für diesen Tag einen beigeviolett getupften Schlips in Batiktechnik gefertigt –, verpassten die Ripienisten – zehn Knabensoprane – gleich dreimal beim Eingangschor den Einsatz. In den ersten Rezitativen war die Stimme des Herrn Zotsch noch halbwegs sicher, ja sie strahlte kurz und leidenschaftlich in den Kirchenraum hinein, obwohl Kemper die Schnapsfahne bis zum Dirigentenpult riechen konnte. Ab der Abendmahls-Szene ging es jedoch mit Stimme und Zotsch bedenklich abwärts. Die Stimme geriet ins Wanken, wie der ganze Mann ins Taumeln geriet. Kemper gab dem Zotsch ein Zeichen, die Partie sitzend weiterzusingen. Das ließ die Sängerehre nicht zu, und so fiel an der Stelle Zu der Stund sprach Jesus zu den Scharen der Evangelist vornüber in die Pulte der Bratschen. Dabei war man fast schon am Ende des ersten Teils der Passion angekommen.
Nach der Pause, die ungewöhnlich lang dauerte – Kemper nutzte sie, um den Evangelisten auszunüchtern –, frettete sich das Collegium durch den zweiten Teil des Werks. In der Tat ging es dem Herrn Zotsch allmählich etwas besser. Nun aber waren die anderen Gesangssolisten völlig mit den Nerven am Ende. Sie bildeten übrigens die einzigen professionellen Kräfte des Ensembles. Die Sänger waren sogar eigens aus Leipzig angereist, wohin sie noch während der Pause unverzüglich zurückreisen wollten. Der Bass warf dem Dirigenten das ein wenig abgewandelte beethovensche Wort an den Kopf: »Für euch Schweine singe ich nicht!« Ein Chorsänger, ein ehemaliger Mitschüler Kempers aus der Grundschule, flüsterte das Wort »Kemper, der Stümper«. Es machte schnell die Runde. Der charismatische Bach-Dirigent in spe hatte in der Pause wirklich alle Hände voll zu tun.
Die Überreiztheit und Irritation der Gesangssolisten färbte wiederum auf das Orchester ab, besonders auf die Continuo-Gruppe, auf Cello, Kontrabass und Orgel. Und hatte nicht Wölfer einmal gelehrt, dass die Gravität das Um und Auf jeder Musik sei? Daran musste Kemper jetzt denken. Er sah sich wieder auf der Emporenbrüstung hin und her balancieren. Ihm wurde für Momente schummrig vor den Augen, was prompt dazu führte, dass Chor und Orchester mit einer halbtaktigen Verzögerung gegeneinander musizierten. Der Maestro musste abklopfen und die betreffende Stelle neu beginnen.
Irgendwie kam das Collegium dann doch zum Ende. In den Kirchenbänken, die übrigens schlecht besetzt waren, wurde während der gesamten Aufführung – sie dauerte anstatt der üblichen drei rund fünf Stunden – viel geflüstert und gezischelt, gestöhnt, ja manchmal sogar hell aufgelacht. Etwa die Hälfte der bachkundigen Bürger war schon in der Pause abgewandert. Darunter einige, denen das elende Schauspiel entweder fast das Herz gebrochen oder die Galle hatte hochsteigen lassen.
Unter den Flüchtenden war auch Kemper Senior, indessen die Mutter ausharrte. Es hatte ihn sowieso schon alle Überwindung gekostet, ein Gotteshaus zu betreten. Als er aber einsehen musste, dass sämtliche Tischreden nichts gefruchtet hatten, dass der Sohn unbelehrbar »rückfällig« geworden war, stapfte er aus der Kirche hinaus und verkündete, ihn umgehend aus dem Haus zu werfen.
Da, plötzlich, aus dem Nichts, unvermittelt, in einem Satz ohne Anfang, begann die Mutter zu reden, nachts, als sie beide allein im Wohnzimmer saßen. Sie sprach ruhig, als redete sie nur mit sich, und starrte dabei mit leeren Augen ihren Mann an. Ihr schmaler Kopf mit dem dunklen, glatten geknoteten Haar bewegte sich kaum, aber in dem harten, disziplinierten Gesicht zeigten sich Ohnmacht und Wut. Ob er nichts aus seinen Fehlern gelernt habe, fragte sie leise, wobei ihr goldener Schneidezahn gefährlich aufblitzte. Ob er nicht sehe, dass er durch seine brutale, herrische Art nun auch noch seinen zweiten Sohn verliere. Der Vater fing an, sich zu rechtfertigen, doch die Mutter flüsterte über ihn hinweg. Jede Nacht, wenn er ihren Atem beim Einschlafen höre, sagte sie, jeden Morgen, wenn er ihr Gesicht wieder sehe, wolle sie ihn an seine Schuld erinnern. Nur deshalb bleibe sie an seiner Seite.
Die Einnahmen aus der denkwürdigen Passionsaufführung reichten nicht im Entferntesten aus, das Dach der Wenzelskirche neu einzudecken. Nach Abzug aller Posten – Herr Zotsch und der Chor sangen um der Sache willen – blieben Kemper von den Einnahmen gerade mal ein paar Mark. Damit überzeugte er einen Dachdecker, ihm eine große Plane zu überlassen, mit der er wenigstens den Prospekt der geliebten Orgel einhüllen könnte.
In den Tagen nach dem Konzert sah der väterliche Betrieb ungewöhnlich viele Naumburger Besen, Bürsten und Rasierpinsel kaufen. Die Kundschaft zeigte sich hochgestimmt, man unterhielt sich über dies und das, wagte irgendwann den Schlenker zu der verunglückten Passion. Auch jene, die nicht dabei gewesen waren, redeten darüber, denn im Tagblatt war anstelle der Rezension eine nicht gezeichnete Notiz erschienen. Sie gab in kurzen und sachlichen Worten wieder, dass »am vergangenen Freitag in der Stadtkirche St. Wenzel die Matthäuspassion von Bach unter Leitung des Herrn Kemper aufgeführt« worden war. Aus Platzmangel könne das Konzert an dieser Stelle nicht besprochen werden. Die Kritik wolle in einer der nächsten Ausgaben nachgereicht sein.
Dass sie nie nachgereicht wurde, war Kemper egal. Er stand sowieso vor dem Aus. Seelisch wie finanziell. Der Vater hatte ihn vor die Tür gesetzt. Von der Dirigierkunst hatte er die Nase voll, und sein Collegium Musicum Naumburgiensis strebte der Auflösung entgegen.
Kam noch hinzu, dass zwei Monate später die Mutter plötzlich starb. Nach kurzer, schwerer Krankheit. Auch dazu soll sie nichts gesagt haben, erst recht nicht am Morgen ihres Sterbens. Sie habe bloß untröstlich ihren Mann angesehen, unablässig. Fürchterlich sei das gewesen. Kemper selbst war nicht dabei. Er erfuhr die Umstände ihres Sterbens erst viel später, denn er hatte nicht den Mut gehabt, auf ihrem Begräbnis zu erscheinen.
Er war bei seinem Onkel in Weißenfels untergekommen und trug sich mit dem Gedanken, einen Ausreiseantrag zu stellen. In den folgenden Wochen plagten ihn daraufhin fürchterliche Alpträume, in denen ihm sein alter Lehrer Wölfer erschien, wie er in Bautzen Kinderspielzeug lackierte, und er verwarf seine Absicht. Kurz darauf fuhr dieser Großonkel, der ihm Tschaikowskys Flügel geschenkt hatte, mit seinem Wartburg gegen einen Alleebaum. Kemper selbst hatte Glück, weil er auf dem Rücksitz saß. Er brach sich das linke Bein, erlitt einige Prellungen und blaue Flecken. Ansonsten blieb er unverletzt.
Dass er mehr als die Mutter seine Orgel vermisste, verursachte ihm zwar quälende Gewissensbisse, aber er hatte nun mal Heimweh nach der Musik. Wer ein geborener Musikus ist, der kann nicht lange ohne die Musik leben, hatte Wölfer immer gesagt. Nur wenn Jakob die Nächte durchpräludieren konnte, war er glücklich und hielt es mit sich aus.
Also kehrte er in seine Heimatstadt zurück. Das Haus des Goldschmieds Baruch Elender am Topfmarkt stand seit Jahrzehnten wegen Baufälligkeit leer. In diesem schmalen, zweistöckigen Häuschen mit noch gut erhaltener Erkerfront aus der Rokokozeit und nassem Mauerwerk auf der Hofseite, nistete er sich ein. Im Dachgeschoss mit Blick auf die Wenzelskirche. Ein Jahrzehnt später sollte man ihn einen Hausbesetzer schimpfen. Er begriff sich eher als Hauserhalter, reparierte hier, flickte dort. Wahr ist hingegen auch, dass er sich, als die DDR zu existieren aufgehört hatte, in seiner Mansarde nicht mehr heimisch fühlte und jeden Tag mit dem Erscheinen eines Nachfahren des Baruch Elender rechnete.
Einstweilen genoss er die neue Freiheit, obwohl ihm sein Vater in der kleinen Stadt so verdächtig oft über den Weg lief, dass er sich geradezu überwacht fühlte. Sein Auskommen fand er als Orgel- und Klavierlehrer. Nachdem er bei einigen Konzerten für den erkrankten Solisten einspringen durfte, erwog er eine Karriere als Orgelvirtuose. Aber auch darin brachte er es nicht über Thüringen hinaus zu Anerkennung. Schuld waren seiner Meinung nach die Umstände, wie er es dem Vater gegenüber vorsichtig formulierte, als dieser, weil Not am Mann war, den Sohn wieder einmal für die Bürstenbinderei »auslieh«. Man gehöre eben leider nicht zu den »Reisekadern«, weshalb eine europäische Karriere von vornherein ausgeschlossen sei. Das Wort »Ausreiseantrag« stand, ja schwebte plötzlich in der staubigen Werkstattluft.
»Sag’s ruhig, du willst abhauen, Kloßkopp.«
»Will ich nicht!«
»Willst du doch!«
»Nein, will ich nicht!«
»Nur Mut! Gib zu, dass du die Biege machen willst!«
»Vater, das will ich nicht! Ich meinte nur … Ich wollte sagen …«
»Ich will dir was sagen«, brüllte der Vater scharf, »und du hörst mir jetzt genau zu! Ich an deiner Stelle, ich würde noch heute Nacht abhauen.«
Der Sohn fing an mit der Zunge zu schnalzen. Hatte er das eben geträumt? Solche Töne waren noch nie aus dem Mund seines alten Herrn gekommen.
»Dhts … Wie, noch heute Nacht … dths … abhauen.«
»Ganz richtig. Aber du hast keine Eier. Du taugst nicht zum Kommunismus, du taugst nicht zum Kapitalismus. Europäische Karriere! Da muss ich glatt lachen!«
Das saß, besonders das mit den Eiern. So sehr, dass der Sohn den Vater anschrie. Das sei staatsfeindliche Hetze in schwerem Fall!, brüllte er. Was aus seinem sozialistischen Bewusstsein denn geworden sei? Ob der Alte am Ende gar selbst »rückfällig« geworden sei? Dann knallte er die Ladentür so heftig zu, dass die Scheibe zu Bruch ging. Zu Hunderten rieselten die Scherben zu Boden.
Von jenem Tag an redeten Vater und Sohn nicht mehr miteinander. Begegneten sie sich zufällig, wechselte der eine die Straßenseite, während der andere zügigen Schrittes weiterging.
In der Tat wurde der Alte »rückfällig«, und zwar auf eine Weise, wie es sich Kemper nicht in den kühnsten Träumen hätte ausdenken können. Nach dem Tod seiner Frau lebte der Witwer einige Jahre allein, obwohl er das eine oder andere Verhältnis unterhielt. Eines Tages – das war im Mai 1980 – fand der Sohn im Postkasten eine Vermählungsanzeige. Er las das Kärtchen, das mit Rosenmotiven geschmückt war, und traute seinen Augen nicht:
»Walter Kemper und Eva Frank, geb. Ücker, geben sich das Jawort. Zu dieser Feier möchten wir alle unsere Freunde …«
Und so weiter, und so fort. Das war der K.-o.-Schlag, die letzte, die furchtbarste Demütigung, die ihm der Vater hatte antun können. Das Erste, wozu Kemper in der Lage war – vermutlich im Schock –, war das Rechnen, was ansonsten nie seine Stärke gewesen war. Er fing mit den Fingern zu zählen an und fand heraus, dass die Braut um sechsundzwanzig Jahre jünger sein musste als der Bräutigam, dass demzufolge der Brautvater, also Walters Schwiegervater, um zwei Jahre jünger war als der Bräutigam. Ihm wurde schwindlig. Dann dämmerten ihm die Bilder jenes Nachmittags im Bürgergarten herauf, wo er Eva Ücker angeblich zu feucht geküsst hatte. Auf der Hochzeit zu erscheinen – sie fand im Bürgergarten statt mit malerischem Blick auf Naumburg –, dazu konnte er sich nicht ermutigen. Eva als seine nunmehrige Stiefmutter – allein dieses Wort! – freundlich in die Arme zu schließen, das wäre zu viel der Schmach gewesen. Immerhin brachte er es fertig, dem Brautpaar eine Glückwunschzeile zu übermitteln, handschriftlich in seiner kalligraphischen Manier, die ihm die Mutter beigebracht hatte.
Die ganze Sache beschäftigte sein Selbstbewusstsein noch Monate. Er fing an zu bohren, zu schnüffeln und fand heraus, dass Evas erster Mann, der Lagenschwimmer Frank, mutmaßlich an einer Überdosis Anabolika gestorben war. Richtig verreckt sei die arme Sau, wie sich der Informant ausdrückte. Nachdem er aber seine Wunden geleckt hatte, scherte ihn die Angelegenheit keinen Deut mehr. Und als er wieder ein Kärtchen im Postkasten vorfand, das die Geburt seines um fünfunddreißig Jahre jüngeren Halbbruders Leo anzeigte, spürte er nicht einmal mehr Groll gegen den Vater. Für ihn war das alles ein schlechter Witz. Er konnte den Alten nicht mehr ernst nehmen. Außerdem hatte er jetzt ohnedies Wichtigeres im Sinn. Höheres. Edleres. Bleibenderes.
Und das kam so: Nachdem er als Komponist ersten Ranges gescheitert war, dann als Maßstäbe setzender Bach-Dirigent, schließlich als Orgelvirtuose von europäischem Format, wandte er sich der Forschung zu. Wissenschaftler wollte er werden, ein bahnbrechender Bachforscher. Nichts weniger.
Anlass war die Baugeschichte der Wenzels-Orgel im Speziellen und die Verbindung der Stadt Naumburg zu den verschiedenen Mitgliedern der Familie Bach im Allgemeinen.
Ihm war bekannt, dass sich Bachs Großvater im Jahr 1661 um die Stelle eines Stadtpfeifers beworben hatte. Nachdem er die Bewerbung abgeschickt hatte, verstarb er jedoch umgehend. Bekannt war ihm auch, dass »der größte Denker aller Zeiten«, wie er Bach zu nennen pflegte – er stellte ihn noch über Newton und Einstein –, seine Finger im Spiel hatte, als es um die Neubesetzung der Organistenstelle ging. Der Thomaskantor aus Leipzig hatte sich damals bemüht, einen seiner Söhne in Naumburg unterzubringen, musste ihm aber nicht gerade viel zugetraut haben, denn der Bewerbungsbrief wie auch das Probestück, das Philipp Emanuel vorlegen sollte, stammten sicherheitshalber aus der Feder des Alten. Diese Art der Bevormundung kam Kemper durchaus bekannt vor. Bei aller abgöttischen Verehrung, das ging zu weit! Übrigens zog der Naumburger Rat dann doch einen erfahreneren Bewerber vor. Kemper konnte sich eine gewisse Schadenfreude nicht verhehlen.
Weiter war ihm bekannt, dass Bach seinen Einfluss noch einmal geltend machte, als es abermals um die Stelle des Stadtorganisten ging. Dieses Mal brachte er einen Mann mit Namen Altnickol auf den Posten, freilich erst, nachdem jener in die Heirat mit Tochter Liesgen eingewilligt hatte, die alles andere als schön gewesen sein soll. Alt wurde Altnickol in Naumburg nicht. Zehn Jahre nach Amtsantritt starb er. Nach Auswertung der im Archiv vorhandenen Quellen beschlich Kemper der Verdacht, dass die Bache in Naumburg weder ein gutes Omen noch eine gesunde Luft vorgefunden haben mussten. Das war natürlich Wasser auf seine Mühlen.
Und schließlich war ihm bekannt, dass Bach selbst vor Ort gewesen war, fünf Tage und Nächte lang, wo er im Gasthaus zum Grünen Schild logiert und eine horrende Zeche hinterlassen hatte. Die erhaltenen Rechnungen belegten es: Merseburger Bier, 30 Kannen Wein, Coffee und Canasder-Toback vor Pfeifen.
Die Vorstellung, dass einst die gichtigen Finger dieses Genies über das Manual seiner geliebten Orgel gedonnert waren, hatte Kemper bereits als Wölfers Schüler mit tiefer Ehrfurcht erfüllt. Obwohl das Instrument im Lauf der Zeit viel Unbill erlitten hatte – den Einbau einer elektropneumatischen Traktur, die komplette Übermalung des reich verzierten Prospekts im Stil des neunzehnten Jahrhunderts, ja sogar den Bombenangriff der Alliierten –, war immerhin noch so viel Originalsubstanz vorhanden, dass man zu Recht von einer Bach-Orgel sprechen durfte.
Wie er nun überhaupt allem auf den Grund gehen wollte, das mit dem Thomaskantor zu tun hatte. Das fasste er wörtlich auf. Das verlangte die Ethik eines Wissenschaftlers, der Anstand. Er begnügte sich darum nicht länger mit Sekundärliteratur, er musste die Quellen mit eigenen Augen sehen, studieren und auf ihre Echtheit hin untersuchen. Wie oft hatten die Herren Wissenschaftler doch Irrtümer verbreitet, die in Schriften und Schriften von Schriften durch die Jahrzehnte hallten! Nein, dem Bach musste man anders kommen. Man musste ihm zu Leibe rücken, ihn unter die Lupe nehmen, sezieren, nach allen Regeln der Kunst zerpflücken.
Naiv, wie er nun mal war, erklärte er das genau in dem Moment, als ihm ein Mitarbeiter eines Leipziger Museums ein Aktenkonvolut aushändigen wollte. Der Archivar riss die Augen auf und schlug die Mappe zu. Ein Schwarm silberner Staubkörnchen umwölkte ihn. Der Archivar umklammerte das Konvolut und rief laut um Hilfe.
In der Folgezeit fiel es dem Forscher schwer, an die Originale seiner Begierde heranzukommen. Meist wurde er entweder abgewiesen oder musste sich mit Faksimile-Drucken, hauptsächlich aber mit Fotokopien begnügen. Damals legte er sich eine ansehnliche Sammlung von Kopien bachscher Notenhandschriften zu und band sie liebevoll ein. Er studierte unermüdlich, schärfte den Blick für des Meisters Federstrich, konnte bald mühelos zwischen frühem, mittlerem und spätem Bach unterscheiden, zwischen Rein- und Konzeptschrift. Er vermochte genau zu sagen, wo in der Partitur oder im Aufführungsmaterial Bachs Frau, die Söhne oder Schüler die Stimmen ausgeschrieben hatten. Bekanntlich bildeten Bachs Partituren oft eine Art Familienkunstwerk. Kemper erfüllte das im Gegensatz zu anderen Forschern mit Abscheu. Während diese darin eine Idylle zu entdecken meinten, sah er nur das brutale Diktat eines herrschsüchtigen, übermächtigen Mannes und Vaters. So sehr er Bach als Komponist verehrte, so sehr stieß ihn dieser Charakterzug ab. Doch als Forscher musste man in der Lage sein, Person und Werk zu trennen. Ein mulmiges Gefühl blieb dennoch, wenn er an Bachs Söhne dachte. Wie froh war er darum, dass er sich vom eigenen Vater losgesagt hatte. Der Alte hatte zum Glück keine Macht mehr über ihn, sagte er sich und schürzte verächtlich die Lippen.
Weil er nun einmal kein »Reisekader« war, wollte er sich auf das umso genauere Studium dessen verlegen, was in der DDR von Bach vorhanden war. Er wusste, dass die Matthäuspassion in der Staatsbibliothek in Ostberlin lagerte. Dorthin musste er reisen und das Autograph auf seine Echtheit hin überprüfen, ihm auf den Leib rücken, es unter die Lupe nehmen, es sezieren …
Doch dazu kam es nicht. Jedenfalls vorläufig nicht. Dafür kam etwas anderes: der Untergang der DDR. Kemper, der sich nie für Politik interessiert hatte – sieht man von der Sinfonie der Arbeitermütter ab –, befand sich an dem Abend, als die Mauer fiel, präludierenderweise in der Wenzelskirche. Wohl vernahm er auf- und abwogendes Jubelgeschrei von draußen, meinte aber, es wäre eine Horde Jugendlicher, die sich betrunken hätten. Wie er dann von der Empore herunterkam und die Kirche verließ, wurde er am Topfmarkt tatsächlich von lauter Betrunkenen umarmt. Bloß waren es keine Halbwüchsigen, sondern Erwachsene und Alte.