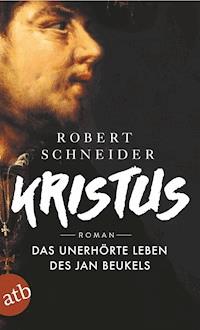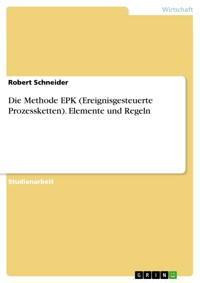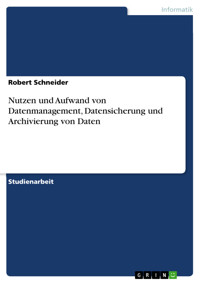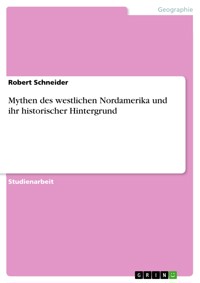9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
»Das ist die Geschichte des Musikers Johannes Elias Alder, der zweiundzwanzigjährig sein Leben zu Tode brachte, nachdem er beschlossen hatte, nicht mehr zu schlafen.« So beginnt der Debütroman von Robert Schneider, mit dem ihm vor 30 Jahren ein literarischer Welterfolg gelang. Der Auftaktsatz nimmt die Geschichte über das Leben eines Genies in der Enge eines österreichischen Bergdorfs vorweg: Schon als Kind ist der 1803 geborene Elias Außenseiter, sein außergewöhnlich scharfes Gehör und sein musikalisches Talent sorgen bei den Dorfbewohnern für Aufsehen und Argwohn. Die unerfüllte Liebe zu seiner Cousine Elsbeth quält ihn im Laufe der Jahre, und sie treibt ihn an. Bei einem Orgelwettbewerb in Feldberg improvisiert Elias über den Bach-Choral »Komm, o Tod, du Schlafes Bruder« und entfacht eine ungeahnt starke Wirkung auf sein Publikum und sich selbst. Der Roman wurde in Dutzende Sprachen übersetzt, erfolgreich verfilmt und ist einer der großen Klassiker der Gegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Ähnliche
Robert Schneider
Schlafes Bruder
Roman
Reclam
2022 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Favoritbuero
Coverabbildung: Albert Anker (1831–1910): Bildnis Walter Stucki (um 1893) – SIK-ISEA, Zürich
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2022
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-960535-7
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011390-5
www.reclam.de
Inhalt
Zwischenblatt
WER LIEBT, SCHLÄFT NICHT
DAS LETZTE KAPITEL
DIE UNGEBORENEN
DIE GEBURT
EIN VATER SEINEN KINDERN
DAS WUNDER SEINES HÖRENS
DIE GADENZEIT
DIE STIMME, DIE TIERE UND DIE ORGEL
DER TAG IST SO FREUDENREICH
DER WINTER 1815
ELSBETH UND DER FRÜHLING
DAS WEIB IM MONDSCHEIN
DIE LICHTER DER HOFFNUNG
GOTT FÜRCHTET DEN ELIAS
IN DER FREMDE
DAS ORGELFEST
KÖMM, O TOD, DU SCHLAFES BRUDER
DIE AUSLÖSCHUNG
FRAU MUTTER, WAS MEINT LIEBE?
NACHWORT
PASCALES HERZSCHLAGEN
WER LIEBT, SCHLÄFT NICHT
Das ist die Geschichte des Musikers Johannes Elias Alder, der zweiundzwanzigjährig sein Leben zu Tode brachte, nachdem er beschlossen hatte, nicht mehr zu schlafen.
Denn er war in unsägliche und darum unglückliche Liebe zu seiner Cousine Elsbeth entbrannt und seit jener Zeit nicht länger willens, auch nur einen Augenblick lang zu ruhen, bis daß er das Geheimnis der Unmöglichkeit seines Liebens zugrunde geforscht hätte. Tapfer hielt er bis zu seinem unglaublichen Ende bei sich, daß die Zeit des Schlafs Verschwendung und folglich Sünde sei, ihm dereinst im Fegefeuer aufgerechnet werde, denn im Schlaf sei man tot, jedenfalls lebe man nicht wirklich. Nicht von ungefähr vergliche ein altes Wort Schlaf und Tod mit Brüdern. Wie, dachte er, könne ein Mann reinen Herzens behaupten, er liebe sein Weib ein Leben lang, tue dies aber nur des Tags und dann vielleicht nur über die Dauer eines Gedankens? Das könne nicht von Wahrheit zeugen, denn wer schlafe, liebe nicht.
So dachte Johannes Elias Alder, und sein spektakulärer Tod war der letzte Tribut dieser Liebe. Die Welt dieses Menschen und den Lauf seines elenden Lebens wollen wir beschreiben.
DAS LETZTE KAPITEL
Als 1912 Cosmas Alder, der letzte Bewohner von Eschberg, einem Bergdorf im mittleren Vorarlberg, auf seinem verwahrlosten Hof verhungert war – nicht einmal die Alten im nahen Götzberg ahnten einen noch lebenden Menschen dort oben –, beschloß auch die Natur endgültig, jeden Gedanken an dieses Dorf auszulöschen. Es schien, als hätte sie fast respektvoll den erbärmlichen Tod ihres letzten Bezwingers abgewartet, um dann mit Wucht und für immer in die lichten Weiler zu fallen. Was ihr vor Jahrhunderten der Mensch weggenommen hatte, holte sie jetzt zurück. Den einstigen Dorfweg und die Pfade zu den Gehöften hatte sie längst mit stachligem Gestrüpp in Beschlag genommen, die Reste der verkohlten Ställe und Häuser verrottet, ihre Grundmauern bemoost. Nach dem Tod des störrischen Greisen fiel sie immer bunter und launiger in die steilen Bergbündten, wo ihr ehemals die Äxte jeden Jungbaum hartnäckig abgeschlagen.
Und die Esche, ihr Lieblingsbaum, wuchs wieder in großer Zahl und stark.
Nach dem Dritten Feuer innerhalb eines einzigen Jahrhunderts – sein nächtlicher Widerschein wurde noch vom Appenzellischen her lärmend bestaunt –, begriffen auch die Lamparter und Alder, die einzigen Geschlechter in Eschberg, daß Gott dort den Menschen nie gewollt hatte. In der Nacht des Dritten Feuers, am 5. September 1892, verbrannten in ihren Betten zwölf Menschen, in den Ställen achtundvierzig Stück Vieh. Den ganzen Tag hatte ein höllischer Föhnwind im Gebälk der Häuser gewühlt, hatte in den Wäldern rumort und geächzt, daß man im nachhinein behaupten durfte, da habe einer im festen Wissen um die kommende Katastrophe ein tausendstimmiges Gelächter angehoben. In der Nacht des Dritten Feuers wagte niemand in Eschberg, seinen Herd anzuzünden, nicht einmal die Kerze zum Gebet. Jeder wußte – das Kind aus den drohenden Erzählungen und den plötzlich gespenstischen Augen der Alten –, was ein offenes Licht zur Föhnzeit anzurichten imstande war. Ein Lamparter, der das Zweite Feuer erlebt, sich dunkel des Ersten besinnen mochte, ging noch in derselben Nacht von Hof zu Hof, einem jeden, wenn nötig mit Gewalt, das Licht zu verbieten. Er schlich hin und spähte in Ställe, Stuben und Gaden und wurde nicht des geringsten Scheins gewahr. Er naste nach den Schornsteinen und roch nicht einmal die Prise kalten Rauchs. Gegen zwei legte er sich auf seinen Laubsack und schlief ruhiger.
Gegen drei verbrannte das ganze Dorf und der Wald um das Dorf in weniger als einer Stunde. Von der Kirche St. Wolfgang und die Hänge hinauf und über die Waldrücken bis zu den Berggraten trieb der Föhn das schreiende Feuer.
In der Nacht des Dritten Feuers flüchteten die Überlebenden im Bachlauf der Emmer brüllend, höhnend und weinend vor Zorn und Verzweiflung hinunter ins Rheintalische, wo sie in der Folge der Zeit entweder in Armut verkamen, oder als bloße Brotknechte bis zum Ende ihres Lebens das Land anderer bestellten. Cosmas Alder, der wie die restlichen zwölf verbrannt geglaubt wurde und für welchen man im nahen Götzberg schon das Dies-Irae gesungen hatte, verblieb als einziger Mensch auf seinem verkohlten Gehöft. Er hatte in den feuchten Mauern seines Kellers geschlafen, denn er pflegte nächtens mit seiner dort begrabenen Tochter Zwiesprache zu halten. Cosmas’ Tochter war eine Abtreiberin gewesen, und der Pfarrer von Götzberg hatte ein kirchliches Begräbnis nicht verantworten können. Als nun Cosmas Alder sah, was Gott angerichtet hatte, beschloß er, auf seinem Hof zu bleiben und untätig den Tag des Jüngsten Gerichts zu erwarten. Zwanzig Jahre hauste er in seinen Ruinen, unternahm nicht die geringste Anstrengung, den Hof wieder aufzubauen, verließ ihn nur, wenn der Hunger ihn immer tiefer in die fröhlichen Jungwälder trieb. Schließlich verhungerte er wirklich. Nicht weil es an Nahrung gefehlt hätte – ein Eschberger wußte alles zu verkochen –, sondern schlicht aus lebensmüdem Trotz.
So zeigte der letzte Alder und zugleich letzte Eschberger noch einmal jenen verhängnisvoll störrischen Charakter, welchen überhaupt das ganze Dorf jahrhundertelang an sich getragen und welchem es schließlich seine Auslöschung zu verdanken hatte.
DIE UNGEBORENEN
Die Aufgabe, Leben und Bräuche der Lamparter und Alder in einem Buch niederzulegen, die Vermischung beider Geschlechter mit präziser Feder in hundert sich kreuzenden Strichen glücklich zu entwirren, die körperlichen Inzuchtschäden, den überdehnten Kopf, die geschwellte Unterlippe im tiefliegenden Kinn als gesundes Ursein zu verteidigen, diese Aufgabe mag sich ein Freund der Heimatgeschichte stellen, der sich um eine innige Kenntnis seiner Vorfahren bemüht. Trotzdem wäre es in allem vertane Zeit, die Geschichte der Eschberger Bauern zu beschreiben, das armselige Einerlei ihres Jahreslaufs, ihre bösen Händel, ihren absonderlich fanatischen Glauben, ihren nicht zu übertreffenden Starrsinn gegen die Neuerungen von draußen, hätte nicht zu Beginn des 19. Jahrhunderts ausgerechnet das Geschlecht der Alder ein Kind mit einer so hohen Musikalität hervorgebracht, die im wahren Sinn des Wortes unerhört war, und, wie es scheint, im Vorarlbergischen auch nicht wieder gehört werden wird. Ein Kind mit Namen Johannes Elias.
Die Beschreibung seines Lebens ist nichts als die traurige Aufzählung der Unterlassungen und Versäumnisse all derer, welche vielleicht das große Talent dieses Menschen erahnt haben, es aber aus Teilnahmslosigkeit, schlichter Dummheit, oder wie jener Cantor Goller, Domorganist zu Feldberg (dessen Gebeine exhumiert und in alle Windesrichtungen verstreut werden sollten, auf daß sein Leib am Tag der Sieben Posaunen nicht wieder zu sich finde), aus purem Neid verkommen ließen. Es ist eine Anklage wider Gott, dem es in seiner Verschwenderlaune gefallen hatte, die so wertvolle Gabe der Musik ausgerechnet über ein Eschberger Bauernkind auszugießen, wo er doch hätte absehen müssen, daß es sich und seine Anlage in dieser musiknotständigen Gegend niemals würde nutzen und vollenden können. Überdies gefiel es Gott, den Johannes Elias mit einer solchen Leidenschaft nach der Liebe auszustatten, daß davon sein Leben vor der Zeit verzehrt wurde.
Gott schuf einen Musikanten, ohne daß dieser auch nur einen einzigen Takt auf Papier setzen durfte, denn er hatte das Notenhandwerk nie erlernen können, sosehr er sich danach gesehnt hatte. Die Menschen aber vollendeten in ihrer himmlischen Einfalt diesen – wir wollen es nicht anders bezeichnen – satanischen Plan.
Als uns das bestürzende Schicksal des Johannes Elias Alder zu Ohren kam, da wurden wir still und dachten: Welch prachtvolle Menschen, Philosophen, Denker, Dichter, Bildner und Musiker muß die Welt verloren haben, nur weil es ihnen nicht gegönnt war, ihr genuines Handwerk zu erlernen. Und wir spannen fort, daß Sokrates nicht der höchste Denker, Jesus nicht der größte Liebende, Leonardo nicht der trefflichste Bildner und Mozart nicht der vollkommenste Musiker sein konnte, daß vollends andere Namen den Gang dieser Welt bestimmt hätten. Da trauerten wir um diese unbekannten, diese geborenen und doch zeitlebens ungeborenen Menschen. Johannes Elias Alder war einer von diesen.
DIE GEBURT
Zum dritten Mal an diesem Nachmittag Johannis 1803 wog Seff Alder die Tür in den Gaden, wo sein Weib lag, die zweite Niederkunft erbettelnd und erschreiend. Es schien, als ließe sich ihr Zweites nicht erpressen, als sperrte es sich gegen diese Welt, in die es aus freiem Willen nicht treten wollte. Sosehr sich die Bedauernswerte anstrengte, es zu gebären und schließlich unter gellendem Weh die Hände gegen den Bauch stemmte, das Kind kam nicht zur Welt. Seff hob den Atem. Die Luft war satt vom Schweiß und Blut der Seffin. Er wandte sich zum Fenster und riß es so mächtig auf, daß davon das halbe Zimmer in Vibration geriet. Vom Fensterstock die Wand hinab vibrierte es, über die Dielen zur Bettstatt und hinauf in den fiebernden Kopf der Gebärenden. Das Fenster zu öffnen schien der einzige Trost, den er seinem Weib geben konnte. Seff war kein Redner. Die Luft spiegelte die Sonne, so schwül war es an diesem Junitag, und ihr Zug bewirkte keine Linderung. Seff spähte aus dem Fenster, hinab zur äußersten Biegung des Dorfwegs, woher doch endlich diese gottverreckte Hebamme kommen mußte. Zwei Stunden und mehr waren vergangen, seit er den Buben nach Götzberg geschickt hatte. Dann sah er sie ungläubig wirklich aus der Kurve treten, wie sie sich mit ihrem roten Lederkoffer und den geschulterten Gurten heraufplackte. Sein Bub, sah er, lief hinterdrein. Seff schob das Fenster zu, ging zu seinem Weib, blickte in den Wasserkrug auf dem Kästchen, goß das unberührte Glas randvoll, wog die Tür und erdachte seinem Weib ein In-Gottes-Namen. Er hätte ihr sagen mögen, daß die Ellensönin gekommen sei. Seff war kein Redner. Unten wartete er in der sperrweit geöffneten Tür, und als die Hebamme schwitzend und schnaufend eintrat, wies er ihr Most, die zwanzig Kreuzer Taggeld und die Stiege zum Elterngaden. Dann ging er mit seinem Buben in den angrenzenden Weiler hinüber, das Heu ein letztes Mal zu wenden.
Sein Weib oben im Gaden gellte vor Schmerzen.
Die Ellensönin machte sich freudlos und ohne die längst gebotene Eile ans Werk. Als sie auf der engtrittigen Stiege zum dritten Mal stolperte, war es beschlossene Sache, den Plan, den sie beim Heraufweg im geschwätzigen Kopf hin und her gewälzt hatte, unwiderruflich in die Tat zu setzen.
Diese hier sei endgültig die letzte Geburt. Sie sei noch immer jung, trotz der einundzwanzig Jahre. Und ihre Stirn zog ungeduldige Falten. Außerdem habe sie zarte Hände, das habe ihr auch schon einer gesagt. Händ’, viel zu zart für die Hebammerei. Und sie runzelte die Stirn noch unzufriedener. Auf dem Waschtisch ordnete sie ihr Instrumentarium in der Reihenfolge, wie sie es auf der Hebammenschule zu Innsbruck gelernt hatte: die Klistierspritze, daneben immer die Taufspritze, das Mutterrohr, die Wendungsschlinge, den Katheter und zum Schluß die Nabelschere. Dann fing sie an, die Gurte nach Länge und Funktion zu ordnen.
Die Seffin gellte vor Schmerzen.
Doch, sinnierte die Ellensönin, sie wolle jetzt das Angebot des Franz Hirsch aus Hötting annehmen und sich beim Beck verdingen. Das garantiere ihr Freibrot und ein höheres Taggeld, mindestens dreißig Kreuzer. Dann sei sie auch die leidigen Händel mit dem Gemeindediener für immer los. Das ewige Streiten ums weihnachtliche Wartgeld, das ihr doch der Herr Richter vom Civil- und Criminalgericht zu Feldberg persönlich zugesichert habe. Der Gemeindediener mit seiner bockigen Art wolle sie ja nur mürbe machen. Von ihretwegen. Es sollen das Geschäft in Zukunft ruhig die Freihebammen verrichten. Aber das wolle sie dann noch erleben, ob die dem Gemeindediener wirklich billiger zu stehen kommen. Nein, diesen Casus sei sie endgültig leid. Und überhaupt müsse ihr der Gemeindediener nichts vormachen. Nur weil sie ihn vor Jahren einmal beim Tanz abgewiesen, deshalb sei er jetzt so sekkant mit ihr. Was könne sie denn dafür, daß er ein Schwellmaul habe und Ziegenfüße.
Die Seffin gellte vor Schmerzen.
Außerdem stimme es nicht, daß ihr ein Mannsbild nie mehr einen Antrag machen werde, denn der Franz Hirsch aus Hötting habe ihr just vor zwei Wochen einen gemacht. Brieflich, jawohl brieflich. Und der Franz Hirsch aus Hötting sei in allem um vieles gebildeter als das Schwellmaul, dieser kleine aufgeblasene Gemeindediener. Zu guter Letzt sei der Franz Hirsch aus Hötting auch noch ein durchaus stattliches Mannsbild, wenn man von dem Buckel einmal absehe. Sie achte auf den Charakter, nur darauf achte sie. Und Innsbruck sei halt schon etwas ganz Großes. Was wolle ihr da ein Gemeindediener von der Welt erzählen, ist er doch in seinem Leben nicht weiter gekommen als bis nach Dornberg, drei Wegstunden von hier. Vielleicht werde sie aber gar nicht den Franz Hirsch aus Hötting nehmen. Sein Buckel sei halt recht bedacht doch ein böses Mallör, und sie sei eine liebliche Person mit zarten Händen. Händ’, viel zu schön für die Hebammerei. Das habe ihr der Feldwaibel Zenker bei seiner k. k. Soldatenehre geschworen, jawohl. Ein kurzes Lächeln nistete sich in ihre Mundwinkel, verflog aber, als sie erneut an den Krüppel aus Hötting denken mußte, dem sie sich zwar nicht versprochen, dem sie aber mit deutlichen Andeutungen die Hoffnung entzündet hatte.
Die Seffin gellte vor Schmerzen.
Er sei in Wort und Tat ein gehöriger Kerl, wenn er bloß nicht an dem störenden Buckel trüge. Und daß er oft auf der Lunge marod, sei ihr natürlich nicht unentdeckt geblieben. Was sie denn da für Sachen denke. Schließlich achte sie auf den Charakter, nur auf den achte sie. Ein bißchen gemütskrank sei er auch. Was man vom Feldwaibel Zenker nun wirklich nicht behaupten könne. Dafür besitze der bestimmt nicht einmal zwei Morgen Land, während hingegen der Franz Hirsch aus Hötting wohlhabend sei. Vielleicht könne sie sich als Dienstbotin in einem der noblen Bürgershäuser vorstellig machen, und den vielen Krankheiten in den Häusern sei sie dann auch nicht mehr ausgesetzt. Jedenfalls wolle sie, falls sie sich bis zum Abend noch immer nicht entschieden, an der Wallfahrt der Herz-Mariä-Bruderschaft auf den Udelberg teilnehmen und die Heilige Jungfrau inständig um Ratschlag bitten. Nach Innsbruck verziehen möchte sie auf jeden Fall. Bevor sie aber gehe, wolle sie dem Schwellmaul so unverschämt die Schande ins Gesicht sagen, daß ihm vor Schreck der Bart abfalle.
Die Seffin lag und weinte ruhig.
Das beste sei, sich an die Weisung der Mutter zu halten, die Menschen nicht nach ihrem Äußeren zu beurteilen, sondern auf den Charakter Obacht zu geben. Sie tue das ohnehin. Und es sei schon wahr, daß der Feldwaibel Zenker einfach zu viel Spott und Alfanzerei mit den Menschen treibe. Sogar gegen den Kaiser habe er schon Äußerungen gemacht, während der Franz Hirsch aus Hötting nun überhaupt kein Lächeln von den Lippen bringe und … Als sie das blutbeklatschte Linnen aufhob, lag das Kind mit gerissener Nabelschnur auf dem Knie der Seffin. Erschrocken nahm die Hebamme das Kind auf, trug es zum Waschtisch und schnitt ihm die Nabelschnur mit zittriger Hand ab. Sie stierte auf das Kind, horchte ängstlich an ihm, schüttelte und schlug es zuletzt.
Es schrie nicht.
Sie hielt den Säugling in ihren tropfenden Händen, schlug abermals auf ihn ein, horchte, hob den Atem, um das kleine Herz endlich schlagen zu hören. In ihrer Verzweiflung stimmte sie das Tedeum an, sang flehentlich und schließlich laut aus heller Angst. Plötzlich spürte sie den Fleischklumpen zusammenzucken. Dann noch einmal. Sie hielt mit dem Singen inne, horchte wieder und wußte jetzt, daß der Klumpen lebte. Das Tedeum hatte dem Kind das Leben gerettet.
Die Ellensönin konnte sich hernach nicht mehr dar auf besinnen, welchen Geschlechts das Kind wirklich war. Jedenfalls gab sie beim Gemeindediener an, daß dem Joseph und der Agathe Alder ein Söhnchen geschenkt worden war, womit sie die Sache trefflich erraten hatte.
Wir verlassen an dieser Stelle die Ellensönin und ihr schwatzhaftes Wesen. Sie wird uns nicht mehr begegnen. Darum möchten wir hinzufügen, daß die Geburt des Johannes Elias tatsächlich ihr letzter Hebammendienst war, daß sie nach Innsbruck verzog und dort den – man möchte denken Feldwaibel Zenker, nein – Franz Hirsch aus Hötting ehelichte. Sie hatte sich also zugunsten des Charakters entschieden. Der Verbindung waren keine Kinder gegönnt, und Franz Hirsch aus Hötting starb 1809 an der Schwindsucht. Die Witwe heiratete ein zweites und gar ein drittes Mal. Als letzten übrigens – es ist nicht zu glauben – das Schwellmaul mit Ziegenfüßen, den Gemeindediener von Götzberg. Ab etwa 1850 verliert sich ihre Spur. Noch ein Jahr zuvor läßt sie sich aktenkundlich im Zusammenhang einer Erbschlichtungssache feststellen. Aber wir können nichts darüber aussagen, auf welche Weise sie ihr Leben beendet hat. Jedenfalls war sie zugegen, als ein genialer Musiker geboren wurde.
Nun, wer wäre nicht stolz, in seiner bescheidenen Biographie auf ein derartiges Ereignis hinweisen zu dürfen? Gesetzt, man hätte der Ellensönin damals ins Gesicht schreien dürfen, daß sich an jenem Nachmittag Johannis 1803 unter ihren Augen ein doppeltes Wunder ereignet hatte, das der Mensch- und das der Geniewerdung, sie hätte nichts begriffen. Und die anderen, die Seffin im Kindbett, der Seff und sein Bub hätten es ebensowenig begriffen. Was aber das Schlimmste ist: Als die Begabung dieses Menschen längst offenkundig war, wollte es noch immer niemand begreifen.
EIN VATER SEINEN KINDERN
Der hochwürdige Kurat Elias Benzer war ein Mann von großen rednerischen Talenten, ein emphatischer Freund des Lebens und – dadurch bedingt und seiner natürlichen Anlage gehorchend – ein leidenschaftlicher Verehrer alles Weiblichen. Diese Leidenschaft gereichte ihm schließlich zum Untergang, wie später noch dargelegt werden wird.
Kurat Benzer stammte aus Hohenberg im Rheintalischen, das von alters her ein Bollwerk des Aberglaubens und der Dämonerei gewesen war. Darum wußte er von der letzten Hexenverfeuerung im Vorarlbergischen zu berichten, die er noch als Kind mit eigenen Augen gesehen hatte. Dieses gewaltige Erlebnis wurde zum Grundpfeiler seiner Theologie schlechthin. Unzählige Male predigte er seinen Eschberger Bauern von jener Verbrennung, und zwar derart wortfeurig, daß ihnen davon die Münder vertrockneten und das Blut in Köpfen und Ohren zu leuchten anfing. Ja, einige wähnten sich gar schon angezündet oder den Flammen leibhaftig übergeben. Wo immer sich dem Kuraten Benzer in der sonntäglichen Evangelienlesung die Gelegenheit bot, eine Brücke zu seinem imposanten Kindheitserlebnis zu schlagen, überquerte er sie auch. Vermöge seiner leuchtenden Phantasie gelang es ihm, die Episode mit dem brennenden Dornbusch am Ende doch wieder in die Szene vom brennenden Weib zu Hohenberg hinüberzuführen. Im Zusammenhang derartiger Homilien wäre es in Eschberg beinahe zu einem mörderischen Vorfall gekommen. Durch die zündenden Predigten des Kuraten bestärkt und daher guten Gewissens, beschlossen drei Lamparter am Funkensonntag des Jahres 1785, anstelle der Strohhexe die Zilli Lamparter, genannt Seelenzilli, in das Funkenfeuer zu stürzen.
Die Seelenzilli, eine greise Witwe, die mutterseelenallein auf des Dorfes höchstem Hof ihres Stündleins harrte, stand in dem merkwürdigen Ruf, mit verstorbenen Eschbergern disputieren zu können. Sie begründete ihre seherische Gabe damit, daß sie von allen Bewohnern dem Herrgott am nächsten wohne und deshalb das Wehklagen der jenseitigen Herrschaften deutlich vernehmen könne, vorausgesetzt, es herrsche eine klare Sternennacht, denn eine Wolkendecke verstelle das Hören. Das leuchtete jedem ein. Als dann die Seelenzilli in der Folge behauptete, daß ihr etliche Mohren aus dem Morgenland erschienen seien, Männer und Weiber von kohlenschwarzer Haut, kohlenschwarzem Gesicht, kohlenschwarzen Gliedern und kohlenschwarzen Zähnen, da zweifelte niemand mehr an den unheimlichen Fähigkeiten dieses Weibes.
Das brachte nun die Greisin auf den Gedanken, ein System zu ersinnen, das einer Art Seelenbuchhaltung glich und ihr indirekt eine geregelte Alterspension einbringen sollte. Sie wußte, daß ein Verstorbener, ehe er ins Paradies eingeht, erst im Fegefeuer brennen muß, und also beschloß sie, einen Katalog all dessen anzulegen, das die Lebenden zur unverzüglichen Rettung ihrer toten Verwandten zu leisten hätten. Nun war in Eschberg verwandt jeder mit jedem. Um die Verwirrung geringer zu halten, hieß man sich beim Vornamen, und die Namen der Eheweiber glich man den Vornamen ihrer Männer an.
Es wanderte also eines Tages die Seelenzilli beschwerlich hinunter zum Hof eines Lamparters und eröffnete ihm, daß dessen Vater ihr jammernd und flennend erschienen sei. Der Vater könne keinen Frieden mehr finden, weil er ihr noch immer die sieben Klafter weiches gehacktes Brennholz schulde. Und weiter: In ungezählten Seancen mit Eschberger Toten wurde die Seelenzilli schließlich inne, daß ihr eigentlich jeder, ob Lamparter oder Alder, etwas schuldete. Aus ihrem Mund klang es dann gleichförmig drohend: »Acht Eier, zehn Vaterunser. Drei Pfund Wachs und fünfzig Ave. Ein Zentner Laubstreu und sieben Heilige Messen. Zehn Ellen Leinen und acht Psalter.«
Da half das ganze Schimpfen und Zutragen beim Kuraten nichts. Noch nie hatte man so viel Wachs, so viele Döchte und Heilige Messen spendiert. Noch nie war im Eschberger Kirchlein so inbrünstig gebetet worden. Wie man sieht, wußte die Seelenzilli das Notwendige mit dem Heilsamen glücklich zu verbinden, und im Grunde war sie die erste Pensionsbezieherin von Eschberg, man darf behaupten, ja, des Vorarlbergischen überhaupt.
So kam es dahin, daß man dieses Weib zu hassen begann. Unglücklicherweise grassierte zu jener Zeit eine äußerst merkwürdige und unseres Wissens bisher nur in Eschberg beobachtete Erdäpfelseuche auf den Bergäckern des Dorfes. Angeblich sollen die Erdäpfel über Nacht hohl geworden und auf Haselnußgröße geschrumpft sein. Wie auch immer.
Unter Lachen und Johlen, durchsetzt vom Rosenkranzgesäusel der Weiber, zog man die Seelenzilli auf einem Misthorner hinüber in den Weiler, der Altig genannt wurde, wo der Scheiterhaufen errichtet worden war. Die Seelenzilli gellte vor Todesnot und schwur, sie wolle jedem das Seine zurückgeben, aber ein Alder wies donnernd und mit feuersgeilen Augen auf die Predigten des Kuraten und machte denen, die von der Tat schon ablassen wollten, wieder neuen Mut. Als man die Greisin vom Misthorner band, schien sie noch immer zu schreien, aber ihr eingeschlagener, von Schrunden entstellter Mund brachte keinen Laut mehr hervor. Salz klebte auf ihren furchigen Wangen, und aus den Mundwinkeln floß ein roter Speuz, den sie dürstend mit langer Zunge ableckte. Das Feuer teilte die Nacht. Etliche zogen die Hüte tiefer, verbargen ihre Gesichter, um nicht erkannt zu werden, wenn sie die Fäuste und Schuhkappen in den verlumpten Körper des Weibes spitzten. Sogar die Kinder kniffen und spuckten und ließen nicht davon ab. Als ein Unbekannter ihr das Kopftuch vom Schädel ohrfeigte, ging ein dunkles Murmeln durch die todesschwüle Bauernschar. Zum ersten Mal sah jeder, daß die Seelenzilli vollkommen kahlhäuptig war, und selbst der Kleingläubigste wähnte eine leibhaftige Hexe vor seinen Augen. Der Unbekannte trieb ihr die pralle Faust in den Magen und in die leeren Brüste, schrenzte ihr die Kleider weg, sollte doch alles so vor sich gehen, wie es der hochwürdige Kurat in seinen Predigten geschildert hatte. Aber plötzlich jellte der Unbekannte so grauenhaft auf, daß man fürchtete, er sei um den Verstand gekommen. »Die Pestseuche! Die Pestseuche!« brüllte er unaufhörlich und stürzte über den harschen Schnee in die Nacht. Und gleich den Funken der zu Boden krachenden Scheite stob auf der Stelle alles auseinander und hinein in jede Himmelsrichtung. Diese vermeintliche Pestseuche hatte dem Weib die letzten Wochen ihres Lebens gerettet.
Als unserem Kuraten dieser Vorfall durch ein Aldersches Plappermaul zu Ohren kam, gelobte er noch am selbigen Tag, nie wieder eine Feuerpredigt zu halten. Mit den Worten, es sei doch um Dreifaltigkeitswillen nicht alles bar zu nehmen, was ein Pfarrer von der Kanzel predige, entließ er das in seinem Glauben an die unzweifelbare Wahrheit des Priesterwortes empfindlich erschütterte Plappermaul.
Der geistvolle Entschluß währte aber nicht lange Zeit, denn bald mußte der Kurat feststellen, daß der religiöse Eifer der Eschberger im Abnehmen begriffen war. Die samstäglichen Rosenkränze, tadelte er, seien bloß noch von Weibsbildern besucht, die Unsitte des Tabakkäuens während des Heiligen Meßopfers sei wieder Mode geworden, einige Mannsbilder auf der Orgelempore störten mit ihrem frechen Grinsen die Andacht, und außerdem seien in den letzten zwei Wochen lediglich acht Kreuzer Opfergeldes eingegangen. Was aber das Allerschändlichste sei, und er blitzte teuflisch in die erschrockenen Äuglein einiger Alder Jungfrauen, daß neuerdings in den Häusern des Dorfes Winkeltänze veranstaltet und geistige Getränke ausgeschenkt würden. Als sich in der Folgezeit an den monierten Zuständen nichts änderte und sich an drei Sonntagen hintereinander außer ein paar Schildpattknöpfen nichts aus dem Opferbeutel rütteln ließ, brach der Kurat das Gelöbnis. Er sann auf eine Predigt, die den Eschbergern jetzt und für alle Ewigkeit den sturen Kleinmut austriebe.
Der Geist zu jener verhängnisvollen Predigt am Pfingstfest des Jahres 1800 überkam den Kuraten im Stall seines Widums, wohin er zu gehen pflegte, wenn immer er auf Schwerwiegendes sann. In der lauen Luft des Stalls, unter Kühen, Ziegen, Säuen und Hühnern, mochte er denken. Dort saß er nun auf seinem Holzfäßchen neben dem Schweinekoben, die Hände in die Stirn gelegt. Lange saß er einfallslos, wußte nur, daß er das Bild des Evangeliums – die Feuerszungen des Pfingstwunders – in ein Feuer ganz anderen Ausmaßes hinüberführen wollte. Lange saß er auf dem Fäßchen, sinnierte und fand keine Brücke, die zu überqueren ihm günstig erschien. Als ihm das Gesäß einschlief, erhob er sich unmutig, tat einige Schritte und tappte in eine noch dampfende Kuhklatter. Er rutschte, stürzte rücklings und mit dem Hinterkopf um Dreifaltigkeitswillen hart auf die Kante des Holzfäßchens. Das Fäßchen! Das war es! Das Schwarzpulver! Marodierende napoleonische Soldaten hatten es im Wald verloren. Er hatte es in Verwahrung genommen, auf daß kein Unfug damit geschehe. Vorsichtig langte er nach der daumendicken Beule und maulte, weshalb der Heilige Geist ausgerechnet auf diese Weise über ihn habe kommen müssen. Aber die Feuerpredigt war augenblicklich entworfen. Bei Nacht stieg der Kurat dann hinab in den Weiler, wo der Lamparter Haintz, der Mesmer von Eschberg, wohnte. Man sah die Kerzen bis zum Stumpf brennen. So lange blieb der Kurat.
Am Pfingsttag nahm alles seinen verhängnisvollen Lauf. Zwar stutzten etliche Kirchgänger ob der sonderbar ausgelegten Schnur, doch niemand zollte dem Umstand die ihm gebührende Obacht. Einer, dem es die Haare versengt hatte, wußte im nachhinein von einem merkwürdigen Fäßchen zu berichten. Er habe noch seinen Nachbarn gestüpft und zu ihm gesagt: »Sieh! Er selber säuft im Hause Gottes!« Ein anderer erzählte, der hochwürdige Herr Kurat habe schon beim Kyrie eine merkwürdig aufgewühlte Stimme gehabt, und ein Ministrant behauptete, daß, indes der Kurat die Kanzel emporgestiegen, der Mesmer just in dem Augenblick die Kirche mit einer eben umgestülpten Sanduhr verlassen habe.
Itzo könne sich das reinigende Pfingstfeuer vollends in das alles versengende Höllenfeuer kehren, bebte der Kurat auf der Kanzel. Belzebub sei so gewaltig, daß er in seinem Übermut nicht einmal vor den Pforten der Kirche haltmache. Item stünde es in seiner Macht, durchaus die Pforten der Kirche einzureißen, habe er einmal die Seelen für sich gewonnen. Und solches sei in Eschberg leider der Fall, darum bedürfe es nur noch einer kleinen Zeit, bis daß alles in Rauch und Schwefel untergehe. So lärmte es von der Kanzel, und eine wache Alderin gab später im Generalvikariat zu Feldberg an, der hochwürdige Herr Kurat habe den Gedanken vom Brennen, Krachen, Rauch und Schwefel gar sonderbar oft und laut wiederholt.
Dreien Bauern, die in den hinteren Bänken saßen, zerriß der Knall das Trommelfell, und das freche Grinsen der Mannsbilder auf der Orgelempore verstummte jäh. Die an der Kirchenpforte lehnten, traf es besonders unglücklich. Einem zerschlugen die berstenden Türen die Beine, einem anderen die Hüfte und einem dritten schoß das Blut aus den Ohren und bespritzte die weißgekalkte Wand bis hinauf zur Kreuzwegtafel. Unglücklich traf es auch den Mesmer, der seine Sache hatte gut machen wollen und der brennenden Lunte dicht gefolgt war, wiewohl das zu tun ihm der Kurat ausdrücklich untersagt hatte. Haintz Lamparter verlor sein Augenlicht und wäre überhaupt verbrannt, hätte er sich nicht verschockt im tauen Morgengras des Feuers abgewälzt. Die auf den Tod erschrockenen Kirchgänger rannten schreiend und, wie man hinzufügen muß, ohne den Segen des Kuraten abzuwarten, aus dem Kirchlein.
Die Sache wurde von den Eschberger Bürgern beim Civil- und Criminalgericht zu Feldberg angezeigt, doch behauptete das Generalvikariat, der Casus sei Kirchenangelegenheit, und man werde den irrigen Bruder vor einem Kirchengericht aburteilen, was dann auch geschah. Dem Kuraten wurde sein jährliches Gehalt von dreihundertfünfzig Gulden auf die Hälfte gestrichen. Ja, man stellte ihn und alle kommenden Eschberger Hirten in den Rang eines Cooperator Expositus, was zur Folge hatte, daß hinfort jede seelsorgliche Entscheidung mit dem Pfarrer von Götzberg abgesprochen werden mußte. Zwar verteidigte sich der Kurat mit beeindruckendem rednerischen Talent – man dürfe doch um Dreifaltigkeitswillen nicht jedes Wort bar nehmen, das ein Priester von der Kanzel predige –, aber es nützte ihm nichts mehr. Der Kurat verließ Eschberg drei Wochen nach jenem Sonntag, der als sogenannter Schwefelsonntag in das Angedenken eingegangen ist. Zwei Zeilen auf der Tür seines Widums deuteten darauf, daß er nach Hohenberg gewandert, die längst überfällige Sommerfrische anzutreten. Acht Monate ermangelte den Eschbergern jede seelsorgliche Pflege. Dann kehrte der Kurat unerwartet zurück. Er trug das feste Ansinnen, seinen Schäfchen zukünftig als ein weiser Hirte vorzustehen. Leider blieb es bei dem Ansinnen.
Das alles geschah drei Jahre vor der Geburt des Johannes Elias. Ein Leser, der uns zwischenzeitlich bis an diesen Punkt gefolgt ist, mag sich die Frage vorlegen, weshalb wir uns so ausführlich über den hitzigen Kuraten verbreiten und nicht endlich die Erzählung auf jenes sonderliche Kind hinführen. Er möge sich diese Frage bewahren.
Zwei Wochen nach der Geburt des Kindes fand im Kirchlein von Eschberg – das nun ob seiner erzenen, zweifach gefütterten, eisenverkeilten und zwölfangligen Flügeltüren bestaunt wurde – eine Doppeltaufe statt. Getauft wurden zwei Knaben aus dem Geschlecht der Alder, das seit Jahrzehnten unter sich verfeindet war. Der eine – unser Kind – wurde auf den Namen Johannes Elias, der andere, welcher fünf Tage später geboren, auf Peter Elias getauft. Dem Peter Elias half eine mit Wägerin bezeichnete Hebamme aus Altberg zur Welt. Man mag bemerken, daß der Name Elias mit einer gewissen Dringlichkeit wiederkehrt. Das hat folgende Bewandtnis:
Kurat Elias Benzer begriff sich seit jenem pfingstlichen Damaskus-Erlebnis nicht mehr bloß als Hirte, sondern als Vater seiner Eschberger Christenkinder. Freilich muß er den rein spirituellen Gehalt des Wortes Vater mit dem fleischlichen durcheinandergebracht haben, denn in Eschberg gab es in der Folgezeit etliche braunschopfige Kinder, welche, wie es hieß, dem hochwürdigen Herrn Kurat wie aus der Form gestürzt waren. Der Kurat besaß überdies einen fast eitel übertriebenen Hang zur Unsterblichkeit. Er schien zu wissen, daß selbst die zündendsten Worte schnell verlöschen, ein Name aber von weit längerer Dauer ist. So stiftete er das eigentümliche Brauchtum, alle männlichen Ankömmlinge im Zweitnamen Elias zu taufen.
Die Taufhandlung geschah im engsten Familienkreis. Die Alder des Johannes Elias saßen auf der Epistel-, die des Peter Elias auf der Evangelienseite. Der Kurat sprach ein Wort, worin er die Kraft des Wassers mit der Kraft des Feuers verglich. Das Wort währte lang, und es mochte fast scheinen, als trage er eine gewisse Scheu vor dem Taufakt selbst. Wie er endlich den Chrisam auf die krebsroten Stirnen der Knaben zeichnete, fing ihm die Hand so heftig zu zittern an, daß er innehalten mußte, wollte er den Würmlein nicht Weh antun. Da verhing sich der Blick des Kuraten ungewollt im Antlitz der Seffin, und beide erröteten im selbigen Moment auf das Allerpeinlichste. Zum Glück intonierte die Orgel den Taufchoral, und zum Glück fing Johannes Elias plötzlich an zu schreien. Er jubilierte, denn er vernahm zum ersten Mal in seinem Leben die Klänge einer Orgel. Er jubilierte über die Entdeckung der Musik.