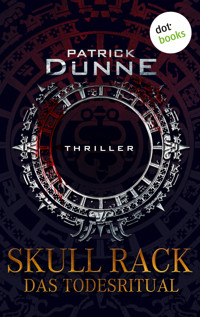1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Illaun-Bowe-Thriller
- Sprache: Deutsch
Er will sie zum Schweigen bringen: Der fesselnde Irland-Thriller »Die Opferstätte« von Patrick Dunne jetzt als eBook bei dotbooks. Als die Archäologin Illaun Bowe im irischen Städtchen Kilkee eine heidnische Stätte untersucht, stößt sie auf einen Knochen, den zunächst alle für einen sensationellen Fund aus der Bronzezeit halten. Aber zu ihrem Entsetzen findet sie heraus, dass er keineswegs historisch ist, sondern hier ein Mensch auf grausame Weise ermordet wurde – und das erst vor wenigen Tagen! Obwohl nun die Polizei zuständig ist, kann Illaun sich nicht aus der Sache heraushalten, denn sie hat den starken Verdacht, dass Detective Rattigan unsauber ermittelt. Doch je tiefer sie in den Fall einsteigt, desto mehr verstrickt sie sich in einem Netz aus Lügen – und gerät ins Visier des Mörders, der eine alte Schuld für immer begraben will ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende Thriller »Die Opferstätte« ist der dritte Band von Patrick Dunnes Spannungsreihe um die Archäologin Illaun Bowe. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als die Archäologin Illaun Bowe im irischen Städtchen Kilkee eine heidnische Stätte untersucht, stößt sie auf einen Knochen, den zunächst alle für einen sensationellen Fund aus der Bronzezeit halten. Aber zu ihrem Entsetzen findet sie heraus, dass er keineswegs historisch ist, sondern hier ein Mensch auf grausame Weise ermordet wurde – und das erst vor wenigen Tagen! Obwohl nun die Polizei zuständig ist, kann Illaun sich nicht aus der Sache heraushalten, denn sie hat den starken Verdacht, dass Detective Rattigan unsauber ermittelt. Doch je tiefer sie in den Fall einsteigt, desto mehr verstrickt sie sich in einem Netz aus Lügen – und gerät ins Visier des Mörders, der eine alte Schuld für immer begraben will ...
Über den Autor:
Patrick Dunne wurde in Dublin geboren und studierte Literatur und Philosophie. Nach dem Studium war er eine Zeitlang Musiker. Inzwischen ist er seit über 20 Jahren als Regisseur und Produzent beim irischen Rundfunk und Fernsehen tätig. Mit seinem Debütroman »Die Keltennadel« gelang ihm ein internationaler Bestseller. Patrick Dunne gehört heute zu den erfolgreichsten Autoren Irlands.
Patrick Dunne veröffentlichte bei dotbooks bereits die Thriller »Die Keltennadel« und »Skull Rack – Das Todesritual«, sowie die Illaun-Bowe-Trilogie mit den Thrillern »Das Keltengrab«, »Die Pestglocke« und »Die Opferstätte«.
***
eBook-Neuausgabe Februar 2023
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2008 unter dem Originaltitel »The Godstone« bei Gill & Macmillan Ltd, Dublin.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2008 by Patrick Dunne
Published by Arrangement with Patrick Dunne
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2010 by Limes Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Die Rechte an der deutschen Übersetzung von Fred Kinzel liegen beim Limes Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Viktor Gladkov, LilKar, Przemek Iciak
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-465-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Opferstätte« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Patrick Dunne
Die Opferstätte
Thriller
Aus dem Englischen von Fred Kinzel
dotbooks.
Ihr hattet Muß’, im Augenblick des Todes,
Der Tiefe Heimlichkeiten auszuspäh’n?
SHAKESPEARE, KÖNIG RICHARD III.
Kapitel 1
»Ich glaube, da vorn ist der Abfallhaufen, Illaun«, sagte Mahon.
Wir beide gingen über einen windgepeitschten Kiesstrand in der Shannon-Mündung. Links von uns endete das Küstenweideland abrupt an einer nackten Uferböschung aus sandiger, mit Steinen durchsetzter Erde. Zu unserer Rechten erstreckte sich kabbeliges, graues Wasser bis zur Küste von Kerry, die als verschwommenes Grün in der Ferne erkennbar war. Über uns drohte sich eine gewaltige Regenwolke zu entladen, während wir über die losen Steine stolperten, die mit allerlei Unrat übersät waren, den die Flut herangetragen hatte: Plastikwasserflaschen, rostige Sprühdosen, ein Stück blaues Nylonseil, das an einer Boje befestigt war, die Ringe von einer Sechserpackung Getränke, eine rosa Kinderbadelatsche. Ich musste über die Ironie lächeln ‒ wir bahnten uns einen Weg über einen neuzeitlichen Abfallhaufen, um zu einem prähistorischen zu gelangen.
Einige Kilometer weiter westlich krachten haushohe Atlantikwellen entlang der Halbinsel Loop Head gegen Klippen und brandeten in kleine Buchten und Meereshöhlen. Was bedeutete, dass das Schiffswrack, nach dem Mahon tauchen sollte, im Moment nicht zugänglich war.
Theo Mahon war Meereshistoriker und sah auch aus wie einer. Er trug eine Seemannsmütze und eine marineblaue, zweireihige Jacke, die sich mit Mühe über einen grauen Rollkragenpullover mit Zopfmuster spannte. Der kratzige weiße Bart, der aus seinen wohl gefütterten Backen spross, erinnerte an eine Scheuerbürste, ein Eindruck, der durch das Fehlen eines Schnurrbarts noch unterstrichen wurde. »Ich rasiere mir den Schnauzer ab, wenn ich tauche«, hatte er erklärt. »Sonst sickert immer Wasser in meine Maske.«
Es war Mahon gewesen, der vorgeschlagen hatte, dass wir zur Flussmündung hinausfahren sollten, um Berichte zu überprüfen, ein Muschelhaufen sei infolge eines Zusammenspiels von hohen Gezeiten und rauer See freigelegt worden. Es war September, und der Vollmond war in einer Linie mit Erde und Sonne. Das allein verursachte bereits besonders hohe ‒ und niedrige ‒ Gezeitenstände. Aber wenn man die bevorstehende Tagundnachtgleiche sowie den Umstand, dass der Mond näher zur Erde stand und irgendwie geneigt war, mit berücksichtigte, wurde es noch komplizierter. Ich versuchte schon lange nicht mehr, diese Wissenschaft zu verstehen, aber alles in allem war es offenbar ein Rezept für extreme Gezeiten.
Regen setzte ein und prasselte auf meine Windjacke. Ich zog die Kapuze über den Kopf, doch ehe ich sie festbinden konnte, erfasste der Wind das Zugband und ließ den Knebel gegen mein Gesicht schlagen. Es brannte, obwohl meine Wangen taub waren von der Kälte. Die Witterung war eher wie Ende Januar als wie Frühherbst.
»Da ist er«, sagte Mahon. Der Erdwall, an dem wir entlanggegangen waren, erhob sich etwa drei Meter hoch und lag genauso viel über der normalen Hochwassermarke. Doch da, wo wir beide jetzt standen, war die Fassade der Böschung auf den Strand abgerutscht, und man sah einen Haufen weggeworfener Schalen von Meeresweichtieren, Stücke von Tierknochen, verbrannte Steine und Sand, der mit Spuren von Holzkohle durchsetzt war.
»Es ist tatsächlich ein Muschelhaufen«, sagte ich und fragte mich, welchen Umfang er wohl haben mochte. An solchen Orten waren regelmäßig prähistorische Grillabende veranstaltet worden, die im gesellschaftlichen Leben der nomadischen Jäger und Sammler offenbar eine große Rolle gespielt hatten. Als Folge davon konnten die über Generationen angehäuften Abfallberge eine erstaunliche Größe erreichen.
»Was halten Sie davon, wenn Sie weitergehen und schauen, wie weit der Abbruch reicht?«, sagte ich. Ich hatte bemerkt, dass die Kiesel in der unmittelbaren Umgebung von verwitterter Erde zusammengebacken worden waren, was es leichter machte, einen Halt für die Füße zu finden.
Mahon ging ein kleines Stück, blieb stehen und drehte sich um. »Hier endet er. Und der Muschelhaufen ebenfalls.«
»Dann ist unter der Uferböschung wahrscheinlich noch mehr davon. Wie weit sind Sie von mir entfernt? Fünf Meter?«
Er nickte.
»Vielleicht sollten wir weitergehen und schauen, ob es noch mehr abgetragene Stellen gibt.«
Eine in die Flussmündung drückende Flutwelle lief über die Kiesel zu uns herauf.
Mahon schüttelte den Kopf. »Die Flut kommt. Wir sollten besser kein Risiko eingehen.«
Kiesel klickten und klapperten, als das Wasser zwischen ihnen zurückströmte.
Ich holte meine Digitalkamera aus der Tasche. »Ich mache lieber ein paar Fotos, für den Fall, dass der ganze Abfallhaufen weggespült wird.«
Auf dem Rückweg blieb Mahon plötzlich stehen. »He, sehen Sie sich das an«, sagte er und bückte sich, um etwas von einer Stelle aufzuheben, wo noch viel von dem abgerutschten Erdreich lag. »Das ist von einem Menschen.«
Er legte das Fundstück auf seine breite Handfläche und hielt es mir entgegen. Es war ein kompletter Unterkiefer.
»Das ist wirklich interessant«, sagte ich. »Aber rühren Sie sich erst mal nicht vom Fleck. Ich schaue mich um, ob es noch mehr Knochen gibt.« Ich wollte nicht, dass wir beide darauf herumtrampelten.
Die meisten Muschelhaufen stammen aus der Bronzezeit oder später, aber menschliche Überreste würden darauf hindeuten, dass dieser hier aus der Steinzeit war; manche mesolithischen Gesellschaften bestatteten ihre Toten, indem sie sie den Elementen aussetzten, bis das Fleisch von den Knochen gefault war.
Ich sah keine weiteren Skelettteile herumliegen, aber ich fragte mich jetzt, ob andere der in den Muschelhaufen eingebetteten Knochenfragmente womöglich ebenfalls menschlichen Ursprungs waren.
»Sehen Sie sich das nur gut an«, sagte Mahon, während ich mich ihm vorsichtig näherte.
Ich betrachtete den Unterkiefer, der in seiner Handfläche lag, genauer. Alle Zähne schienen noch vorhanden zu sein, aber sie waren von einer Menge zusammengebackener Erde bedeckt.
Ich untersuchte abwechselnd die beiden Unterkieferäste, die senkrechten Abschnitte, die den Unterkiefer mit dem Schädelknochen verbinden. »Hey, schauen Sie hier«, sagte ich und deutete auf den u-förmigen oberen Teil des rechten Astes. »Sieht aus wie Biss- oder Schnittspuren.«
»Sieht für mich wie angenagt aus«, sagte Mahon, nachdem er einen Blick darauf geworfen hatte. »Höchstwahrscheinlich von Aasfressern.«
»Nanu, was ist das?« Ich hatte mit dem Fingernagel etwas Sand aus demselben Teil des linken Astes gekratzt. Es gab weitere, jedoch tiefere Schnitte im Knochen und ‒ was noch aussagekräftiger war ‒ eines der U-Häkchen war ganz abgetrennt worden.
Die Zerstückelung des verwesten Körpers war der nächste Schritt bei der prähistorischen Leichenentsorgung. Und an Stellen, an denen die Knochen noch von Bändern und Sehnen zusammengehalten wurden, hatte man das Skelett auseinandergeschnitten.
Mahon hielt den Unterkiefer am intakten rechten Ast fest und drehte ihn zu sich herum. »Na, mein Hübscher. Und was hast du uns nach all der Zeit zu sagen?«
»Machen wir lieber ein paar Fotos, ehe wir ihn wegnehmen«, sagte ich. Ich wollte den Fund nicht unnötig bewegen und überlegte bereits, wie wir ihn transportieren konnten.
»Natürlich.« Mahon legte ihn dorthin zurück, wo er ihn gefunden hatte, und trat beiseite.
Ich begann, aus verschiedenen Winkeln Bilder von dem Kiefer und dem Abfallhaufen zu machen. Zum Glück hatte ich den Regen im Rücken ‒ er war nicht heftiger geworden, aber er schien uns waagrecht entgegenzukommen.
Mahon stocherte in dem Abfallhaufen. »So schlecht ist die globale Erwärmung wohl doch nicht, wenn sie uns zu solchen Funden verhilft.«
Selbst als Archäologin erschien es mir nicht als guter Tausch. Ich lenkte das Gespräch in eine leicht andere Richtung. »Aber der Meeresspiegel steigt in diesem Gebiet seit rund zehntausend Jahren, oder?«
»Stimmt. Es gibt sogar einen untergegangenen Wald aus der Steinzeit nicht weit von hier.« Er steckte eine Hand in die Jacke. »Und einer Legende zufolge befindet sich in der Mündung des Flusses eine Kirche im Meer. Wahrscheinlich stand sie früher einmal an Land. Voilá!«, rief er aus und holte einen Zahnstocher hervor.
Ich ließ die Kamera sinken.
»Fertig?«
»Ja. Ich brauche nur noch etwas …« Ich suchte in dem herumliegenden Müll nach einem Transportbehälter. Als ich gerade die abgebrochene Ecke einer Fischkiste ausprobieren wollte, bemerkte ich, dass Mahon den Kiefer wieder in die Hand genommen hatte.
»Damit du auf deiner Reise einen guten Eindruck machst«, sagte er zu ihm und schwang den Zahnstocher. Nachdem er etwas von der festgeklebten Erde gelockert hatte, drehte er den Knochen um und stieß ihn ein paar Mal mit dem Zeigefinger an. »Und ich denke, ein letztes Foto geht auch in Ordnung.« Er hielt den Unterkiefer vor sein Kinn und grinste durch ihn hindurch, dann schob er ihn etwas höher, sodass sein Bart aus ihm herauszuwachsen schien. »Cheese.«
Ein bisschen krass, dachte ich, lächelte aber dennoch. Ein wenig Schauspielerei war typisch für den Mann, wie ich allmählich herausfand.
»Ach, kommen Sie, Illaun.« Er merkte mir meine mangelnde Begeisterung offenbar an.
»Also gut.« Ich bedeutete ihm, genau vor der Kamera in die Hocke zu gehen, machte ein Bild und zoomte dann zu einer Nahaufnahme heran. Der Größenunterschied zwischen seinem Gesicht und dem Kiefer war frappant. Der Knochen gehörte offenbar zu einer Frau.
Aber dann sah ich etwas, das mich vor Schreck erstarren ließ.
»Was ist los?«
Ich ließ die Kamera sinken. »Schauen Sie sich die Zähne an, Theo. Da ist etwas …« Ich schluckte. »Da ist etwas, das nicht da sein dürfte .«
»O mein Gott«, sagte er. Plötzlich wusste er nicht mehr, wohin mit dem Stück Mensch, das er in der Hand hielt.
Einer der Backenzähne enthielt eine Metallfüllung.
Kapitel 2
Mahon ging in die Polizeistation in Kilkee, um den Fund abzuliefern, während ich draußen wartete. Das Gebäude dürfte ursprünglich weiß getünchte Wände mit grauen Ecksteinen gehabt haben, aber jetzt war es zitronengelb gestrichen. Vielleicht hatte jemand gedacht, man müsse es der signalfarbenen Tracht der Polizei angleichen, aber wahrscheinlich lag es eher an der Begeisterung für leuchtend bunte Häuser, die für diesen Teil des Landes typisch war.
Regentropfen klatschten lustlos auf die Windschutzscheibe. An der Westküste muss sich der Regen anstrengen, wenn man ihn noch bemerken soll, aber dieser hier schien den Versuch bereits aufgegeben zu haben. Dennoch machte er den grauen Septembernachmittag noch düsterer. Kein Wunder, dass die Häuser so fröhlich bunt angemalt sind, dachte ich. Ein Teil von mir sehnte sich zurück nach Hause, ins County Meath, wo das Sonnenlicht in meiner Vorstellung wie warmer Sirup vom Himmel strömte, wie es immer der Fall gewesen war, wenn wir nach den Sommerferien wieder zur Schule gingen. Ich erinnerte mich an die bittersüßen Nachmittage, an denen ich ins Klassenzimmer gesperrt war, während der Sommer draußen in strahlendem Glanz zu Ende ging.
Ich tröstete mich mit dem Wissen, dass der Regen auf den Felsen rasch trocknete und der frisch gestrichene Ozean die Lebensgeister weckte, wenn die Sonne hier an der Küste von Clare herauskam.
Auf der Karte sieht die Halbinsel Loop Head wie eine verrostete Messerklinge aus ‒ ein fünfzig Kilometer langes Dreieck, das die Shannon-Mündung vom Atlantik trennt. Flach und beinahe baumlos, ist die Landschaft ein Flickenteppich aus rechtwinkligen Feldstreifen voller Binsen, unterteilt von niedrigen Erdwällen und Hecken. Gehöfte sind einzeln oder in Gruppen darüber verteilt und immer gut sichtbar in dem kahlen Gelände, das zum Meer hin sanft ansteigt, um in einer dramatischen Küstenlinie zu enden, mit hohen Klippen und von Wogen umtosten Riffen, düsteren Höhlen und von Möwen beherrschten Felssäulen im Meer. Es sieht aus, als hätte jemand die Seite eines Billardtischs mit einer Axt bearbeitet, der grüne Bezug der Wiesen endet abrupt über einer dunklen Fassade aus Kalksteinschiefer, der teilweise senkrecht ins Meer abstürzt und sich an manchen Stellen in Stufen unter Wasser fortsetzt, um ein an Meerespflanzen und Fischen reiches Riff zu bilden. Aus dem Meeresgrund ragen mächtige Brocken und Felssplitter auf, die dem Angriff widerstanden haben und von Resten des grünen Tuchs bedeckt sind. Etwa in der Mitte dieses Küstenabschnitts führt eine rund einen Kilometer breite Öffnung in der Steilwand wie ein Tor zu der sichelförmigen Sandbucht von Kilkee.
Nach einer schmerzhaften Zeit, in der ich meinen Vater verloren und mich von meinem Verlobten getrennt hatte, legte ich gerade eine kurze Pause ein und war dazu an einen Ort mit glücklichen Erinnerungen zurückgekehrt. Ich befand mich außerdem an einer Art Scheidepunkt meiner Berufslaufbahn, nachdem man mir angeboten hatte, ein archäologisches Museum für das County Meath aufzubauen. Die Entscheidung dafür würde Art und Umfang meines Beratungsunternehmens in den nächsten Jahren bestimmen. Es gab einen neuen Mann in meinem Leben ‒ und sei es auch weit entfernt ‒, und im November würde ich vierzig werden. Das bereitete mir keinerlei Kopfzerbrechen, aber es schien wie von allein zu einer Art Meilenstein in meinem Leben zu werden.
Während der letzten fünf Tage hatte mein Handy ausgeschaltet in einer Schublade gelegen; ich hatte mich vergewissert, dass ich in meinem Hotelzimmer über einen Internetzugang verfügte, und meinen Laptop dann im obersten Fach meines Wandschranks verstaut. Ich hatte lange Spaziergänge auf den Klippen unternommen und war beim Riff nahe der Stadt geschwommen und geschnorchelt, hatte das Meer in verschiedenen Stimmungen fotografiert und Skizzen von Anemonen in Felstümpeln angefertigt, in der Absicht, eine Reihe von Aquarellen zu malen, wenn ich nach Hause kam ‒ tatsächlich hatte ich bereits eines mit dem Blick von meinem Hotelbalkon begonnen.
Am Vortag hatte ich eine alte Studienfreundin besucht, die weiter unten auf der Halbinsel ein kunsthandwerkliches Atelier besaß. Mir war nicht klar gewesen, dass Kim Tyrell hier zu Hause war, bis ich vor Monaten ein beschriftetes Werk von ihr ‒ einen beleuchteten Briefbeschwerer ‒ in einer Galerie in Dublin gesehen hatte. Der Besitzer der Galerie hatte mir erzählt, sie sei vor ein paar Jahren dorthin gezogen, nach dem Tod ihres Mannes Jamie, eines hochgelobten Keramikers. Er war anscheinend wegen einer harmlosen Operation ins Krankenhaus gegangen, wo er sich eine Infektion holte, die in einer tödlichen Sepsis endete.
Ich hatte mir Kims Kontaktdaten notiert und ihr eine Woche, bevor ich von Castleboyne aufbrach, eine E-Mail geschickt. Sie hatte mich eingeladen, sie in ihrem Haus nahe dem Dorf Carrigaholt an der Flussmündung zu besuchen. Nachdem ich ein paar Mal falsch abgebogen war, hielt ich vor einem weiß getünchten Cottage mit orangefarbenen Türen und Fenstern.
Geranientöpfe wechselten sich mit Treibholzfunden an den Wänden des Häuschens ab, und ein grüner Kleinwagen stand im gekiesten Hof. Als ich neben ihm parkte, kam Kim um das Haus herum, um mich zu begrüßen. Klein wie ich selbst, aber untersetzter, trug sie ein Batik-Top in Purpur und Weiß und Bluejeans. Ihr weiches, blasses Gesicht war breiter geworden, und ihre dunklen Augen funkelten zwar noch lebhaft, wie ich sie in Erinnerung hatte, waren jedoch von einem Netz von Fältchen umgeben. Ein Schopf dichter Locken krönte immer noch ihr Haupt, auch wenn er jetzt grauer war und einzelne Strähnen wie die Ranken einer Kriechpflanze auf der Suche nach Halt aus ihm sprossen.
Bei einem Lunch mit Quiche aus Ziegenkäse und Pilzen mit Salat plauderten Kim und ich an ihrem Küchentisch. Unsere Gespräche wurden von Zeit zu Zeit unterbrochen, wenn eine ihrer drei Katzen ‒ zwei gescheckte und eine schwarze Halbsiam ‒ an den Tisch kamen, um mich zu begutachten. Ich erzählte ihr von Boo, meinem großen Maine-Coon-Kater, der selbst für Katzenverhältnisse ein exzentrisches Verhalten an den Tag legt. »Er trinkt das Wasser aus den Gläsern, wenn ich meine Aquarelle male, er leert jede Schublade im Haus auf der Suche nach seiner Spielmaus, und neuerdings lässt er sich vom Hund meiner Mutter ums Haus jagen ‒ und ich rede von einer dänischen Dogge.«
Das amüsierte Kim, und ihr kehliges Lachen war mir sofort wieder vertraut. Sie drängte mir noch eine Portion Quiche auf, und ich willigte gern ein. Sie schmeckte köstlich. »Dann wohnst du also mit deiner Mutter zusammen«, fragte sie, während sie das Stück auf meinen Teller lud.
Ich hatte ihr bereits erzählt, dass mein Vater im Juni gestorben war, nachdem er seit Jahren an Alzheimer gelitten hatte. »Als uns klar wurde, dass mein Vater das Pflegeheim nie mehr verlassen würde, bauten wir ein Büro für mich und eine Wohnung für sie an unser Haus an.«
»Du standest deinem Vater sehr nahe, soweit ich mich erinnere.«
»Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mit seinem Tod wirklich schon fertig geworden bin. Er hinterlässt ein irgendwie … taubes Gefühl.«
Kim nickte. »Ich weiß, was du meinst. Bei mir war es genauso, als James starb.«
»Und ist es inzwischen besser geworden?«
»Eigentlich nicht. Auch nach sieben Jahren nicht. Ich glaube, dass wir über den Tod einer geliebten Person nie hinwegkommen. Es wird mit der Zeit nur ein bisschen weniger schmerzhaft. Ab und an fällt mir ein Foto von James in die Hände, oder ich sehe vielleicht ein Werkstück von ihm, und plötzlich breche ich in Tränen aus. Es ist, als würden wir unsere Trauer in Raten durchmachen, weil wir mit dem ganzen Gefühl auf einmal nicht fertig werden.«
Wir aßen eine Weile schweigend. Dann sprang mir eine der gescheckten Katzen auf den Schoß.
»Wirf sie runter«, sagte Kim.
»Sie stört mich nicht. Ich bin sowieso fertig.«
Kim räumte den Tisch ab, während ich mit der Katze sprach und sie unter dem Kinn kraulte.
»Möchtest du einen Kaffee?«
»Nein, danke.«
»Dann Tee, vielleicht?« Kim hielt zwei Beutel hoch. »Orange Pekoe? Jasmin?«
»Danke, ich brauche nichts.«
Sie legte die Beutel auf die Arbeitsplatte. »Dabei fällt mir ein ‒ warst du nicht mit Finian Shaw zusammen, dem Typ mit dem berühmten Garten, Broomfield oder ...«
»Brookfield. Ich habe vor ein paar Monaten mit ihm Schluss gemacht. Zu der Zeit, als mein Vater starb.«
»Gibt es seitdem jemanden in deinem Leben?«
»Na ja, gewissermaßen … Ich habe etwa zur selben Zeit diesen Südafrikaner kennengelernt. Peter ist Pathologe, er sollte der Polizei bei der Aufklärung eines vermeintlichen Ritualmords helfen. Wir haben uns nur über einige Tage hinweg gesehen, es war also keine Zeit, eine intime Beziehung zu entwickeln. Aber wir sind in Kontakt geblieben.«
»In Kontakt geblieben? Das klingt nach Brieffreundschaft.«
»Manchmal fühlt es sich auch so an.«
»Du hast ihn nicht besucht?«
»Noch nicht.«
»Noch nicht«, flüsterte sie für sich und sah aus dem Fenster. Nachdem sie eine Weile über etwas nachgedacht hatte, kam sie wieder an den Tisch. Die Katze beschloss, dass es Zeit war zu gehen, und sprang auf den Boden.
Kim beugte sich vor und schloss beide Hände um meine Hand. »Jamie und ich haben die Gründung einer Familie immer vor uns hergeschoben. Noch nicht, sagten wir, als wir Anfang dreißig waren, noch nicht. Und dann … war Jamie tot.« Sie holte tief Luft, um sich zu sammeln, und drückte gleichzeitig meine Hand. »Ich hatte nicht Kinder haben wollen, nur damit ich sie hatte. Ich hatte sie mit ihm haben wollen.« Sie sah mich durch ihre Tränen durchdringend an. »Aber jetzt ist es zu spät. Der Punkt ist, Illaun, wir leben oft, als würden wir nur für das echte Leben üben. Aber das Leben ist nicht etwas, das nächste Woche anfängt, es spielt sich jetzt ab, in jeder Minute, die wir auf der Welt sind. Lass nicht zu, dass ›Noch nicht‹ zu deiner Grabinschrift wird.«
Sie ließ meine Hand los und rieb heftig mit den Handflächen um ihre Augen herum. Dann schluchzte sie kurz und sagte lächelnd: »Du bist früher getaucht, als wir noch auf dem College waren. Warst du schon beim Tauchen, seit du hier bist?«
»Nein«, sagte ich mit Nachdruck. »Ich tauche nicht mehr. Hey ‒ ich würde gern etwas von deinen Arbeiten sehen.« Ich verstand es ebenfalls, das Thema zu wechseln.
In ihrem Atelier auf der anderen Seite des Hofs ‒ einem umgewandelten Schuppen, in dem früher Torf gelagert wurde ‒ zeigte mir Kim eine Auswahl an Briefbeschwerern und erklärte mir, wie sie hergestellt wurden. Ehe ich ging, bat ich sie, einen als Geschenk für meine Freundin Fran anzufertigen, und sie machte sich Notizen, während wir den Entwurf besprachen.
Danach unternahmen wir eine kleine Wanderung auf einer Landstraße in der Nähe, pflückten unterwegs Brombeeren und saßen dann fast eine Stunde lang auf einer niedrigen Mauer, um Brachvögel und Austernfischer zu beobachten, die in einem bei Ebbe trockenen Wasserlauf herumstocherten.
»Ich verstehe, wieso es dir hier gefällt«, sagte ich. Nicht ein einziges Fahrzeug war auf der Straße vorbeigekommen, während wir auf der Mauer saßen. Es wehte kaum eine Brise, und man hörte nichts als die Rufe der Stelzvögel.
»Es kann manchmal etwas einsam sein«, sagte sie und blickte in die Ferne. »Besonders im Winter. In den langen, dunklen Nächten wird einem die Entfernung zwischen dir und dem nächsten Haus bewusster.«
»Machst du dir gelegentlich um deine persönliche Sicherheit Sorgen?«
Sie lachte. »Nur wenn ich befürchte, dass der Wind das Haus flachlegt. Man fühlt sich hier in der Gegend nicht persönlich bedroht. Es sei denn … Na ja, eine junge Frau, die ich kannte, ist vor ein paar Jahren verschwunden. Es hieß, sie habe Selbstmord begangen, aber ...« Sie schien kurz zu erschaudern. »Ich war mir da nicht so sicher.« Sie glitt von der Mauer. »Lass uns über Carrigaholt zurückgehen. Vielleicht kehren wir im Long Dock noch auf einen Drink ein.«
»Wunderbar«, sagte ich. »Ich habe keine Eile.«
Ich sah Mahon aus der Polizeistation kommen. Der Regen hatte aufgehört, und nach Westen hin klarte der Himmel auf.
»Herrgott im Himmel«, fluchte er und ließ sich schwer in den Sitz fallen. »Von wegen kurz reinschauen und weiterfahren. Ich dachte, ich komme da nie mehr raus. Ich hätte Sie zuerst zu Ihrem Hotel fahren lassen sollen.« Das Ocean Cove war nur drei Minuten zu Fuß entfernt.
»Kein Problem. Was haben sie gesagt?«
»Nachdem ich ihnen ausführlich berichtet hatte, wie wir den Unterkiefer gefunden haben, verstrickten wir uns in eine Diskussion darüber. Ich wies auf den offensichtlichen Umstand hin, dass er jüngeren Datums sein musste. Nicht unbedingt aus unseren Tagen, aber auch nicht aus antiken Zeiten.«
»Und?«
»Der diensthabende Beamte meinte, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine ertrunkene Person handelt. Ihre Leichen werden vom Fluss mitgenommen und dann in der Mündung ans Ufer gespült, weil die Gezeiten hier wirken. Er rief den Sergeant dazu, und irgendwie sind wir dann bei einem Gespräch über die Kriminalität in Limerick gelandet. Jedenfalls sagte Sergeant Hynes am Ende, er würde mit seinen Kollegen von der Kripo in Ennis reden. Als ich ging, diskutierten sie darüber, ob sie den Kiefer in Kilkee behalten sollten, für den Fall, dass der amtliche Gerichtsmediziner hinzugerufen wird.«
»Was sie brauchen, ist ein forensischer Archäologe, der sich den Fundort ansieht.«
»Menschliche Überreste ‒ ich hasse es, wenn ich mich mit ihnen beschäftigen muss«, sagte Mahon angewidert.
Sein Umgang mit dem Kieferknochen widersprach dieser Aussage irgendwie. »Das ist auch ein Grund, warum mir das Meer so gefällt«, fuhr er fort. »Fische essen Fleisch. Salzwasser löst Knochen auf. Keine unappetitlichen Überreste.«
Er überging praktischerweise die früheren Stadien einer Leiche im Wasser, aber ich sagte nichts dazu.
»Hm … Vielleicht war dieser Kieferknochen noch intakt, weil er ans Ufer gespült wurde«, fuhr er fort. »Der Polizist könnte recht damit haben, dass es sich um eine ertrunkene Person handelt. Sehen wir uns doch mal die Fotos an, die Sie gemacht haben.« Er rieb die Windschutzscheibe frei, die beschlagen hatte, seit er im Wagen saß. »Sieht aus, als würde es aufklaren. Und die Vorhersage für morgen ist gut. Wir werden tauchen.«
Ich nahm die Kamera aus meiner Tasche und gab sie ihm.
»Die Polizei bittet darum, dass Sie ihr diese Aufnahmen zukommen lassen«, sagte er. »Einmal an die Jungs hier und einmal an einen Detective, der in Ennis sitzt.« Er gab mir einen Zettel mit den handschriftlichen E-Mail-Adressen.
Er klickte sich durch die Bilder und war peinlich berührt, als er zu dem kam, auf dem er den Unterkiefer vors Gesicht hielt. »Ach du Schreck«, sagte er. »Vielleicht lassen wir das hier weg.«
Er ging die Fotos rückwärts durch, bis er eines gefunden hatte, das er genauer untersuchen wollte. »Wir haben uns vielleicht zu sehr auf die Idee versteift, dass es sich um eine vorsätzliche Zerstückelung handelt. Doch wenn das tatsächlich eine ertrunkene Person war, dann könnte die Beschädigung am Knochen auch von Aasfressern im Wasser verursacht worden sein …« Er gab mir die Kamera zurück. »Denken Sie darüber nach.«
Ich betrachtete das Bild, das er ausgewählt hatte. »Ich weiß, was Sie meinen. Die allgemeine Regel in der Archäologie lautet allerdings, wenn der Schnitt nahe dem Gelenk ist, stammt er wahrscheinlich von Menschenhand.«
Mahon zeigte auf den gestutzten Unterkieferast. »Ein Hai oder ein Meeraal könnte ein Stück Knochen so sauber abtrennen. Ich habe gesehen, was …«
»Ich auch«, sagte ich. »Ich fahre besser zum Hotel zurück.«
Kapitel 3
Als Kim und ich am Tag zuvor im Long Dock ankamen, bestellten wir Weißwein, und nachdem sich unsere Augen an das Licht im Raum gewöhnt hatten, betrachteten wir den Boden aus Steinfliesen, die Drucke mit Meeresmotiven an den Wänden und ein Torffeuer, das in einem gemauerten Kamin brannte.
Auf unserem Spaziergang zum Pub war das Thema eines lokalen Bauvorhabens zur Sprache gekommen, und Kim erklärte, sie sei in einem Bürgerkomitee aktiv, das sich gegen den Vorschlag wandte, einen ausgedehnten Windpark zu errichten. Ihr Standpunkt war der, dass Windräder mit ihrer Höhe nicht in das flache Gelände der Halbinsel mit seinen freien Blicken passten. Während des Gesprächs erwähnte sie verschiedene Auseinandersetzungen, die sie im Lauf der Jahre gewonnen und verloren hatten. Die Niederlage, die sie am meisten wurmte, war ein Ferienhaus-Projekt, das fünf Jahre zuvor in Kilkee realisiert worden war.
»Es liegt oben, am George’s Head, hinter dem Golfclub«, erklärte sie, nachdem wir uns an einem Tisch am Fenster niedergelassen hatten.
»Ich habe gesehen, wie viel in der Stadt gebaut wird«, sagte ich. »Aber ich habe weiter draußen in Richtung Landspitze nichts Neues außer dem Clubhaus bemerkt.«
»Genau das war das Argument der HFH. Dass man die Ferienhäuser nicht sehen würde.«
»HFH?«
»Head for Heights. Der Name der Bauträgerfirma, aber auch eine Art Slogan für das Projekt. Sie behaupteten, als kleine, exklusive Anlage, die in einer Senke in den Hügeln versteckt liegt, würde das Ganze nicht stören. Aber natürlich sieht man es, wenn man zur Landspitze hinaufgeht. Naturschützer haben für uns argumentiert, auch wenn es sich so einfüge, dass man buchstäblich darüber stolpere, würde es die Landschaft doch für alle Zeiten verändern ‒ mit der unberührten Natur hier oben wäre es vorbei. Dann haben wir die Unterstützung von Archäologen für unsere Sache bekommen ‒ eine vorläufige Erkundung hatte ergeben, dass eine frühmittelalterliche Klostereinfriedung unter der Erde existierte. Die noch nirgendwo verzeichnet war. Damit war die Sache aus unserer Sicht erledigt. Eine Erhaltung war zwingend vorgeschrieben. Aber wir hatten nicht mit der Skrupellosigkeit der Projektentwickler gerechnet. Die Reste wurden über Nacht vernichtet ‒ vorsätzlich.«
»Wie bitte? Das ist ja unglaublich.«
»Mit Bulldozern vom Angesicht der Erde getilgt … Natürlich war den Bauträgern nichts nachzuweisen. Man schob es auf Vandalismus. Und was mich wirklich wütend machte dabei, war, dass ich es hätte verhindern können.«
Die Kellnerin kam mit unserem Wein. Ich gab ihr einen Zwanzig-Euro-Schein, und auf dem Rückweg zur Theke hielt sie inne und sah aus einem der Fenster.
Ich blickte ebenfalls hinaus und entdeckte einen schwarzen Jeep Cherokee auf der anderen Straßenseite stehen. Er zog einen Bootsanhänger mit einem rotblauen Festrumpfschlauchboot, kurz RIB genannt, von Rigid Inflatable Boat. Ein weißhaariger Mann stieg aus dem Jeep, und ich wusste, dass ich ihn schon einmal gesehen hatte. Ein jüngerer Mann in einem roten T-Shirt und schwarzen Jeans schloss sich ihm an, und sie kamen ins Pub. Der Jüngere verabschiedete sich sofort in Richtung Toilette, während der Ältere an der Bar stehen blieb. Die Kellnerin war mit meinem Wechselgeld zurückgekommen und grüßte ihn von unserem Tisch aus. Als er sich zu uns drehte, um den Gruß zu erwidern, dämmerte mir, wer er war ‒ Theo Mahon. Wir hatten uns im Jahr zuvor getroffen, als ich an einem Seminar über die Archäologie und Schifffahrtsgeschichte des Flusses Boyne teilnahm. Die Kellnerin ging wieder hinter die Theke und plauderte mit ihm, während sie zwei Gläser Stout zapfte. Mahon sah ein paar Mal zu mir herüber, und als er sein Pint bekommen hatte, kam er an unseren Tisch.
»Kennen wir uns?«, sagte er.
»Sie haben letztes Jahr um diese Zeit einen Vortrag auf einem Seminar in Drogheda gehalten. Wir haben uns nachher ein wenig unterhalten. Ich bin Illaun Bowe.«
»Ach ja. Aus Castleboyne, richtig?«
Ich nickte. »Das ist eine Freundin von mir. Kim Tyrell.«
»Theo Mahon. Freut mich, Sie kennenzulernen.«
Sie schüttelten sich die Hand.
Der andere Mann kam ins Lokal zurück, und Theo winkte ihn zu uns. »Dürfen wir Ihnen Gesellschaft leisten?«
Mahons Begleiter holte sein Bier ab, und die beiden nahmen auf den Stühlen gegenüber unserer Bank Platz.
»Das ist Senan Costello aus Kilkee«, stellte Mahon vor. »Er begleitet uns auf diesem Abschnitt unserer Tour. Ortskenntnisse sind unschätzbar.« Er schlug seinem Begleiter auf den Rücken. »Und auf unseren Senan hier kann man sich meist verlassen. Jedenfalls solange er nicht bekifft ist.«
Costello grinste schüchtern. Er hatte schwarzes, strubbliges Haar und einen dichten, kurzen Bart. Seine Zähne waren wie weit auseinandergesetzte Scrabble-Plättchen.
»Was genau machen Sie?«, fragte Kim.
»Wir bereiten einen Bericht über den Zustand der Schiffswracks an der Küste von Clare vor«, sagte Mahon. »Er beruht auf einer Erkundung des Meeresbodens, die vor ein paar Jahren durchgeführt wurde. Wir tauchen zu jedem Wrack hinab, das dabei entdeckt wurde, damit wir seinen Zustand aus nächster Nähe einschätzen können.«
Kim sah mich an, ob ich eine Frage stellen wollte. Als ich es nicht tat, stellte sie selbst eine. »Holen Sie auch Funde nach oben?«
Mahon schüttelte den Kopf. »Nein. Wenn man Artefakte vom Meeresgrund entfernt, stellen sich alle möglichen Probleme ein. Holz zerfällt, wenn es austrocknet. Eisen beginnt sich sofort aufzulösen, wenn es an die Luft kommt.«
»Was eine Konservierung schwierig macht«, sagte ich.
»Illaun hat recht«, sagte Mahon. »Es kann zum Beispiel zehn Jahre dauern, eine einzige Kanone zu konservieren.«
»Jedenfalls sind wir mit der Shannon-Mündung heute fertig geworden«, sagte Costello. »Vierzig Wracks allein von hier bis zum Loop Head, stellen Sie sich das vor.«
»Wo geht es danach hin?«, fragte ich.
»Wir arbeiten uns im Uhrzeigersinn um die Küste«, sagte Mahon. »Morgen ist also die Atlantikseite der Halbinsel dran. Und da wir in Kilkee wohnen, fangen wir in dieser Gegend an.«
»Die Vorhersage ist allerdings nicht sehr gut«, sagte Costello mit düsterer Miene.
»Ist in der Bucht von Kilkee nicht ein Schiff mit Hungerflüchtlingen gesunken?«, fragte Kim.
Mahon nickte. »Die Edmond. Es wurde komplett zerstört.«
»Und hundert Leute sind ertrunken«, ergänzte Costello.
»Was ist mit der Intrinsic?«, sagte ich. »Ist von der noch etwas übrig?« Ich wusste, dass die Intrinsic Bay nördlich der Stadt ihren Namen von einem Schiff hatte, das dort auf Grund gelaufen war.
»Genau zu der wollen wir morgen hinuntertauchen«, sagte Mahon. »Das Schiff ist 1836 gesunken. Aber viel wird nicht zu sehen sein. Teile davon waren von hier bis Spanish Point über die ganze Küste verstreut. Und der größte Teil der Fracht wurde kurz nach dem Untergang geborgen. Durch Taucher, man stelle sich vor. Was aus historischer Sicht interessant ist.«
»Taucher? Schon damals?« Kim war verständlicherweise überrascht.
»Die Brüder Dean aus London«, sagte Mahon. »Das sind dieselben Burschen, die auch die Mary Rose im Solent vor Southampton gefunden haben.«
»Das Kriegsschiff Heinrichs VIII.«, warf ich ein.
»Das war ebenfalls 1836«, fuhr Mahon fort. »Sie hatten gerade erst einen Tauchhelm entwickelt, in den Luft gepumpt wurde, während der Taucher in einem Gummianzug und mit schweren Stiefeln und Bleigewichten angetan über den Meeresboden spazierte. Während des Sommers gelang es ihrer Bergungsfirma, den größten Teil der Fracht aus der Intrinsic heraufzuholen. Hauptsächlich Kupfer- und Zinnbarren sowie Zugräder, Eisenbahnschienen und andere Eisengüter.«
»Bis ein Taucher namens Manuel di Lucia aus Kilkee 1979 einen Anker barg, wurde sonst nichts mehr an die Oberfläche gebracht«, sagte Costello. »Aber er hat mir erzählt, dass es noch einen zweiten Anker und anderes versunkenes Gut da unten gibt. Und bei einem Sidescan-Sonar ist außerdem ein merkwürdiges Gebilde sichtbar geworden, das aus einer Rinne ragt. Wie ein Abschnitt vom Brustkasten eines Wals, nur viel größer.«
»Die Spanten eines Schiffsrumpfs vielleicht?«, vermutete ich.
Mahon schüttelte den Kopf. »Nein. Ich tippe auf Eisenbahnschienen. Konkretion kann Dinge verzerrt aussehen lassen.«
Kim blinzelte mich an. »Konkretion?«
»Metallgegenstände werden unter Wasser mit organischen und anderen Stoffen überzogen«, erklärte ich.
»Wir werden festzustellen versuchen, was es ist«, sagte Mahon. »Wahrscheinlich liegt noch mehr solcher Schutt in Spalten und Rinnen herum, aber wir werden nicht alles aufzeichnen können.«
»Falls wir überhaupt zum Tauchen kommen.« Costello wirkte wieder niedergeschlagen.
»Das Gebiet um die Klippen ist selbst unter günstigen Bedingungen gefährlich«, sagte Mahon. »Man kann dort nur bei gutem Wetter tauchen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen.« Er stand auf und ging in Richtung der Toiletten.
»Sie werden sehr enttäuscht sein, wenn es nicht dazu kommt?«, sagte ich zu Costello.
Er trank einen Schluck von seinem Bier. »Ja, aber die Gründe, warum ich da hinunter will, unterscheiden sich von Theos. Als ich ein Kind war, hat mir mein Großonkel Derry nämlich die Geschichte vom Wrack der Intrinsic erzählt. Und die hat mich nie mehr losgelassen.«
Hieß das, Senans Großonkel war Derry Costello? Wenn ja, dann war mir klar, wieso der junge Mann so viel über die lokale Geschichte wusste.
»Und was ist so besonders am Wrack der Intrinsic?«, fragte Kim.
»Wissen Sie was …« Senan stand auf und ging zur Wand am Ende der Theke. Er ließ den Blick über die Dinge schweifen, die dort hingen, dann nahm er eins von der Wand und brachte es an den Tisch zurück. »Ich muss rasch telefonieren. Lesen Sie sich das durch.« Er legte einen gerahmten Zeitungsausschnitt auf den Tisch zwischen Kim und mich. »Ich komme gleich wieder«, sagte er und ging auf die Straße hinaus.
Kapitel 4
CLARE JOURNAL
TRAURIGES SCHIFFSUNGLÜCK
Die Intrinsic aus Liverpool, ein mit fünfhundert Tonnen Fracht beladenes Segelschiff mit Ziel New Orleans, wurde am letzten Januartag als auf See verloren gemeldet. Man nimmt an, dass das Schiff die Nordspitze Irlands umrundet hatte, als es in einen unbarmherzigen Nordweststurm geriet, der sie die gefährliche Atlantikküste hinuntertrieb. Am 31. Januar wurde sie bei Tagesanbruch von der Küstenwache vom Lookout Cliff bei Kilkee gesichtet. Das Segelschiff ritt von zwei Ankern gehalten in der Bucht unter ihr, die Trosse waren zum Zerreißen gespannt und bewahrten es nur mit Mühe davor, von Wellen, welche die halbe Höhe der Klippen erreichten, gegen die Felsen geschleudert zu werden.
Bis Mittag hatte sich eine große Menge auf den Höhen über der Bucht versammelt. Die Menschen konnten nichts tun, als für die vierzehn Seelen an Bord des Schiffs zu beten, das inzwischen ohne Masten war und einzig von seinen Ankern abhing, während es von gewaltigen Wellen, die vielfach über es hinweggingen, vor- und zurückgeworfen wurde. Zuletzt wurde die Belastung zu groß, die Trosse rissen, und das Schiff wurde von der Wut des Sturms unter die Klippen getrieben. In diesem Moment sahen die Zuschauer einige Besatzungsmitglieder sowie ein junges Paar an Deck kommen. Doch als sie erkannten, wie hoffnungslos alles war, machten sie sich wieder auf den Weg nach unten, um dort ihr Schicksal zu erwarten. Dabei wurde der Ehemann von einer Welle über Bord gespült. Seine Frau, die ein lavendelblaues Kleid getragen haben soll, fiel sofort betend auf die Knie. Augenblicke später wurde der Gatte von der Dünung an die Schiffswand zurückgetragen. Die Frau warf sich darauf neben ihn ins Meer, und zusammen versanken sie in den Wellen. Eine große Woge, die von den Klippen zurücklief, trug das Schiff wieder vom Land fort, eine weitere hereinkommende Welle brachte es zum Kentern, die Ladung brach durch den Rumpf, und die Intrinsic ging unter.
An diesem Punkt legte Kim den Finger auf die Seite. Wir hörten beide auf zu lesen und sahen einander an. »Was hatte ein solches Paar auf einem Frachtschiff verloren?«, sprach Kim meine Gedanken aus.
»Ich glaube, das kann ich beantworten.« Costello war zurückgekommen und hatte sie gehört. »Anscheinend waren sie frisch verheiratet und reisten nach New Orleans, um ein neues Leben zu beginnen. Vielleicht hatten sie Verbindungen zum Kapitän oder zu den Eignern des Schiffs.« Er setzte sich wieder zu uns, trank einen letzten Schluck von seinem Guinness und rülpste dann laut. »Herrje, tut mir leid. Das hat mich jetzt überrascht.« Er lächelte verlegen und zeigte seine großen Zähne. Plötzlich schnellte sein Kopf nach vorn.
»Und das bestimmt auch.« Mahon war zurückgekommen und hatte ihm einen Schlag auf den Hinterkopf gegeben, aber nicht allzu stark. »Führst du deine Manieren vor, ja? Man kann dich nicht einen Moment allein lassen.«
»Ich habe ihnen gerade von der Intrinsic erzählt«, sagte Costello und zog den Kopf ein für den Fall, dass ein weiterer Schlag kam. Es wirkte aber wie ein Spiel zwischen ihnen.
Mahon blieb stehen und legte die Hand aufs Herz. »Im Tode vereint«, intonierte er.
Kim seufzte leise. »Trotzdem, was für eine Tragödie. Und wenn die Frau hineinsprang, um bei ihrem Liebsten zu sein, war es kein Selbstmord, oder?«
Costello schnippte begeistert mit den Fingern. »Da liegen Sie völlig richtig, Kim. Mein Großonkel hat mir erzählt, dass die Leute deshalb in der Intrinsic Bay von den Klippen springen. Weil sich der Glaube verbreitet hat, wenn man es dort tue, sei es kein Selbstmord, und man komme nicht in die Hölle dafür.«
Kim warf mir einen scharfen Blick zu, ehe sie das Gespräch fortsetzte. »Haben das in letzter Zeit viele Leute getan?«
»Zwei oder drei, während ich aufgewachsen bin. Und dann gab es einen Fall erst vor ein paar Jahren.«
»Lena Morrison?«, sagte Kim.
»Richtig. Sie kannten sie?«
»Ihre Leiche wurde nie gefunden«, gab Kim zur Antwort. Sie war offenbar skeptisch, was die Selbstmordtheorie betraf. Ich nahm an, Lena Morrison war dieselbe Frau, auf die sie zuvor schon angespielt hatte.
»Die Intrinsic Bay, das ist ein seltsamer Ort«, warf Mahon ein. »Es heißt, die Leichen derer, die dort ertrinken, tauchen nie wieder auf.« Er beugte sich über den Tisch und hob den gerahmten Zeitungsausschnitt auf.
Costello nickte. »Sehr vieles, was mit der Intrinsic zu tun hat, ist rätselhaft. Was die Leute damals zum Beispiel nicht verstehen konnten, war, wieso der Kapitän den Sturm nicht auf hoher See ausgesessen hat, anstatt an die Küste zu kommen.«
»Das ist gar nicht so rätselhaft«, sagte Mahon. »Er hat vermutlich in der Shannon-Mündung Schutz für die Nacht gesucht und ist zu weit nördlich eingebogen. Man kann sich vorstellen, wie die Sicht bei dem Sturm war.« Er überflog den Artikel.
Mir lag eine Frage auf der Zunge, aber sie nahm nicht recht Gestalt an.
Mahon klopfte auf das Schutzglas über dem Artikel. »Haben Sie den letzten Absatz gelesen?«
»Nein, so weit waren wir noch nicht gekommen«, erwiderte ich.
»Vielleicht hat das zu der Legende geführt, die ich gerade erwähnt habe.« Er gab mir den Rahmen und hielt den Finger auf die Stelle, wo ich anfangen sollte.
Ich las laut vor. »Die ersten Taucher, die in einen Teil der Kabine vordrangen, der auf dem Meeresgrund lag, fanden die Besatzung der Intrinsic im Tod zusammengedrängt vor. Fische und riesige Aale schwärmten darüber und taten sich an ihnen gütlich …« Ich hielt inne. Etwas, das ich verdrängen wollte, hatte einen Weg an meiner Abwehr vorbei gefunden.
»Igitt.« Kim verzog das Gesicht.
Ich holte tief Luft und fuhr fort. »Es war ein derart grausiger Anblick, dass sich die Männer weigerten, noch einmal hinunterzugehen, bis Mr. Dean selbst hinabtauchte, um es sich anzusehen. Aber als er wieder nach oben kam, versicherte er ihnen, sie müssten sich getäuscht haben. Und tatsächlich wurden in der Folge weder Leichen gefunden, noch wurden jemals welche an Land gespült.«
»Wie merkwürdig«, sagte Kim.
»Möchte noch jemand etwas trinken?«, fragte Costello.
»Wir sollten lieber gehen, Kim, oder?« Sie hielt mich hoffentlich nicht für unhöflich, aber ich wollte weg.
»Ja, du hast recht. Es ist ein ganzes Stück bis nach Hause.«
»Wo wohnen Sie?«, fragte Mahon.
Sie beschrieb, wo ihr Cottage lag, und erklärte, ich hätte meinen Wagen dort gelassen.
»Ich muss Senan sowieso in Kilkee absetzen, wenn Sie wollen, fahre ich Sie nach Hause.«
Wir dankten ihm, und als wir aufbrachen, fragte mich Mahon, wo ich wohnte. Dann erwähnte er den freiliegenden Muschelhaufen, der mich interessieren könnte, und fügte an, falls das Wetter zum Tauchen zu schlecht sei, würde er mich am nächsten Morgen im Hotel abholen, und wir könnten ihn uns zusammen ansehen.
Ich murmelte eine höfliche, wenngleich vage Erwiderung, aber sie reichte offenbar, um ihn annehmen zu lassen, ich sei interessiert. Aber es war nicht der Muschelhaufen, der mich an diesem Abend auf der Rückfahrt zum Hotel beschäftigte.
Kapitel 5
Fünfzehn Jahre zuvor war ich vor der Isle of Man zum Wrack des Küstenfrachters Arabella getaucht. Wie die Intrinsic war die Arabella von Liverpool gekommen, als sie sank. Aber damit endete die Ähnlichkeit auch schon. Die Arabella war mit einer Fracht Souvenirkeramik anlässlich der Krönung von Königin Elizabeth II. auf dem Weg nach Belfast. Es war das Jahr 1953, und das Schiff war gesunken, nachdem es im Nebel mit einem anderen Handelsschiff zusammengestoßen war. Das Wasser drang in den Bugabschnitt, der Frachter sank mit der Nase voran, und als es sich in den sandigen Meeresgrund bohrte, brach der beschädigte Bug ganz ab. Die Ladung ergoss sich auf den Meeresboden, während das Schiff sich auf die Backbordseite legte. Bald brachen der Steuerbordrumpf und die Decks dazwischen ein und rutschten nach vorn, sodass die gesamten Deckaufbauten wie ein Pappkarton in dieselbe Richtung gefaltet wurden.
Da es keine starken Strömungen gab und die Arabella in leicht zugänglichen dreißig Metern Tiefe lag, wurde sie schließlich dazu benutzt, angehende Unterwasserarchäologen im Wracktauchen auszubilden.
Ich meldete mich nach meinem Diplom zu dem Kurs an. Brian Pender war mein Tauchlehrer, und es war unser letzter Tauchtag, als er verschwand.
Sechs Taucher waren bereits paarweise entlang einer am Wrack verankerten Leine nach unten gestiegen, waren in den Bug vorgedrungen und wohlbehalten zum Boot zurückgekehrt. In unserem Kurs wurde häufig Luft durch Schläuche von der Oberfläche geatmet, aber innerhalb des Wracks tauchten wir mit Flaschen. Brian und ich stiegen als Letzte hinab. Während ich über dem Rumpf entlangschwamm, blieb er direkt hinter mir ‒ die angemessene Position für einen Tauchlehrer. Er war jünger als ich, aber ich hatte ihn in den vergangenen Tagen als Profi durch und durch erlebt und hätte ihm mein Leben anvertraut. Ich brauchte das Gefühl, ihm so trauen zu können, denn ich war eine ängstliche Taucherin.
Ich ließ meinen Lampenstrahl über das Wrack wandern und staunte einmal mehr, wie das Meer die widerspenstigsten Materialien verändert. Auch wenn keine Tropffiguren aus Rost wie bei der Titanic von dem Schiff hingen, wurde es in etwas völlig anderes verwandelt und diente einem neuen Zweck. Organisches Material bedeckte es wie Raureif. Die Rumpfplatten waren von Entenmuscheln und Hunderten weißer Seesterne besetzt. Gelbe und rosa Anemonen umgaben die Bullaugen, eine stachlige Spinnenkrabbe bahnte sich einen Weg über Klumpen orangefarbener Schwämme, die eine Leiter einhüllten, eine Hecke aus leicht schwankenden Venusfächern besiedelte den Kiel auf ganzer Länge. Und die ganze Zeit sausten Fische in und aus Löchern und Spalten in dem künstlichen Riff.
Meine Betrachtung wurde unterbrochen, weil Brian auf meine Flasche klopfte ‒ man lässt sich unter Wasser leicht ablenken. Aber er wollte mich nicht ermahnen, sondern mir zeigen, was er im Strahl seiner Tauchlampe entdeckt hatte: einen riesigen Meeraal, der aus dem geräumigen Maul des offen liegenden Bugs der Arabella genau vor uns glitt.
Er stieg wie eine Rauchfahne auf, dann verschwand er in das dunklere Wasser hinter dem Wrack. Brian fing meinen Blick auf und zeigte mir den erhobenen Daumen. Ich verstand es so, dass wir jetzt zum Bug hinuntertauchen würden. Ich richtete meine Lampe nach unten, um zu sehen, wo wir in den Bug eintauchen würden, und erschrak, als ich einen Vorhang aus Seegras um die Öffnung sah. Ich mochte seine ledrige Umarmung nicht und dachte nicht gern daran, was sich in den wogenden Wedeln verbergen könnte. In dieser Tiefe hatte ich mit keinem gerechnet. Ich würde all meinen Mut zusammennehmen müssen. Angst ist in dieser Tiefe lebensgefährlich.
Ich sah zu Brian hinüber und wartete darauf, dass er die Führung übernahm, aber er achtete nicht auf mich, sondern blickte in die Richtung, die der Meeraal eingeschlagen hatte. Er drehte sich zu mir und machte mir ein Zeichen, zu warten. Dann paddelte er kräftig mit den Schwimmflossen und war nach wenigen Sekunden hinter dem Bug verschwunden.
Ich war verwirrt. Brian hätte nicht einfach so davonschwimmen dürfen. Es passte auch gar nicht zu ihm. War es ein Test für mich? Ich sah auf meine Uhr. Theoretisch lautet die Regel: Eine Minute warten, dann an die Oberfläche zurückkehren und den Taucher als vermisst melden. Ich schwamm langsam einen vollständigen Kreis und hielt nach oben, unten und allen Seiten nach einem Anzeichen von Brian oder seinen Luftblasen Ausschau. Ich war eine einigermaßen erfahrene Sporttaucherin ‒ jedenfalls erfahren genug, um zu wissen, dass das Partnersystem nicht allzu verlässlich ist. Manche Taucher schwammen ihren Partnern vielleicht hinterher, andere trödelten einfach herum, bis sie zurückkamen. Aber ich wusste auch, dass es besser war, auf der sicheren Seite zu bleiben, selbst wenn ich mich dafür von Brian oder den anderen Kursteilnehmern im Boot verspotten lassen musste. Eine Minute später begann ich mit dem Aufstieg. Aber Brian kam nicht nach oben. Und obwohl eine Woche lang intensiv nach ihm gesucht wurde, fand man seine Leiche nicht.
Die Kursteilnehmer und Tauchlehrer kehrten für den Rest des Kurses nach Schottland zurück, aber ich blieb. Brians Eltern waren angereist, und ich versprach ihnen, noch nicht aufzugeben ‒ in meine Entschlossenheit, das Rätsel seines Verschwindens zu lösen, mischten sich Schuldgefühle, weil ich ihn allein zurückgelassen hatte. Ich stellte ein Freiwilligenteam aus ortsansässigen Tauchern zusammen, und wir setzten die Suche fort.
Brian war neun Tage lang im Wasser gewesen, als ich ihn fand. Er trieb mit dem Kopf nach unten zwanzig Meter unter der Wasseroberfläche. Nur der in schwarzes Neopren gekleidete Oberkörper ragte aus den Schlingen eines weggeworfenen Fischernetzes. Es hatte einen mächtigen Knoten auf seinem Rücken gebildet, und von dort breitete es sich wie ein riesiger Umhang in die Dunkelheit unter ihm aus. Er schien es aus der Tiefe heraufzuziehen, als wäre es eine Art Herkulesaufgabe, die er erfüllen musste.
Sein Körper war in Sichtweite des Wracks den halben Weg bis zur Oberfläche hinaufgetrieben. Wie hatten wir ihn an jenem Tag übersehen können? Wie hatten ihn die Suchteams übersehen können, die das Gebiet eine Woche lang durchforstet hatten?
Ich vermutete, dass er sofort seine Tauchausrüstung abgeworfen hatte, als er sich in dem Trawlernetz verfing, aber als er sich befreien wollte, hatte sich das Netz um ihn gewickelt und verhindert, dass er aufstieg. Während ich sorgsam darauf achtete, dass ich mich nicht selbst verhakte, näherte ich mich ihm von vorn und sah, dass seine Maske fehlte. Ich rechnete damit, dass sich sein hübsches Gesicht in eine groteske Fratze verwandelt hatte, aufgebläht durch den Verwesungsprozess. Deshalb schloss ich meine Augen für einen Moment, ehe ich sie wieder öffnete und die Taschenlampe einschaltete. Und genau in diesem Moment hob Brian den Kopf.
Ich fuhr mit einem Ruck zurück, während ein Meeraal unter seiner Brust hervorglitt, wo er Schutz gesucht hatte. Seine Flucht hatte die Kopfbewegung verursacht. Und jetzt folgte der nächste Schock. Brians Kapuze bedeckte noch immer seinen Kopf, sodass der fleischlose Schädel an eine mittelalterliche Darstellung des Todes erinnerte. Doch die Knochen waren noch nicht gänzlich abgenagt. Eine kleine Flotte winziger Fische schwärmte noch um sein Gesicht herum ‒ die Unterwasserentsprechung eines Fliegenschwarms.
Ich dachte, ich hätte das Schlimmste gesehen, was das Meer anrichten konnte, aber erst, als wir Brians Leiche an Land gebracht und aus dem Netz gewickelt hatten, entdeckten wir, dass seine gesamte untere Hälfte fehlte. Und auch im Rest seines Tauchanzugs war nicht mehr viel übrig. Am Ende konnten Brians Eltern dank meiner Entschlossenheit, ihn zu finden, nicht viel mehr als einen Schädel in den Sarg legen, und mich hielt es für alle Zeiten vom Tauchen ab.
Kapitel 6
Als mich Mahon bei meinem Hotel absetzte, ging ich direkt in den Speisesaal und bestellte ein frühes Abendmahl ‒ seit einem aus Tee und Toast bestehenden Frühstück hatte ich nichts mehr gegessen. Bei einem Blick auf die Bucht sah ich, dass der Wind nachgelassen hatte und heller, wolkenloser Himmel die einsetzende Dämmerung verzögerte.
Danach ging ich auf mein Zimmer, duschte und wickelte mich in meinen Bademantel, entschlossen, mich früh mit einem Buch ins Bett zurückzuziehen. Aber erst holte ich meinen Laptop aus dem obersten Schrankfach. Es war mehr als vierundzwanzig Stunden her, seit Kim und ich im Long Dock mit Theo Mahon und Senan Costello geredet hatten. Während ich die Kamera mit dem Notebook verband, beschloss ich, sie anzurufen, um zu hören, wie sie mit dem Briefbeschwerer vorankam, den ich in Auftrag gegeben hatte, und um ihr von dem grausigen Fund in dem Muschelhaufen zu erzählen. Ich geriet an ihren Anrufbeantworter und hinterließ eine Nachricht. Ich nahm an, sie arbeitete ‒ sie hatte mir erzählt, dass es im Atelier keinen Telefonanschluss gab, da es sie nur stören würde und jede plötzliche Bewegung, wenn sie ihre fragilen Glasgebilde zusammensetzte, die Arbeit von Stunden vernichten konnte.
Nachdem ich die Bilder auf den Computer überspielt hatte, wählte ich die besten aus, um sie der Polizei zu schicken, dann öffnete ich mein Postfach und tippte die Adressen ein, die mir Mahon gegeben hatte. Bei einer tauchte der Name hynes auf ‒ offenbar der Sergeant in Kilkee. Der andere war ivor.nolan, der Detective in Ennis, der Hauptstadt der Grafschaft. Ich verfasste ein kurzes Anschreiben und wartete dann, bis ich das beruhigende Rauschen hörte, mit dem die Mail samt Anhang in den Cyberspace abhob. Ich hatte bereits bemerkt, dass neue E-Mails eingetroffen waren, und ging sie rasch durch, entschlossen, keine zu öffnen, die etwas mit meiner Arbeit zu tun hatten. Aber neugierig war ich doch.
Es gab nur eine, die ich lesen wollte. Sie war von Peter Groot.