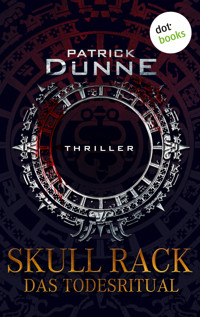
4,99 €
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Tod lauert in der Tiefe … Der abgründige Thriller »Skull Rack – Das Todesritual« von Patrick Dunne jetzt als eBook bei dotbooks. Ein Maya-Tempel in Yucatan, Mexiko: Einem weltweiten Fernsehpublikum stockt der Atem, als ein bekannter TV-Moderator während einer Live-Übertragung aus den Schatten heraus enthauptet wird! Kurze Zeit später trifft die Tauchexpertin Jessica Madison am Tatort ein; sie soll den Kopf des Toten bergen, der wie bei einem bizarren Ritual in eine der zahlreichen Unterwassergrotten des Tempels geworfen wurde. Doch nur wenige Tage nach dem Tauchgang stirbt eines ihrer Teammitglieder an einer unbekannten Krankheit: Kann es sein, dass tief unten in der Dunkelheit eine alte Seuche lauert? Weder die Polizei noch die Behörden wollen Jessica glauben – und ihr wird schnell klar: Sie ist die Einzige, die die Welt jetzt noch retten kann ... Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der actionreiche Thriller »Skull Rack – Das Todesritual« von Patrick Dunne wird die Fans des Bestseller-Duos Preston & Child begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein Maya-Tempel in Yucatan, Mexiko: Einem weltweiten Fernsehpublikum stockt der Atem, als ein bekannter TV-Moderator während einer Live-Übertragung aus den Schatten heraus enthauptet wird! Kurze Zeit später trifft die Tauchexpertin Jessica Madison am Tatort ein; sie soll den Kopf des Toten bergen, der wie bei einem bizarren Ritual in eine der zahlreichen Unterwassergrotten des Tempels geworfen wurde. Doch nur wenige Tage nach dem Tauchgang stirbt eines ihrer Teammitglieder an einer unbekannten Krankheit: Kann es sein, dass tief unten in der Dunkelheit eine alte Seuche lauert? Weder die Polizei noch die Behörden wollen Jessica glauben – und ihr wird schnell klar: Sie ist die Einzige, die die Welt jetzt noch retten kann ...
Über den Autor:
Patrick Dunne wurde in Dublin geboren und studierte Literatur und Philosophie. Nach dem Studium war er eine Zeitlang Musiker. Inzwischen ist er seit über 20 Jahren als Regisseur und Produzent beim irischen Rundfunk und Fernsehen tätig. Mit seinem Debütroman »Die Keltennadel« gelang ihm ein internationaler Bestseller. Patrick Dunne gehört heute zu den erfolgreichsten Autoren Irlands.
Von Patrick Dunne erscheint bei dotbooks außerdem:
»Die Keltennadel«
***
eBook-Neuausgabe September 2022
Die deutsche Erstausgabe erschien 2002 unter dem Titel »Das Maya-Ritual« im Limes Verlag.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2001 by Patrick Dunne
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2002 by Limes Verlag GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2022 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Stefan Hilden, HildenDesign.de, © HildenDesign unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock.com
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (mm)
ISBN 978-3-98690-108-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Skull Rack – Das Todesritual« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Patrick Dunne
Skull Rack – Das Todesritual
Thriller
Aus dem Englischen von Fred Kinzel
dotbooks.
»Die alten Kulturen Mittelamerikas gründeten auf der Angst, dass ihnen ihre beiden kostbarsten Rohstoffe ausgehen könnten – Blut und Wasser.«
Rafael de Valdivia, Krankheit und der Verfall der postklassischen Mayazivilisation
Kapitel 1
Nick Goldberg lächelte, als sie ihm den Kopf abschlugen.
Sekunden bevor es geschieht, sieht man ihn im gleißenden Flutlicht auf der Spitze der Stufenpyramide. Er steht in weißem Hemd und Shorts vor dem Tempel und spricht in ein winziges Funkmikrofon seitlich von seinem Mund.
Der Kameramann witzelt irgendetwas in Goldbergs Kopfhörer und zoomt dann nahe an das Gesicht des Mannes heran, um seine Reaktion zu beobachten. Goldberg grinst von einem Ohr zum anderen.
Die Farben der Scheinwerfer wechseln. Die Pyramide erstrahlt nun blutrot, als würde sie von innen beleuchtet.
Die Kamera fährt zurück und gibt einen umfassenderen Blick auf das Gebäude frei, das sich prächtig vor dem Nachthimmel abhebt. Es ist leicht unscharf.
Goldberg dreht sich um und tritt ins Halbdunkel des Tempels.
Der Kameramann bekommt das Bild genau in dem Augenblick scharf, als Goldbergs Körper aus dem Tempel heraus und über den Rand der Pyramide katapultiert wird.
Auf halbem Weg nach unten prallt er von den steinernen Stufen ab, überschlägt sich und wirbelt durch die Luft, bis er aus dem Bild heraus in den unbeleuchteten Bereich am Fuß der Pyramide fällt.
Die Scheinwerfer schalten auf normales Licht und beleuchten den Platz, auf dem die Pyramide steht. Drei Meter von ihrem Sockel entfernt liegt ein roter Klumpen im Staub. Die Kamera zoomt heran und fährt an Goldbergs Hemd entlang, das von der Taille bis zu den Schultern blutgetränkt ist. Dann schwenkt sie langsam die Stufen hinauf und sucht nach dem Rest von ihm.
Wir sahen die Videoaufzeichnung im Hauptquartier der Policia Judicial del Estado in Merida, im Beisein von Captain Ernesto Sanchez. Trotz der geschlossenen Fensterläden, die das Licht der Nachmittagssonne größtenteils aussperrten, war die Luft im Raum wie heißer Sirup. Und der Ventilator, der an der Decke mit der Drehzahl eines abhebenden Flugzeugs rotierte, schien den Dunst nur immer mehr zu verquirlen. Nicht zum ersten Mal kam ich mir in Mexiko wie ein Hähnchen im Umluftherd vor. Bei Sanchez zeigte die Hitze keine Wirkung, aber anders als Ken und ich war er hier aufgewachsen.
Und im Augenblick schien Ken sogar mehr zu leiden als ich. Das lange, grau werdende Haar klebte ihm am Schädel. Er beugte sich im Sessel vor und zog an dem schweißgetränkten T-Shirt, das ihm wie Frischhaltefolie am Rücken klebte. Dann lüftete er es einige Male, um sich Kühlung zu verschaffen. Die Erleichterung würde von kurzer Dauer sein.
Als Ken Arnold mich bat, mit ihm in einem Wasserloch auf der Halbinsel Yukatan zu tauchen, wunderte ich mich zunächst, warum ihn die Aussicht darauf so zu begeistern schien. Wir waren bereits viele Male in einem cenote getaucht. Diese Kalksteinbecken im Dschungel, von denen manche im Mittelpunkt von Mayaritualen standen, sind die einzige Frischwasserquelle auf dem Plateau. Und sie sind außerdem eine Attraktion für Taucher aus den USA und Europa.
»Es handelt sich nicht um irgendeinen Zenote«, sagte er, »sondern um den Heiligen Brunnen in Chichen Itza.«
»Wow.« Ich war beeindruckt. Und verwundert, denn abgesehen von selten genehmigten archäologischen Tauchgängen war der Zenote gesperrt.
»Worum geht es?«, fragte ich.
»Um eine polizeiliche Ermittlung. Wir sollen ihnen etwas aus dem Brunnen heraufholen.«
Ich fragte mich kurz, warum sie nicht ihre eigenen Taucher einsetzten. Doch man braucht Spezialisten und eine besondere Ausrüstung, um einen Zenote zu erkunden und sich in den klaustrophobisch engen Durchgängen des Systems zurechtzufinden, den Portalen zu einer unterirdischen Wasserwelt aus Kammern und Höhlen. Und Ken Arnold hatte diesen Sport auf Yukatan beinahe im Alleingang etabliert.
»Was genau?«
»Warst du mal bei dem Spektakel zur Tagundnachtgleiche in Chichen?«
»Nein.«
»Aber du weißt, was es ist?«
Es wurde in jedem Reiseführer über Yukatan erwähnt. »Ja. Der Einfallwinkel der Sonne erzeugt die Illusion einer riesigen Schlange, die an der Pyramide hinabgleitet. Müsste demnächst passieren, glaub ich.«
»Heute Nachmittag, um genau zu sein. Dreiundzwanzigster September. Normalerweise zieht es Tausende von Besuchern an, aber diesmal hätten es Millionen sehen sollen. Sie haben ein großes Medienereignis daraus gemacht, eine Neuinszenierung der Mayazeremonie mit Kostümen und allem Drum und Dran, gefolgt von einer großen Licht- und Tonshow, und das Ganze rund um den Globus gesendet. Nur wurde es leider abgesagt. Man hat den Typ, der das ganze Spektakel produziert, gestern Abend ermordet.«
»Oh.«
»Er wurde auf der Pyramide getötet.«
»Dann suchen wir also nach der Tatwaffe?«
»Nein, Jessica. Wir sollen seinen Kopf finden.«
»Und Sie sind überzeugt, dass er sich im Zenote befindet?«, sagte Ken zu Sanchez. »Wieso?«
Der Polizeibeamte war glatt rasiert bis auf einen äußerst schmalen, fast wie mit dem Augenbrauenstift gezogenen Schnauzbart. Er war militärisch gekleidet, seine muskulöse Gestalt wirkte wie eine zusammengerollte Springfeder unter dem weißen Baumwollhemd mit dem steifen runden Kragen, das er über einer Hose im Landesstil trug. »Chichen war ein rituelles Zentrum, ein Zentrum von Menschenopfern. Haben Sie von dem rituellen Ballspiel gehört?«
Ken nickte.
Mir war bekannt, dass sich das Bild der Maya im Laufe der Jahre verändert hatte. In meiner Kindheit hielten wir sie für friedliebende Sterngucker mit einer Obsession für Kalender und astronomische Berechnungen. Im Gegensatz dazu galten die Azteken als blutrünstige Bande, die ihren Opfern mit Vorliebe die noch schlagenden Herzen aus dem Leib rissen. Doch gegen Ende des zwanzigsten Jahrhunderts haben Archäologen den Mythos von den sanften Maya ins Wanken gebracht. Und bei den rituellen Ballspielen, die zwischen den Wänden ihrer monumentalen Spielfelder stattfanden, ging es um Leben und Tod.
»Die Experten behaupten, dass die Opfer dieser Rituale in den Zenote geworfen wurden«, fuhr Sanchez fort. »Deshalb ist er auch unter dem Namen ›Opferbrunnen‹ bekannt. Man hat viele Skelette in ihm gefunden.« Dann lächelte er. »Aber von all dem abgesehen haben wir auch Blutflecken auf einem Stein nahe dem Rand entdeckt.« Er hatte uns zum Narren gehalten.
Ken warf mir einen Blick zu, dann wandte er sich wieder an Sanchez. »Wann gehen wir rein?«
Goldberg war seit beinahe vierundzwanzig Stunden tot. Wollte man noch etwas finden, das an seine Gesichtszüge erinnerte, musste es bald geschehen. Die unterirdischen Flüsse des Yukatan ernähren verschiedene Arten von Fischen und Krustentieren, manche davon blind, aber allesamt in der Lage, an einem Kadaver herumzunagen.
»Morgen früh, sobald es hell wird. So können Sie Ihre Arbeit erledigt haben, bevor die Touristen kommen.«
»So hätten Sie das gern.« Ken sah ihn skeptisch an. »Das Wasser im Zenote ist fünfundzwanzig Meter tief, die Hälfte davon Schlamm. Wir werden eine ganze Weile da unten herumstochern müssen.«
»Ich glaube, Sie verstehen nicht. Heute mussten Tausende von Besuchern weggeschickt werden. Aber das Phänomen ist auch morgen noch sichtbar, deshalb werden ganze Busladungen wieder zur Stelle sein.«
»Dann lassen Sie die Leute hinein und halten sie nur vom Zenote fern«, schlug ich vor.
»Wir haben bereits den Tempelbereich oben auf der Pyramide abgesperrt«, jammerte Sanchez, und er klang nicht mehr wie ein Polizeibeamter, sondern eher wie ein Fremdenführer, der an seine Trinkgelder denken muss. Andererseits war der Tourismus nun mal das große Geschäft in Yukatan. Und vielleicht hatte Sanchez ja ein persönliches Interesse an dessen Gedeihen.
Ken zuckte mit den Achseln. »Na und? Jedes Mal, wenn ich in Europa bin, ist die Hälfte aller großen Sehenswürdigkeiten wegen Renovierung geschlossen.«
Ich warf Ken einen Blick zu, und er blinzelte zurück.
»Wir lassen bis Mittag niemanden auf das Gelände«, sagte Sanchez. »Damit schlagen wir noch einmal vier Stunden heraus.«
»Wie auch immer«, erwiderte Ken ohne großes Interesse. »Jessica hier wird mich begleiten, wie Sie wissen. Ich habe alles an Ausrüstung mitgebracht, was wir meiner Ansicht nach brauchen. Und Sie besorgen wie vereinbart den Rest.« Er zeigte auf ein Fax auf dem Schreibtisch, das dort zwischen einigen Fotografien von Goldberg lag. »Wer kommt von Ihrer Seite?«
»Ich werde persönlich dabei sein. Und ein Pathologe, Dr. Rafael de Valdivia. Er meldet sich heute Abend bei Ihnen im Hotel.«
Ken zog nun an der Vorderseite seines T-Shirts und fächelte sich Luft zu. »Wenigstens wird es so früh am Morgen kühl sein.«
»Noch etwas«, sagte Sanchez, kam um den Schreibtisch herum und blickte uns abwechselnd mitten ins Gesicht. »Wenn Sie da unten noch etwas anderes sehen, lassen Sie’s liegen.«
»Sie meinen historische Fundstücke?«, fragte ich.
»Nein. Ich meine andere menschliche Überreste. Wir untersuchen einen Mordfall, nicht das Rätsel der Mayakultur.«
Kapitel 2
»Ein Kran?« Das war kein Gegenstand, den ich mit Tauchen in Verbindung brachte, aber er stand auf der Einkaufsliste, die Ken Arnold an Sanchez gefaxt hatte.
Wir saßen uns an einem Plastiktisch vor einer kleinen taqueria gegenüber und löschten unseren Durst mit eisgekühltem Dos-Equis-Bier. Die einzigen anderen Gäste waren zwei junge mexikanische Verkäuferinnen, die gerade ihren Arbeitstag beendet hatten. Das Taco-Lokal lag drei Straßen von unserem Hotel entfernt und hatte soeben für den Abend geöffnet, als wir eintrafen.
»Der Zenote gehört zu der Sorte mit senkrechten Wänden«, erwiderte Ken. »Du hast ihn mal gesehen, oder?« Er begann, in der Gesäßtasche seiner Jeans zu kramen.
Ich nickte. Ich hatte Chichen Itza zum ersten Mal mit meinem Vater besucht, als ich sechzehn war.
»Zwanzig Meter Steilwand bis zum Wasser«, sagte er und entfaltete eine Seite, die er offenbar aus einer Zeitschrift gerissen hatte. »Auch ohne Taucherausrüstung am Leib würde ich da nicht runterzuklettern versuchen.«
Er strich das Papier mit der Handkante glatt und drehte es herum, sodass ich die Abbildung sehen konnte. Es war ein grobkörniges Farbfoto von einem Gebilde, das aussah wie ein Boxring, der auf der Oberfläche eines großen grünen Teichs am Fuß einer Klippe trieb. Ein paar Leute standen auf der Plattform neben einer gelben Industriepumpe, von der eine Reihe Gummischläuche über den Rand der Plattform ins Wasser führten. Einige weitere Schläuche schlängelten sich hinter der Plattform aus dem Teich die Steilwand hinauf.
»Das war vor dreißig Jahren«, sagte Ken. »Damals haben sie ganze Berge von Schlamm abgesaugt, aber bis zum Grund sind sie trotzdem nicht vorgestoßen.«
»Das haben sie jetzt alles eingestellt.«
»Und genau deshalb ist das eine einzigartige Gelegenheit. Einfach, um es sich in den Lebenslauf zu schreiben. Der Heilige Brunnen von Chichen Itza, Mensch!«
Ken Arnold hatte mit fünfundfünfzig noch nichts von seinem jungenhaften Abenteuergeist verloren.
»Und Sanchez kann den Kran bis morgen früh hierher schaffen?«, fragte ich skeptisch. So schnell bewegte sich in Mexiko normalerweise nichts.
»Ich tippte darauf, dass bereits einer zur Stelle ist. Für die Fernsehshow.« Er sah mich von der Seite an und setzte die Flasche an die Lippen. »Und ich lag richtig.«
Die Hitze ließ nun nach, da die Sonne unterging; ihre Strahlen wurden grell von den weißen, stuckverzierten Glockentürmen einer Kirche reflektiert, die sich einige Straßen weiter hinter den Häusern erhob. Leute fuhren in VW-Käfern und alten Pick-ups vorbei oder knatterten auf lauten Mopeds dahin.
Die winzig kleine Frau, die uns die Getränke serviert hatte, kam mit unserer Essensbestellung. Sie trug ein huipil, eine traditionelle Kleidung der Maya – schlichtes weißes Hemd mit leuchtenden Stickereien an Kragen und Saum. Seit ich in diesem Teil der Welt lebe, bewundere ich die Fähigkeit der einheimischen Frauen, stets in makellosem Weiß aufzutreten, egal, ob sie gerade mit einer Horde Kinder im Schlepptau aus dem Dschungel kommen, mit ihren Einkäufen aus einem schmuddeligen Bus steigen oder Essen servieren, so wie jetzt eben.
»Frijoles refritos?«, fragte sie.
Ich hob die Hand. »Gracias.« Ken war unerbittlich in seiner Ablehnung von gebackenen Bohnen. Oder Guacamole. »Ich mach mir nichts aus Essen, das aussieht, als hätte ich’s schon mal in mir gehabt«, wiederholte er immer aufs Neue.
Ken Arnold steckte voller Widersprüche. Ein knallharter Texaner, der sein ergrauendes Haar gerne zum Zopf gebunden trug wie sein musikalischer Held Willie Nelson. Ein Nichtakademiker, nach dem man eine in Höhlen wohnende Fischart benannt hatte. Einer, der Mexiko liebte, aber kaum einen Satz auf Spanisch zusammenstöpseln konnte. Der eine riesige Sammlung psychedelischer Musik aus den Sechzigern besaß, aber schwor, niemals auch nur einen einzigen Joint geraucht zu haben. Ein Mann, der eine Taco-Bude jederzeit einem schicken Restaurant vorzog, andererseits aber Massenkost ablehnte.
»Ein paar von den Sachen sind gestrichen«, sagte ich, zeigte auf die Liste und biss in eine empanada, eine mit Käse gefüllte und dann zusammengeklappte und frittierte Maistortilla. Ken hatte tacos al pastor bestellt, eine Spezialität Yukatans, die aus dünnen Scheiben von am Spieß gebratenem, gewürztem Schweinefleisch bestand, serviert mit Cilantro, Zwiebeln und roter oder grüner Chilisauce nach Wahl.
»Ja. Ich wollte einen Schlammabsauger auf den Rand des Brunnens stellen lassen. So einen mit extra langen Saugschläuchen, wie auf dem Foto. Aber dafür hätten sie eine Sondergenehmigung gebraucht, was eine Woche dauern würde, und wahrscheinlich hätten wir sie sowieso nicht gekriegt. Könnte ja irgendwelche Fundgegenstände beschädigen.«
»Ich dachte, da sind nicht mehr viele übrig, die man beschädigen könnte.«
»Die Jungs, die damals diese Grabung gemacht haben …«, er wies mit seinem Taco auf die Fotografie, bevor er es zum Mund führte, »haben jede Menge Zeug gefunden. Und Taucher später auch noch, unter strenger Überwachung, versteht sich.«
»Dann hat Thompson also nicht alles abgeräumt?«
»Auf keinen Fall…« Ken biss ein Stück von seinem Taco ab und begann zu kauen.
Wir hatten auf dem Weg vom Hotel hierher darüber gesprochen, was wir von der Erforschung des Heiligen Brunnens wussten. Edward H. Thompson war zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts amerikanischer Konsul in Yukatan gewesen. Er hatte die Ranch oder hacienda gekauft, auf der die Ruinen von Chichen Itza standen, und sich darangemacht, den Zenote auszubaggern. Nach einigen Jahren Baggern und Tauchen hatte er zahlreiche menschliche Skelette und einen riesigen Schatz von Kunstgegenständen heraufgeholt, die ins Peabody Museum von Harvard gebracht worden waren. Eine Hinweistafel in Chichen beklagt diesen ansehnlichen Beutezug – ein Beispiel für die schwierigen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Aber Thompson hatte seine Funde immerhin für die Nachwelt bewahrt. Andere Mayastätten sollten weniger Glück haben.
»Was haben die Taucher über die Verhältnisse dort unten berichtet?«
»Sehr schlechte Sicht. Die Wände sind unterhalb des Wasserspiegels unterhöhlt und auch wegen Thompsons Grabungsarbeiten instabil. Das Hauptproblem ist allerdings der Schlick. Keiner weiß, wie tief er ist, von sechs bis zwölf Meter ist alles drin. Eine Mischung aus Kompost, Fledermaus- und Vogelscheiße, menschlichem und tierischem Abfall von Jahrhunderten, Kadaver… weiß der Himmel, was in der Pampe da unten noch alles steckt.«
Ich legte meine Tortilla kurz ab und bemühte mich dabei, den Berg brauner Bohnen auf dem Teller zu übersehen. Mein Appetit auf sie war plötzlich geschwunden.
»Für eine Biologin wie dich bestimmt sehr interessant«, fuhr Ken fort. »Dann wäre da noch das klebrige grüne Zeug auf der Oberfläche. Es ist stehendes Gewässer, deshalb ist der Algenbewuchs sehr dicht und schleimig. Stinkt auch ganz schön. Sollte man tunlichst umgehen.«
Ich hatte mir gerade eine Portion Guacamole auf meine Tortilla laden wollen. Ich ließ sie auf dem Teller. Vielleicht hatte Ken nicht ganz Unrecht, was diese Speise anging.
»Aber wie umgehen wir die Guacamo …?«
Ken bemerkte meinen Lapsus und lachte laut. »Verstehst du jetzt, warum ich um diese Art Kost einen Bogen mache? Alles erbrochen, wenn du mich fragst.«
»Also nicht so gut wie das Essen in Europa?«, fragte ich durchtrieben.
»Wie meinst du das?«
»Na, wenn dort immer so viele Sehenswürdigkeiten geschlossen sind, hast du doch bestimmt jede Menge Zeit gehabt, essen zu gehen.«
Er schaute dumm. »Äh… das ist mir gerade so eingefallen. Ich hab’s mal in einer Zeitung gelesen.«
»Du liest keine Zeitungen.«
Er hob die Hände. »Okay, okay, Kleine, ich geb’s ja zu. Ich hab das Gespräch von zwei Frauen auf dem Flughafen belauscht, als ich dich abgeholt habe. Jetzt lass uns essen.«
Er war ausnahmsweise verlegen, und ich hatte mich für seine boshaften Versuche revanchiert, mir das Essen zu verderben.
Die Kellnerin kam vorbei, und Ken gab ihr ein Zeichen, noch zwei Bier zu bringen.
Ich kam auf meine Frage zurück. »Wie gehen wir den Algen denn nun aus dem Weg?«
»Ich vermute, der Bewuchs wird am Rand des Brunnens am dichtesten sein. Wir lassen uns vom Kran in die Mitte schwenken.«
»Und dann? Wenn wir annehmen, dass ein menschlicher Kopf sinkt, dann ist er im Schlamm verschwunden. Und den können wir nicht aufwühlen, also was soll das Ganze?«
»Ich habe das Gefühl, es handelt sich um eine Art kosmetische Übung. Wegen der Witwe und der US-Regierung vielleicht, oder um…« Ken blickte mit schief gelegtem Kopf zu einem hoch gewachsenen Mann in weißem Leinenanzug und Panamahut, der plötzlich unmittelbar vor uns auf dem Bürgersteig stand.
»Vielleicht eine Möglichkeit für die neue Untersuchungsbehörde der Regierung, sich zu beweisen?«, schlug der Mann vor. Ich bemerkte, dass er einen Gehstock benutzte. »Señor Arnold und Señorita Madison, nehme ich an?«
Er stützte sich auf den Stock, nahm seinen Hut ab und verbeugte sich vor mir, während ich sein nach hinten gestrichenes silbernes Haar, den sorgsam geschnittenen Ziegenbart und den wallenden Schnauzer musterte. Er war zweifellos spanischer Abstammung und wäre auf einem Ölgemälde im glänzenden Brustpanzer eines conquistador keineswegs aufgefallen.
Kapitel 3
»Ja«, antwortete ich.
»Das sind wir«, fügte Ken überflüssigerweise hinzu.
»Sehr erfreut«, sagte der große Mann und verbeugte sich noch einmal. »Rafael Santiago de Valdivia. Sie haben mir eine Nachricht in Ihrem Hotel hinterlassen.«
»Ja, Captain Sanchez meinte, Sie würden vorbeischauen«, sagte ich. »Bitte setzen Sie sich doch zu uns.«
Er zögerte einen Augenblick. Sicherlich verwirrte es ihn ein wenig, dass diese beiden norteamericanos in einer Kolonialstadt, die für ihre vorzüglichen Restaurants bekannt war, in einer primitiven Taco-Bude aßen.
»Gerne«, erwiderte er und rückte einen Stuhl an unseren Tisch. Die Mayakellnerin kam herbeigehuscht.
»Möchten Sie etwas trinken oder essen?«, fragte Ken.
Dr. de Valdivia nickte und sagte etwas zu der Frau. Aber nicht auf Spanisch, wie mir auffiel. Vielleicht täuschte ich mich in ihm. Sie machte einen Knicks und eilte lächelnd davon. Dann wandte de Valdivia seine Aufmerksamkeit wieder uns zu. »Gestatten Sie, dass ich mich richtig vorstelle. Ich bin der oberste Gerichtsmediziner für den Staat Yukatan, inzwischen allerdings im Ruhestand.«
»Ich bin Ken, und das ist Jessica.«
»Darf ich Sie fragen, woher Sie kommen, Jessica?«
»Ursprünglich aus Florida, aber jetzt bin ich –«
»Jessicas Vater ist wie Sie pensionierter Mediziner«, warf Ken ein. Er benahm sich absichtlich boshaft. »Lebt in Tampa.« Die Beziehung zwischen meinem Vater und mir war, gelinde gesagt, angespannt.
»Ich verstehe«, sagte Dr. de Valdivia und versuchte, aus der Situation schlau zu werden, indem er sich höflich erkundigte, auf welchem medizinischen Gebiet mein Vater tätig gewesen war.
»Er arbeitete als Allgemeinarzt«, erwiderte ich knapp und fuhr rasch fort: »Aber ich lebe jetzt auf Cozumel.«
Florida und die Halbinsel Yukatan sind wie die beiden Scheren einer Krabbe, die im Begriff ist, Kuba in den Schwanz zu zwicken, und zwischen sich umschließen sie den Golf von Mexiko. Die Insel Cozumel liegt auf der anderen, der karibischen Seite der Yukatan-Schere, zwölf Meilen vor der Küste und genau südlich des Ferienortes Cancun.
»Ah-Cuzamil-Peten«, bezeichnete Dr. de Valdivia die Insel mit ihrem vollständigen Mayanamen, »das ›Land der Schwalben‹.«
Ich wartete darauf, dass er anfügen würde, Cozumel sei der Mayagöttin der Fruchtbarkeit geweiht, und einst habe jede Mayafrau eine Pilgerreise dorthin unternehmen müssen, und ob ich ebenfalls aus diesem Grund dort sei. Es handelte sich um eines der Lieblingsklischees nur allzu vieler mexikanischer Männer, denen ich begegnet war. Aber er sagte kein Wort davon.
»Und Sie, Señor Arnold, leben in … Cancun?« Er schien den Namen des Ferienparadieses an der Spitze der Halbinsel mit Missfallen auszusprechen, aber ich war mir nicht ganz sicher. Man durfte jedoch davon ausgehen, dass ein alteingesessener Bürger von Merida Vorbehalte gegen einen Ort hatte, der erst Mitte der Siebziger entstanden war.
»Ja. Mir gehört dort ein Tauchclub. Und ich habe noch einen kleineren auf Cozumel, den Jessica betreibt.«
»Aha. Dann werden Sie also beide tauchen?«
»So halten wir’s für gewöhnlich«, sagte Ken.
»Wir arbeiten oft im Team«, ergänzte ich und fragte dann: »Warum haben Sie gerade die Bundespolizei erwähnt? Wird der Fall denn nicht von der PJE untersucht?«
»Ah, ich verstehe. Captain Sanchez hat Ihnen offensichtlich nichts erklärt.«
»Was erklärt?«, fragte ich.
»Sie wissen wahrscheinlich, dass die mexikanische Polizei gerade umstrukturiert wird. Um die Zuständigkeiten der verschiedenen Dienste zu klären … und auch, um gewisse, nennen wir es zur Institution gewordene Gewohnheiten, zu korrigieren …«
Ich nickte. Es war allgemein bekannt, dass vom schlecht bezahlten Verkehrspolizisten, der anstelle eines Bußgelds seine mordida erwartete, bis hinauf zum Comandante, der unerklärlicherweise in einem Luxuspalast wohnte, seit Generationen Korruption in Mexikos Polizeiapparat grassierte. Die Ermittlungsbehörde des Bundes war der neueste Versuch der Regierung, den notorisch korrupten Bereich der Strafverfolgung zu säubern, den man deshalb von der PJE übernahm, der Polizei der einzelnen Bundesstaaten. Aber das ging nicht über Nacht.
»Captain Sanchez ist im Auftrag der Bundespolizei tätig. Die PJE wurde aufgefordert, alles an nötiger Unterstützung zu leisten, aber Sanchez entschied, Sie beide hinzuzuziehen, statt sich auf seine früheren Kollegen zu verlassen, die nicht übermäßig glücklich waren, als er einen Werbefeldzug für Reformen begann.«
»Und dass wir beide Nordamerikaner sind, hat das irgendetwas damit zu tun?«, fragte ich.
Dr. de Valdivia lächelte. Seine vom Alter schon ein wenig dunkel gewordenen Zähne waren in gutem Zustand, wenngleich sie sichtbare Silberfüllungen enthielten, was in dieser Region Tradition hatte.
»Si, Señorita Madison. Das FBI hat an der Ausbildung unserer Bundespolizei mitgewirkt, deshalb gibt es kein Problem hinsichtlich einer Zusammenarbeit mit norteamericanos. Und die Tatsache, dass Goldberg selbst Amerikaner war… Vielleicht kam der Vorschlag von ganz oben, ich weiß es nicht.«
»Äh, Doktor…« Ken wollte unbedingt eine Frage loswerden.
»Ja, Señor Arnold?« Dr. de Valdivia blickte von mir weg, und erst jetzt wurde mir bewusst, dass er mir seine gesamte Aufmerksamkeit gewidmet hatte. Er besaß großen Charme, und ich spürte auch eine tiefe Lebenserfahrung.
»Wenn Sie bereits im Ruhestand sind, wieso arbeiten Sie dann an dem Fall?«
»Eine gute Frage –«
Die Bedienung war mit seinem Drink gekommen. Aber zu dem Glas mit dem strohfarbenen Likör brachte sie außerdem die ganze Flasche mit und ließ sie auf dem Tisch für ihn stehen. Er bedankte sich elegant für diese Geste, indem er das Glas in ihre Richtung hob, bevor er trank. Ich erkannte die Marke. Es war ein Mayalikör namens xtabentun, der aus Anis und vergorenem Honig hergestellt wurde.
»Ja, eine gute Frage, Señor Arnold. Ich vermute, der Grund dafür ist so ziemlich derselbe, warum auch Sie hier sind. Captain Sanchez konnte wahrscheinlich keinen Gerichtsmediziner ohne ausgeprägte Verbindungen zur PJE bekommen. Die hätten dann vielleicht versucht, ihn in Verlegenheit zu bringen. Einen diplomatischen Zwischenfall provoziert. Aber offiziell hat er mich hinzugezogen, weil ich so etwas wie ein Amateurgelehrter in Sachen Maya bin.«
Ken und ich waren erst einmal verdutzt.
»Weil doch Señor Goldberg in Chichen Itza ermordet wurde.« Er streckte die Arme aus und drehte die Handflächen nach oben, um anzuzeigen, dass es keiner weiteren Erklärung bedurfte.
»Ah ja«, murmelte Ken, dem, wie mir selbst, der Zusammenhang verborgen blieb. »Wie wurde er eigentlich getötet, da wir gerade dabei sind?«
»Machete. Ein einziger Schlag in den Hals.« Dr. de Valdivia ließ seinen langen Zeigefinger durch die Luft sausen. »Ich verstehe schon, warum die Polizei Mayafanatiker in Verdacht hat«, fügte er in skeptischem Tonfall an.
»Und was glauben Sie, wer es war?«, fragte ich.
»Ich habe mir noch keine Meinung gebildet, Señorita.« Er ließ den Blick ein wenig schweifen, verschränkte die Hände und stützte sie auf den Griff seines Spazierstocks. Der Griff stellte den stilisierten Kopf eines Tiers mit offenem Rachen dar und war aus Silber, was in Mexiko nicht überraschte. Ich bemerkte außerdem, dass Dr. de Valdivias Fingernägel vorzüglich manikürt waren.
Ken beendete die Pause in unserem Gespräch. »Captain Sanchez zufolge sind die hiesigen Maya verärgert, weil sie keinen freien Zutritt zur Ausgrabungsstätte haben, um ihre Waren zu verkaufen.«
»Was wohl kaum ein Grund sein dürfte, jemanden zu enthaupten«, sagte der Doktor. Ich bemerkte, dass er sich abwehrend zu verhalten begann, wenn es um die Maya ging.
»Publicity für ihre Sache«, meinte Ken. »Sie suchen sich ein Großereignis wie dieses aus und machen den Kerl kalt, der es veranstaltet.«
»Aber das hat nicht funktioniert«, sagte ich. Goldberg hatte die Generalprobe am Vortag aufgezeichnet, falls bei der LiveShow etwas schief gehen sollte, und diese Probe wurde nun gesendet.
»Die Maya haben gewichtigere Anliegen, als Nippes an Touristen zu verkaufen«, sagte Dr. de Valdivia in scharfem Ton. Das war es also. Offenbar hegte er große Sympathien für die Maya, die in der Vergangenheit starke Unterdrückung erlitten hatten und noch heute von der Bevölkerungsmehrheit, die selbst aus Mischlingen spanischen und indianischen Bluts bestand, häufig als Bürger zweiter Klasse behandelt wurden.
Ich wandte mich an Ken. »Du unterstellst außerdem, dass zwischen Goldberg und seinen Mördern vorher keine Beziehung bestand.« Dann fing ich Dr. de Valdivias Blick auf. »Aber das ist ungewöhnlich bei einem Mordfall, nicht wahr, Doktor?«
»Richtig, Señorita. Und darum möchte ich auch kein vorschnelles Urteil abgeben. Allerdings kann ich die Möglichkeit, dass es sich um eine rituelle Hinrichtung handelte, auch nicht ausschließen, und deshalb müssen wir uns über bestimmte Dinge unterhalten.« Er nippte an seinem Glas. »Selbst wenn es Ihnen gelingt, den Kopf zu finden, erwarte ich nicht, dass er uns in gerichtsmedizinischer Hinsicht eine große Hilfe ist. Es sei denn, nach der Enthauptung wurde eine weitere Gräueltat begangen.«
»Was für eine Gräueltat?«, fragte Ken.
»Der menschliche Kopf übte auf die mittelamerikanischen Kulturen eine große Faszination aus«, entgegnete Dr. de Valdivia. »Und seine Rolle bei rituellen Opferungen ist in der Kunst, die wir in Mayastätten sehen, gut dargestellt. Nach der Enthauptung konnte der Kopf etwa in einen ausgehöhlten Gummiball gestopft werden, um im Ballspiel Verwendung zu finden, oder man hat ihm die Haut abgezogen und ihn dann zur Schau gestellt. Manchmal wurde Gefangenen sogar vor der Hinrichtung der Unterkiefer entfernt.«
»Eine sehr düstere Form der Faszination«, sagte ich.
»Zugegeben. Aber sie war mit der spanischen Eroberung nicht zu Ende, Señorita. Sie beeinflusst unsere Kunst und unsere Rituale hier in Mexiko bis auf den heutigen Tag – El Dia de los Muertos zum Beispiel.«
»Der Tag der Toten«, sagte ich Ken zuliebe.
Ich dachte an die Bäckereien, die pan de muerto, eingelegte Knochen aus Teig, in der Auslage hatten, an das Klappern der hölzernen Skelettpuppen, die an Straßenecken tanzten, und an Kinder, die Totenköpfe aus Zucker und gefärbtem Marzipan mampften.
»Es könnte also sein, dass sie den Kopf verstümmelt haben«, sagte Ken, »und darauf wollten Sie uns vorbereiten.«
»Darauf und auf die Bedeutung des Ortes, in den Sie eintauchen werden.«
»Ah ja.« Ken nahm offenbar an, er würde nun gleich einige abergläubische Mayageschichten zu hören bekommen, und die Aussicht darauf sagte ihm nicht sehr zu.
Ich dagegen war interessiert. Dr. de Valdivia vermittelte einem den Eindruck, als sei der Zenote noch immer heilig.
»Für die Maya«, fuhr er fort, »waren alle Höhlen, alle Zenoten, alle Öffnungen in der Erde Eingänge zur Unterwelt Xibalba, in der schreckliche Wesen lebten. Tatsächlich bedeutet das Wort ›Ort des Schreckens‹ Aber die Eingänge zu Xibalba waren auch zeremonielle Stätten, und der Zenote von Chichen Itza blieb noch lange, nachdem die Stadt aufgegeben worden war, das Ziel von Pilgerreisen. Und seit der Eroberung durch die Spanier bewahrt er das Versprechen, dass die Maya einst wieder auf ihrem Gebiet an die Macht zurückkehren.«
»Tatsächlich?«, fragte Ken mit geheucheltem Interesse.
Dr. de Valdivia wandte sich an mich. »Denn die Maya behaupten, als die Spanier hierher kamen, wurde die Nabelschnur der Welt durchtrennt – die Verbindung von der Menschheit zu den Göttern. Doch sie liegt unter dem großen Ballspielplatz in Chichen und wird durch den Heiligen Brunnen wieder auftauchen, wenn erneut ein Mayakönig herrscht.«
»Und wann wird das sein?«, fragte Ken.
»In gar nicht so ferner Zukunft. Am 21. Dezember 2012, um genau zu sein.«
Ken wirkte eingeschnappt. Mit einer so deutlichen Antwort hatte er nicht gerechnet.
So faszinierend dieses Thema auch war, wollte ich doch mehr über die Ansichten des Doktors zu Goldbergs Tod erfahren. »Worin bestand also Ihrer Meinung nach der tiefere Sinn, jemanden auf der Pyramide zu enthaupten?«
»Da wäre einmal die Tagundnachtgleiche. Der gefiederte Schlangengott Kukulkan kommt aus dem Tempel, der die Pyramide krönt, und betritt den Boden, um sich dem Heiligen Brunnen zu nähern. Kukulkan ist das Pendant der Maya zu Quetzal-coatl, dessen von der Legende vorhergesagte Wiederkehr sich Cortez bei der Eroberung des Aztekenreichs so raffiniert zu Nutze machte. Ich kann nur vermuten, dass eine rituelle Handlung auf der Pyramide, die ihm geweiht ist, etwas über seine Wiederkehr aussagt, bei der er diesmal seine Anhänger verteidigen wird.«
»In diesem Fall würde Goldberg den Feind repräsentieren«, schlug ich vor.
»Hm …« Dr. de Valdivia schien nur ungern zuzustimmen. Als hätte er nicht gewollt, dass ich zu dieser Schlussfolgerung gelangte.
Mein Handy läutete. Mit einer Entschuldigung entfernte ich mich ein paar Meter. Es war meine Freundin Deirdre O’Kelly; sie rief von Cozumel aus an, wo sie sich in meiner Abwesenheit um den Tauchclub kümmerte, zusammen mit einem Studenten namens Alfredo Yam, der schon seit Beendigung seiner Abschlussprüfungen zu Beginn des Sommers für mich arbeitete.
»Tut mir Leid, dass ich dich störe, Jessica. Ich habe hier ein paar Taucher, die morgen früh rausfahren wollen. Aber ich weiß nicht, ob Alfredo hier sein wird, um sie rauszubringen.«
»Kannst du ihn nicht fragen? Ist er heute nicht erschienen?« Ich hatte Cozumel mit der Morgenmaschine nach Merida auf der anderen Seite der Halbinsel Yukatan verlassen. Ken war frühmorgens in Cancun losgefahren und hatte mich am Flughafen abgeholt.
»Nein. Und ich erreiche ihn nicht auf dem Handy.«
Dann fiel mir ein, dass Alfredo zwei Tage Urlaub hatte.
»Herrje, Deirdre, das hab ich ganz vergessen. Alfredo hat heute auch noch frei. Tut mir Leid, dass ich dich mit dem Laden allein gelassen habe. Aber morgen ist er mit Sicherheit wieder da.«
»Kein Problem. Was soll ich nun diesen Tauchern sagen?«
»Sag Nein, es sei denn, sie wollen es riskieren, die Sache bis morgen früh offen zu lassen.«
»Wird gemacht. Und vielleicht versuche ich es nochmal bei Alfredo. Ruf mich später an, und erzähl mir, was es Neues an Klatsch gibt.«
»Mach ich. Bis dann.«
Als ich an meinen Platz zurückkam, fragte Ken gerade Dr. de Valdivia: »Warum war Captain Sanchez so besorgt wegen der Sperrung des Zenote für Besucher?«
»Es gibt auf dem Gelände eine Reihe von Ständen, die Snacks und Erfrischungsgetränke verkaufen«, erwiderte Dr. de Valdivia. »Sein Bruder ist an dem Unternehmen beteiligt, das die Konzession besitzt. Und der Stand neben dem Zenote macht das lebhafteste Geschäft.«
Ken pfiff durch die Zähne. »Und seit Beginn der Proben für die Fernsehübertragung ist er wahrscheinlich geschlossen. Wann war das, vor drei Tagen?«
Dr. de Valdivia nickte.
»Sagten Sie nicht, Captain Sanchez sei so eine Art guter Sheriff, der angetreten ist, um in Dodge City aufzuräumen?«, warf ich ein. »Das klingt mir eher nach weiter wie gehabt.«
»Nicht ganz, Señorita. Was Sanchez betrifft, handelt es sich hier um eine Frage von familiärem Zusammenhalt – Korruption ist da nicht im Spiel. Damit ist es bei uns in Mexiko jetzt nämlich vorbei«, sagte Dr. de Valdivia und zwinkerte mir zu.
Kapitel 4
Ich war gerade im Begriff, die Nummer des Tauchclubs zu wählen, als mir der Gedanke kam: Es scheint im Leben eines jeden Menschen eine Phase zu geben, in der eine Reihe von Dingen geschehen, deren Wirkung lange anhält. Vielleicht liegt es daran, dass sie sich während der letzten Häutung zutragen, die wir durchmachen und die unsere endgültige Gestalt festlegt. Und wem immer wir in dieser Zeit nahe sind, wovon wir besessen sind, das behält einen Einfluss auf unser gesamtes Leben. Für mich gehörte Deirdre O’Kelly wesentlich zu dieser prägenden Erfahrung, genau wie Ken. Und Manfred Günter.
Deirdre und ich lernten uns auf der zweiten Rainbow Warrior kennen, als Greenpeace das Schiff von Miami aus in den Golf von Mexiko schickte; wir sollten die Behauptung von Dorfbewohnern der Anrainerstaaten untermauern, Pemex, die gigantische Ölkompanie, würde giftige Raffinerieabfälle in den Wäldern und Feuchtgebieten der Region entsorgen. Deirdre war bereits vor der Atlantiküberfahrt in Dublin zur Mannschaft gestoßen, doch während ich einen langweiligen Job gegen etwas Aufregenderes eintauschte, floh sie aus einem Leben am Rande des Müßiggangs, nachdem ihr verstorbener Vater Deirdre und ihrem Zwillingsbruder ein beträchtliches Erbe hinterlassen hatte, das ein sehr erfolgreiches Pub-Unternehmen mit einschloss. Trotz ihres familiären Hintergrunds war Deirdre das, was die Iren einen »Charakter« nennen, eine extrovertierte Persönlichkeit mit viel Humor, eine begnadete Sängerin und Entertainerin.
Meine Hoffnung auf aufregende Zeiten erfüllte sich bald, als wir an Bord einer aufgegebenen Ölplattform gingen, aus der Öl ins Meer lief, während eine Korvette der mexikanischen Marine sich die ganze Zeit zur Einschüchterung in der Nähe aufhielt. Anschließend zeigte uns die Landbevölkerung, wo Giftmüll in Teichen und Mangrovensümpfen entsorgt wurde, und wir beobachteten die Arbeitsbedingungen von ölverschmierten Jungen im Teenageralter, bekannt als chaperos – Teermenschen –, denen man ein paar Dollar dafür bezahlte, dass sie Rohölüberläufe säuberten, und die sich am Ende eines Arbeitstages mit Diesel wuschen.
Nach wie vor von der Marine beschattet, legte die Rainbow Warrior im Golfhafen Campeche an, und dort lernte ich Ken Arnold kennen, der als Gast an Bord kam und uns von den Schäden erzählte, die an Mexikos Korallenriffen angerichtet wurden, und von den Anstrengungen der Regierung, eine aufgeklärte Politik hinsichtlich des Problems zum Tragen zu bringen, was in schroffem Gegensatz zu den Sabotageakten an der Umwelt stand, die das staatliche Ölmonopol beging. Nach seinem Vortrag kam ich mit Ken ins Gespräch, und daraus resultierte eine Einladung, auf Cozumel für ihn zu arbeiten. Aber meine Berufung für Greenpeace war damals noch frisch. Ich würde auf ihn zurückkommen.
Nach dem Besuch in Yukatan nahmen wir Nahrung, Kleidung und Medikamente an Bord, um sie nach Nicaragua zu liefern, das von einem Hurrikan schwer getroffen worden war, und unterwegs festigte sich die Freundschaft zwischen Deirdre und mir. Wir beide waren auch die jüngsten Rekruten, ein weiterer Grund zusammenzuhalten.
Für die älteren europäischen Helfer an Bord waren wir Agnetha und Annafrid, die beiden Frauen von Abba. Deirdre braunäugig, dunkelhaarig und klein, ich großknochiger, blauäugig und seinerzeit mit langen, blonden Haaren. Wir wurden so häufig damit aufgezogen, dass wir beschlossen, eine Partynummer daraus zu machen, also sangen wir Fernando, mit Glitter im Haar und in seidenen Pyjamas, die wir über hautengen Tauchanzügen aus Lycra trugen.
Nach vier Monaten, der üblichen Verpflichtungsdauer von Freiwilligen, flogen wir beide kurz nach Hause, dann gingen wir erneut auf die Warrior und fuhren nach Australien. Auf dieser zweiten Reise lernte ich Manfred Günter kennen, einen Computerbastler aus Ratingen bei Düsseldorf, der Idealismus und praktisches Geschick zu gleichen Teilen zu verbinden wusste. Während wir in Sydney vor Anker lagen, blühte unsere Beziehung auf, und wir wurden ein Paar.
Deirdre. Ken. Manfred. Alle in dieser kurzen Zeit. Doch diese glücklichen Tage endeten abrupt. Nicht auf See, sondern im Eis und Schnee des Himalaja.
Mir war jetzt plötzlich kalt, und ich schauderte kurz. Dann streifte ich diese Empfindung ab, wählte die Nummer und streckte mich mit dem Telefon in der Hand auf dem Bett aus.
»Aquanauts, Cozumel, was kann ich für Sie tun?«, meldete sich Deirdre mit heiserer Stimme. Unnötig zu erwähnen, dass Aquanauts Kens Idee war. Ich versuchte ihm gelegentlich zu erklären, dass die Zeit für einen solchen Namen längst abgelaufen war, aber er wollte nicht hören.
»Du klingst so sexy«, sagte ich. »Als würde ich in einem Nachtclub anrufen.«
»Schöner Nachtclub. Nicht mal ein anständiger Drink ist im Haus, und ich bin schon heiser vor Verlangen nach einem.«
»Ich hab dir Tequila besorgt. Hornitos reposada – vom Feinsten.«
»Aber den mag die kleine Deirdre nur in Margaritas«, sagte sie in schmollendem, mädchenhaftem Tonfall.
»Faule Schlampe!«, gebrauchte ich einen ihrer eigenen Ausdrücke. »Dann quetsch dir eben ein paar Limonen aus. Eis findest du im Kühlschrank, und eine Flasche Cointreau steht obendrauf.«
»Und die Limonen? Wo krieg ich die her, Mami?«
»Von der Terrasse draußen. Dort wachsen sie am Baum, wie ich dir bereits erklärt habe. Aber sei vorsichtig – in dem Baum wohnen mexikanische Springspinnen.«
»Waas!?« Ein, zwei Sekunden lang hatte sie es geglaubt. »Oh, du Miststück.«
Deirdre hatte derart panische Angst vor Spinnen, dass man ihr jeden Unsinn darüber einreden konnte, egal wie lächerlich er war.
»Und, schon was von Alfredo gehört?«, sagte ich, um das Gespräch in eine vernünftige Richtung zu lenken.
»Nein. Er wohnt in San Miguel, oder? Ich könnte bei ihm zu Hause vorbeischauen.«
San Miguel war die einzige Stadt auf der Insel, und vom Tauchclub in Dzulha aus, einem Erholungszentrum, das sieben Kilometer vom Ortskern entfernt aus dem Boden geschossen war, fuhr man keine zehn Minuten bis dorthin. Es hatte jedoch wenig Sinn, Deirdre auf die Suche nach Alfredo zu schicken. »Nicht nötig. Er wird morgen früh schon auftauchen.«
»Gut. Und wenn er nicht kommt, kann ich mich ja auch selbst um alle Anfragen kümmern. Und was gibt es bei dir Neues?«
Ich unterrichtete sie über einige Einzelheiten aus den Gesprächen mit Sanchez und Dr. de Valdivia.
»Ich beneide dich nicht darum, in diesem alten Tümpel zu tauchen«, sagte sie voller Überzeugung, als ich zu Ende erzählt hatte.
»Das liegt daran, dass du eben immer nur auf Vergnügen aus bist«, neckte ich sie. »Dir fehlt der wahre Abenteuergeist.«
»Und was ist falsch daran, auf Vergnügen aus zu sein, Mami?«
Sie sagte es mit so viel Doppeldeutigkeit in der Stimme, dass ich laut lachen musste. »Deirdre O’Kelly, du bist durch und durch schlecht, ein ›schamloses Weibsstück‹, wie du selbst sagen würdest.«
»Ich gebe mir jedenfalls Mühe«, erwiderte sie lachend.
»Irgendwelche Neuigkeiten bei dir?«, fragte ich.
»Nicht viel. Hast du von dem Grenzzwischenfall gehört?«
»Grenzzwischenfall? Nein.«
»Es ist die Hauptmeldung auf CNN. Du weißt ja, dass es gestern in Mexico City eine große Studentendemonstration gab… wegen der Reisebeschränkungen für Hispanios zwischen Mexiko und Kalifornien.«
»Hm.« Ich wusste ungefähr Bescheid. In der Folge des freien Handels zwischen allen amerikanischen Staaten hatten die USA angefangen, sich Sorgen zu machen, sie könnten von illegalen Einwanderern überschwemmt werden, und deshalb eine Regelung eingeführt, die den Zustrom mexikanischer Arbeiter zwar erlaubte, aber streng regulierte. Und nun drängte die spanischstämmige Gemeinde in Kalifornien auf größere Flexibilität, was den Zugang zu diesem Staat betraf. Eine Forderung, die bei den Studenten auf der anderen Seite offensichtlich Widerhall fand.
»Ein Bus voll Studenten war zur Grenze aufgebrochen und hat sie dann am Nachmittag auf einer abgelegenen Wüstenstraße zu überqueren versucht. Eigentlich nur eine symbolische Aktion, aber sie wurden aus dem Hinterhalt angegriffen, und vier Studenten ließen dabei ihr Leben.«
»Das ist ja furchtbar.« Ich spürte, wie ich vor Scham rot wurde. »Wer hat sie denn angegriffen? Doch hoffentlich nicht die Grenzwachen?«
»Washington behauptet, es waren Mitglieder einer Bürgerwehr, und ihr Vorgehen wurde offiziell verurteilt. Aber die Überlebenden sagen aus, es seien Grenzsoldaten zugegen gewesen, und sie hätten weggeschaut.«
»Klingt, als würde sich da Ärger zusammenbrauen.« Dann sah ich eine mögliche Verbindung. »Vielleicht hat Goldbergs Tod etwas mit diesem Zwischenfall zu tun.«
»Da könntest du Recht haben. Aber wenn es so wäre, würde die Polizei wohl kaum zwei Amerikaner bitten, sich an der Untersuchung zu beteiligen.«
»Stimmt. Aber ich habe es vielleicht nicht erklärt – es ist nicht direkt die Polizei, die den Fall bearbeitet. Es ist diese neue Bundesbehörde.«
»Ach so? Was ist das denn?«
Ich erklärte Deirdre, so gut ich konnte, Mexikos neue Strafverfolgungsstruktur.
»Hört sich an, als würde hinter diesem Mord mehr stecken, als du dachtest. Haben sie schon irgendwelche Verdächtigen im Sinn?«
»Einige Maya, die sonst immer Zugang zum Ausgrabungsgelände hatten, könnten ihrer Verärgerung Luft gemacht haben. Das ist alles, was sie uns gegenüber durchblicken lassen.«
»Hm … Klingt unwahrscheinlich, oder?«
»Finde ich auch.«
»Ich wäre sehr vorsichtig an deiner Stelle. Lass dich von denen bloß nicht unnötig in Gefahr bringen.«
Deirdre und ich hatten in unserer Zeit bei Greenpeace persönliche »Linker-und-Zinker-Sensoren« entwickelt, wie wir es nannten, da wir uns damals routinemäßig mit Ausflüchten, Behinderungen und Einschüchterungsversuchen seitens der Regierungen und Ordnungsbehörden auseinander setzen mussten.
Ich spürte, sie hatte da einen wichtigen Punkt berührt. Warum wollte man, dass wir diese Sache erledigten? Dr. de Valdivias Erklärung war zu dürftig. Und die Tatsache, dass man ihn selbst aus dem Ruhestand geholt hatte, ließ den Eindruck entstehen, als würde die gesamte Untersuchung an offiziellen Kanälen vorbeigeführt. Aber warum?
Kapitel 5
Ken und ich standen im Dunkeln am Rand des Heiligen Brunnens. Hinter uns winkten zwei Arbeiter mit Schutzhelmen auf dem Kopf einen auf einem LKW montierten Kran in die richtige Position. Der Kranwagen manövrierte ächzend und knarrend um die Kalksteinfelsen am Brunnenrand herum. Hin und wieder schwenkten seine Scheinwerfer kurz über den Zenote; ihr Licht warf die flatternden Schatten aufgescheuchter Fledermäuse an die fünfundsechzig Meter entfernte Wand gegenüber und gewährte uns die ersten Blicke auf das große Loch in der Erde.
In den Bäumen rund um den Brunnen flirrte es von Insektengeräuschen; eines davon stach heraus, es war wie ein hartnäckiges Morsesignal, das von der Erde ausgesandt wird und keine andere Antwort erhält als das bedeutungslose statische Rauschen des Alls.
Wir gingen zurück zu Kens Toyota Land Cruiser, und er brachte eine Thermoskanne mit Kaffee zum Vorschein.
»Wo hast du denn die ausgegraben?« Es war noch zu früh für ein Frühstück gewesen, als wir das Hotel verlassen hatten. Außer Wasser hatte ich deshalb noch nichts zu mir genommen.
»Ich habe sie mir von einer Serviererin abfüllen lassen, die in der Hotelküche gerade frühstückte.« Er holte zwei Styroporbecher hervor. »Ich denke eben immer voraus.«
In dem akustischen Sperrfeuer der Insekten entstand eine plötzliche Pause, aber innerhalb von Sekunden, praktisch ohne Unterbrechung, fingen die Vögel an – die Tagschicht war da, um zu übernehmen. Die Dämmerung war erst ein Hauch von Rosa am Saum des Nachthimmels.
Zehn Minuten später gab es genügend Licht, dass wir die Umgebung besser in Augenschein nehmen konnten. Die Luft war bereits mild, erfüllt von jenem einzigartigen tropischen Versprechen von Wärme und Leben, von Wachstum und Erneuerung. In den gestrüppreichen Bäumen am Rand des Zenote mischten sich die einzelnen Rufe von Urwaldvögeln zu einem dissonanten Chor aus Zirpen, Trillern, Kreischen, Krächzen und Grunzen. Und mir war bewusst, dass diese morgendliche Kakofonie überall aus den Tausenden von Quadratkilometern der Halbinsel emporstieg.
Über Yukatan zu fliegen ist, wie auf eine grüne Wüste hinabzublicken, die mit glitzernden Wasserbecken gesprenkelt ist. Das sind die Zenoten – Stellen im dornenreichen Buschwald, wo die Decke über einem riesigen unterirdischen Flussnetz eingestürzt ist. Dieses Flusssystem wird von Regenwasser gespeist, mit dem sich der poröse Kalkstein vollsaugt. Es ist wie ein U-Bahn-Netz, zu dem die Zenoten die Eingänge sind. Nicht alle Zenoten sind offene Becken; der Eingang zum System kann durch Höhlen oder sogar schmale Erdspalten erfolgen, von denen manche in riesige Grotten führen, gefüllt mit Wasser, das so klar ist, dass hindurchschwimmende Taucher in der Luft zu schweben scheinen.
Was sich jetzt meinem Blick darbot, sah aus wie ein Hohlraum, der entstanden war, nachdem eine riesige Maschine einen zylindrischen Kalksteinpfropf aus der Erde gebohrt hatte; anschließend war dieser Hohlraum bis zur Hälfte voll Wasser gelaufen. Die kreisrunde Wand zeigte horizontale Risse in parallelen Bändern entlang der Sedimentschichten und einen struppigen Bewuchs von Sträuchern und Ranken bis hinab zum Wasserrand.
An der Stelle, wo sich die Staubpiste von der einen halben Kilometer entfernten Pyramide um den Zenote herum öffnete, war der dünne Belag khakifarbener Erde, wie sie das nördliche Yukatan bedeckt, vollständig abgetragen und gab einen unebenen, brüchigen Kalksteinboden frei. Links von uns befand sich der geschlossene Kiosk, vor dem einige der Arbeiter auf verstreut herumstehenden Stühlen saßen und auf Anweisungen warteten.
Ich trat auf einer rechtwinkligen Felsplatte näher an den Rand und schaute auf eine olivgrüne Scheibe Wasser zwanzig Meter unter mir hinab, die von Büschen und Ranken gesäumt war. Ihre ruhige Oberfläche wurde nur durch ein mir unbekanntes Lebewesen gestört, das eine Furche durch das trübe Wasser zog. Gab es Wasserschlangen in Zenoten? Meine Fantasie ging plötzlich mit mir durch. Wahrscheinlich war es eine Ratte. Das Wasser sah abgestanden aus.
»Erinnert mich an einen alten, aufgelassenen Steinbruch, der voll Regenwasser gelaufen ist«, sagte Ken hinter mir und artikulierte damit meine noch ungeformten Gedanken.
Doch ich wusste, dass dieser Zenote, wie alle anderen, irgendwie mit dem Hydrosystem der Region verbunden war und von Wasserläufen gespeist wurde, die unter dem Kalksteinplateau flossen.
Anstelle der Fledermäuse flitzten inzwischen Mauersegler von einer Seite des Heiligen Brunnens zur anderen. Als ich einen Schritt zurück neben Ken trat, bemerkte ich etwas, das wie ein türkisfarbenes Band aussah, das vom Zweig eines Strauchs in der Wand des Zenote direkt gegenüber von uns herabhing. Die aufgehende Sonne ließ die Farbe hervortreten, und nun sah ich, dass es ein langer Federschwanz war, der an zwei schlanken Bändern zu hängen schien, die ich zu dem halb im Busch verborgenen Vogel zurückverfolgte.
»Könnte das ein Quetzal sein?«, fragte ich Ken und zeigte mit dem Finger darauf.
»Die kommen nicht so weit nach Norden«, sagte er.
Der Vogel kam nun ganz zum Vorschein, und ich sah, dass er rostbraun gefärbt war, mit einer türkisen Markierung auf dem Kopf, die zum Schweif passte. »Das ist ein türkisstirniger Motmot«, sagte Ken gebieterisch und sprach die erste Silbe dabei mit einem langen O aus. Es war nicht das erste Mal, dass Ken Arnold mich überraschte, weder heute noch irgendwann. »Lass uns in die Gänge kommen«, nuschelte er und gab dem Kranführer ein Zeichen. Mit viel Gestikulieren und Deuten gab er seine Anweisungen, während ich zum Land Cruiser zurückging, um unser Equipment auszuladen.
Wir hatten uns am Abend zuvor auf die Ausrüstung geeinigt. Es war nicht nötig, eine vollständige Montur zum Höhlentauchen zu verwenden, wobei man bis zu sechs Sauerstoff- oder Pressluftflaschen mit sich führt, nicht auf dem Rücken befestigt, sondern in einem Gurt um den Körper herum, damit man durch enge Durchgänge schwimmen kann und genügend Luft zum Überleben hat – die Faustregel lautete: ein Drittel für den Hinweg, ein Drittel für den Rückweg und ein Drittel für Notfälle. Wir würden auf unserem ersten Tauchgang jedoch sehr wahrscheinlich keine unterirdischen Passagen erkunden, das Ganze würde eher freiem Tauchen in einem kleinen See ähneln. Deshalb entschieden wir uns für zwei auf dem Rücken montierte Flaschen, mit denen wir eine Stunde oder länger unten bleiben konnten. Ken hatte in seinem Geländewagen außerdem einen tragbaren Kompressor mitgebracht, mit dem wir die Flaschen im Lauf des Tages auffüllen konnten.
Während die Bauarbeiter zwei Ketten um eine Holzpalette wickelten, die sie von der Ladefläche des LKWs geholt hatten, begannen wir, unsere Ausrüstung anzulegen.
Wir schlüpften in drei Millimeter starke Neoprenanzüge, Kapuzen und Taucherstiefel, der Anzug von Ken nüchtern, männlich, schwarz mit gelben Schläuchen, meiner blaugrün mit einem orangefarbenen Tauchoverall darunter, eine Kombination, die mich an den Motmot erinnerte. Dann zogen wir unsere aufblasbaren Tarierwesten darüber, die als Auftriebsausgleich, Geschirr für die Atemlufttanks und Halterung für die Bleigewichte in einem dienten. So in der Schwebe zu bleiben, dass sich kaum ein Millimeter Bewegung nach oben oder unten feststellen lässt, ist eine lebenswichtige Fähigkeit, wenn man durch schlammbedeckte Gänge und Kammern schwimmt, weil es zu null Sicht führen kann, wenn man dagegenstößt. Und für mich war es äußerst nützlich, wenn ich nahe an zerbrechlichen Korallen arbeitete.
Da wir schlechte Sicht erwarteten, war jeder von uns mit zwei Hundert-Watt-Tauchlampen ausgerüstet, die Hauptlampe am Handrücken befestigt und von einer Batterie an der Hüfte mit Strom versorgt, die Ersatzlampe am Geschirr. Die Sonne über uns würde uns als dritte Lichtquelle dienen. Licht, oder vielmehr Mangel an Licht, ist eine häufige Todesursache beim Höhlentauchen, einer der gefährlichsten Sportarten der Welt. Unerfahrene Taucher werden davor gewarnt, eine Lichtquelle mit in Höhlen zu nehmen, da sie versucht sein könnten, weiter vorzudringen, während sie ohne Licht erst gar nicht in Schwierigkeiten geraten. Und Taucherneulinge setzt man an irgendeinem Punkt ihrer Ausbildung dem klaustrophobischen Schrecken aus, mit abgeschaltetem Licht tief in den wassergefüllten Eingeweiden der Erde zu schweben.
Wir trugen beide eine Konsole am Handgelenk, mit Tiefenmesser, Luftdruck- und Kompassanzeige sowie einem Digitalrechner, um unseren Blutstickstoffgehalt und die relevanten Dekompressionszeiten zu überwachen – wobei wir uns wegen einer Stickstoffvergiftung natürlich keine Sorgen zu machen brauchten, da wir wahrscheinlich nicht längere Zeit tiefer als zehn Meter tauchen würden. Eine Spule mit mehr als dreihundert Meter verdrehter Führungsleine aus Nylon, die mit einem Karabinerhaken an unseren Westen befestigt war, und ein kurzes, an den Oberarm geschnalltes Messer komplettierten unsere Überlebensausrüstung.
Nachdem wir uns gegenseitig mit unseren Flaschen geholfen und Druckmesser, Schnellabwurfschließe und Lungenautomaten einschließlich des Zusatzgeräts für Notfälle überprüft hatten, kamen wir mit dem schweren, klirrenden Gang von Tauchern an Land hinter dem Fahrzeug hervor. Jeder von uns hatte ein Paar Flossen in der Hand und eine Silikonbrille mit eingekerbter Linse wie ein zweites Augenpaar auf der Stirn sitzen. Schnorchel und Atemschläuche ließen uns vollends wie frisch gelandete Außerirdische aussehen.
Der Kran war probehalber einmal über den Zenote geschwenkt und brachte unsere Plattform nun an den Rand zurück; die zwei Ketten bildeten ein umgedrehtes V im Griff des Hakens. Ich bemerkte, dass eine Reihe von Zementblöcken in dem offenen Spalt zwischen den beiden Ebenen der Palette steckten und als Ballast dienten. Die Plattform kam anderthalb Meter über dem Boden zum Stehen, und einer der Arbeiter schraubte eine Metallklammer an die Front eines Bretts auf der Unterseite.
»Lass mich raten«, sagte ich zu Ken. »Wir beginnen die Suche von einem festgelegten Punkt aus?«
»Ja«, sagte er und trat an den Rand. »So, nun stell dir vor, du würdest von hier aus einen schweren Stein werfen – was meinst du, wo er versinken würde?«
»Wir könnten es einfach ausprobieren.«
»Das würde zu viel Schlamm aufwühlen. Was schätzt du?«
»Nicht weit – vielleicht drei Meter vom Rand.«
»Gut. Und genau da wirst du suchen, während ich von der Mitte her auswärts kreise.« Er gab dem Kranführer ein Zeichen, der senkte die Palette, und wir stiegen hinauf. Ken winkte noch einmal, wir hielten uns an je einer Kette fest, und die Plattform wurde angehoben, blieb jedoch stehen, als Ken erneut den Arm hob. Er zog ein wenig Leine von seiner Spule und bedeutete dem Mann, der die Klammer angeschraubt hatte, herzukommen. Ken gab ihm den Karabiner am Ende seiner Leine und deutete auf die Palette hinunter. Der Mann verstand und befestigte die Leine an der Klammer.
Wir begannen, uns erneut nach oben zu bewegen und gleichzeitig auf den Zenote hinaus, doch als wir gerade dessen Rand hinter uns gelassen hatten, hörten wir das Heulen einer Polizeisirene. Entlang der Piste, auf der wir heruntergekommen waren, stieg eine Staubwolke aus dem Dschungel auf und raste auf uns zu. Dann brach ein Streifenwagen der PJE aus dem Wald hervor und kam neben dem Kran zum Stehen, der uns inzwischen sanft zur Mitte hinschwenkte.
Sanchez sprang aus der Beifahrertür und gestikulierte dem Kranführer, er solle warten. Nach Sanchez stieg ein finster dreinblickender, uniformierter Fahrer aus und öffnete die hintere Tür des Streifenwagens. Langsam kletterte Dr. de Valdivia aus dem Fond und trat neben Sanchez, der die Hände um den Mund wölbte und rief: »Viel Glück, amigos.«
Wir winkten zurück, während Dr. de Valdivia aufmunternd seinen Spazierstock hob.
Dann setzten wir uns wieder in Bewegung. Aus unserer neuen Perspektive wirkte die Wasserfläche wesentlich größer, und der Kranarm musste weiter ausfahren, um uns bis zu dem Punkt zu bringen, wo Ken dem Führer das Zeichen zum Anhalten gab.
Wir spähten beide nach unten.
»Sieht aus, als wäre die Mitte relativ frei von Algen«, sagte Ken und deutete mit gesenktem Daumen zum Kranführer.
Der Abstieg war, als würden wir in die Pupille eines riesigen Auges hinabgelassen, ein glänzendes schwarzes Loch, umgeben von einer trüben, grünen Iris.
»Es ist unheimlich«, sagte ich. »Außer uns beiden waren nicht viele Leute in diesem Wasser, die eine Chance hatten, lebend wieder herauszukommen.«
»Na, dann viel Spaß bei der Kopfjagd«, sagte Ken und grinste boshaft.
Kapitel 6
Wir nutzten die Zeit, in der wir hinabgesenkt wurden, um uns auf die Plattform zu setzen und unsere Flossen überzustreifen. Dann standen wir auf, und Ken wartete, bis die Plattform die Oberfläche durchbrach, ehe er ein Zeichen gab. Das grünliche Wasser umspülte unsere Knie, bevor die Palette zum Stillstand kam. Das war eine ideale Tiefe für den Einstieg, noch wichtiger aber war, dass wir damit auch leicht wieder zurück auf die Plattform kamen. Als das Wasser durch meinen Tauchanzug drang, spürte ich, dass es lauwarm war; der scharfe Geruch pflanzlicher Verwesung stieg von ihm auf.
»Wer als Letzter drin ist, gibt eine Runde aus«, sagte Ken, spuckte auf die Innenseite seiner Maske und verschmierte den Speichel, ein Trick, mit dem Taucher verhindern, dass die Brille anläuft. Dann merkte er, dass er den Speichel nicht abwaschen konnte, es sei denn, er benutzte das faulige Wasser des Zenote.
»Tu’s nicht«, warnte ich ihn. »Du kannst das hier haben, wenn ich fertig bin.« Ich hatte eine Sprühflasche aus Plastik aus einer Tasche meiner Weste geholt und spülte damit meine Taucherbrille aus.
»Sieht aus wie mein Anginaspray.«
Ich gab ihm die Flasche.
»Igitt, Parfüm«, sagte er, als er das Etikett las.
»Nein, reines Wasser. Ich denke eben immer voraus.«
Er brummte etwas, besprühte einige Male seine Maske und gab mir die Flasche dann zurück. Als er den Riemen der Brille dehnte, um sie aufzusetzen, bemerkte ich, dass er an einer Stelle schon ganz dünn war. Ken trug eine altmodische Taucherbrille mit einer Neopreneinfassung anstatt einer aus Silikon.
»Ich glaube, deine Maske ist nicht mehr die jüngste«, sagte ich. »Zeit für eine neue.«
»Das Schusterkind geht in den ältesten Schuhen«, sagte er und spielte damit auf die Tatsache an, dass er einen Taucherladen besaß und jeden Tag eine neue Maske tragen konnte, wenn er wollte. Aber dieser Widerspruch war typisch für ihn.
»Du bist Letzter«, rief ich, setzte mein Mundstück ein und ließ mich ins Wasser gleiten. Dann holte ich Luft und tauchte unter.
Es war, als würde man in Gemüsebrühe getunkt. Ich sah mich um, konnte jedoch nur sehr wenig erkennen in dem düsteren Licht. Ich machte einen Flossenschlag und nahm einen Hauch von Schwefel durch meinen Atemregulator wahr. Als ich wieder nach oben zum Licht blickte, sah ich, dass ich nun durch eine orangefarbene Flüssigkeit schwamm. Der Schwefelwasserstoffgeruch verriet mir, dass es sich um eine Schicht aus Bakterien handelte, die sich an dem Laub und Kot, den Insekten und Federn gütlich taten, die unablässig in den Teich rieselten und in den Algen hängen blieben.
Dann war Ken neben mir, und wir schalteten unsere Lampen an. Rings um den klaren Bereich in der Mitte hingen gelbgrüne Algen herab wie schleimiges Louisianamoos oder in knotigen Klumpen wie Goldregen, und in sie verwoben war die orangefarbene Bakterienschicht wie Nebel auf einem Science-Fiction-Filmplaneten. Wir befanden uns etwa zwei Meter unterhalb der Oberfläche, aber schon jetzt trug das Sonnenlicht so gut wie nichts mehr zur Sicht bei. Wir richteten unsere Lampen auf den Grund, und die Strahlen prallten von einem undurchdringlichen Schleier ein kurzes Stück vor unseren Masken zurück. Als wir abwärts schwammen, warf ich einen letzten Blick nach oben, wo unsere Plattform im Halo eines trüben Sonnenlichts auf Postkartengröße schrumpfte.
Wir kamen nun in beinahe völlige Dunkelheit. Ich schaute auf meinen Tiefenmesser. Wir waren erst sechs Meter unter der Oberfläche.
Plötzlich stießen wir in einen Bereich mit verblüffend klarem Wasser vor. Als wir unsere Lampen umherschwenkten, durchdrangen die Strahlen den Zenote bis zu den schlammbedeckten Wänden in dreißig Meter Entfernung. Sechs Meter tiefer trafen die Wände auf den Boden, der dann steil zur Mitte hin bis auf eine Tiefe von zwölf Metern unter uns abfiel, als würde er in ein Loch abfließen. Ken und ich waren wie zwei Stäubchen, die in einer Sanduhr schwebten und in den Ablauf hinabblickten. Die Vorstellung, ich befände mich in einer Eieruhr, brachte mich sofort auf zwei entmutigende Gedanken: zum einen, dass ich überhaupt nicht auf den Boden des Zenote schaute, sondern auf eine schwarze Schlammschicht mit glatter, nur leicht flockiger Oberfläche. Und zum anderen, dass weiter unten eine zweite Kammer existierte, eine Höhle von ähnlicher Größe wie der Auffangbehälter, in den wir getaucht waren. Das war zwar nicht erwiesen, aber die Form des Schlammbodens legte es doch sehr nahe.
In dieser Umgebung fehlte jedoch etwas, was mir als Biologin sofort auffiel: Es gab keinerlei Anzeichen von tierischem Leben. Man könnte meinen, ins Sonnenlicht getauchte Zenoten würden eine üppige Fauna beherbergen, aber überraschenderweise schwimmen Wassergeschöpfe nur in den finstersten Winkeln unterirdischer Höhlen umher.
Ken unterbrach meine Gedanken. Er signalisierte mir, dass er nun mit seiner systematischen Inspektion des Bodens beginnen würde, was auch bedeutete, dass er mit jeder Runde, die er vollendete, mehr Leine lassen würde, wie eine Spinne beim Netzbau. Da das Wasser klar war, würden wir einander im Auge behalten können, ich entfernte mich deshalb von ihm, um unterhalb der Steilwand nachzusehen, von der Goldbergs Mörder den abgetrennten Kopf geschleudert hatten.





























