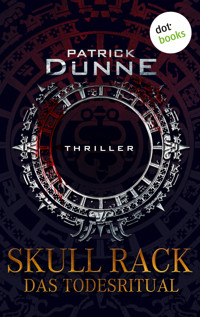5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Illaun-Bowe-Thriller
- Sprache: Deutsch
Wenn ein dunkles Geheimnis unter der Erde lauert: Der packende Irland-Thriller »Die Pestglocke« von Patrick Dunne jetzt als eBook bei dotbooks. Ein irisches Dorf wird in Angst und Schrecken versetzt: Als eine Leiche in Castleboyne gefunden wird, soll der Ort plötzlich abgeriegelt werden – denn der Tote scheint an einer längst ausgerotteten Seuche gestorben zu sein. Aber wie ist das möglich – und kann es einen Zusammenhang geben mit der geheimnisvollen Madonnenfigur, die gerade bei Ausgrabungen auf dem alten Pestfriedhof entdeckt wurde? Die Archäologin Illaun Bowe stürzt sich fieberhaft in die Recherche und versucht herauszufinden, was wirklich geschehen ist. Doch dann erschüttert ein brutaler Ritualmord den Ort – und nur Illaun erkennt, dass die beiden Todesfälle auf grausige Weise zusammenhängen. Kann sie den Mörder finden? Fesselnd wie ein Kino-Blockbuster: »Patrick Dunnes Thriller bescheren Gänsehaut!« Münchner Merkur Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der fesselnde Thriller »Die Pestglocke« ist der zweite Band von Patrick Dunnes Thrillerreihe um die Archäologin Illaun Bowe. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 472
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ein irisches Dorf wird in Angst und Schrecken versetzt: Als eine Leiche in Castleboyne gefunden wird, soll der Ort plötzlich abgeriegelt werden – denn der Tote scheint an einer längst ausgerotteten Seuche gestorben zu sein. Aber wie ist das möglich – und kann es einen Zusammenhang geben mit der geheimnisvollen Madonnenfigur, die gerade bei Ausgrabungen auf dem alten Pestfriedhof entdeckt wurde? Die Archäologin Illaun Bowe stürzt sich fieberhaft in die Recherche und versucht herauszufinden, was wirklich geschehen ist. Doch dann erschüttert ein brutaler Ritualmord den Ort – und nur Illaun erkennt, dass die beiden Todesfälle auf grausige Weise zusammenhängen. Kann sie den Mörder finden?
Fesselnd wie ein Kino-Blockbuster: »Patrick Dunnes Thriller bescheren Gänsehaut!« Münchner Merkur
Über den Autor:
Patrick Dunne wurde in Dublin geboren und studierte Literatur und Philosophie. Nach dem Studium war er eine Zeitlang Musiker. Inzwischen ist er seit über 20 Jahren als Regisseur und Produzent beim irischen Rundfunk und Fernsehen tätig. Mit seinem Debütroman »Die Keltennadel« gelang ihm ein internationaler Bestseller. Patrick Dunne gehört heute zu den erfolgreichsten Autoren Irlands.
Patrick Dunne veröffentlichte bei dotbooks bereits »Die Keltennadel« und »Skull Rack – Das Todesritual«, sowie die Illaun-Bowe-Trilogie mit den Thrillern »Das Keltengrab«, »Die Pestglocke« und »Die Opferstätte«.
***
eBook-Neuausgabe April 2023
Die englische Originalausgabe erschien erstmals 2006 unter dem Originaltitel »The Lazarus Bell« bei Gill & Macmillan Ltd, Dublin.
Copyright © der englischen Originalausgabe 2006 by Patrick Dunne
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2008 by Limes Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Jim Dwyer, David K Photography, neady, Madlen
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-98690-506-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Pestglocke« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Patrick Dunne
Die Pestglocke
Thriller
Aus dem Englischen von Fred Kinzel
dotbooks.
Für meine geliebte Frau Thekla
und im Gedenken an Sheila
Eine düstre kleine Blume,
in der Trauerfarbe des Verfalls
VITA SACKVILLE-WEST
Prolog
An der Biegung des Bachs hatte die Wasserströmung eine Vertiefung im grasbewachsenen Ufer ausgehöhlt. Unter der Böschung war eine Sandbank entstanden, und dahinter drehte sich der Bach in trägen Wirbeln unter einer überhängenden Weide. Treibgut verfing sich häufig dort und kreiste unablässig an Ort und Stelle, bis eine Unregelmäßigkeit in der Strömung oder ein Windstoß es wieder befreite. Im Sommer trugen blühende Schlingpflanzen zur Anziehungskraft des Strudels bei.
An einem Freitagmorgen im Mai stützte sich Arthur Shaw auf das Geländer einer hölzernen Fußgängerbrücke über den Bach und betrachtete die Szenerie. Die Sonne hatte das Wasser unter ihm in durchscheinenden Honig verwandelt. Darüber schwebten und flitzten metallisch rote Libellen. Von einer nahen Wiese wehte der Duft von Mädesüß heran, und unter den schattigen Bäumen flussabwärts plätscherte der Bach an moosbewachsenen Kalksteinfelsen vorbei. Oben in der Biegung schaukelte eine Matte aus gelbem und weißem Krähenfuß in der Strömung. Arthur fühlte sich an seine Jugend erinnert, an die Zeit bevor das Flussbett des Boyne und mit ihm alle Inseln, Wehre und Mühlgerinne auf dem größten Teil seines Laufs für eine bessere Entwässerung der Felder und Wiesen zerstört wurden.
Das Geflecht des Krähenfußes erinnerte ihn noch an etwas anderes ‒ an eines seiner Lieblingsgemälde: Ophelia, die in einem Bach auf einer Bahre aus Blumen lag. So wie manche Leute Stillleben, Winterlandschaften oder Bilder von Pferden mochten, sprach ihn alles an, was mit Flüssen zu tun hatte, umso mehr, wenn es sich um ein tragisches Motiv handelte. Denn obwohl der alternde Arthur Shaw im 21. Jahrhundert lebte, gehörte sein Herz der viktorianischen Zeit an: schmiedeeiserne Fassade ‒ und im Innern plüschweich.
Nach dieser kurzen Meditation wollte Arthur seinen Spaziergang durch Brookfield Garden fortsetzen, als er stromaufwärts etwas im Wasser glitzern sah. Er verließ die Brücke und ging einige Meter am Ufer entlang, um einen besseren Blick zu haben. Enttäuscht stellte er fest, dass es nur eine Bierdose auf dem Grund des Gewässers war, die das Sonnenlicht reflektierte. Es verdross ihn. Schlimm genug, dass junge Leute Getränke mit in den Garten brachten, aber dass sie ihren Müll dann hier abluden, war unverzeihlich. Trotz all ihrer Proteste gegen die Verschmutzung des Planeten ging diese Generation nicht liebevoller mit den Flüssen und Bächen um als jene von Amts wegen autorisierten Vandalen des 20. Jahrhunderts, die den Boyne zugrunde gerichtet hatten.
Dann bemerkte Arthur noch etwas, diesmal machte ihn sein Geruchssinn darauf aufmerksam. Ein totes Schaf oder Lamm, dachte er. Sie ertranken manchmal in den Frühjahrsfluten, wurden flussabwärts gespült und verfingen sich in der Aushöhlung an der Biegung.
Er sah, dass tatsächlich etwas Sperriges in den Schlingpflanzen hing, aber es war kein Schaf. Es sah aus wie ein Sack. Fliegen surrten in Scharen darum herum. Jemand hat einen Wurf Kätzchen ertränkt, dachte er, duckte sich unter die Weide und näherte sich dem Uferrand.
Er hatte seinen Spazierstock dabei. Er half ihm, die von einem Schlaganfall geschwächte Körperseite abzustützen. Mit einiger Mühe kletterte er auf einen Fleck trockenen Sandes unter der Böschung und stieß den Sack mit dem Stock an. Anstatt aus dem Pflanzengewirr zu treiben, drehte sich der Sack jedoch um die eigene Achse, und etwas, was daran befestigt war, stieg aus dem Wasser auf.
Es war ein Fuß. Und es musste der Fuß einer Frau sein, da einige Zehen purpurn lackiert waren. Arthur sah, dass die Haut des Leichnams seltsam gefleckt war, wie das Gefieder einer Elster. Er blinzelte heftig, weil er glaubte, das gesprenkelte Licht unter dem Baum könnte ihn getäuscht haben.
Die gescheckte Haut war nicht die einzige Merkwürdigkeit. Auf Millais’ Gemälde war Ophelias Gesicht aufwärts gerichtet, und ihre langen Locken trieben in der Strömung. Das Gesicht dieser Frau war zunächst nicht sichtbar, oder jedenfalls schien es ihm so. Doch als der aufgedunsene Rumpf eine weitere Drehung in der Strömung vollführte, sah er, dass von ihrem Kopf nichts übrig war als ein knöcherner Stiel, der zwischen den Schultern emporragte.
Kapitel 1
Der Unfall mit dem Bleisarg geschah am anderen Ende von Castleboyne, etwa zur selben Zeit, als Arthur Shaw seinen Spaziergang machte. Meine archäologische Beratungsfirma, Illaun Bowe Consulting, hatte einen mittelalterlichen Friedhof am ursprünglichen Ortsrand der Stadt ausgegraben, und wir bereiteten uns gerade darauf vor, die Grabungsstätte an die lokalen Behörden zu übergeben. Und da passierte es.
Kurz zuvor war ich dabei gewesen, einen cremefarbenen Leinenblazer mit Rock anzuprobieren, als ich einen aufgeregten Anruf von Gayle Fowler, einer Mitarbeiterin meines Teams, erhielt. Gayle vertrat mich vor Ort bei der Ausgrabung. Ich selbst musste einen Termin mit einem Vertreter der Stadtverwaltung wahrnehmen, um das Projekt, das seit Ostern den größten Teil meiner Zeit beansprucht hatte, offiziell abzuschließen. Aus irgendeinem Grund war ich jedoch mit dem Kostüm nicht zufrieden, obwohl ich das weiße Baumwolltop mit dem V-Ausschnitt, das ich darunter trug, sehr mochte.
»Wir haben zwei Särge entdeckt …« Gayle war außer Atem. »Mit Blei ausgekleidet ... genau außerhalb des umzäunten Grabungsgeländes … In der Nähe der Kapelle hat der Boden an einer Stelle nachgegeben, als wir mit der Wiederaufschüttung begannen. Du musst herkommen, Illaun.«
Ich konnte ihre Begeisterung nachvollziehen. Keiner der menschlichen Überreste war in irgendwelchen Behältern begraben gewesen, von Bleisärgen ganz zu schweigen.
»Sind sie intakt?«
»Einer scheint voll Wasser zu sein. Der andere … Am besten, du siehst es dir selbst an.«
»Wenn es darum geht, dass er weiches Gewebe enthält, weißt du ja, was zu tun ist. Man wird es in starke Plastikfolie schließen und wieder vergraben müssen.
»So ist es aber nicht. Deshalb brauchen wir dich hier.«
Ich sah auf die Uhr. War das die Ausrede, die ich gebraucht hatte, um das Kostüm wieder auszuziehen? Helles Leinen war nicht eben die beste Aufmachung, um zu einer Ausgrabung zu gehen, und ich musste ohnehin erst abnehmen, ehe ich es tragen konnte. Es blieb gerade noch genügend Zeit, um mich umzuziehen, zur Ausgrabungsstelle zu fahren und es trotzdem zu meinem Termin zu schaffen.
»Okay, ich komme. Fasst das Blei inzwischen so wenig wie möglich an. Sag allen, sie sollen Schutzkleidung anziehen. Und Helme in der Nähe der Einsturzstelle tragen.«
Das Team war daran gewöhnt, Schutzanzüge einschließlich mikrobiologischer Atemmasken zu tragen. Bei unserer Ausgrabung handelte es sich um ein Massengrab, belegt von Opfern des Schwarzen Todes.
Die Straße von Dublin her gabelte sich an der Einfahrt zum alten Castleboyne, und in dem V lag hinter einer niedrigen Steinmauer eine Wiese, die leicht anstieg. Die meisten Leute, die hier vorbeikamen, wussten wohl nichts über die Geschichte des Ortes. Es gab keine Grabsteine, Kreuze oder sonstige Markierungen; den einzigen Hinweis lieferte die hügelige, unebene Oberfläche unter dem Gras. Früher einmal hatten sich hier ein Krankenhaus der Magdalenerinnen, eine Kapelle und ein Friedhof befunden. Das Gelände war nun wabenförmig von Gräben durchzogen, die von einem riesigen Waffeleisen hätten stammen können. Sie sollten gerade wieder aufgefüllt werden, als weiter oben das Erdreich nachgegeben hatte. Dort sah ich Mitglieder meines Teams, die um ein klaffendes Loch in einer von Gras bewachsenen Böschung kauerten. Darüber ragten eine Mauer und die Giebelseite einer verfallenen Kapelle auf. Auf einer Seite meiner Leute waren Fundstücke aufgehäuft und war ein zerlegtes Gerüst gestapelt, auf der anderen stand ein gelber Bagger.
Gayle sah mich kommen und löste sich von den anderen. Genau wie ich hatte sie einen weißen Schutzhelm auf, unter dem gekräuseltes schwarzes Haar hervorlugte. Sie trug eine Brille mit untertellergroßen Gläsern, ausgebeulte Jeans und ein schwarzes T-Shirt, das sich im Sommerwind blähte. Gayle hatte in letzter Zeit stark abgenommen, es jedoch versäumt, entsprechende neue Kleidung zu kaufen. Zunehmend besorgt stellte ich fest, dass der Helm das Einzige war, was sie an Schutzausrüstung trug.
»Hallo, ganz schön aufregend, was?«, sagte sie.
»Was genau ist passiert?«
»Der Baggerführer wollte eben mit der Wiederaufschüttung beginnen, als er bemerkte, dass der Boden unter einem der Kettenräder absackte. Er konnte sein Gefährt gerade noch zurücksetzen, ehe der Untergrund ganz einbrach und ein teilweise eingestürztes Gewölbe unterhalb der Mauer zum Vorschein kam. Es muss früher einmal zur Kirche gehört haben und war gerade groß genug, dass es den beiden Särgen Platz bot. Wir haben einen davon heraufgeschafft ‒ den kleineren.« Sie ging in Richtung eines rechteckigen, aschgrauen Behälters voran, der auf dem Hang im Gras stand. Als ich ihr über die Holzplanken und Raine zwischen den Gräben folgte, war ich froh, dass ich eine Cargohose und leichte Wanderschuhe trug. Ich hatte immer noch das weiße Top an, aber wenn ich mein Businesskostüm, die Aktentasche und hochhackige Sandalen zu dem Helm getragen hätte, hätte ich ausgesehen wie einer der Politiker oder Behördenvertreter, die im Lauf der Monate häufig auf dem Ausgrabungsgelände erschienen waren. Als wir näher zu dem Sarg kamen, der etwa zehn Meter von der Einsturzstelle entfernt stand, bemerkte ich Roststreifen an den Seiten, wahrscheinlich alles, was von den Eisenbändern übrig geblieben war, die das längst verfaulte Holz des Sarges einmal zusammengehalten hatten.
»Wie habt ihr ihn da herausgebracht?«, fragte ich.
»Mit Gerüststangen als Rollen und Planken als Hebel. Dann haben wir Seile darum geschlungen und ihn mit dem Bagger herausgehoben. Der Trupp arbeitet jetzt an dem größeren Sarg. Er scheint, wie gesagt, voll Wasser gelaufen zu sein. Man hört etwas darin herumschwappen.«
Als sie das vorhin erwähnte, hatte es bei mir ein schwaches, aber hartnäckiges Signal ausgelöst, wie ein ferner Hausalarm. Ich schaute zum Bagger hinüber. Auf den Köpfen der Leute, die ich sah, saßen zumindest Schutzhelme, und einige der Arbeiter hatten außerdem weiße Overalls und Gesichtsmasken übergezogen. Ich öffnete meine Aktentasche und entnahm ihr eine weiße Staubmaske und zwei Paar strapazierfähige Gummihandschuhe.
»Das ist nicht nötig, glaub mir«, sagte Gayle und tätschelte mir aufmunternd den Arm, während ich die Handschuhe überstreifte und die Maske über den Mund zog.
»Das beurteile ich lieber selbst«, sagte ich, wobei die Autorität in meiner Stimme durch die Maske etwas gedämpft wurde. Da wir die meiste Zeit im Freien gearbeitet und nur mit Knochen zu tun gehabt hatten, und da Krankheitskeime in Skelettresten üblicherweise höchstens fünfzig Jahre überdauern, war es verständlich, dass die Mannschaft eine lockere Einstellung dazu entwickelt hatte, was das Tragen von Schutzkleidung betraf, erst recht an einem warmen Sommertag wie diesem. Doch fest verschlossene Bleisärge können tödliche Krankheiten beherbergen, und Bleistaub kann Sporen und Eier von Parasiten durch die Luft befördern.
Ich wollte Gayle eben den Hang hinauf folgen, als uns ein Warnruf abrupt anhalten ließ. Am oberen Ende der Wiese wurde der andere Sarg gerade in einer Seilschlinge am Baggerarm nach oben gezogen. Der schwere Bleibehälter drehte sich langsam in der Luft, als der Baggerführer ihn in unsere Richtung schwenkte, offenbar in der Absicht, ihn neben dem anderen Sarg abzusetzen. Mir war nicht ganz wohl bei der Sache. Wenn der Sarg voll Wasser war, dann war er vermutlich beschädigt, und das bedeutete, sein Inhalt konnte möglicherweise auslaufen, oder er fiel ganz auseinander, ehe wir ihn in starke Kunststofffolie verpacken konnten.
Da noch einige Meter bis zu seinem Ziel fehlten, begann der Bagger langsam den Abhang herunterzukriechen. Gayle und ich wichen ihm aus, behielten den kreiselnden Sarg jedoch im Blick. Ohne Vorwarnung machte der Bagger einen Satz zur Seite, als der Boden unter seinen Raupenketten nachgab und zu dem Gewölbe hin abrutschte, in dem sich die Särge befunden hatten. Die Arbeiter stoben fort von der Maschine, die sich bedenklich neigte und auf die Seite zu fallen drohte. Gayle und ich standen wie angewurzelt da, als könnte jede Regung von uns sie umkippen lassen.
Einige Mitglieder des Teams schrien dem Baggerführer zu, er solle die Kabine verlassen, aber der behielt das Gerät unter Kontrolle, und es gelang ihm, zurückzusetzen und wieder in eine aufrechte Position zu gelangen. Inzwischen schaukelte jedoch der nur provisorisch befestigte Sarg wild hin und her. Eins der Seile rutschte plötzlich ab, und der Sarg kippte in steilem Winkel nach unten. Ich war nun ernsthaft beunruhigt.
Gayle machte sich instinktiv auf den Weg nach oben zum Bagger. »Halt«, warnte ich. »Komm ihm lieber nicht zu nahe.«
Während der Baggerführer zögerte, unschlüssig, wohin er den rotierenden Sarg manövrieren sollte, langte einer der Arbeiter hinauf, um ihn zum Stillstand zu bringen. Er rief den anderen zu, ihm zu helfen. Ich erkannte ihn als Terry Johnston, einen erfahrenen Ausgräber ‒ einer, der sich seinen Lebensunterhalt damit verdiente, von einer Ausgrabung zur nächsten zu eilen. Und natürlich war Terry nur mit einem ärmellosen Trikot und Shorts bekleidet, die seine sehnigen, streichholzdünnen Arme und Beine sehen ließen, während er dem Fahrer Zeichen machte.
»Zurück, Terry«, rief ich.
Der Sarg drehte sich wieder von ihm fort, und er beschloss, zu bleiben, wo er war. Aber wie ein Pendel schwang der Behälter zurück, und ich sah etwas aus der unteren Ecke hängen, das ich zunächst für eine dicke Spinnwebe hielt. Dann fiel das Sonnenlicht darauf.
Ich rannte auf Terry zu und wedelte mit den Armen. »Weg hier, um Himmels willen!«
Eine Flüssigkeit lief aus dem Sarg.
Terry begann zurückzuweichen, aber er stolperte und fiel auf den Rücken. Dann gab der Boden des Sarges nach, der Stütze beraubt, die ihm die Erde jahrhundertelang geboten hatte. Terry schrie entsetzt auf, als sich eine dunkle, dickflüssige Flüssigkeit auf ihn ergoss.
Wir alle rannten los, um ihm zu helfen. Doch der Gestank ließ uns nach wenigen Schritten wie angewurzelt stehen bleiben.
Kapitel 2
Während die Männer den splitternackten Terry hinter dem Bagger abspritzten, näherten Gayle und ich uns der Stelle, wo sich die Flüssigkeit ergossen hatte, und sahen, dass sie rasch in die von einer langen regenlosen Zeit trockene Erde einsickerte. Ich machte dem Baggerführer ein Zeichen, den tropfenden Behälter sofort abzusetzen. Das verbliebene Seilnetz hatte zwar verhindert, dass der Bleiboden auf Terry gefallen war, aber es gab keine Garantie, dass er halten würde.
Ich händigte Gayle meine Autoschlüssel aus. »Hinten drin liegen ein paar Probengläser. Hol welche her, dann versuchen wir, etwas von dem Zeug einzusammeln.«
Gayle verzog das Gesicht und machte sich auf den Weg. Derbes Gelächter erklang vom Ende der Wasserleitung her, wo Terry ausgiebig mit dem Schlauch abgespritzt wurde, mit dem wir bei Ausgrabungen von Zeit zu Zeit die Erde anfeuchteten. Zweifellos versuchten ihn seine Kollegen nach diesem Erlebnis wieder aufzubauen.
Ich beobachtete, wie sich der Sarg dem Boden näherte. Plötzlich rutschte er aus seiner Halterung, drehte sich in eine senkrechte Position, und etwas Festes fiel auf die Erde. Es war ein Haufen geschwärzter Knochen, und sie landeten nicht mit einem Klappern, sondern klatschten mit dem dumpfen Geräusch von nassem Rasen auf.
Der gesamte Sarg rutschte nun endgültig aus den Seilen. Er landete hochkant, blieb zunächst einige Sekunden lang aufrecht stehen und kippte dann keine zwei Meter von mir entfernt auf den Boden, dass die Erde unter meinen Füßen zitterte.
»Mann, das war aber knapp«, sagte Gayle, die soeben mit den in Papiertüten verpackten Probengläsern zurückkam.
»Knapp? Das Ganze hier wird zunehmend zum Desaster, Gayle. Ich wünschte, du hättest … ach, egal.« Ich musste der Versuchung widerstehen, meinen Frust an ihr auszulassen. Auch wenn ich fand, dass sie mit der Entfernung der Särge vorschnell gehandelt hatte, hätte ich sie wahrscheinlich dafür kritisiert, nicht die Initiative ergriffen zu haben, wenn das Gewölbe eingestürzt wäre, ehe wir sie herausholen konnten.
Der abgestürzte Sarg lag verkehrt herum auf dem Grashang, der teilweise herausgebrochene Boden ganz oben. Er sah aus wie eine übergroße, halb offene Sardinendose. Ein Belag aus pulverisierten Knochen verteilte sich ringsum, aber der größte Teil der nach außen gefallenen Masse lag darunter, wahrscheinlich zermalmt.
Im Innern des Behälters klebten noch immer Rückstände eines schwarzen, faulig riechenden Glibberzeugs an den Oberflächen. Es handelte sich zweifellos um »Leichensuppe« ‒ eine dicke Flüssigkeit, die beim Zerfall menschlichen Gewebes entsteht.
»Du liebe Güte, das riecht ja grauenhaft«, sagte Gayle. Sie schluckte heftig, um gegen den Brechreiz anzukämpfen.
Ich musste zugeben, dass der Gestank wahrhaft widerwärtig war. Und in der Mittagshitze schien er in zunehmend beißenden Wellen zu uns aufzusteigen.
»Bleib ein bisschen zurück«, sagte ich und schob mir die Maske wieder über Mund und Nase.
Ein Blick ins Innere des Sarges zeigte, dass er ansonsten leer war. Eine braune Linie auf einem Drittel der Höhe markierte, wie hoch die Flüssigkeit darin gestanden hatte, ehe sie auslief. Ich war enttäuscht, keine weiteren Knochen vorzufinden. Alter oder Geschlecht der Person zu bestimmen, würde unmöglich sein. Es blieb nichts zu tun, als ein wenig von den Rückständen abzukratzen und in einem luftdichten Behälter aufzubewahren, damit sie nicht unter der Einwirkung von Licht und Luft weiter zerfielen.
Gayle reichte mir eines der sterilen Probengläser ‒ ein durchsichtiges Kunststoffröhrchen mit einem eingebauten Löffel samt Griff, der einen wiederverschließbaren Deckel bildete. Wegen des Helms und der Maske lief mir der Schweiß über die Stirn ‒ ich würde aufpassen müssen, dass ich nicht einen Tropfen davon unter die Probe mischte. Ich schraubte den Verschluss ab und holte tief Luft, dann beugte ich mich unter den vorstehenden Teil des Sargbodens und schabte etwas von der Substanz mit dem Löffel ab, wobei ich das Röhrchen darunterhielt, um alles aufzufangen.
Während ich noch unter der Bleizunge kauerte, begann ich den Deckel wieder draufzuschrauben. Dabei bemerkte ich in einer Ecke des Sargs unter mir etwas, das wie ein durchtränktes Geflecht aus Fasern aussah.
Ich tauchte unter dem Boden hervor, wandte mich ab und schnappte ein wenig frische Luft. »Da ist noch etwas«, murmelte ich in meine Maske und gab Gayle den Probenbehälter zurück. »Mach den anderen auf, bitte.«
Dann beugte ich mich wieder in den Sarg, aber erst, nachdem ich die Fasern auf die Spitze des Löffels gespießt hatte, sah ich, dass es sich um einen Klumpen verfilzter Haare handelte, etwas in der Art, wie man es aus einem lange vernachlässigten Waschbeckenabfluss holen konnte.
Während ich das tropfende Geflecht in den Probenbehälter senkte, klickte etwas an die Innenseite des Glases. Ich drehte es und sah eine Art schwarzen Span aus Blei an einer Haarsträhne baumeln.
Während ich gegen die zunehmende Übelkeit ankämpfte, verschloss ich das Gefäß rasch und reichte es Gayle, dann legte ich Maske und Helm ab und holte tief Luft.
»Alles in Ordnung, Illaun? Was ist da drin?«
»Haare … und etwas, das wie ein menschlicher Fingernagel aussieht.«
»Igitt, das ist ja total widerlich«, sagte Gayle, hielt das Glas auf Armeslänge von sich und schloss die Augen, damit sie nicht in Versuchung geriet hineinzuschauen.
Was tun mit den Proben? Knochen hätte ich an den Osteo-archäologen schicken können, der bis vorige Woche mit uns zusammen an der Ausgrabung gearbeitet hatte. Aber das hier?
»Ich schaue mal, wie es Terry geht«, sagte ich. »Auf jeden Fall bringe ich ihn ins St.-Loman-Krankenhaus ‒ zusammen mit dem hier.«
»Du bringst das Zeug in ein Krankenhaus?«, fragte Gayle verwundert.
»Wir können es ja wohl kaum ans Nationalmuseum schicken.« Dann wurde mir klar, dass Gayle den Inhalt der Gläser zwar abstoßend fand, aber offenbar nicht daran dachte, dass er eine mögliche Krankheitsquelle sein könnte.
Terry tauchte hinter dem Bagger auf und trocknete sich das kurz geschnittene schwarze Haar. Er trug ein schwarzes T-Shirt und eine Jogginghose, die jemand aus der Mannschaft spendiert hatte. Ich stopfte meine Maske und die Handschuhe in eine Papiertüte, klemmte mir den Helm unter den Arm und wartete mit der Aktentasche in der Hand, bis er bei uns war.
Während er näher kam, sah ich, dass er blass war unter seiner Sonnenbräune.
»Wie geht es Ihnen, Terry?«
»Ich krieg diesen Scheißgestank nicht aus der Nase, aber ansonsten fühl ich mich prächtig.« Terry war Engländer, hatte sich aber im Laufe vieler Jobs in Irland zahlreiche hiesige Redewendungen angeeignet.
»Das war knapp. Das ganze Ding hätte auf Sie herunterkrachen können. Haben Sie etwas von der Flüssigkeit geschluckt oder inhaliert?«
»Nein, bewahre, ich versuch, es mir gerade abzugewöhnen.«
Gayle fand das rasend komisch.
»Ich bringe Sie jedenfalls ins St. Loman«, sagte ich.
»Ich habe erst vor ein paar Wochen eine Tetanusspritze bekommen.«
»Tetanus ist nicht das, was mir Sorgen macht.«
»Es ist nur Leichensuppe«, sagte er und schwankte leicht. »Ich habe jede Menge von dem Zeug gesehen, als ich damals bei der Christuskirche in Spitalfields mitgearbeitet habe.«
»Wow, du hast bei den Ausgrabungen in der Krypta mitgearbeitet? Das war in den Achtzigern, oder?«, sagte Gayle, sichtlich beeindruckt.
»Ja, wir haben die Überreste von rund tausend Särgen gehoben. Die meisten aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Ich habe genug von dieser Kadaversauce berührt. Die Leichen schwammen zum Teil in dem Zeug. Pocken waren damals eine große Sorge, und der Bleipegel in unserem Blut. Aber die größten Probleme waren psychologischer Art, wie sich herausstellte.«
»Wie dem auch sei«, sagte ich, »wir können nicht vorsichtig genug sein. Ich möchte, dass Sie auf jeden Fall gründlich untersucht werden.«
»Sie befürchten, dass es ein Pestbegräbnis gewesen sein könnte, oder?«
»Ich weiß nicht, ob es eines war. Aber in diesem Stadium ist es wohl besser, wir gehen davon aus und lassen die Mediziner beurteilen, welches Gesundheitsrisiko für Sie besteht.« Ich zeigte zum Tor. »Fahren wir.«
»Was ist mit dem anderen?«, fragte Gayle, während wir die Wiese hinabgingen.
Ich warf einen Blick zurück zu dem kleineren Sarg, der im Gras stand. »Wir können keinen zweiten Unfall gebrauchen. Wir betrachten ihn vorläufig als Gefahr. Ich will nicht, dass ihm jemand nahe kommt, bis wir zurück sind.«
Gayle und Terry wechselten einen Blick.
Terry stieg in meinen kürzlich erworbenen dunkelgrünen Geländewagen, auf dessen Türen in Gelb mein Name sowie Anschrift und Kontaktnummern standen. Ich stellte meine Aktentasche in den hinteren Teil, neben einen großen Pappkarton mit wasserdichter Kleidung, einer Matte, Wanderstiefeln und verschiedenen Werkzeugen. Während ich meinen Helm verstaute, zwängte Gayle die Probengläser zwischen die Aktentasche und den Karton.
»Was machen wir mit der Sauerei oben auf der Wiese?«, fragte sie, während ich in den Wagen stieg.
»Lass den beschädigten Sarg vom Baggerführer wieder näher zum Gewölbe schleppen, dann deckt ihr ihn mit starker Plastikfolie ab. Dasselbe mit dem zweiten. Dann sperrt das ganze Gebiet mit Gittern ab und stellt ein paar große Warnschilder auf.«
»Was soll ich auf die Schilder schreiben?«
»Hm …« Leichensuppe wird als medizinischer Abfall eingeordnet, aber das klang vielleicht nicht abschreckend genug. »Schreib: ›Vorsicht, Giftmüll‹. Lass es dir von Peggy im Büro ausdrucken. Es ist nur vorübergehend. In …«, ich sah auf die Uhr, »etwa einer halben Sunde wird die Stadtverwaltung offiziell für die Ausgrabungsstätte zuständig sein. Aber es ist nur fair, wenn wir das zumindest noch für sie erledigen ‒ sie haben sich nicht darum gerissen, an einem Freitagnachmittag ein solches Problem auf den Schoß zu bekommen.« Ich startete den Motor.
»So, dann wollen wir mal nach Typhus-Terry sehen lassen«, sagte Terry und setzte ein tapferes Gesicht auf. Aber als wir dem Krankenhaus näher kamen, verflog seine gute Laune. »Sind Sie gegen solche Dinge versichert?«
»Unfälle bei der Ausgrabung? Natürlich.«
»Wenn im Krankenhaus etwas zu bezahlen ist, erledigen Sie das, ja? Ich bin nämlich total pleite.« Er lächelte dünn und begann eine bekannte Melodie zu summen, die mit den Worten endete: »Mein ganzer Zaster ging hin für ’ne Kleine und Gin.« Terry schmückte seine Rede gern mit Zitaten aus alten Balladen und Volksliedern.
»Ich hoffe, sie war es wert«, sagte ich. Mein gesamtes Team hatte eine großzügige Prämie erhalten, weil die Leute das Projekt vor der Zeit abschlossen. Sie waren erst am Vortag mit ihren Gehaltsschecks ausbezahlt worden.
Er sah mich geheimnisvoll an. »Was dagegen, wenn ich rauche?«
»Nur zu«, sagte ich und ließ das Fenster auf meiner Seite hinunter. Dann überlegte ich, ob das Päckchen vielleicht in seiner Kleidung gesteckt hatte. »Sind Sie sicher, dass sie nicht kontaminiert sind?«
»Ach woher. Dann würden sie sowieso nicht brennen.« Er kicherte und räumte seine Lungen frei, ehe er inhalierte. Seine Stimmung hatte sich erneut geändert. »Ich habe eine Geschichte von einem Kumpel bei der Ausgrabung in Spitalfields gehört. Eine Sache, die nach dem großen Brand von London passiert ist. Zwei neugierige Gentlemen beschlossen, die sterblichen Überreste eines Dekans von St. Paul zu trinken, der hundertfünfzig Jahre zuvor in einem Bleisarg beerdigt worden war.«
»Igitt.«
»Es hieß, die Brühe war durch das vorbeiziehende Feuer erhitzt worden.«
»Und sie haben das Zeug wirklich getrunken?«
»Anscheinend. Schmeckte nach Eisen, soviel man …« Er begann zu husten und warf die Zigarette aus dem Fenster. »Verfluchte Krebsstängel«, sagte er.
Ich warf ihm einen kurzen Blick zu. Terry sah aus, als hätte man ihm die Sargbrühe, die er eben beschrieben hatte, gewaltsam eingeflößt. Unter der Sonnenbräune wirkte sein Gesicht grau, und die Augen waren blutunterlaufen.
»Ich habe in Spitalfields selbst einige merkwürdige Dinge gesehen ‒ leere Särge, einer mit Steinen gefüllt, ein paar doppelt belegt ‒, aber nichts wie das, was wir heute ausgegraben haben, was?«
»Was meinen Sie damit?«
»Dann haben Sie den zweiten Sarg also noch gar nicht gesehen, oder?«
»Nein. Wieso?«
Wir passierten gerade das Tor der Klinik. Terry lächelte wissend. »Sie werden schon sehen.«
Kapitel 3
Während Terry die Aufnahmeprozedur durchlief, sah ich eine der diensthabenden Ärztinnen vor dem Warteraum vorbeikommen. Cora Gavin war mit mir zusammen in Castleboyne zur Schule gegangen, und wir hielten immer noch freundschaftlichen, wenn auch keinen sehr engen Kontakt. Ich nutzte die Gelegenheit, um zu erklären, was Terry zugestoßen war und den Zusammenhang mit unserer Arbeit auf dem Friedhof zu erläutern. Wir saßen gemeinsam im Wartezimmer. Sonst war niemand da. St. Loman war ein kleines städtisches Krankenhaus; Ausstattung und Personal waren auf hohem Niveau, aber in der Aufnahme herrschte selten viel Betrieb.
Cora hörte aufmerksam zu. Sie hatte ein längliches Gesicht, mit einem kleinen, vorstehenden Mund, und sie verstärkte diese Merkmale noch durch die Art und Weise, wie sie ihr Haar zu einem hohen Knoten auftürmte.
»Ich bezweifle, dass der Sarg Beulenpest beherbergte, selbst wenn sein Insasse ein Opfer dieser Krankheit war«, sagte sie schließlich. »Unsere Hauptsorge dürften im Moment Leptospirosen und Hepatitis A sein. Wir entnehmen ein paar Blutproben, die wir zur Analyse aufheben, für den Fall, dass sich etwas entwickelt.« Leptospirosen und Hepatitis sind Gefahren, denen Archäologen gelegentlich begegnen, wenn Erdreich durch Abwässer oder Wasser durch Rattenurin verseucht wurde.
»Ich glaube, der Vorfall hat ihn stärker mitgenommen, als er zugibt«, sagte ich.
»Dann sollten wir ihn zu seiner Beruhigung vielleicht ein paar Stunden hierbehalten und beobachten.«
»Gute Idee. Kann ich euch die hier lassen?« Ich zeigte ihr die Probenröhrchen. »Damit wir auch wirklich alles vorschriftsmäßig machen, sollte man das Zeug vielleicht auf den Pestbazillus testen ‒ und vielleicht noch auf Pocken und Milzbrand.«
»Hey, seit wann versteht ihr Archäologen etwas von Labormedizin?«, sagte sie mit einem Blick auf die Behälter. So, wie sie es sagte, klang es herabsetzend. Cora gehörte zu jenen bierernsten Menschen, die es gelegentlich mit lockerem Geplauder versuchen, was aber häufig zu katastrophalen Ergebnissen führte. Ihr sympathischster Zug während der Schulzeit war ihr leidenschaftliches Eintreten für Gerechtigkeit und Menschenrechte gewesen, und wenn sie bei einer Auseinandersetzung auf deiner Seite war, konnte man keine bessere Fürsprecherin haben, und sei es auch eine ziemlich humorlose.
Am besten hielt man es bei Cora so, dass man ihr einfach direkt antwortete. »Wenn wir bei einer Ausgrabung mit Proben von zweifelhaftem organischem Material rechnen, sind wir entsprechend vorbereitet.«
»Wir werden die Analyse jedenfalls nicht selbst machen können. Ich schicke die Proben ans CRID in Dublin.«
»Was ist das denn?«
»Das Centre for Research in Infectious Diseases, das Seuchenerforschungszentrum. Dort haben sie ein Labor der Biosicherheitsstufe Drei. Nur für alle Fälle, wie du sagtest.« Sie steckte die Röhrchen in die Tasche ihres weißen Mantels und stand auf. »So, und jetzt sollte ich mich wohl mit Mr. Johnston unterhalten.«
Am Eingang zur Aufnahme drehte sie sich um. »Wie wär’s gelegentlich mit einer Partie Tennis?«, rief sie.
Wir waren beide Mitglied im örtlichen Tennisverein, aber ich hatte seit fast einem Jahr nicht mehr gespielt. »Gern«, erwiderte ich. Vor meinem geistigen Auge sah ich, wie sich Cora zum Aufschlag streckte und eine Granate von Ball über das Netz gesaust kam.
Cora ging flotten Schritts zur Aufnahme weiter. Ich sah auf die Uhr an der Wand. 12.05 Uhr. Ich war bereits zu spät für meinen Termin bei Dominic Usher von der Stadtverwaltung. Ich machte mein Handy an und schickte ihm eine SMS, in der ich ihn über meine Verspätung informierte. Dann schaltete ich es wieder aus.
Minuten später kam Terry zu mir in den Warteraum.
»Sie behalten mich zur Beobachtung hier«, sagte er und nahm neben mir Platz.
»Ich habe mit einer Ärztin gesprochen. Man wird sich gut um Sie kümmern. Haben Sie der Schwester gesagt, dass ich die Krankenhausrechnung bezahle?«
Er nickte.
»Und haben Sie ihnen gesagt, mit wem sie Kontakt aufnehmen sollen, falls über eine Behandlung zu entscheiden ist?«
Er schüttelte den Kopf und lächelte grimmig. »Die Freunde der Kindheit und meine Verwandten, sind alle gegangen wie der schmelzende Schnee …«
»Eine Ballade, nehme ich an?«
»›Carrickfergus‹. Eine der besten. Könnten Sie mir übrigens ein bisschen Kohle leihen? Nur für den Fall, dass ich telefonieren muss.«
»Klar.« Ich kramte in meiner Börse und gab ihm, was ich an Kleingeld hatte, und dazu einen Fünfzig-Euro-Schein.
»Ich zahl es Ihnen zurück«, sagte er dankbar.
»Schon gut.« Ich stand auf. »So, Terry, ich glaube, ich muss wieder zum Friedhof. Machen Sie’s gut.«
Ich stieg in meinen Freelander und sah auf dem Handy nach, ob ich Nachrichten erhalten hatte. Zwei SMS. Eine von Dominic Usher, der sich mit der Verschiebung einverstanden erklärte. Die andere war von meinem Verlobten Finian Shaw, der schrieb, dass es Neuigkeiten gebe. Finian war der Schöpfer von Brookfield, einem Schaugarten von internationalem Ruf, den er aus dem Nichts auf dem Gelände des elterlichen Hofs geschaffen hatte.
Ich rief ihn an. »Du hast mich gesucht«, sagte ich, als er sich meldete. »Ich bin im St. Loman, deshalb hatte ich das Handy ausgeschaltet.«
»Wieso bist du im Krankenhaus? Alles in Ordnung?«
»Mir geht es gut, Schatz.« Ich erzählte ihm von der Panne mit dem Sarg und was ich darin gefunden hatte.
»Pfui Teufel. Aber musstest du dich so in Gefahr begeben? Ich wette, die wenigsten deiner Archäologenkollegen würden es für einen Teil ihres Berufs halten, verflüssigtes menschliches Gewebe von einem Sarg zu kratzen.«
»Ich kenne viele, die es tun würden. In deinem Geschäft ist auch nicht alles eitel Sonnenschein, oder? Wie viele Gärtner würden die Nase rümpfen, wenn man ihnen eine Ladung Pferdemist vor die Haustür kippen würde?«
Finian seufzte hörbar. »Ich merke schon, ich habe keine Chance. Darf ich dir jetzt meine Neuigkeit erzählen?«
»Ja, natürlich. Ich hätte dich gleich danach fragen sollen.«
»Sie ist fast noch grausiger als dein Erlebnis, falls das möglich ist. Mein Vater ist vor ein paar Stunden bei einem Spaziergang auf eine Frauenleiche im Bach gestoßen.«
»O mein Gott, wie schrecklich! Die arme Frau. Und wie furchtbar für Arthur. Wie geht es ihm?«
»Na, du kennst den alten Herrn ja. Den kratzt nicht viel. Ich glaube, mich nimmt es viel mehr mit. Vor allem der Umstand, dass sie auf unserem Anwesen gefunden wurde.«
»Wo denn da?«
»Unweit der Fußbrücke. Die Leiche wurde wahrscheinlich flussabwärts gespült und ist dort in der Biegung hängen geblieben.«
»Weiß man, wer sie ist?«
»Nein. Der Polizei zufolge wurde niemand in der Gegend vermisst gemeldet. Aber es ist noch zu früh. Tatsächlich haben sie gerade erst bestätigt, dass es sich wirklich um eine Frauenleiche handelt.«
»Wieso? War sie schon stark verwest?«
»Hm … Das ist nur teilweise das Problem. Aber du kannst bestimmt leicht herausfinden, warum sie sich nicht sicher waren. Dein Freund Malcolm Sherry ist dabei, eine Autopsie durchzuführen.«
Der staatlich zugelassene Pathologe Malcolm Sherry war nicht direkt mein »Freund«, aber wir kannten uns. Finian hoffte vermutlich nur darauf, dass man seinen Vater auf dem Laufenden halten werde, nachdem er derjenige war, der die Leiche gefunden hatte. Dennoch war es unwahrscheinlich, dass mir Malcolm viel verraten würde ‒ und ich legte auch keinen besonderen Wert darauf.
»Na gut, falls ich ihm zufällig über den Weg laufe. Bis später dann, Finian.«
»Wir haben heute eine Menge Besucher, aber Gott sei Dank werden abends keine VIPs erwartet. Würden dir Drinks um sieben passen?«
»Ich kann es kaum erwarten. Wir speisen wieder im Freien, oder?« Ich lachte. Finian und ich hatten die letzten drei Abende draußen im Garten gegessen, und er hatte jedes Mal das Essen zubereitet.
»Ich verderbe dich völlig. Eines Tages wirst du mal etwas kochen müssen.«
»Wenn sich das Wetter ändert, versprochen.«
»Eher wenn die Hölle zufriert, würde ich sagen.«
Ich hatte inzwischen mehrere Gründe, Dominic Usher anzurufen. »Tut mir leid, wenn ich Sie aufgehalten habe«, sagte ich, als er sich auf seine pedantisch jede Silbe seines Namens betonende Weise gemeldet hatte. »Erstens, ich werde es nicht vor dem Lunch schaffen. Könnten wir die Übergabe also für, sagen wir, drei Uhr vereinbaren?«
Keine Reaktion. Komm schon, Dominic, mach die Sache nicht kompliziert.
»In Ordnung. Ich werde noch da sein«, sagte er mit leicht gequältem Tonfall.
»Zweitens, bei der Ausgrabung wurde etwas verschüttet. Wir haben einen Bleisarg entdeckt, aus dem Flüssigkeit auslief. Einer meiner Leute wurde vollgespritzt, aber das meiste ist im Boden versickert. Wir stellen Schilder und Absperrgitter auf. Proben sind auf dem Weg ins Zentrum für Ansteckungskrankheiten, und der Grabungsarbeiter ‒ er heißt Terry Johnston ‒ wird im St.-Loman-Krankenhaus untersucht. Ich schlage vor, Sie sperren den unmittelbaren Bereich um die Austrittsstelle, bis die Ergebnisse da sind.«
Dieses unerwartete Problem ließ Usher aufstöhnen.
Bei der Fahrt zurück zum Friedhof gingen mir tausend Spekulationen über die Bleisärge durch den Kopf. Die Maudlins, wie das Areal allgemein genannt wurde, waren ursprünglich ein Begräbnisort für Aussätzige gewesen. Das Krankenhaus der Magdalenerinnen, oder auch Lazarushaus, das dazugehörte, lag in den Außenbereichen der Stadt ‒ die gängige Praxis im Mittelalter. Wir hatten im Lauf der Ausgrabung zweifelsfrei bewiesen, dass tatsächlich Leprakranke, wenn auch nur eine geringe Zahl, auf dem Friedhof beigesetzt worden war ‒ die Art und Weise, in der die Krankheit die Knochen auffrisst, ist unverkennbar. Aber wir hatten ebenfalls gezeigt, dass der Ort Mitte des 14. Jahrhunderts als Pestgrube benutzt worden war, und die Leichen, die dort im Laufe eines einzigen Jahres begraben wurden, überstiegen bei Weitem die Zahl der Aussätzigen, die man in den hundert Jahren zuvor zur letzten Ruhe gebettet hatte.
Doch weder Lepra- noch Pestopfer hatte man in Särgen irgendwelcher Art beigesetzt, schon gar nicht in kostspieligen Modellen aus Blei. Wer waren also die Insassen dieser Särge? Wann hatte man sie in dem Gewölbe beerdigt und warum?
Ich konnte den Zeitraum ausschließen, in dem die meisten Leprakranken gestorben waren. Mit Blei ausgekleidete Särge kamen erst Mitte bis Ende des 14. Jahrhunderts unter den Reichen Irlands in Gebrauch, zu einer Zeit, in der Lepra scheinbar von der Pest ausgelöscht wurde ‒ eine Nebenwirkung, die die Leute der damaligen Zeit kaum getröstet haben dürfte. Aber Särge aus Blei müssen bestellt, angefertigt und geliefert werden; ein angemessener Ort muss für sie reserviert sein ‒ alles Dinge, die nicht stattfanden, wenn der Schwarze Tod wütete. 1348 hatte man in Castleboyne Glück, wenn man in ein Laken gehüllt wurde.
Die Beisetzung in einer Kirche, nahe des Hauptaltars oder woanders, war das Privileg der Frommen und Mächtigen. Man nannte es ein Begräbnis ad sanctos ‒ das hieß, in der Nähe der jeweiligen Heiligen- oder Märtyrerreliquien, die sich die Kirche hatte sichern können. Aber die Kapelle des Lazarushauses war unter den vielen Stätten der Anbetung des mittelalterlichen Castleboyne die am wenigsten prestigeträchtige. Und dennoch hatten zwei Leute ‒ möglicherweise Mann und Frau, nach den Größenunterschieden der Särge zu urteilen ‒ es fertiggebracht, in bleiverkleideten Särgen dort in einer winzigen Gruft beerdigt zu werden. Es roch nach Größenwahn.
Kapitel 4
Bei meiner Ankunft in den Maudlins standen zwar Absperrgitter im Kreis um die kontaminierte Erde und das eingestürzte Gewölbe, aber von Warnschildern war nichts zu sehen. Mehr Sorge bereitete mir jedoch, dass der zweite Sarg noch an derselben Stelle wie zuvor im Gras stand. Aus irgendeinem Grund hatte man eine blaue Plane über seinen oberen Teil gelegt.
Gayle rannte quer über das größtenteils wieder aufgefüllte Ausgrabungsgelände, um mich am Tor zu begrüßen. »Wir warten noch … auf die Schilder«, keuchte sie.
»Nur die Ruhe. Du kannst nicht alles auf einmal schaffen.« Ich gab ihr Zeit, zu Atem zu kommen. »Aber wieso hast du den anderen Sarg dort stehen gelassen?« Ich zeigte nach oben.
»Wie ich heute Morgen am Telefon schon sagte: Du musst es dir selbst ansehen.«
Mich ärgerte die Geheimnistuerei. »Kannst du mir nicht einfach sagen, was ich mir ansehen muss?«
»Es ist schwer zu beschreiben«, antwortete sie, während wir in Richtung des Sargs gingen.
»Wir tragen keine Schutzkleidung«, bemerkte ich.
Gayle schüttelte den Kopf. »Nicht nötig. Das wollte ich ja gerade erklären, als der Unfall passiert ist. Vertrau mir.« Sie hüpfte voraus und erreichte den Sarg vor mir. »Voilà!«, rief sie und zog wie ein Zauberer die Plane weg.
Der Deckel war so weit zurückgeschoben, dass das Gesicht einer Frau zu sehen war, blass, aber mit rosigen Wangen. Ihre himmelblauen Augen waren weit offen und starrten mich an. Ich wusste, dass das Gift im Blei den Zerfall von Leichen stoppen konnte, aber die hier schien förmlich zu neuem Leben erweckt.
Und dann begriff ich, dass ich eine bemalte Statue vor mir hatte.
Ich schüttelte ungläubig den Kopf.
»Ich weiß«, sagte Gayle. »Es ergibt keinen Sinn.«
Ich kniete nieder, um die Skulptur zu untersuchen.
Eine mit Blattgold beschichtete Krone und die feinen Fleischtöne des ovalen Gesichts wiesen auf vornehme Herkunft hin, eine Königin oder Heilige ‒ in dem Zusammenhang, in dem wir sie gefunden hatten, aller Wahrscheinlichkeit nach eine religiöse Figur. Unter der Krone war kein Schleier, und das Haar hatte die Farbe von Stroh. Ihre roten Lippen waren sittsam geschlossen, aber mit der Andeutung eines Lächelns. Abgesehen von einem altersbedingten feinen Netz aus Haarrissen in der Lackierung war die bemalte Oberfläche vollkommen unbeschädigt. Ohne die Statue zu berühren, wusste ich, dass sie aus Holz war.
»Eine bunt bemalte Holzschnitzerei«, verkündete ich und erhob mich. »Und sie scheint in einem ausgezeichneten Zustand zu sein. Beinahe lebensgroß noch dazu, wie es aussieht.«
»Ein seltener Fund, oder?«, sagte Gayle stolz.
»Auf jeden Fall.«
»Welche Epoche?«
»Das kann ich erst sagen, wenn wir sie besser zu Gesicht bekommen.«
»Da sie aus Holz ist, kann sie natürlich problemlos wissenschaftlich datiert werden.«
»Irgendwann vielleicht. Aber im Augenblick kommt es nicht in Frage, eine Probe zu entnehmen. Außerdem macht es sowieso mehr Spaß, das Alter selbst zu schätzen, findest du nicht?«
»Dir vielleicht. Mittelalterliche Holzschnitzereien sind nicht gerade meine Stärke.«
Sie sind zwar auch nicht meine Spezialität, aber ich habe für mein Diplom die Archäologie von Kunst und Kultur studiert und meine Doktorarbeit über die Verwendung von zerbrochener Bildhauerei als Füllmaterial für Gebäude nach der Auflösung der Klöster geschrieben. Man kann sich vorstellen, welche Ehrfurcht ich Leuten auf Dinnerpartys damit einflöße.
»Schaffen wir sie zunächst mal aus der Sonne.« Aber wie sollten wir den Sarg bewegen? »Am besten, wir holen sie ganz aus dem Sarg ‒ er ist nicht mehr luftdicht und schützt weder vor Feuchtigkeit noch Insekten, was vermutlich zur Konservierung der Statue geführt hat. Wir werden versuchen müssen, diese Umgebung fürs Erste so gut wie möglich nachzubilden.«
»Kühl, dunkel und trocken, würde ich sagen.«
»Ja, das klingt richtig. Wir machen dabei auch fortlaufend Fotos. Ich nehme an, du hast bereits welche gemacht.«
»Stimmt.« Gayle holte ihre Digitalkamera aus einer geräumigen Tasche ihrer Jeans.
Ich ging um den Sarg herum und sah mir an, wie er gefertigt war. Im Wesentlichen handelte es sich um einen rechtwinkligen Kasten, die Seitenteile hatte man mit dem hochgeklappten Boden an den Rändern verlötet. Der Deckel war in gleicher Weise gebaut. »Wie habt ihr den Deckel übrigens aufbekommen?«
»Das Lötmetall war spröde geworden. Die Oberseite erhielt einen Schlag, als das Gewölbe herunterkam, und ein Teil des Lötmetalls darum herum bröckelte einfach weg, sodass wir den Deckel ohne große Mühe ein Stück aufziehen konnten. Ich muss sagen, ich bin erschrocken, als ich sah, was darunter lag.«
Ich wusste noch nicht genau, wo wir die Statue untersuchen sollten, wenn wir sie befreit hatten. Der tragbare Unterstand, den wir zum Säubern und Zusammensetzen unserer Skelettfunde benutzten, würde viel zu warm und hell sein; und als ich den Blick nun über das Gelände schweifen ließ, stellte ich fest, dass er überdies bereits abgebaut war.
»Ich meine, was hat sie überhaupt auf einem Friedhof verloren? Und in einem Sarg?« Gayle war immer noch aufgeregt, was ihre Stimme schrill klingen ließ.
»Da bin ich überfragt«, sagte ich. Meine Theorie vom beigesetzten Ehepaar war damit ebenfalls hinfällig. »Die Frage ist, wo können wir sie sicher aufbewahren?«
»Im Heritage Centre?«
Ich dachte kurz darüber nach. Wir hatten im Castleboyne Library and Heritage Centre zu Beginn des Monats eine kleine Ausstellung aufgebaut. »Kulturerbezentrum« war nicht ganz die richtige Bezeichnung. Es handelte sich eigentlich nur um einen einzigen Raum, der für Kunstausstellungen, Vorträge und Buchpräsentationen genutzt wurde. Die Stadtverwaltung würde wahrscheinlich keine Einwände dagegen erheben, die Statue vorübergehend in diesem Raum unterzubringen. Immerhin war sie auf städtischem Grund gefunden worden. Oder nicht? Es spielte im Grunde keine Rolle. Das Kunstwerk war Eigentum des Staates, der seinen Besitzanspruch über das Nationalmuseum ausüben würde.
»Gute Idee«, sagte ich. »Du wirst ein paar kräftige Kerle brauchen, um den Deckel abzulösen und sie herauszuholen ‒ vorausgesetzt, sie ist vollständig. Schutzkleidung ist Pflicht, einschließlich Masken und Handschuhen. Lass sie in ausreichend Isolationsmaterial packen und bitte Peggy, den Transport ins Museum zu organisieren. Ich kläre die ganze Sache inzwischen mit Dominic Usher.«
Auf dem Rückweg zum Wagen empfand ich eine merkwürdige Mischung aus Begeisterung und Unruhe. Der Fund konnte sehr bedeutsam sein, aber irgendetwas an seiner Anwesenheit auf einem Pestfriedhof war höchst sonderbar. Bei der anderen Bestattung handelte es sich eindeutig um einen menschlichen Leichnam. ‒ Warum wurde die Schnitzerei daneben begraben?
Ich setzte mich ins Auto und dachte eine Weile darüber nach, kam aber zu keinem Ergebnis. Es gab keine Präzedenzfälle, auf denen ich aufbauen konnte. Ich beschloss, Finian anzurufen. Er war Geschichtslehrer gewesen und war außerdem leidenschaftlicher Volkskundler. Vielleicht fiel ihm etwas ein.
»Du hast sicher sofort an die Muttergottes von Castleboyne gedacht«, war seine erste Bemerkung.
Hatte ich nicht. Aber ich wusste, wovon er sprach: ein wundertätiges Bildnis der Jungfrau Maria, das im Mittelalter berühmt gewesen war. In der Kirche St. Patrick, wo ich im Chor sang, war sie auf einem Buntglasfenster abgebildet.
»Aber die wurde in der Zeit der Reformation zerstört, oder nicht?«
»Den offiziellen Berichten nach, ja. Aber es gibt auch eine Geschichte, wonach sie weitere hundert Jahre versteckt gehalten wurde, ehe in der Stadt stationierte Truppen Cromwells sie als Feuerholz verbrannten.«
»Dann kann sie es jedenfalls so oder so nicht sein. Tatsächlich weiß ich noch nicht einmal, ob es überhaupt eine Marienstatue ist.«
»Vielleicht ist es Lady Death.«
Ein Schauder lief mir über den Rücken. Lady Death und die Maudlins: eine Geistergeschichte, die irgendwann bei der Recherche zur Vorbereitung der Grabung aufgetaucht war. Ich hatte ihr damals nicht viel Beachtung geschenkt. »Was hatte es damit gleich wieder auf sich?«
»Können wir später darüber reden, Liebling? Ich stecke hier bis zum Hals in Arbeit.« In Brookfield Garden begann eben die Hochsaison.
»Natürlich. Bis dahin habe ich mir dann auch die Statue richtig angesehen.«
Dominic Usher hing halb aus dem Fenster seines Büros im zweiten Stock, als ich zur Tür hereinkam.
Ich nahm in dem Sessel vor seinem Schreibtisch Platz und hüstelte höflich. Usher faltete sich zurück ins Zimmer und stellte eine kleine Gießkanne auf den Boden.
»Ah, Illaun. Ich habe gerade den Blumen noch tüchtig zu trinken gegeben vor dem Wochenende.« Ich konnte den Blumenkasten vor dem Fenster nicht sehen, aber der süße Duft von Goldlack wehte in den Raum.
Usher war Anfang vierzig, er hatte schwarzes Haar, das sich in jener unvorteilhaften Weise lichtete, dass vorn auf der Stirn ein isoliertes Büschel stehen blieb. Seine Augenbrauen waren im Gegensatz dazu dichte Gestrüppe. Eine weitere Auffälligkeit an ihm war, dass er die Lippen beim Sprechen kaum bewegte, sondern einen stetigen Strom von Worten durch sie hindurch produzierte, als hätte er einen Drucker im Mund verborgen.
Er setzte sich an seinen Schreibtisch und warf einen Blick zurück zum Fenster. »Man sieht ihn heutzutage nicht mehr oft. Goldlack, meine ich. In Brookfield Garden wird man ihn wohl kaum mehr finden, oder?«
Die Bemerkung zeugte von Kleinstadtmentalität. Er wollte damit andeuten, dass Finian, nun, da er einen internationalen Ruf genoss, sich für etwas Besseres hielt.
»Keine Ahnung«, sagte ich. Am besten, man ignorierte solche spöttischen Bemerkungen. »Was haben Sie wegen der ausgelaufenen Flüssigkeit unternommen?«
»Ach ja, das«, sagte er mit einer gewissen Gereiztheit. »Ich musste den technischen Dienst und das Gesundheitsamt konsultieren. Da die Stelle ein gutes Stück von jedem Wohngebiet entfernt liegt und keine Gefahr besteht, dass noch mehr ausläuft, glauben sie zum Glück nicht, dass man sich große Sorgen machen muss.«
»Damit haben Sie wahrscheinlich recht. Trotzdem wäre es vielleicht klug, über Nacht eine Wache aufzustellen.«
Usher sah auf die Uhr an der Wand hinter mir. »Jetzt kann ich es bestenfalls noch unserem mobilen Sicherheitsbeamten auf die Liste für seine Runde setzen. Und ich werde die Polizei bitten, ein Auge auf das Gelände zu werfen.«
»Wir haben noch etwas in dem Gewölbe gefunden. Eine hölzerne Statue. Sie lag in einem Bleisarg.«
Ich konnte Usher ansehen, dass er überlegte, ob ihn diese weitere Entwicklung beunruhigen sollte.
»Ich habe mir das Stück bisher noch nicht richtig angesehen, deshalb kann ich Ihnen nicht viel darüber sagen«, fuhr ich fort. »Aber ich habe veranlasst, dass es zur Aufbewahrung ins Heritage Centre gebracht wird, wenn Sie einverstanden sind.«
Usher runzelte die Stirn. »Äh … ich denke schon.«
»Das Nationalmuseum wird die Statue natürlich in Besitz nehmen. Aber da ich es noch nicht verständigt habe, wird das erst nach dem Wochenende passieren. In der Zwischenzeit halte ich es für das Beste, wenn außer mir niemand einen Schlüssel zum Zentrum hat.«
»Wenn keine Veranstaltung stattfindet, ist es normalerweise abgesperrt, selbst wenn die Bibliothek geöffnet ist.«
»Ich weiß. Aber ich müsste jederzeit Zugang dazu haben. Außerdem wäre es nicht fair, dem Bibliothekspersonal die Verantwortung für den Fund aufzubürden.«
»Also gut, ich sage ihnen Bescheid.« Er schaute wieder auf die Uhr. »Am besten, wir bringen diese Übergabe hinter uns.«
Er hatte die Dokumente auf dem Schreibtisch liegen. Meine Unterschrift auf einem davon würde das Grundstück zur Bebauung freigeben. Seine Unterschrift auf dem anderen würde bestätigen, dass die Stadt nun das Gelände in ihre Zuständigkeit übernahm.
»So, das wär’s, Dominic. Jetzt können Sie Ihren Kreisverkehr bauen«, sagte ich und schob ihm das Formular hinüber.
Er hob es auf, lehnte sich zurück und tippte mit dem Mittelfinger darauf. Er wollte offenbar etwas loswerden. »Ist es nicht trotzdem eine tolle Sache für Leute wie Sie?«, sagte er.
»Wen meinen Sie mit ›Leute wie mich‹?«
»Archäologen. Auf der einen Seite beschwert ihr euch über Erschließung von Land. Auf der anderen holt ihr dabei alles heraus, was nur geht.«
Usher mochte einen Minderwertigkeitskomplex in Bezug auf Leute haben, die sich seiner Ansicht nach über ihren Stand erhoben, aber er war normalerweise nicht so unverblümt grob. Das konnte ich mir nicht bieten lassen, und ich wollte ihm gerade eine scharfe Antwort geben, da läutete sein Telefon. Als er den Hörer abnahm, schob er eine Zeitung beiseite, die ihm den Blick auf seinen Kalender verdeckte. Ich erkannte die Titelseite des Boulevardblatts Ireland Today und sah, dass die Ausgabe zwei Wochen alt war. Jetzt wusste ich, was den Verwaltungsmann so provoziert hatte.
In der Folge eines Vortrags über die Ausstellung, den ich im Heritage Centre gehalten hatte, hatte ein Journalist von Ireland Today in einem Artikel geschrieben, ich hätte »kurzsichtige« Beamte der Stadtverwaltung kritisiert, weil sie den Friedhof zugunsten eines Kreisverkehrs zerstörten, und ich sei gegen eine weitere Entwicklung Castleboynes.
Usher legte auf und trug etwas in seinen Kalender ein.
»Wenn Sie mir das nächste Mal eine vor den Latz knallen wollen, sollten Sie vielleicht vorher Ihre Fakten überprüfen«, sagte ich.
»Wovon reden Sie?«
»Sie haben gerade eine Bemerkung gemacht, die ohne Frage auf einem angeblichen Zitat von mir in dieser Zeitung beruht. In einem Artikel von Darren Byrne.«
»Streiten Sie ab, es gesagt zu haben?«
»Ich wurde gefragt, wie viel von Castleboyne ich gern noch ausgraben würde. Ich sagte, eine Ausgrabung sei eine Form wissenschaftlicher Zerstörung und nicht die einzige Möglichkeit, über die Archäologen und Stadtplaner verfügten. Ich fügte an, ich würde Castleboyne ungern von einem Ende zum anderen umgepflügt sehen, auch nicht von Archäologen, wenn es nur darum ginge, den Ort in eine weitere Shopping Mall zu verwandeln. Ich habe mich weder gegen die Zerstörung des Friedhofs ausgesprochen noch irgendwelche Behördenvertreter kritisiert oder den Ausdruck ›kurzsichtig‹ gebraucht. Byrne hat es so hingestellt, um Unfrieden zu stiften, und wie es aussieht, ist ihm das geglückt.«
»Es klingt immer noch so, als würden Sie ganz gern die Hand beißen, die Sie nährt.«
»Sicher, aber ich versuche, kein Blut fließen zu lassen. Ich bin mir völlig darüber im Klaren, dass mir die sogenannte ›Entwicklung‹ meinen Lebensunterhalt sichert. Aber ich denke, das sollte mich nicht davon abhalten, mich gegen die Aushöhlung der besten Seiten meiner Heimatstadt zu wenden ‒ der Züge, die sie einzigartig machen. Ich bin nicht gegen Veränderung an sich ‒ niemand weiß besser als Archäologen, dass Menschen schon immer das Landschaftsbild verändert haben. Wogegen ich jedoch bin, ist, dafür zu werben, in die historische Stadt Castleboyne mit ihrem mittelalterlichen Erbe zu kommen ‒ weil genau dieses Erbe durch die Neubautätigkeit zerstört wird. Und zwar mit Zustimmung Ihrer Stadtverwaltung.«
»Sie haben keine Ahnung, unter welchem Druck wir stehen. Wir tun unser Möglichstes, aber es ist, als würde man sich gegen eine Flut stemmen.« Ushers Miene verfinsterte sich. »Und manche dieser Leute schrecken vor nichts zurück.«
Kapitel 5
Als ich den Ausstellungsraum betrat, stand die Statue mit dem Gesicht zu mir auf einer niedrigen Bühne, die für gelegentliche Lesungen und Vorträge genutzt wurde. Gayle und ein Mitglied des Ausgrabungsteams ‒ Brian Morley, ein schlaksiger Student, der eine randlose Brille und einen zerknitterten grünen Hut trug ‒ sahen beide zu der Figur hinauf. Sie war bemalt und vergoldet, und ich sah auf den ersten Blick, dass sie von beträchtlichem künstlerischem Wert war. Es handelte sich außerdem unverkennbar um eine Darstellung der Jungfrau Maria mit Kind.
Marias Mantel war ‒ zu meiner Überraschung ‒ leuchtend rot, das gegürtete Gewand vollständig golden. Das Kind trug einen schlichten weißen Umhang. Einen Ausgleich zu den lebhaften Farben der Kleidung bildeten die dezenten und lebensnahen Hauttöne, die vom gesunden Rosa im Gesicht des Kindes bis zum blassen, aber von einer leichten Röte überzogenen Teint der Frau reichten. Noch verblüffender war ihr Gesichtsausdruck: Ich hatte das Gefühl, als würden mich die blauen Augen durchdringend ansehen, während ein Lächeln um ihre roten Lippen zu spielen schien. Es war ein bisschen beunruhigend ‒ als würden wir uns gegenseitig beobachten.
Einen runden Sockel, auf dem sie stand, nicht eingerechnet, hatte die Statue etwa meine Größe. Ihr Gewicht ruhte auf dem linken Bein, das rechte war angewinkelt und zeichnete sich durch das Gewand ab. Diese frauliche Haltung wurde noch durch den Faltenwurf ihrer Kleidung betont und durch die Art, wie der Gürtel, der fast bis zum Boden hinabhing, der geschwungenen Linie ihres Umhangs folgte. Ein Grund dafür, warum sie so stand, war, dass sie den Jesusknaben ‒ beinahe kleinkindgroß und ebenfalls strohblond ‒ auf die linke Hüfte gesetzt hatte und ihn mit dem linken Arm unter dem Gesäß stützte. Das Kind hatte eine Hand auf ihrer Schulter und die andere um die äußere Wölbung ihrer Brust gelegt, während es saugte, den Kopf vom Betrachter abgewandt und die Augen auf das Gesicht seiner Mutter fixiert. Mit den Fingern der rechten Hand hielt sie die Vorderseite ihres Gewands offen, um die Brust zu entblößen. Der Bogen des Kinderrückens vervollständigte die konvexe Krümmung der Schnitzerei auf dieser Seite, und die Neigung des Kopfes der Mutter bildete ein Gegengewicht dazu und schuf den oberen Teil einer ungefähren S-Form mit einem kürzeren oberen und einem verlängerten unteren Abschnitt.
»Sind die Farben nicht verblüffend?«, sagte Gayle zu Brian, als ich hinter sie trat. Sie machte ein Foto. Die beiden hatten mich noch nicht bemerkt.
»Ein bisschen viel für meinen Geschmack«, erwiderte er. Er nahm seine Brille ab und polierte sie mit dem Saum seines T-Shirts, als würden die Farben die Gläser verschmieren.
Ein Oberlicht in der Decke über der Statue verwandelte Marias vergoldete Krone in einen blendenden Heiligenschein um ihren Kopf. Mit den beiden Betrachtern, die zu ihr emporblickten, wirkte das Ganze wie eine Momentaufnahme aus einer surrealen Modenschau und erinnerte mich irgendwie an eine Szene aus einem Fellini-Film, auf dessen Titel ich gerade nicht kam.
»Nein, sie ist wunderschön«, sagte Gayle.
»Finde ich auch«, stimmte ich zu.
»Ah, hallo, Illaun. Wir haben sie eben erst hereingebracht«, sagte Gayle.
»Wir mussten den Fahrer bitten, uns zu helfen«, ergänzte Brian und setzte seine Brille wieder auf. »Sie ist schwerer, als man glauben möchte.«
Ich stieg auf das Podest und ging um die Skulptur herum. Der Rücken war vollständig ausgearbeitet, der Umhang fiel in Falten, das unverhüllte Haar mit den vergoldeten Strähnen war zu zwei dicken Zöpfen zusammengefasst, die bis unter ihre Hüfte hinabhingen, wo beide von schwarz-gold gemusterten Bändern verlängert wurden, die fast bis zum Saum des Umhangs reichten. In den geflochtenen Zöpfen waren realistisch anmutende Haarsträhnen zu sehen ‒ eine Wirkung, die dadurch erreicht wurde, dass man vor dem Bemalen die Gipshülle eingeritzt hatte, mit der die Figur überzogen war.
Aus der Nähe betrachtet, waren die Farben ihrer Kleidung atemberaubend, von keinerlei Patina gedämpft. Das kräftige, glänzende Rot ihres Umhangs wirkte wie frisch aufgetragener Nagellack, der sich womöglich noch feucht anfühlte; der Kontrast von Licht und Schatten in den Falten des vergoldeten Gewands ließ dieses aussehen, als wäre es aus einem geheimnisvollen metallischen Gewebe gefertigt. Ich begann, einige Details zu bemerken: eine Reihe kleiner Knöpfe auf der Unterseite ihrer Ärmel; rote Rosetten mit schwarzer Umrandung, die ihren Gürtel zierten. Es gab so viel zu betrachten, aber ich würde es auf ein andermal verschieben müssen.
»Und dir ist sie also zu grell, Brian?«, sagte ich und stieg zu den beiden hinunter.
»Ich hab’s lieber schlicht. Wenn das Material, aus dem eine Skulptur ist, für sich selbst spricht.«
»Und das ist deine persönliche Meinung?«
»Sicher.«