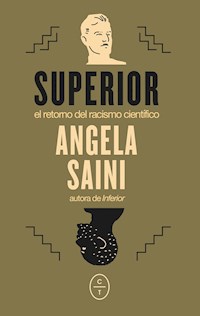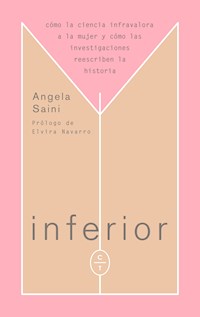18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Für Leser:innen von Yuval Noah Harari und David Graeber & David Wengrow – eine bahnbrechende Neuerzählung dessen, was wir Patriarchat nennen
„Angela Saini ist eine unheimlich kluge Autorin, die komplexe Sachverhalte einfach und lesenswert vermitteln kann.“ Alice Hasters
Was ist das Patriarchat, und wie ist es entstanden? Jahrhundertelang sahen Gesellschaften männliche Vorherrschaft als natürlich an. Was aber, wenn wir nicht davon ausgehen, dass Männer stets über Frauen herrschten? Wenn wir die Ungleichheit der Geschlechter als etwas Fragiles wahrnehmen, das immer wieder neu durchgesetzt werden muss?
Die preisgekrönte Autorin Angela Saini erzählt radikal neu, was wir "Patriarchat" nennen. Sie erforscht die Ursprünge männlicher Herrschaft in den frühesten menschlichen Siedlungen, in kulturellen Praktiken aus der ganzen Welt und aktuellsten Daten aus der Wissenschaft. Entstanden ist eine umfassende Geschichte des Patriarchats: vielschichtig, von Ort zu Ort unterschiedlich, zutiefst menschengemacht – und endlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 491
Ähnliche
Über das Buch
Für Leser:innen von Yuval Noah Harari und David Graeber & David Wengrow — eine bahnbrechende Neuerzählung dessen, was wir Patriarchat nennen»Angela Saini ist eine unheimlich kluge Autorin, die komplexe Sachverhalte einfach und lesenswert vermitteln kann.« Alice HastersWas ist das Patriarchat, und wie ist es entstanden? Jahrhundertelang sahen Gesellschaften männliche Vorherrschaft als natürlich an. Was aber, wenn wir nicht davon ausgehen, dass Männer stets über Frauen herrschten? Wenn wir die Ungleichheit der Geschlechter als etwas Fragiles wahrnehmen, das immer wieder neu durchgesetzt werden muss?Die preisgekrönte Autorin Angela Saini erzählt radikal neu, was wir »Patriarchat« nennen. Sie erforscht die Ursprünge männlicher Herrschaft in den frühesten menschlichen Siedlungen, in kulturellen Praktiken aus der ganzen Welt und aktuellsten Daten aus der Wissenschaft. Entstanden ist eine umfassende Geschichte des Patriarchats: vielschichtig, von Ort zu Ort unterschiedlich, zutiefst menschengemacht — und endlich.
Angela Saini
Die Patriarchen
Auf der Suche nach dem Ursprung männlicher Herrschaft
Aus dem Englischen von SGL
hanserblau
Als ich tötete, tat ich es mit der Wahrheit, nicht mit einem Messer …
Es ist meine Wahrheit, die sie in Schrecken versetzt. Diese furchtbare Wahrheit gibt mir große Kraft. Sie schützt mich davor, Tod oder Leben zu fürchten, Hunger oder Kälte oder Zerstörung. Es ist diese furchtbare Wahrheit, die verhindert, dass ich die Brutalität von Herrschern und Polizisten fürchte.
Ich spucke auf euch. Eine Frau am Punkt Null von Nawal El Saadawi, geschrieben 1975, 1994 auf Deutsch erschienen
Karte der Mutterfolge
Illustration © Martin Brown basierend auf Abbildung 1 in: Surowiec, Alexandra, Snyder, Kate T. & Creanza, Nicole (2019). A worldwide view of matriliny: using cross-cultural analyses to shed light on human kinship systems. Philosophical Transactions of the Royal Society B, Bnd. 374, Nr. 1780, 2. September 2019.
Einleitung
Während ich dieses Buch schrieb, haben mich Bilder von Göttinnen beschäftigt. Es gibt besonders eines, zu dem ich immer wieder zurückkehre.
Dabei handelt es sich um eine weitverbreitete indische Lithografie, die vor etwas mehr als einem Jahrhundert entstand. Kali, die Dämonentöterin, Symbol des Todes und der Zeit, fordert uns auf, das von ihr angerichtete Blutbad zu betrachten. Ihre Augen sind aufgerissen und ihre Zunge gebleckt, ihre blaue Haut leuchtet auf dem Papier. Gewelltes schwarzes Haar fällt ihr bis zur Taille, auf der sie einen Rock aus körperlosen Armen trägt. Abgeschlagene Köpfe sind wie ein Blumenkranz um ihren Hals geschlungen. In einer Hand hält sie ein Schwert, in der zweiten den Kopf eines Dämons, in einer dritten einen Teller, um sein tropfendes Blut aufzufangen, und die vierte Hand deutet ausgestreckt auf die blutige Szene um sie herum.
Altindische Göttinnen und Götter erscheinen oft grenzüberschreitend, wie aus anderen Universen herbeigerufen. In der Zeit des Britischen Weltreichs fürchteten die britischen Behörden und die christlichen Missionare in Indien Kali so sehr, dass nationalistische Revolutionär:innen sie als Symbol gegen die Kolonialherrschaft erkoren. Es gibt Darstellungen, in denen sie Leichen als Ohrringe trägt, ganze Körper, die durch ihre Ohrläppchen gefädelt sind. »Was für ein schreckliches Bild«, schrieb eine Engländerin 1928 in einem von der Bible Churchmen’s Missionary Society veröffentlichten Traktat. »Und diese unzivilisierte wilde Gottheit nennen sie die sanfte Mutter!«
Das Widersprüchliche an Kali ist, dass sie eine göttliche Mutter ist, die jede moderne Annahme über Weiblichkeit und Macht infrage stellt. Ob als Spiegelbild der Menschheit oder eine Umkehrung davon, die Tatsache, dass sie überhaupt erdacht wurde, bleibt erstaunlich. Im 21. Jahrhundert bezeichnen Frauenrechtlerinnen von Neu-Delhi bis New York sie als die »feministische Ikone, die wir heute brauchen«. In Kali können wir immer noch unser Potenzial erkennen, die soziale Ordnung zu zerstören. Wir können uns die übermächtige Wut im Herzen der Unterdrückten vorstellen. Wir können uns sogar fragen, ob das die Köpfe der Patriarchen unserer Geschichte sind, die sie um den Hals trägt.
Das ist die Macht, die unsere Vergangenheit auf uns ausübt. Warum muss uns im 21. Jahrhundert eine Figur aus der antiken Geschichte unsere Macht, die Welt zu verändern, vor Augen führen? Was kann uns Kali schenken, das wir nicht in uns selbst finden können? Der Philosoph Kwame Anthony Appiah fragte einmal, warum einige von uns an eine gleichberechtigtere Vergangenheit glauben müssen, um sich eine gleichberechtigtere Zukunft vorstellen zu können. Diese Frage beschäftigt Historiker:innen, Wissenschaftler:innen, Anthropolog:innen, Archäolog:innen und Feminist:innen noch heute. Als Wissenschaftsjournalistin, die über Rassismus und Sexismus schreibt, denke auch ich oft darüber nach. Uns interessiert, wie unsere Gesellschaften so strukturiert wurden, wie sie es heute sind — und wie sie vorher waren. Wenn wir Kali sehen, versuchen wir, denke ich, nach der Idee zu greifen, dass es eine Zeit gab, in der Männer nicht herrschten, eine verlorene Welt, in der Weiblichkeit und Männlichkeit nicht das bedeuteten, was sie heute bedeuten.
Dieser Wunsch nach einem historischen Vergleich sagt uns noch etwas anderes. Er deutet darauf hin, wie hoffnungslos sich unser Leben manchmal anfühlen kann. Das Wort, mit dem wir heute die Unterdrückung von Frauen beschreiben — »Patriarchat« — ist niederschmetternd und allumfassend und schließt jeglichen Missbrauch und jegliche ungerechte Behandlung von Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt ein, von häuslicher Gewalt und Vergewaltigung bis hin zum Lohngefälle zwischen Männern und Frauen und der Doppelmoral, mit der sie behandelt werden. Nimmt man all das zusammen, scheinen diese Realitäten aufgrund ihres bloßen Ausmaßes und ihrer Tragweite außerhalb unserer Kontrolle zu liegen. Das Patriarchat beginnt wie eine riesige Verschwörung auszusehen, die bis weit in die Vergangenheit zurückreicht. Irgendetwas Schreckliches muss in dunkler Vorzeit geschehen sein, um uns dorthin zu führen, wo wir jetzt sind.
Wenn es nur so einfach wäre.
*
Seit Langem bemühen sich Menschen, die Ursprünge des Patriarchats zu verstehen.
1680 verteidigte der englische Politiktheoretiker Sir Robert Filmer in Patriarcha das Gottesgnadentum der Monarchie mit dem Argument, der Staat sei wie eine Familie, mit Königen in der Rolle der Väter und ihren Untertanen als Kindern. Das königliche Staatsoberhaupt war der ultimative irdische Patriarch von Gottes Gnaden, dessen Handlungsmacht auf die Patriarchen der biblischen Zeit zurückging. In Filmers Vision des Universums — der Vision eines eigennützigen Adeligen — war das Patriarchat naturgegeben. Es begann im Kleinen in der Familie, wo der Vater über seinen Haushalt herrschte, und endete im Großen, wo es sich in den Institutionen der Politik, des Rechts und der Religion widerspiegelte.
Mitte des 19. Jahrhunderts und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschäftigten sich Intellektuelle erneut mit der Frage, was das Patriarchat sei und wie es zustande gekommen sei. War es die umfassende Herrschaft aller Männer über alle Frauen, oder handelte es sich um etwas Spezifischeres? Ging es um Geschlecht, oder ging es um Arbeit? Wurde das Patriarchat vom Kapitalismus gestützt, oder war es unabhängig davon? Hatte es überhaupt eine Geschichte, oder war es ein universelles, von der menschlichen Natur bestimmtes Muster?
Robert Filmers These der Wiederholung des Kleinen im Großen überzeugte auch Jahrhunderte später noch. In Sexus und Herrschaft, einem klassischen Text der feministischen Theorie aus dem Jahr 1970, definierte die US-amerikanische Aktivistin Kate Millett das Patriarchat als die Machtausübung älterer Männer auf jüngere Männer sowie die Machtausübung auf Frauen durch Männer im Allgemeinen. Man ging also weiterhin davon aus, dass die geschlechtsspezifische Macht, ausgehend vom Vater, vom Haus auf die Gemeinde und den Staat ausstrahle.
Es blieb jedoch die Frage, wie Männer überhaupt zu dieser Macht gekommen waren. 1979 stellte die britische Soziologin Veronica Beechey bei der Lektüre eines inzwischen reichhaltigen Kanons an feministischen Schriften über das Patriarchat fest, dass männliche Vorherrschaft häufig auf Sex und Fortpflanzung zurückgeführt wurde. Der pathologische Drang von Männern, die Körper von Frauen zu kontrollieren, wurde als Grund für die Unterdrückung von Frauen angesehen. »Doch«, so schrieb Beechey, »es wird nie deutlich, was dafür verantwortlich ist, dass Männer Frauen sexuell unterdrücken, geschweige denn welche spezifischen Merkmale bestimmter Gesellschaftsformen Männer in Machtpositionen gegenüber Frauen bringen«.
Laut Beechey wird jede universelle Theorie des Patriarchats dadurch erschwert, dass geschlechtsspezifische Ungleichheit und Unterdrückung nie für alle überall gleich waren. Die Göttin Kali stellt schließlich ein Symbol für weibliche Macht dar. Sie mag nur ein Mythos sein, aber sie hätte nicht eine derart große Anhänger:innenschaft, wenn wir nicht auch einen Teil von uns selbst in ihr erkennen würden.
In Indien, wo ich früher lebte, beschäftigen indische Frauen der Ober- und Mittelschicht oft sowohl männliche als auch weibliche Angestellte, die für sie kochen und putzen, und zwar für einen Hungerlohn. Ich war zweiundzwanzig und lebte allein, als zwei Männer für mich arbeiteten. Diejenigen am unteren Ende der Kastenhierarchie verrichten die schmutzigsten und am schlechtesten bezahlten Arbeiten, einschließlich der Entsorgung menschlicher und tierischer Abfälle und Ausscheidungen. Während des ersten Lockdowns im Jahr 2020, als ihre Angestellten nach Hause zurückkehrten und nicht arbeiten konnten, sahen sich die wohlhabendsten Frauen des Landes plötzlich gezwungen, Hausarbeit zu verrichten — in einigen Fällen zum ersten Mal in ihrem Leben. Anfang 2021 begann eine Partei im indischen Bundesstaat Tamil Nadu eine politische Kampagne für die Zahlung eines Monatslohns an Hausfrauen.
Chandra Talpade Mohanty, eine Professorin für Frauenforschung, fragte einmal: »Wie kann man sich auf ›die‹ geschlechtliche Arbeitsteilung beziehen, wenn sich die tatsächliche Ausgestaltung dieser Arbeitsteilung von einer Umgebung zur nächsten und von einem historischen Zeitpunkt zum anderen radikal verändert?« Wenn einige grundlegende Aspekte der männlichen und weiblichen Natur Männern die Kontrolle über Frauen gäben und uns fein säuberlich in verschiedene Rollen aufteilten, würden wir erwarten, dass alle Menschen auf der ganzen Welt und im Laufe der Geschichte ähnliche Lebens- und Arbeitsmuster hätten.
Aber das ist natürlich nicht der Fall. Der niedrige Status einiger Frauen hat andere Frauen in derselben Gesellschaft nie daran gehindert, selbst enormen Reichtum oder Macht zu erlangen. Seitdem Menschen Aufzeichnungen hinterlassen, gab es Königinnen, Kaiserinnen, Pharaoninnen und mächtige Kriegerinnen. In den letzten zwei Jahrhunderten regierten Frauen länger als Männer über Großbritannien und Nordirland. Überall auf der Welt haben Frauen Sklav:innen und Diener:innen gehalten und tun dies auch heute noch. In manchen Kulturen werden Mütter priorisiert, und ihre Kinder gelten nicht als Teil des Haushalts ihrer jeweiligen Väter.
»Frauen verschiedener Klassen machen unterschiedliche historische Erfahrungen«, schrieb Gerda Lerner, eine der Begründerinnen der akademischen Frauengeschichte in den USA, die sich mit diesen Widersprüchen auseinandersetzte.
»Ja, Frauen sind Teil der Namenlosen in der Geschichte, aber sie sind auch Teil der herrschenden Elite und waren es schon immer. Sie werden unterdrückt, aber nicht auf dieselbe Weise wie rassifizierte oder ethnische Gruppen, mit Ausnahme der Frauen, die zu diesen Gruppen gehören. Sie werden untergeordnet und ausgebeutet, aber nicht auf dieselbe Weise wie Menschen aus den unteren Gesellschaftsschichten, mit Ausnahme der Frauen, die diesen Schichten angehören.«
1989 schrieb die Rechtswissenschaftlerin Catharine MacKinnon über die Erkenntnis, dass der Feminismus bis auf wenige Ausnahmen »männliche Macht nicht als ein geordnetes, wenn auch gestörtes, Ganzes begriff. Der Feminismus begann auszusehen, wie eine Anklage epischen Ausmaßes auf der Suche nach einer These, einer epischen These, die noch aufgeschrieben werden muss.« Die Endprodukte männlicher Macht sind gut dokumentiert — in der höheren Anzahl von Männern in Führungspositionen, in der Bevorzugung von Söhnen in vielen Teilen der Welt, in den Statistiken zu sexualisierter Gewalt, in einer Erhebung nach der anderen — aber das allein ist noch keine Erklärung dafür, wie Männer überhaupt zur Herrschaft gelangten. »Das zu erklärende Thema — wie sich männliche Vorherrschaft entwickelt hat — wird quasi vorausgesetzt«, so MacKinnon.
»Soziale Macht wird nicht hinterfragt, sondern nur hingenommen.«
Wie wir tatsächlich zu diesem Moment gekommen sind, nimmt eine mythische Qualität an. Wenn Frauen stärker ausgebeutet wurden als Männer, so MacKinnon, dann wurde der Grund dafür in ihrem Charakter gesucht und nicht in ihrer materiellen Situation. Der Fehler liegt in uns, nicht außerhalb von uns. Selbst Karl Marx, der davon träumte, wie der Kommunismus die Klassenungleichheit abschaffen würde, sah die Ungleichheit der Geschlechter in biologischen Argumenten begründet. Diese Ungleichheit sei somit eine Ausnahme von anderen Formen der Unterdrückung, die eher auf biologischen Unterschieden beruhe als auf historischen Prozessen.
Eine Zeit lang vereinfachten die Bemühungen, eine universelle Grundlage für die Unterdrückung der Frau zu finden, die Realität bis zur Absurdität. Berichte über die Ursprünge des Patriarchats endeten beispielsweise damit, dass Frauen einfach nicht in der Lage waren, sich der männlichen Vorherrschaft zu widersetzen. Frauen waren zu schwach, und Männer waren zu stark. In den anschaulichsten dieser Erzählungen kam der große Wendepunkt in der Frühgeschichte, als friedliche Gesellschaften, in denen Frauen eine zentrale Rolle einnahmen, plötzlich von gewalttätigen, plündernden Männern gestürzt wurden, die eine unaufhaltsame Gier nach Macht und sexueller Kontrolle hatten. Patriarchalische Götter ersetzten sanfte, umsorgende Muttergöttinnen.
»Mit anderen Worten«, warnte die französische Soziologin Christine Delphy vor diesen rein spekulativen Geschichtserzählungen, »wird die Kultur unserer tatsächlichen Gesellschaft auf die ›Natur‹ einer hypothetischen Gesellschaft zurückgeführt«.
Auch die US-amerikanische Anthropologin Michelle Rosaldo war skeptisch. »Wir sind einer begrifflichen Tradition zum Opfer gefallen, die ein ›Wesen‹ in den natürlichen Merkmalen entdeckt, die uns von Männern unterscheiden, und daraus das gegenwärtige Los der Frauen ableitet«, schrieb sie 1980. Aufgrund ihrer anthropologischen Beobachtungen von Gesellschaften auf der ganzen Welt war Rosaldo der Meinung, dass die männliche Vorherrschaft tatsächlich weitverbreitet sei. Aber sie erkannte auch, dass sie sich auf so unterschiedliche Weise manifestierte, dass die Suche nach einer weltweit gemeinsamen Erfahrung oder Ursache dafür zum Scheitern verurteilt war.
»Wir täten gut daran, biologisches Geschlecht wie biologische race zu betrachten«, schlug sie vor, »als Ausrede und nicht als Ursache für den Sexismus, den wir beobachten«.
*
Es sind die Ausnahmen von der Regel, die unsere Annahmen wirklich auf die Probe stellen. Wer wir sind, entdecken wir nicht in den großen, vereinfachten Darstellungen der Geschichte, sondern an den Rändern, wo die Menschen anders leben, als wir es vielleicht erwarten. Beweise aus vielen verschiedenen Kulturen zeigen, dass das, was wir uns als feste biologische Regeln oder schnurgerade Lebensläufe vorstellen, meist alles andere als das sind. Unsere Spezies weist enorm unterschiedliche Lebensentwürfe auf, mit einem bemerkenswerten Spielraum für kulturelle Veränderungen. Wenn wir die Ungleichheit der Geschlechter als etwas betrachten, das uns unwiderruflich eingeschrieben ist, übersehen wir, was sie wirklich ist: etwas Zerbrechliches, das immer wieder neu geschaffen und durchgesetzt werden musste.
Wir gestalten sie auch jetzt noch wieder und wieder neu.
Es scheint wenig überzeugende Beweise für die Existenz matriarchalischer Utopien zu geben, die mit einem Schlag umgestürzt wurden. Ebenso gibt es kaum Belege dafür, dass die Unterdrückung der Frauen im eigenen Zuhause begann. Diese Hinweise finden wir stattdessen in historischen Aufzeichnungen etwa zu der Zeit, als die ersten Staaten und Reiche expandierten und darauf angewiesen waren, ihre Bevölkerung zu vergrößern und Armeen zu unterhalten, um sich zu verteidigen. Aus der Sicht der Eliten, die diese Gesellschaften führten, sollten junge Frauen dazu angeregt werden, so viele Kinder wie möglich zu bekommen. Die Söhne, die sie erzogen, wurden idealerweise willige Krieger. An diesem Punkt kann man die Ausprägung von geschlechtsspezifischen Regeln ausmachen, die das Verhalten und die Freiheit der einzelnen Menschen einschränken. Tugenden wie Loyalität und Ehre wurden in den Dienst dieser grundlegenden Ziele gestellt. Auch Traditionen und Religionen entwickelten sich um diese sozialen Normen herum.
Der gesellschaftliche Druck drang in die einzelnen Haushalte vor und wirkte sich auf die Machtdynamik in Beziehungen aus. In den Teilen der Welt, in denen Bräute ihre Familien verließen, um bei den Familien ihrer Ehemänner zu leben, scheint die Ehe von weitverbreiteten, entmenschlichenden Praktiken wie Gefangennahme und Sklaverei geprägt gewesen zu sein. So wurden Ehefrauen beispielsweise in ihren eigenen Gemeinschaften als Außenseiterinnen behandelt. Ihr Status verbesserte sich oft erst, wenn sie älter wurden und Kinder bekamen. Die Unterdrückung der Frauen begann vielleicht nicht im Heim, aber sie endete dort.
Überbleibsel aus der Vergangenheit lassen vermuten, dass die entstehenden und von Männern dominierten Weltsichten und Institutionen kein einheitliches System gebildet haben können, in dem alle Männer gleichzeitig Macht über alle Frauen ausübten, sondern dass Unterschiede herrschten, je nach den örtlichen Gegebenheiten. Patriarchalische Macht konnte von jeder Person in der Gesellschaft auf vielfältige Weise ausgeübt werden. Aber zu jeder Zeit wehrten sich die Menschen dagegen. Es gab immer Widerstand und Notlösungen. Die Veränderungen, die wir über die Jahre beobachten, vollziehen sich allmählich und unbeständig und schleichen sich oft über Generationen hinweg in das Leben der Menschen ein, bis eine Welt ohne sie nicht mehr vorstellbar ist. Schließlich funktioniert gesellschaftlicher Wandel in der Regel so: durch die Normalisierung dessen, was vorher undenkbar gewesen wäre.
Letztlich ist das hier die Geschichte von Einzelpersonen und Gruppen, die darum kämpfen, die wertvollste Ressource der Welt zu kontrollieren: andere Menschen. Wenn sich Formen patriarchalischer Gesellschaft an unterschiedlichen Enden der Welt auf unheimliche Weise ähneln, liegt das nicht daran, dass sich diese Gesellschaften auf magische (oder biologische) Weise gleichzeitig patriarchalisch organisierten oder dass Frauen sich überall plötzlich unterwarfen. Es liegt daran, dass Macht erfinderisch ist. Geschlechtsspezifische Unterdrückung wurde nicht nur innerhalb von Gesellschaften erdacht und verfeinert, sondern auch jahrhundertelang durch Zwangsmissionierung und Kolonialismus absichtlich in andere Gesellschaften exportiert.
Der heimtückischste Teil dieser Masche ist, wie viele unserer Vorstellungen über die menschliche Natur sie geprägt hat. Wenn uns die indische Göttin Kali eins über unsere Vergangenheit erzählt, dann, dass unsere Wahrnehmung der Welt nie aufgehört hat, neue Richtungen einzuschlagen und sich zu wandeln. Die Machthabenden haben sich verzweifelt bemüht, den von ihnen erfundenen geschlechtsspezifischen Normen und Hierarchien die Illusion von Unumstößlichkeit zu verleihen. Heute sind diese Mythen zu Überzeugungen geworden. Sie leiten unser Leben. Wir wagen nicht zu fragen, ob wir Kali deshalb so radikal finden, weil sie, die alle Regeln der Weiblichkeit bricht, aus einer Zeit stammt, in der diese Regeln anders waren.
Nachdem wir jahrhundertelang in den Gesellschaften gelebt haben, die wir geschaffen haben, geben wir dem, was wir sehen, einen einzigen Namen: »Patriarchat«. Aus unserem Blickwinkel erscheint es fast wie eine Verschwörung, als wäre es von Anfang an klug geplant gewesen — obwohl es in Wahrheit immer ein langsamer, betrügerischer Prozess war. Wir können das an den Patriarchen sehen, die auch heute noch versuchen, ihre Tentakel nach unseren Leben auszustrecken, an der Rückkehr der Taliban in Afghanistan, der Einschränkung geschlechtsspezifischer Freiheiten in Russland und Osteuropa sowie der Abschaffung des Abtreibungsrechts in den USA. Doch dies ist keine abgeschlossene Ursprungsgeschichte, mit der wir nichts mehr zu tun haben. Es ist eine, an der wir aktiv mitschreiben.
Für dieses Buch habe ich jahrelang recherchiert und bin ebenso lange gereist. Die größte Herausforderung bestand darin, die Unmengen an vermeintlichen Fakten zu entwirren, die sich als objektives Wissen tarnen und dann als Vermutungen herausstellen. Je weiter man in der Frühgeschichte zurückgeht, desto zweideutiger werden die Beweise. Mythen und Sagen vermischen sich mit Tatsachen, bis es fast unmöglich ist, sie auseinanderzuhalten. Ich habe die frühesten Anzeichen männlicher Vorherrschaft, die sozialen und ideologischen Wurzeln von geschlechtsspezifischer Unterdrückung, so deutlich es ging offengelegt und habe ihr langsames Wachstum bis in unsere Zeit verfolgt. Die von mir vorgelegte Darstellung ist natürlich weder vollkommen noch vollständig. Auch wenn wir Täuschungsmanöver erkennen, schränken unsere eigenen Erfahrungen und Überzeugungen unser Sichtfeld ein. All unsere Bemühungen, die Ursprünge des Patriarchats zu finden, sagen vielleicht weniger über die Vergangenheit als über die Gegenwart aus.
Aber vielleicht ist es ohnehin die Gegenwart, die wir verstehen wollen.
Kapitel 1
Herrschaft
»Aber gab es denn jemals eine Herrschaft, welche denen, die im Besitz derselben waren, nicht natürlich erschien?«
John Stuart Mill und Harriet Taylor Mill in Die Unterwerfung der Frauen, 1869
Stellen Sie sich vor, Sie erschaffen die Welt von Grund auf neu.
Genau das ist die Prämisse des milliardenschweren Hollywood-Franchise Planet der Affen. In der dystopischen Geschichte, die auf dem Werk des französischen Schriftstellers und ehemaligen Geheimagenten Pierre Boulle aus dem Jahr 1963 beruht, wird die nichts ahnende Menschheit von einem Kollektiv von Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans verdrängt, die daraufhin ihre eigene Zivilisation aufbauen, ihre eigenen politischen und sozialen Institutionen schaffen und von nun an die neuen mächtigsten Lebewesen der Erde darstellen. Mit einem Schlag sind wir die unterlegene Spezies. Eine grundlegendere Revolution kann es gar nicht geben.
Die Filme sind bewusst provokativ, angefangen mit dem Original aus dem Jahr 1968 mit Charlton Heston in der Hauptrolle und gefolgt von Fortsetzungen und Remakes bis 2017. Dass die Filme auch eine Erzählung über Krieg, Tierrechte und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Glaubens an die eigene Außergewöhnlichkeit beinhalten, kann man kaum übersehen. Der offensichtliche rassismuskritische Unterton mit Anklängen an die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung wurde von Kritiker:innen als Angriff empfunden. Ein weiterer Aspekt von Planet der Affen bleibt oft unbemerkt: Ob Mensch oder Affe, Männer stehen fast immer im Mittelpunkt des Geschehens.
Der Originalfilm hatte eine starke weibliche Figur. Doch in dem Film von 2014 ist Cornelia, die sichtbarste Schimpansin und Frau des Affenprotagonisten Caesar, nur ein paar Minuten auf der Leinwand zu sehen. Darüber hinaus ist sie ein lebendiges genderspezifisches Rollenklischee. Unmittelbar nach der Revolution verwandelt sie sich in eine verletzlich wirkende fürsorgliche Mutter und Partnerin mit Perlenschmuck im Haar und einem Säugling im Arm.
Der Reiz von Science-Fiction sollte darin liegen, dass sie mit Konventionen brechen darf. Dieses Genre hält das radikale Versprechen, dass es uns helfen kann, gegen die Welt anzukämpfen, in der wir leben. Die verstorbene Ursula K. Le Guin schrieb einmal, dass ihre und viele der von ihr bewunderten spekulativen Romane »eine ausgedachte, aber überzeugende alternative Realität bieten, die meinen Geist und den Geist der Leser:innen aus der faulen, ängstlichen Denkgewohnheit befreit, dass die Art, wie wir jetzt leben, die einzige Art ist, wie Menschen leben können.«
Aber unsere Fantasie scheint ihre Grenzen zu haben. Wir können nicht anders, als in fiktionalen Situationen nach vertrauten Denkmustern zu suchen. Vielleicht verliehen die Filmemacher:innen von Planet der Affen den anderen Primaten deshalb einen Hauch mehr Menschlichkeit, als sie sie im wirklichen Leben aufweisen. Schimpansen sind im Stammbaum der Evolution gar nicht so weit von uns entfernt, und bei näherer Betrachtung, können wir uns sogar vorstellen, dass sie uns überwältigen könnten. Wir erkennen uns in ihnen wieder — eine Spezies, die auf dem Weg zu globaler Dominanz ist.
Wie sieht also die Gesellschaft in dieser schönen neuen Welt aus, in der alles von vorne beginnt? Seltsamerweise unterscheidet sie sich wenig von unserer aktuellen. Wir lassen uns zwar auf die Möglichkeit eines von Schimpansen angeführten Aufstandes ein, stellen jedoch nicht infrage, warum in diesen Filmen immer noch die Männchen das Sagen haben. Wir fragen nicht, warum eine andere Spezies automatisch heterosexuelle Heiratsgewohnheiten annimmt und die Weibchen schnell hinter dem heimischen Herd verschwinden. Irgendwie hat sich die Kultur der Affen in ein weiteres Patriarchat verwandelt.
Um einen anderen Weg zu finden, denken wir — wenn wir überhaupt darüber nachdenken —, bräuchte es einen eigenen Science-Fiction-Plot. Das würde eine weitere Revolution erfordern.
*
Ich hatte den Zoo von San Diego in Kalifornien gerade noch rechtzeitig erreicht, um die Folgen des Angriffs zu sehen.
Als ich in das Gehege blickte, überkam mich Mitleid mit dem Affen, der sich eine Wunde an der Hand zugezogen hatte. Er kauerte mit dem Rücken zur Gruppe und sah für mich ängstlich oder beschämt aus. Amy Parish, eine Primatologin von der University of Southern California, die hier schon so lange Bonobo-Affen studierte, dass die Tiere sie wiedererkannten, erklärte mir, dass männliche Bonobos Schutz und Status von ihren Müttern erhielten. Ohne seine Mutter in der Nähe war dieser Bonobo sofort Opfer eines gewalttätigen Angriffs durch ein älteres Weibchen geworden.
In den fünf Jahren, seit ich Parish an jenem Tag im Zoo traf, hat ihre Arbeit mit Bonobos den wissenschaftlichen Konsens, dass die weibliche Dominanz bei dieser Spezies die Norm ist, nur noch verstärkt. Bonobo-Weibchen sind dafür bekannt, dass sie Männchen jagen und angreifen. Und das ist für die menschliche Geschichte von Bedeutung, denn Bonobos kommen uns evolutionär gesehen mindestens genauso nahe wie Schimpansen und sind somit einer unserer beiden nächsten genetischen Verwandten im Tierreich. Der Primatenexperte und Professor für Psychologie an der Emory University Frans de Waal bestätigt, dass niemals eine Bonobo-Kolonie beobachtet worden sei, die von einem Männchen angeführt wurde, weder in Gefangenschaft noch in freier Wildbahn. »Früher, vor etwa zwanzig Jahren, gab es ein paar Zweifel daran«, erzählt er mir, aber »heute geht man nicht mehr davon aus. […]
Wir gehen jetzt davon aus, dass die Weibchen dominant sind.«
Männliche Dominanz ist im Tierreich durchaus üblich. Zum Beispiel bei Schimpansen. »Die meisten Menschen halten das Patriarchat für eine Selbstverständlichkeit«, sagt mir Amy Parish. Aber das sei nicht immer so. Je mehr Forscher ins Detail gingen, desto mehr Unterschiede fänden sie. Nicht nur Bonobos, sondern auch Orcas, Löwen, Tüpfelhyänen, Lemuren und Elefanten werden von Weibchen geführt.
Wenn wir verstehen wollten, wie Dominanz funktioniere, »können wir so viel von Bonobos lernen«, fügt Parish hinzu. Bei dieser Spezies hat Dominanz zum Beispiel nichts mit der Größe zu tun. Bonoboweibchen sind im Durchschnitt etwas kleiner als die Männchen, ebenso wie Schimpansenweibchen. Doch im Gegensatz zu Schimpansinnen bauen Bonoboweibchen enge soziale Bindungen zueinander auf, auch wenn sie nicht miteinander verwandt sind. Sie festigen diese Beziehungen und bauen Spannungen ab, indem sie ihre Genitalien aneinanderreiben. Diese engen sozialen Netzwerke schaffen Macht und verhindern, dass einzelne Männchen die Gruppe dominieren können.
»Wir haben diese Vorstellung, dass männliche Wesen von Natur aus dominanter sind als weibliche und dass sie bessere Anführer sind. Und ich glaube, dass diese Vorstellung einfach nicht stimmt«, so de Waal weiter. Davon abgesehen gebe es keine stichhaltigen Beweise dafür. Doch de Waal und Parish mussten feststellen, dass es länger als nötig dauerte, andere davon zu überzeugen. »Es ist für Männer sehr schwer zu akzeptieren, dass Frauen das Sagen haben«, sagt de Waal. Wenn in den Planet der Affen-Filmen Tatsachen übersehen wurden, könnte den sexistischen Klischees die Schuld daran gegeben werden, die seit Generationen die Verhaltensforschung von Tieren lähmen.
»Für mich als Mann ist es interessant, über Gender [sic] und Bonobos zu schreiben, denn wenn eine Frau die Dinge schreiben würde, die ich über Bonobos schreibe, würde man sie in der Wissenschaft wahrscheinlich nicht ernst nehmen«, fügt er hinzu. Selbst andere Primatolog:innen akzeptieren nur zögerlich, dass manche Spezies eindeutig von Weibchen dominiert werden. Einmal, als er in Deutschland einen Vortrag über die Macht der Bonobo-Alphaweibchen hielt, »stand am Ende der Diskussion ein deutscher Professor, ein älterer Mann, auf und fragte: ›Was stimmt nicht mit diesen Männchen?‹ Er war offensichtlich der Meinung, dass sie dominant sein sollten.«
Aber es geht um mehr als Sexismus. Wenn wir andere Spezies beobachten, suchen wir das, was wir an uns selbst beobachten. Wenn Menschen patriarchalische Gesellschaften bilden, wie kann es dann bei unseren nächsten Primatenverwandten, von denen wir annehmen, dass sie unsere Urvergangenheit repräsentieren, anders sein? Was sagt das über die evolutionären Wurzeln von männlicher Vorherrschaft aus?
Fünf Jahre nach dem Kinostart des ersten Planet der Affen-Films 1968 veröffentlichte der Soziologieprofessor Steven Goldberg der City University of New York ein Buch, in dem er argumentierte, dass die grundlegenden biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen so tiefgreifend seien, dass sich in jeder menschlichen Gesellschaft letztendlich ein patriarchalisches System durchsetzen würde. In The Inevitability of Patriarchy (zu Deutsch etwa: Die Unvermeidbarkeit des Patriarchats) behauptete er, dass Männer — die seiner Ansicht nach von Natur aus mächtiger und aggressiver seien — immer das größere Stück des Kuchens abbekommen würden, egal wie man ihn aufteilen würde.
Goldberg schrieb, er schätze wissenschaftliche Wahrheiten und harte biologische Fakten über alles. Aber seine Argumentation beruhte darauf, wie andere Menschen ihren eigenen Status empfanden. »Männliche Dominanz bezieht sich auf das Gefühl [seine Hervorhebung] von sowohl Männern als auch Frauen, dass der Wille der Frau dem des Mannes irgendwie untergeordnet ist«, erklärte er. »Jede Gesellschaft akzeptiert die Existenz dieser Gefühle und passt sich ihnen an, indem sie ihre Kinder entsprechend sozialisiert, denn jede Gesellschaft muss das tun.« Goldberg hätte dieses Verhalten als eine sich selbst erfüllende Prophezeiung interpretieren können, als eine Kultur, die unser Verhalten über Generationen hinweg beeinflusst. Stattdessen sah er es als einen biologischen Instinkt an, als das Verhalten, das die Natur uns vorschreibt.
So schnell seine Erklärung aus heutiger Sicht von der Hand zu weisen sein scheint, gibt es doch große Ähnlichkeiten zwischen Goldbergs Schlussfolgerung und den Schriften von Wissenschaftler:innen und Philosoph:innen der letzten Jahrhunderte. Der Naturforscher Charles Darwin etwa war der Meinung, dass »der Mann der Frau letztendlich überlegen ist«, und zwar als Ergebnis der Evolution. Der Biologe Edward O. Wilson schrieb 1975, dass es zu den grundlegenden menschlichen Verhaltensweisen gehöre, dass erwachsene Männer »über Frauen herrschen«. Dieser Glaube taucht immer wieder in der Populärkultur auf. In einer Folge der Science-Fiction-Serie Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert aus dem Jahr 1988 beamt sich die Besatzung auf einen Planeten, der von Frauen regiert wird, die Männer als Untergebene behandeln. Warum Frauen auf diesem rätselhaften Planeten über Männer herrschen, wird für die Zuschauer:innen durch ein einfaches visuelles Zeichen gelöst: Die Männer dieser Welt sind auffallend kleiner und zarter als die Frauen. Natürlich haben die Frauen das Sagen, weil sie größer sind!
Von den Bonobos wissen wir allerdings, dass durchschnittliche körperliche Größen- oder Kraftunterschiede zwischen den Geschlechtern nicht zwangsläufig zu einem starken Machtungleichgewicht auf der Gesellschaftsebene als Ganzes führen müssen. Aus physischer Überlegenheit folgt keine biologische Regel.
Warum gehen wir dann routinemäßig davon aus, dass es eine geben muss? Selbst Feminist:innen, so die Soziologin Christine Delphy, haben die Stellung der Frau anhand biologischer Argumente erklärt. Sie sehen die Wurzeln des Patriarchats in einer natürlichen Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern oder in einem überwältigenden männlichen Instinkt, weibliche Sexualität zu kontrollieren. »Der Naturalismus ist im antifeministischen Denken zwar noch offensichtlicher«, schreibt Delphy, »aber er ist auch im Feminismus in hohem Maße vorhanden.«
*
Steven Goldberg wurde schließlich zum Vorsitzenden der soziologischen Fakultät an der City University of New York ernannt. Als ich fast fünf Jahrzehnte nach der Veröffentlichung von The Inevitability of Patriarchy mit ihm spreche, scheint sein Glaube an seine Theorie ungebrochen. Goldberg bekräftigt, dass er politisch nicht an dem Thema interessiert war, als er vor all den Jahren anfing, es zu erforschen. Er versuchte nur, einer neutralen Beobachtung einen Sinn zu geben.
»Im Grunde ist es Neugier … das ist meine eigentliche Motivation«, erzählt er mir am Telefon von seinem Haus in New York aus. »Bei meiner soziologischen Forschung beunruhigte mich, wie schwammig vieles davon war. Und als ich auf die Tatsache stieß, dass alle Gesellschaften patriarchalisch sind, hat mich das fasziniert.«
Im Mittelpunkt seiner Argumentation stand eine einzige Tatsache: 1973, als er sein Buch veröffentlichte, wurden viele der mächtigsten Länder der Welt, darunter die USA, China und die Sowjetunion, von Männern regiert. Man hätte dagegenhalten können, dass Indira Gandhi Premierministerin von Indien war und Golda Meir Ministerpräsidentin von Israel. Goldberg wusste damals außerdem nicht, dass Margaret Thatcher 1979 Regierungschefin von Großbritannien und Nordirland werden würde. Doch er formulierte eine tatsächliche unbequeme Wahrheit: Es schien ein hartnäckiges Festhalten an männlicher Autorität zu geben. Selbst in den Staaten, die von Frauen regiert wurden, waren die meisten Politiker:innen unter ihnen Männer. Thatcher war ein Paradebeispiel dafür: Sie wählte in den elf Jahren, die sie an der Macht war, nur eine einzige Frau für ihr Kabinett aus.
»Das Patriarchat ist universell«, erklärt mir Goldberg. »Die Tatsache, dass jede Gesellschaft so organisiert ist, deutet für mich stark auf ein biologisches Element hin, und bis zu einem gewissen Grad scheint es unvermeidlich zu sein.«
In einer damaligen Buchbesprechung für die Zeitschrift American Anthropologist zeigte sich Eleanor Leacock, die den Lehrstuhl für Anthropologie am City College of New York innehatte, verärgert über das Fehlen einer wissenschaftlichen Verbindung zwischen Goldbergs Theorie und etwas Messbarem in unserem Körper. Seine Antwort auf männliche Herrschaft war ein frustrierender Zirkelschluss. Es sei natürlich, dass sie existiere, und sie existiere, weil sie natürlich sei. »Wenn ich den Sinn dazu hätte, würde ich eher eine Parodie als eine direkte Kritik schreiben«, schrieb sie. »Aber vielleicht ist Goldbergs Theorie selbst schon Parodie genug.«
Als sein Buch erschien, bestätigten die Daten über Frauen in Führungspositionen Goldbergs These. In den vergangenen Jahrzehnten haben sich die Zahlen jedoch in die andere Richtung entwickelt. 1960 wurde die weltweit erste Frau in Sri Lanka zur Premierministerin gewählt. Sirimavo Bandaranaike regierte für drei separate Amtszeiten. Nach 1960 stieg der Anteil der Staaten, in denen das höchste Amt der Exekutive von einer Frau bekleidet wurde, fast unaufhörlich, und liegt heute bei etwa siebzehn Prozent. Anfang 2020 bestanden nach Angaben der Vereinten Nationen die Regierungen von vierzehn Ländern mindestens zur Hälfte aus Ministerinnen: Spanien, Finnland, Nicaragua, Kolumbien, Österreich, Peru, Schweden, Ruanda, Albanien, Frankreich, Andorra, Kanada, Costa Rica und Guinea-Bissau.
»Die Wissenschaft spricht nur von dem, was ist, und dem, was im Rahmen der mathematischen Wahrscheinlichkeit sein muss«, schrieb Goldberg 1973 in der festen Überzeugung, dass die Datenlage zu seinen Gunsten ausfallen würde. Angesichts eines fünfzigjährigen gesellschaftlichen Wandels, der sich größtenteils in die Gegenrichtung vollzog, »entfernt man sich langsam von der These meines Buchs«, räumt er ein. »Wenn man eine Theorie formuliert, muss man immer darauf gefasst sein falschzuliegen.« Aber er glaubt trotzdem, dass er auf lange Sicht recht behalten wird. »Ich glaube, die Situation ist jetzt etwas unübersichtlicher«, sagt er. »Wenn die Situation noch dieselbe wäre wie vor hundert Jahren, wäre meine Theorie stärker, aber ich glaube, sie ist immer noch stark.«
Er lässt mich mit einer Vorhersage zurück: »Wir werden nie an den Punkt gelangen, an dem das Patriarchat aus allen Gesellschaften verschwunden ist.« Für ihn ist männliche Vorherrschaft eine biologische Bewegung, die durch kulturellen Druck nur bis zu einem gewissen Grad aufgehalten werden kann. Die Gleichstellung der Geschlechter muss gegen unsere natürlichen Instinkte erkämpft werden.
Goldbergs Argument fällt also wieder auf seinen persönlichen Eindruck zurück. Er folgert, dass weibliche Macht etwas Neues sei, ein moderner Eingriff in eine universelle, zeitlose Ordnung. Menschliches Leben sei schon immer patriarchalen Regeln unterworfen gewesen. Aber es fehlen immer noch tatsächliche Beweise. Welche Bestätigung haben wir dafür, dass das Leben schon immer so war? Wenn das Patriarchat universell und zeitlos wäre, müssten wir zumindest einige der patriarchalischen Muster, die wir beim Menschen sehen, auch bei anderen Spezies finden, insbesondere bei denen, die uns evolutionär am nächsten stehen.
Der Primatenforscher Frans de Waal erklärt jedoch, dass sich Tierforscher, wenn sie von männlicher Dominanz sprechen, fast immer auf Männchen beziehen, die ihre Dominanz übereinander zu behaupten versuchen — nicht über Weibchen. »Auch unter Schimpansen, wo die Männchen dominieren, gibt es weibliche Anführer«, sagt er.
Sexuelle Nötigung von Weibchen komme zwar vor, aber wie heftig und in welchem Ausmaß sei von Art zu Art sehr unterschiedlich. Und beim Machtkampf unter Männchen gäben Größe und Aggressivität nicht unbedingt den Ausschlag. Das Alphamännchen gewinne nicht immer, indem es andere unterwerfe, sondern indem es strategische Netzwerke mit Verbündeten aufbaue. Primaten würden nicht gerne von Tyrannen beherrscht oder ungerecht behandelt. Einige der wichtigsten Eigenschaften, die mit Dominanz verbunden seien, sind Freundlichkeit, Kontaktfreudigkeit und Kooperationsfähigkeit. Selbst der kleinste Schimpanse könne zum Alphatier werden, wenn er in der Lage sei, Vertrauen und Loyalität zu gewinnen, fügt de Waal hinzu. Konfliktbewältigungsstrategien zur Friedenswahrung könne man laut der Biologin Amy Morris-Drake von der Universität Bristol auch bei Raben und Haushunden beobachten. Morris-Drake gehörte zu einem Team, das 2021 zeigte, dass Zwergmangusten sich merken, wer aus ihrer Gruppe Streit mit anderen anfing, und diesen Individuen später die kalte Schulter zeigten.
Zu bestimmen, welches Verhalten von Tieren »natürlich« ist und welches nicht, ist nicht immer einfach. Im Jahr 2010 beobachteten Forscher:innen des Max-Planck-Instituts, wie eine Schimpansin in einem Schimpansenwaisenhaus in Sambia ohne ersichtlichen Grund einen Grashalm in ihr Ohr steckte. Andere Schimpansen taten es ihr bald gleich und setzten den Trend auch nach ihrem Tod fort. Wissenschaftler:innen bezeichneten dies als eine »Tradition«. Das warf ein Dilemma auf: Wenn andere Primaten Traditionen oder soziale Bräuche entwickeln können, wie wollen wir dann bei einer so kulturell komplexen Spezies wie unserer eigenen eine unveränderliche, sich nie verändernde Natur erkennen? De Waal erzählt mir, dass einige Schimpansengemeinschaften in Westafrika im Vergleich zu denen in Ostafrika einen größeren Zusammenhalt aufweisen. In diesen Gesellschaften spielen die Weibchen eine größere Rolle. Er glaubt, dass der Unterschied auch hier teilweise kulturell bedingt sein könnte.
»Ich denke, wenn jemand sagt, dass das Patriarchat für die menschliche Spezies quasi natürlich ist, dass männliche Dominanz und männliche Gewalt natürlich sind, übertreibt diese Person völlig«, sagt er. »Ich denke nicht, dass das unbedingt der natürliche Zustand unserer Spezies ist.«
Im Vergleich zu anderen Primaten erscheint die »patriarchalische« menschliche Familie mit dem Vater an der Spitze in der Tat recht seltsam. In einer Sonderausgabe einer Zeitschrift der Royal Society aus dem Jahr 2019 stellte die Anthropologin Melissa Emery Thompson von der University of New Mexico fest, dass »keine Primatenart einen direkten Vergleich zum Menschen bietet«. Im Gegenteil: Laut ihrer Forschung seien die Verwandtschaftsbeziehungen bei anderen Primaten durchweg über die Mütter und nicht über die Väter organisiert. Das bedeutet vielleicht gar nichts. Es könnte durchaus sein, dass der Mensch einfach anders ist. Aber es war ein so hartnäckiges Merkmal, dass Thompson sich fragte, ob Wissenschaftler:innen, die Menschen studiert hatten, die Bedeutung der mütterlichen Beziehung über Generationen hinweg unterschätzt haben könnten. Die Expert:innen waren sich so sicher, dass das menschliche Patriarchat durch die Biologie erklärt werden kann, dass sie blind für die Möglichkeit geworden waren, dass Mütter ebenso Macht ausüben können wie Väter.
*
An einem Monsunmorgen im Juli 1968 reiste Robin Jeffrey mit dem Bus durch den indischen Bundesstaat Kerala. Der Forscher, der sich heute mit der modernen Geschichte und Politik Indiens befasst, arbeitete damals als Lehrer im Punjab im Norden des Landes. Das Klima in Kerala ist eher feucht, und nach einer Weile wurde es schwül im Bus. Also öffnete er an der nächsten Haltestelle die Plane an seinem Fenster, um etwas Luft hereinzulassen. Ein paar Meter weiter bemerkte er eine alte, weiß gekleidete Frau, die sorglos auf ihrer Veranda saß.
Sie blickte aufmerksam durch ihre dicken Brillengläser. Erst dann bemerkte Jeffrey die Zeitung in ihrem Schoß.
Dieser Moment war für ihn so bemerkenswert, dass er ihn nie vergessen hat. »Er hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt«, erzählt er mir. Für Jeffrey war es ungewöhnlich, jemanden in der Öffentlichkeit eine Zeitung in der Landessprache lesen zu sehen, zumindest im Punjab. Wie in weiten Teilen der Welt war zu dieser Zeit auch in Indien die Alphabetisierungsrate niedrig, erst recht bei den Frauen. Es war selten, dass eine Person überhaupt eine Lesebrille besaß. Und doch saß da diese Frau, die in aller Ruhe ihre Zeitung las. »Es ist eines dieser lebhaften Bilder, die einem ins Auge springen, weil sie so gar nicht dem entsprechen, was man erwartet.«
Die Alphabetisierungsrate bei Erwachsenen liegt heute bei etwa drei Vierteln der Bevölkerung, aber in den meisten Bundesstaaten besteht nach wie vor ein ausgeprägtes Gefälle zwischen den Geschlechtern. In Kerala jedoch ist die Alphabetisierungsrate unter Frauen seit Beginn dieser Erhebungen etwa gleich hoch wie unter Männern. Derzeit liegt sie bei über fünfundneunzig Prozent. Der an der fruchtbaren Südwestküste Indiens gelegene Bundesstaat ist dafür bekannt, dass Frauen dort allein reisen und relativ sicher und unbehelligt durch die Straßen gehen können. Das ist keine Nebensache. In meinem ersten Job bei einem indischen Nachrichtenmagazin in der geschäftigen, staubigen Hauptstadt Delhi lernte ich schnell, dass man nach Einbruch der Dunkelheit nicht ohne einen Freund oder Verwandten unterwegs sein sollte. Eine misogyne Geringschätzung von Frauen und Mädchen, die an Verachtung grenzt, wurde nur von der eisernen Widerstandsfähigkeit übertroffen, die wir uns aneignen mussten. Kerala hingegen erschien wie ein Märchenland, ein Ort, an dem die Geschlechterrollen vertauscht waren, an dem Frauen schon immer geherrscht hatten und an dem Töchter höher geschätzt wurden als Söhne.
Auch heute wird Kerala von Außenstehenden oft als Matriarchat bezeichnet. In Wirklichkeit gibt es dort genauso wie anderswo Frauenfeindlichkeit und Missbrauch, und absolut nicht alle Macht ist in weiblichen Händen, schon gar nicht in den Händen von Frauen der unteren Kasten. Aber manche der Legenden sind trotzdem wahr. Zumindest ein Teil der Gleichstellungsbilanz von Kerala kann den alten Nayar zugeschrieben werden, einer mächtigen Kaste von Kriegern und Fürsten, die einst Teile dieser Region beherrschten und sich matrilinear organisierten. Das bedeutet, dass bei ihnen die Abstammungslinie über die Mütter ging und nicht über die Väter.
Matrilineare Gesellschaften werden oft als Ausnahmen behandelt, doch es gibt sie im gesamten asiatischen Raum, in Teilen Nord- und Südamerikas und in einem breiten »matrilinearen Gürtel«, der sich quer durch die Mitte von Afrika zieht. Nur in Europa sind sie ungewöhnlich. Matrilinearität oder »Mutterfolge« garantiert nicht, dass Frauen besser behandelt werden oder dass Männer keine Macht- und Autoritätspositionen innehaben, aber sie trägt dazu bei, wie eine Gesellschaft über die Geschlechter denkt. Ganz grundlegend vermittelt sie Kindern die Bedeutung ihrer Vorfahrinnen und dass Mädchen einen wichtigen Platz in ihren Familien einnehmen. Die Mutterfolge kann den Status einer Frau bestimmen und festlegen, wie viel Reichtum und Eigentum sie eines Tages erben wird. Im Jahr 2020 veröffentlichte die Wirtschaftswissenschaftlerin Sara Lowes von der University of California in San Diego eine Umfrage unter mehr als sechshundert Menschen, die in Kananga in der Demokratischen Republik Kongo lebten, das im afrikanischen »matrilinearen Gürtel« liegt. Lowes verglich ihre Antworten mit unabhängigen demografischen und gesundheitlichen Erhebungen im ganzen Land. Sie fand heraus, dass »Frauen, die matrilinear leben, über eine größere Selbstständigkeit bei der Entscheidungsfindung berichten, häusliche Gewalt weniger unterstützen und vor allem weniger häusliche Gewalt erleben.«
Lowes fand auch heraus, dass die Kinder matrilinearer Frauen im vorhergehenden Monat seltener krank waren und im Durchschnitt über fast ein halbes Jahr mehr Bildung verfügten.
Forscher:innen schätzen, dass etwa 70 Prozent der Gesellschaften weltweit patrilokal sind, was bedeutet, dass Menschen in der Regel bei den Familien ihrer Väter leben. Die Matrilokalität, bei der Menschen ihr ganzes Leben lang bei den Familien ihrer Mütter oder in deren Nähe leben, geht häufig mit der Mutterfolge einher. Einige dieser matrilokalen Gesellschaften sind vermutlich Tausende von Jahren alt. 2009 wiesen Biolog:innen und Anthropolog:innen in der Fachzeitschrift Proceedings of the Royal Society B anhand von genetischen Beweisen in Verbindung mit kulturellen Daten und Stammbäumen nach, dass matrilokale Gemeinschaften beispielsweise im Pazifik bis zu fünf Jahrtausende alt sein könnten. Die Lebensgewohnheiten haben sich seither zwar verändert, aber Mutterfolge und Matrilokalität sind ihnen immer noch eingeschrieben.
In seinen 1991 erschienenen Memoiren in der Landessprache Malayalam, die später unter dem Titel The Village Before Time (zu Deutsch etwa: Das Dorf vor der Zeit) ins Englische übersetzt wurden und nicht in deutscher Sprache vorliegen, zeichnet der Journalist Madhavan Kutty ein intimes Porträt des Alltagslebens in seinem matrilinearen Elternhaus in Kerala. Statt kleiner Kernfamilien, die sich nach der Heirat aufspalteten, lebten die Nayar in großen Tharavadus zusammen, Haushalten mit unter Umständen Dutzenden von Familienmitgliedern, die eine gemeinsame ältere weibliche Vorfahrin hatten. Schwestern und Brüder blieben ihr ganzes Leben lang unter einem Dach wohnen. Eine Frau durfte mehr als einen Sexualpartner haben, von denen keiner mit ihr zusammenleben musste. Von den Vätern wurde nicht erwartet, dass sie eine große Rolle bei der Erziehung ihrer eigenen Kinder spielten, sondern dass sie stattdessen bei der Erziehung der Kinder ihrer Schwestern halfen. Kutty, der in ein großes Tharavadu hineingeboren wurde, erzählt, dass in seinem Stammbaum nur die Kinder der Töchter aufgeführt waren.
Kuttys Großmutter, Karthiyayani Amma, wurde schließlich das Oberhaupt des Haushalts. Gemäß den örtlichen Gepflogenheiten bedeckte sie nie ihre Brüste. »Ein tiefer, unbewusster Reichtum an Geschichte befand sich in ihr«, schreibt er. »Diese Matriarchin unserer Großfamilie, eine Persönlichkeit von großer Stärke und großem Verständnis, war zutiefst besorgt um die Freiheit der Frauen.«
Die Gemeinschaft, in der Kutty aufwuchs, war weder klein noch unbedeutend. Die Nayar genossen ein hohes Ansehen in einem Land, in dem sozialer Status ohnehin sehr wichtig ist. Der in Kerala geborene Autor Manu Pillai hat die Geschichte des Königreichs Travancore nachgezeichnet, das sich mindestens zweihundert Jahre lang bis Mitte des 20. Jahrhunderts über Teile des südlichen Kerala erstreckte. »Die Nayar-Frauen konnten sich ihr ganzes Leben lang auf die Sicherheit des Hauses verlassen, in dem sie geboren wurden, und waren nicht von ihren Ehemännern abhängig«, schreibt er in seinem Buch The Ivory Throne (zu Deutsch etwa: Der Elfenbeinthron). »Witwenschaft war keine Katastrophe, Witwen waren den Männern praktisch gleichgestellt in Bezug auf ihre sexuellen Rechte und hatten die volle Kontrolle über ihren Körper.«
Für diejenigen, die in dieser Gesellschaft lebten, war das natürlich nichts Besonderes. So sah das Familienleben aus, das seit Generationen gelebt wurde. Aber von dem Moment an, als sie den Nayar in Kerala begegneten, waren europäische Besucher:innen wie gebannt. Nicht nur die Realität faszinierte sie, sondern auch das Potenzial einer scheinbar »normalen« Gesellschaft, die auf den Kopf gestellt schien. Einige waren schockiert, so G. Arunima, eine Wissenschaftlerin für Frauenstudien an der Jawaharlal Nehru University und Direktorin des Kerala Council for Historical Research. Im 17. Jahrhundert fand ein holländischer Reisender, dass es sich um die »lüsternste und unkeuscheste Nation im ganzen Orient« handelte, schreibt sie. Andere wurden inspiriert. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts schrieb James Henry Lawrence, ein junger britischer Romancier und Sohn eines Sklavenbesitzers, einen Roman, der später unter dem Titel Das Paradies der Liebe veröffentlicht wurde. Lawrence benutzte Kerala als Beispiel dafür, dass Frauen in Europa eine bessere Ausbildung erhalten sollten, dass sie mehrere Liebhaber haben dürfen und dass die Ehe abgeschafft werden sollte.
Doch wie auch immer sie reagierten, schreibt Arunima, Außenstehende beäugten die Nayar in der Regel wie eine Kuriosität, da ihrer Überzeugung nach die Vaterfolge die normale Lebensweise sei. Matrilineare Gesellschaften wurden als »unzivilisiert« und »unnatürlich« bezeichnet. Ihre Existenz war erklärungsbedürftig.
Noch heute begegnen westliche Wissenschaftler:innen ihnen mit einer Mischung aus Verwirrung und Überraschung. In der neueren anthropologischen Literatur wird die Mutterfolge als ein Zustand beschrieben, der von Natur aus instabil sei. Der Ausdruck »matrilineares Rätsel« wird seit siebzig Jahren von Forscher:innen verwendet, die Gesellschaftssysteme wie das der Nayar in Kerala untersuchen: Warum sollte ein Vater seine Zeit und Energie in die Erziehung seiner Nichten und Neffen investieren statt in die seiner eigenen Kinder? Warum duldet ein Mann, dass die Autorität über seine eigenen Kinder und deren Mutter bei deren Schwager liegt? Wie konnten Männer dies jahrhundertelang hinnehmen, ohne eine Änderung zu erzwingen?
Als sich Kerala im 19. Jahrhundert veränderte, war dies ironischerweise zum großen Teil auf neugierige und schockierte Außenstehende zurückzuführen. Britische Kolonialist:innen, die die Herrschaft in der Region übernommen hatten, und christliche Missionar:innen zwangen die Bewohner:innen von Kerala, ihre Geschlechterkonventionen den viktorianisch-englischen Normen anzupassen. »Auf der Suche nach einem psychologischen Vorteil gegenüber ihren Untertanen bestätigte die koloniale Ideologie die moralische Überlegenheit der Herrscher auf viele subtile und weniger subtile Arten«, schreibt die indische Historikerin Uma Chakravarti.
Im Verlauf des 19. Jahrhunderts ging die Macht in den Tharavadus, die zuvor zwischen den älteren Brüdern und den Frauen der Haushalte geteilt war — immer nach aktuellen Umständen und Seniorität — alleinig und unanfechtbar auf die Brüder über. Gesetzliche Regelungen aus der Kolonialzeit, die matrilineare Gemeinschaften »zivilisieren« sollten, trugen dazu bei, den Status der ältesten Männer in den Tharavadus aufzuwerten. Familienstreitigkeiten waren die Folge. In einem Gerichtsfall aus dem Jahr 1855 erklärte ein Richter im damaligen Kalikut (heute: Kozhikode), einer der größten Städte Keralas und damals unter direkter britischer Herrschaft, dass »es in der Tat eine gewaltsame Folgerung wäre, dass … die Autorität nur bei den Frauen läge.«
Die Frage, wie viel Macht eine Frau von Natur aus besitzen kann, stellte sich bereits, als die Königin von Travancore, Rani Gowri Lakshmi, 1810 ihre Herrschaft antrat. Von dem Moment an, als sie einen Sohn zur Welt brachte, sollte sie ihm den Thron überlassen, erklärt Manu Pillai. Die Königin bekam stattdessen den verwässerten Titel »Regentin«, bis ihr Sohn alt genug wäre, um zu regieren. Doch sosehr die britischen Behörden auch versuchten, ihre Position zu schwächen, war sie in den Augen der Einheimischen trotzdem die rechtmäßige Monarchin. Laut Pillai übte sie ihre Autorität ungebremst aus. Und das setzte sich auch fort, als ihre Schwester nach ihrem Tod die Regierung übernahm. Die Königin wurde in offiziellen Dokumenten sogar als »Maharadscha« angesprochen, also mit dem Titel, den normalerweise ein indischer König innehat.
Im matrilinearen System, in dem die Geschlechter relativ gleichberechtigt waren, war »das Geschlecht des Monarchen von geringer Bedeutung«, schreibt Pillai. »Die Stellung selbst und die damit verbundene Würde waren von Bedeutung, und wer auch immer die oberste Autorität im Staat und im Königshaus ausübte, galt als Maharadscha.«
Doch im Laufe der Jahrzehnte begann der koloniale Druck auf die Nayar-Familien seine beabsichtigte Wirkung zu zeigen. Junge, gebildete Reformer:innen hatten gelernt, ihre Traditionen durch die Augen anderer als peinlich und rückständig zu betrachten und waren zu gern bereit, mit der Vergangenheit zu brechen. Die monogame Ehe und kleinere Familien wurden langsam zu einer akzeptierten modernen Form des Zusammenlebens. Literatur und Kunst spiegelten die sich wandelnden Ansichten über Frauen und ihren Platz in der Gesellschaft wider. Die kulturelle Skala verschob sich und mit ihr auch die Vorstellungen der Menschen über sich selbst.
*
Unter den Millionen Khasi, die in den grasbewachsenen Hügeln von Meghalaya im Nordosten Indiens leben, gibt es ein lokales Sprichwort: Long Jaid na ka Kynthei. Es bedeutet so viel wie: »Alle Menschen stammen von der Frau ab.« Die Khasi leben im Gegensatz zu den Nayar in Kerala auch heute noch matrilinear. Ein Kind wird als zur Mutter gehörend betrachtet. Diese wiederum gehört zu ihrer eigenen Mutter, und so weiter, bis hin zu einer großen Urahnin. Die Geburt einer Tochter ist ein Grund zum Feiern, denn ohne Töchter gibt es niemanden, der die Familienlinie fortsetzt.
»Männer haben kein Recht auf Eigentum, und Männer haben auch kein Recht auf Kinder, denn die Kinder gehören zum Clan der Mutter, zur Familie der Mutter«, erklärt mir Tiplut Nongbri, eine pensionierte Professorin für Soziologie an der Jawaharlal Nehru University, die in den Khasi-Bergen aufgewachsen ist. Nach der Heirat zieht ein Khasi-Ehemann zu seiner Frau in das Haus ihrer Familie. Aber sein angestammter Platz ist immer noch bei der Familie seiner eigenen Mutter — manchmal werden seine sterblichen Überreste nach dem Tod dorthin geschickt. »Traditionell geht das Erbe bei den Khasi von der Mutter auf die Tochter über, wobei die jüngste Tochter den größten Teil erbt«, fügt Nongbri hinzu. Es sei ihre Aufgabe, für ihre Eltern und unverheiratete Geschwister zu sorgen. Sie ist die Hüterin der Familie.
Es handelt sich bei den Khasi nicht um eine streng matriarchalische Gesellschaft. Die familiäre Autorität liegt eigentlich beim Bruder der Mutter, obwohl seine Macht nicht absolut ist. In der lokalen Politik spielen Frauen eine untergeordnete Rolle. Trotzdem sind sie laut Nongbri im Durchschnitt besser dran als in patrilinearen Gesellschaften in anderen Teilen Indiens. Khasi-Frauen lassen sich häufiger scheiden und heiraten häufiger wieder als andere indische Frauen. Sie haben mehr Freiheit und Handlungsspielraum. Nongbri hat beide Lebenswege kennengelernt — als Frau innerhalb und später außerhalb einer matrilinearen Gesellschaft — und sagt, dass man beides nicht vergleichen könne.
»Ich bin froh, dass ich in diese Gesellschaft hineingeboren wurde«, sagt sie.
Aber genau wie in Kerala herrschte Veränderungsdruck. Hier überschneidet sich die Geschichte der modernen Khasi mit der Geschichte der Nayar. Als christliche Missionar:innen aus Wales im 19. Jahrhundert in die Khasi-Berge kamen, zerstörten sie die Wurzeln lokaler Verwandtschaftsgepflogenheiten und verdrängten religiöse Bräuche, die die Familien zusammenhielten. Dies schwächte die Beziehungen zwischen Brüdern und Schwestern, die den Kern der matrilinearen Familie bildeten. In der jüngsten Zeit, in der die Welt immer vernetzter wurde, konnten Khasi-Männer patriarchalische Alternativen zu ihrer eigenen Gesellschaft im übrigen Indien erkennen. Einige setzen sich für eine Anpassung der Erbschaftsgesetze ein, die Söhne und Töchter gleichstellt.
»Sie wollen die gleiche Macht und Autorität und dieselben Privilegien, die Männer in nicht —matriarchalischen Gesellschaften genießen«, erklärt Nongbri. »Wenn Männer, die mit der Außenwelt in Berührung gekommen sind, sich selbst mit den Männern in patriarchalischen Gesellschaften vergleichen, die Rechte über Kinder und Eigentum haben und die Kontrolle über alles im Kernhaushalt ausüben, sehen sie sich in vielerlei Hinsicht benachteiligt«, fügt sie hinzu. »Das führt zu einem Minderwertigkeitskomplex.«
Die internationale Presse ist fasziniert von dem, was sie als umgekehrten Kampf um die Gleichberechtigung der Geschlechter darstellt. »Die Männerrechtler von Meghalaya«, lautete eine Schlagzeile in der Times of India. Khasi-Männer fühlen sich marginalisiert und nicht gewertschätzt, sie würden wie Zuchtbullen behandelt, die nur zum Kinderkriegen taugten, berichten andere Journalist:innen. »Hier regieren die Frauen, und die Männer sind Suffragetten«, so BBC News.
Die belustigten Reaktionen der Presse befördern das Selbstverständnis einiger Khasi-Männer. »Frauen sind überall, auf den Basaren, in den Regierungsbüros«, zitiert die Deutsche Welle Keith Pariat, den ehemaligen Vorsitzenden der Männerrechtsgruppe Synkhong Rympei Thymmai (übersetzt etwa: Vereinigung zur Reformierung der Familienstruktur). Pariat verstieß gegen die Tradition, indem er seinen eigenen Nachnamen an seine Tochter weitergab. Ihm zufolge habe das Unbehagen der Khasi-Männer über die Mutterfolge einige von ihnen in die Alkohol- oder Drogenabhängigkeit und in die Arme anderer Frauen getrieben.
Doch Pariat ist ein Ausreißer. Andere befürworten die Traditionen ihrer Gesellschaft. Die Unterstützung für die Mutterfolge ist nach wie vor groß. Bereits 1936 wehrte sich der in Shillong geborene und im heutigen Kolkata ausgebildete Khasi-Schriftsteller David Roy Phanwar gegen die Scheinheiligkeit, mit der Fremde seine Gesellschaft als einfach und abergläubisch darstellten, während sie den relativ jungen Kampf um das Frauenwahlrecht als modern und fortschrittlich ansahen. »Frauen genießen bei den Khasi eine Position von ungewöhnlicher Würde und Bedeutung«, schrieb er. »Die Versklavung der Ehefrau als bloßes Eigentum der Männerfamilie war der Ursprung der feministischen Bewegung in der Welt, aber in Khasi ist die Frau die verherrlichte Person, die frei handeln kann.«
Die Spannung zwischen neueren und altbewährten patriarchalischen Kräften, zwischen dem, was als modern angesehen wird, und dem, was als traditionelles Erbe geschätzt wird, zeigt sich auch in anderen matrilinearen Gesellschaften. In Sumatra Barat in Indonesien bestehen die Haushalte der Minangkabau traditionell aus Frauen und ihren Kindern. Ehemänner ziehen nach der Heirat zu ihren Frauen. Männer können zwar Land von ihren Müttern erben, doch nur für ihre eigene Lebenszeit — sie dürfen ihr Erbe nicht an ihre Kinder weitergeben. Die Anthropologin Evelyn Blackwood schreibt, dass die Kolonisator:innen, als diese Region im 19. Jahrhundert unter holländischer Herrschaft stand, ältere Minangkabau-Männer routinemäßig als Häuptlinge und Anführer ansahen. Ausgewählte Männer sollten mit ihnen zusammenarbeiten, um die Gesetze der Kolonisator:innen durchzusetzen. Im Laufe der Zeit erließen die niederländischen Behörden Dekrete, wonach nur Männer Land registrieren oder ihre Familien bei Streitigkeiten vertreten durften.
Kurzfristig mag dies keinen großen Einfluss auf das Selbstverständnis der Minangkabau-Familien gehabt haben, doch Blackwood argumentiert, dass die Allgegenwärtigkeit dieser anderen Weltsicht »einen starken Eindruck auf die in niederländischen Schulen ausgebildeten Minangkabau-Männer der Oberschicht« machte. Als der Islam dort aufkam, eröffnete er Männern noch mal neue Wege in bisher unerreichbare Autoritätspositionen wie die des Religionsführers. Im Laufe der Zeit entwickelte sich im Land eine muslimische Mehrheit. Bis heute gibt es Konflikte zwischen denen, die nach neuen Traditionen leben wollen, und denen, die an den alten Bräuchen festhalten wollen, die in der Landessprache als Adat bekannt sind.
Der verstorbene indonesische Anthropologe Mochtar Naim, der aufzeichnete, wie sich die Gesellschaft der Minangkabau über die Jahre veränderte, sah einen Teil des Problems darin, dass der Vater als Gast in der Familie seiner Kinder angesehen wurde. Es überrascht nicht, dass einige junge unverheiratete Männer nach Alternativen zu einer Gesellschaft suchten, die sie marginalisierte und in der sie nach Erreichen des Erwachsenenalters weder festen Halt im Haus ihrer Mutter hatten noch eine Frau, zu der sie ziehen konnten. Einige Menschen wanderten aus, auf der Suche nach Besitz und Wohlstand. Paare, die sich mehr Unabhängigkeit wünschten, spalteten sich in Kernfamilien ab oder fanden Kompromisse zu alten Ehetraditionen. Sie lehnten die Mutterfolge nicht zwangsläufig ab. Vielmehr fragten sie sich, ob das Leben auf andere Weise besser sein könnte.
*
Über die Tharavadus der Nayar im Kerala des 19. Jahrhunderts brach der Wandel, wie auch über die matrilinearen Gesellschaften, die in der Gegenwart um ihr Überleben kämpfen, nicht etwa wie ein heftiger Sturm herein. Er kam langsam.
In einem berühmten Roman auf Malayalam aus dem Jahr 1889 wird laut Manu Pillai schließlich eine neue Art von Frau vorgestellt. »Sie hat alle Kennzeichen einer selbstbewussten Frau, aber (und das ist entscheidend) sie ist ihrem einen Mann ergeben, besitzt die Anmut einer englischen Lady und reagiert entsetzt, wenn ihre Tugendhaftigkeit infrage gestellt wird.« Vier Jahre später zeigte ein Gemälde des berühmten indischen Malers Raja Ravi Varma eine junge Nayar-Frau der Oberschicht in traditioneller Kleidung, mit einem Baby auf dem Arm und einem Hund zu ihren Füßen. Die drei warten auf die Ankunft einer geheimnisvollen Person in der Ferne. Der Titel des Bildes, There Comes Papa (zu Deutsch etwa: Da kommt Papa), klärt die Identität dieser vierten Person auf. Der Vater, der im matrilinearen Haushalt noch nie eine zentrale Rolle gespielt hatte, rückte nun in dessen Zentrum.
Das Bewusstsein, bei wem die Autorität über die Familie lag, änderte sich. Dies geschah nicht nur durch die Bemühungen der kolonialen Behörden und eifriger Missionar:innen, sondern wurde auch von denjenigen unterstützt, die sich von der neuen Gesellschaftsordnung einen Vorteil versprachen und die im Ende der gemeinschaftlichen Haushalte die Chance sahen, einen Teil der Macht, des Eigentums und des Wohlstands der Familie an sich zu reißen.
Die Geschlechterrollen änderten sich, vorangetrieben durch die Gesetzgebung. 1912 wurden laut Arunima in Travancore neue Gesetze zur Aushöhlung der Mutterfolge erlassen. Diese Gesetze sollten Partnerschaften zwischen Frauen und Männern, die bis dahin leicht beendet werden konnten, in den Bereich legaler, monogamer Ehen verschieben. Frisch verheiratete Ehemänner konnten ihren eigenen Frauen und Kindern Eigentum vererben, das zuvor von den Familien ihrer Mütter geteilt worden war. Ehefrauen konnten Unterhalt erhalten, aber nur, wenn sie nicht »ehebrecherisch« waren, fügt Arunima hinzu, was bedeutete, dass sie ihre sexuelle Freiheit verloren. Diese Änderungen erfolgten langsam und stückweise, aber sie summierten sich.
Der endgültige Schlag gegen die Tharavadus erfolgte 1976, Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit Indiens von britischer Kolonialherrschaft. In diesem Jahr schaffte die Legislative von Kerala die Mutterfolge vollständig ab.
Ende des 20. Jahrhunderts waren die weitläufigen Wohnsitze der ehemaligen matrilinearen Familien baufällig geworden. Häuser in gutem Zustand wurden verkauft. Andere wurden abgerissen. Die Soziologin Janaki Abraham von der University of Delhi hatte in Kerala geforscht und stellte fest, wie dramatisch der Zusammenbruch der Tharavadus zu diesem Zeitpunkt aussah. Ältere Menschen konnten sich noch daran erinnern, wie viele Menschen, vor allem Kinder, einst in den Häusern lebten. »Manchmal reichte es sogar für eine Cricket-Mannschaft!« Jetzt lebten in den noch stehenden Häusern »nur noch ein oder zwei alte Leute, und viele waren verschlossen, und das Grün wucherte hoch und wild um sie herum«.
Die Abkehr von der Mutterfolge in Kerala zog sich schmerzlich über mehr als ein Jahrhundert dahin. Es kann keine einzelne Ursache für diese Entwicklung ausgemacht werden, und sie war auch nicht unvermeidlich gewesen. Stattdessen wurden die Menschen von ihr mitgerissen und bemerkten erst, was sie verloren hatten, als es schon verschwunden war.
*
Schon seit Jahrzehnten stellten Biolog:innen und Anthropolog:innen eine Hypothese nach der anderen auf, um die Bedingungen zu bestimmen, unter denen die Mutterfolge aufblüht oder verfällt.
Einige behaupten zum Beispiel, sie könne nur bei Jäger-und-Sammler-Völkern oder einfachen Ackerbauern vorkommen, nicht aber in deutlich größeren Gesellschaften. Andere sagen, dass die Mutterfolge am besten funktioniere, wenn die Männer sich im Krieg befänden und den Frauen die Verantwortung überließen. Manchen zufolge sei sie dem Untergang geweiht, sobald Menschen Vieh oder andere große Tiere halten, weil Männer diese Ressourcen kontrollieren wollten. Und vielen Theorien nach führt Landbesitz oder Eigentum aus ähnlichen Gründen automatisch zum Patriarchat. Allein die Existenz dieser Erklärungen setzt voraus, dass matrilineare Gesellschaften ungewöhnliche Fälle sind, »von besonderen Belastungen betroffen, zerbrechlich und selten, möglicherweise sogar zum Aussterben verurteilt«, schreibt die Anthropologin Linda Stone von der Washington State University. In akademischen Kreisen hat das Problem seinen eigenen Namen: das »matrilineare Rätsel«.
Die Vaterfolge hingegen wird als überhaupt nicht erklärungsbedürftig angesehen. Sie ist einfach da.
2019 versuchten Forscher:innen der Vanderbilt University das matrilineare Rätsel zu lösen. Sie analysierten bekannte matrilineare Gemeinschaften auf der ganzen Welt auf Gemeinsamkeiten. Sie suchten nach übereinstimmenden evolutionären Fäden, nach einem Muster, das sie verbinden könnte. Von den 1291 Gesellschaften, die sie untersuchten, waren 590 traditionell patrilinear und 160 traditionell matrilinear organisiert. Weitere 362