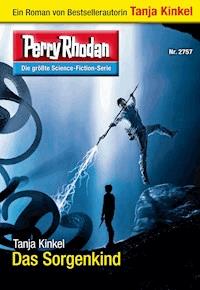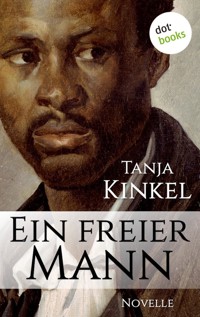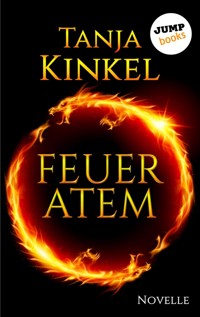Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: dotbooks VerlagHörbuch-Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein einzigartiges Leseerlebnis: Der prachtvolle historische Roman »Die Puppenspieler« von Bestsellerautorin Tanja Kinkel jetzt als eBook bei dotbooks. »Die Hexe, sie soll brennen!« Im Jahre 1484 muss Richard, Sohn eines schwäbischen Kaufmanns und einer Sarazenin, hilflos mit ansehen, wie seine Mutter auf dem Scheiterhaufen stirbt; ist damit auch sein Schicksal besiegelt? Als der Junge in den Haushalt seiner Tante aufgenommen wird, wendet sich das Blatt – sie ist die Frau von Jakob Fugger, dem einflussreichsten Kaufmann des Abendlandes. Unter seiner Führung wächst Richard zu einem schlauen Unterhändler heran, der im Italien der Medici und Borgia den Ruhm der Fugger mehren soll. Doch es sind unruhige Zeiten in Rom und Florenz, aufgeheizt von der prachtvollen Kunst Michelangelos und den hasserfüllten Predigten des Savonarola. Als Richard sich in die geheimnisvolle Saviya verliebt, fürchtet er, dass auch sie bald in größter Gefahr schweben wird – und nimmt den Kampf gegen den Hexenwahn der Kirche auf. Aber kann dies einem einzigen Mann gelingen? Übersetzt in zahlreiche Sprachen, verfilmt und millionenfach verkauft: »Dieses Buch ist Liebesgeschichte und Krimi zugleich – besser als jeder Geschichtsunterricht!« Brigitte Jetzt als eBook kaufen und genießen: »Die Puppenspieler« von Bestsellerautorin Tanja Kinkel, einer der meistverkauften historischen Romane der Gegenwart und als großer Zweiteiler verfilmt, lässt das Zeitalter der Renaissance in all seiner Pracht und seinen Schrecken auferstehen. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 919
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
»Die Hexe, sie soll brennen!« Im Jahre 1484 muss Richard, Sohn eines schwäbischen Kaufmanns und einer Sarazenin, hilflos mit ansehen, wie seine Mutter auf dem Scheiterhaufen stirbt; ist damit auch sein Schicksal besiegelt? Als der Junge in den Haushalt seiner Tante aufgenommen wird, wendet sich das Blatt – sie ist die Frau von Jakob Fugger, dem einflussreichsten Kaufmann des Abendlandes. Unter seiner Führung wächst Richard zu einem schlauen Unterhändler heran, der im Italien der Medici und Borgia den Ruhm der Fugger mehren soll. Doch es sind unruhige Zeiten in Rom und Florenz, aufgeheizt von der prachtvollen Kunst Michelangelos und den hasserfüllten Predigten des Savonarola. Als Richard sich in die schöne Zigeunerin Saviya verliebt, fürchtet er, dass auch sie bald in größter Gefahr schweben wird – und nimmt den Kampf gegen den Hexenwahn der Kirche auf. Aber kann dies einem einzigen Mann gelingen?
Übersetzt in zahlreiche Sprachen, verfilmt und millionenfach verkauft: »Dieses Buch ist Liebesgeschichte und Krimi zugleich – besser als jeder Geschichtsunterricht!« Brigitte
Über die Autorin:
Tanja Kinkel, geboren 1969 in Bamberg, studierte und promovierte in Germanistik, Theater- und Kommunikationswissenschaft. Sie erhielt acht Kultur- und Literaturpreise, Stipendien in Rom, Los Angeles und an der Drehbuchwerkstatt der HFF München, wurde Gastdozentin an Hochschulen und Universitäten im In- und Ausland sowie Präsidentin der Internationalen Feuchtwanger Gesellschaft. 1992 gründete sie die Kinderhilfsorganisation Brot und Bücher e. V, um sich so aktiv für eine humanere Welt einzusetzen (mehr Informationen finden Sie auf der Website brotundbuecher.de). Tanja Kinkels Romane, die allein in Deutschland eine Gesamtauflage von über sieben Millionen erzielten, wurden in mehr als ein Dutzend Sprachen übersetzt und spannen den Bogen von der Gründung Roms bis zum Amerika des 21. Jahrhunderts.
Bei dotbooks veröffentlichte Tanja Kinkel ihre großen Romane »Die Löwin von Aquitanien«, »Wahnsinn, der das Herz zerfrisst«, »Mondlaub«, »Die Söhne der Wölfin«, »Die Schatten von La Rochelle« und »Unter dem Zwillingsstern«, die Novelle »Ein freier Mann« sowie ihre Erzählungen »Der Meister aus Caravaggio«, »Reise für Zwei« und »Feueratem«, die auch in gesammelter Form vorliegen in »Gestern, heute, morgen«.
Die Autorin im Internet: tanja-kinkel.de
***
eBook-Neuausgabe April 2021
Copyright © der Originalausgabe 1993 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, Memmingen, unter Verwendung eines Bildmotivs von shutterstock/Lia Koltyrina
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ts)
ISBN 978-3-96655-618-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Versand zweimal im Monat – unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Puppenspieler« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Tanja Kinkel
Die Puppenspieler
Roman
dotbooks.
Für meinen Vater,
der die Geschichte mit zur Welt brachte,
und meine Mutter,
die Richard sofort adoptierte.
Vorbemerkung der Autorin
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
mein Roman »Die Puppenspieler« entstand in den Jahren 1991 und 1992; veröffentlicht wurde er erstmals 1993. Sie werden in ihm dem Begriff »Zigeuner« begegnen, da dieser zur Handlungszeit – d.h. in den letzten beiden Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts – das gängige Synonym für das Volk der Sinti und Roma war. Diese Bezeichnung wird spätestens seit dem 18. Jahrhundert mit einem stigmatisierenden Rassismus verbunden – einem Rassismus, der zur gesellschaftlichen und staatlichen Ausgrenzung geführt hat, zu Vertreibung, Pogromen, Internierung und staatlich organisiertem Völkermord. Die Sinti und Roma lehnen den Begriff daher heute ab.
Wie der Antisemitismus ist auch der Antiziganismus, den ich in »Die Puppenspieler« darstelle und verurteile, keineswegs ein historisches, sondern leider immer noch ein Gegenwartsphänomen. Es ist mir daher wichtig zu betonen, dass ich mich gegen die Verwendung des Begriffes im aktuellen Sprachgebrauch ausspreche.
Tanja Kinkel
im Frühjahr 2021
Erstes BuchDER ALPTRAUM
Kapitel 1
Die Frühlingssonne schien hell durch das verglaste Fenster auf den Tisch, hinter dem der Abt des Klosters St. Georg zu Wandlingen saß und ein Dokument, das vor ihm lag, studierte. Die tanzenden Strahlen ließen einzelne Buchstaben wie dunkle Flecke hervortreten. Satzbruchteile fingen seinen Blick auf: »Innozenz, Diener der Diener Gottes… Es sind uns große Beschwerden zu Ohren gekommen, daß in einigen Teilen Oberdeutschlands, wie auch … sehr viele Personen beiderlei Geschlechts, ihre eigene Seligkeit vergessend … die geliebten Söhne Heinrichs Institoris. Jakob Sprenger, daß diesen Inquisitoren das Amt solcher Inquisition erlaubt sei und sie zur Besserung, Inhaftierung und Bestrafung solcher Personen.«
Ein leises Hüsteln lenkte ihn von seiner Lektüre, der Bulle »Summis desiderantes« des neuen Papstes Innozenz VIII., ab. Der Abt seufzte. Die neue Bulle war von höchster Wichtigkeit, und er hätte sich ihr gern ausführlicher gewidmet. Doch noch andere Aufgaben warteten auf ihn. Dieses Kloster beherbergte nicht nur Angehörige des Benediktinerordens, sondern auch eine Menge Schüler. Mit einem solchen befand sich Bruder Ludwig jetzt hier; der Abt hatte die beiden eintreten lassen, konnte sich jedoch nicht sofort von seinem Dokument losreißen. In dem Begleitschreiben, das von einem befreundeten Würdenträger der Kirche stammte, wurde die Bulle als Meilenstein bezeichnet. Und so warteten der Lehrer und sein Schüler schon an die fünf Minuten. Die Bulle mußte ein wenig zurückgestellt werden.
»Was gibt es, Frater?« fragte der Abt freundlich, doch mit ein wenig ungeduldigem Unterton. Bruder Ludwig zählte noch nicht lange zu seinen Mönchen. Vor einem halben Jahr war er aus Speyer gekommen und hatte nun den alten Bruder Andreas als Geographie- und Geschichtslehrer abgelöst. Die Schüler hatten, soweit der Abt wußte, bisher nicht allzu begeistert darauf reagiert, und er hegte den Verdacht, daß der neue Bruder aus diesem Grund zu ihm gekommen war.
Bruder Ludwig räusperte sich erneut. Er war ein mittelgroßer, unauffälliger Mann, ein wenig gedrungen, noch keine dreißig, doch sein Haar wäre auch ohne die Tonsur bereits schütter gewesen. Er blickte von dem Abt zu seinem Schüler und sagte schließlich unbehaglich: »Es handelt sich um diesen Schüler hier, ehrwürdiger Abt, Richard Artzt.«
In den Augen des Abts leuchtete erstmals so etwas wie Interesse auf. »Das dachte ich mir, Bruder Ludwig«, erwiderte er trocken, »doch was hat er getan?«
Der Mönch, der in der schwarzen Kutte der Benediktiner unnatürlich bleich aussah, trat verlegen von einem Fuß auf den anderen. Er war kein begnadeter Redner, und er wußte, daß es dem Abt nicht gefallen würde, wenn er jetzt schon Schwierigkeiten mit den Jungen, die ihm anvertraut waren, nicht allein lösen konnte. Bruder Andreas hatte es immer verstanden, sich durchzusetzen, das hielt man ihm jedenfalls ständig vor, und dieser Junge war, wie es hieß, einer seiner Vorzugsschüler gewesen. Ludwig versuchte energisch zu wirken und straffte die Brust.
»Er schenkt dem Unterricht wenig oder überhaupt keine Aufmerksamkeit und widerspricht seinem Lehrer«, sagte er, und seine Stimme klang dünn und abwehrend zugleich.
Der Abt zwinkerte. »Nun, Richard«, sagte er, immer noch freundlich, »weißt du nicht, daß ein Schüler seinem Lehrer mit Gehorsam und Ehrfurcht begegnen muß?«
Der Junge verzog das Gesicht. »Ich gehorche doch… ich lerne jede meiner Lektionen. Wenn Bruder Ludwig mich im Unterricht aufruft, kann ich ihm jederzeit den Inhalt der Stunde wiederholen. Das ist doch wahr, oder?« wandte er sich herausfordernd an Ludwig. Dieser errötete. Der Abt griff ein.
»Richard«, sagte er streng, »dies ist nicht die Art, mit einem Erwachsenen zu sprechen, von einem Priester ganz zu schweigen.« Er schwieg einen Moment und musterte den Jungen. Richard war zwölf Jahre alt, doch eher klein für sein Alter, und seine leicht bräunliche Haut stach gegen die Blässe Bruder Ludwigs ab. Auch seine Haare waren braun, doch von einer satten, üppigen Farbe, die an Herbstlaub erinnerte und manchmal ins Rötliche, zu anderen Zeiten ins Schwarze überzugehen schien. Seine Augen funkelten tiefschwarz und gaben dem Jungen zusammen mit seinen hohen Wangenknochen einen fremdartigen Ausdruck. Richard hatte gerade, dichte Augenbrauen und einen feingeschnittenen Mund, der im Ärger schmal und hart wirkte. Wenn jemand Grund dazu hat, ärgerlich zu sein, dachte der Abt verdrießlich, dann bin ich es. Wo käme ich hin, wenn ich mich um jede kleine Unstimmigkeit zwischen Schülern und Lehrern kümmern müßte?
»Wenn Richard gelernt hat, was er lernen soll«, sagte er ein wenig müde, »dann sehe ich nicht, wo die Schwierigkeit liegt.«
Die Röte auf Bruder Ludwigs Wangen vertiefte sich noch weiter, was bei seiner sonstigen Blässe und dem korpulenten Körperbau äußerst unvorteilhaft wirkte.
»Er widerspricht mir«, sagte er hastig, »und das auf die abscheulichste und ketzerischste Weise. Das schadet meinem Ansehen bei den übrigen Schülern, ganz abgesehen davon, daß es sie zum Lachen bringt, wenn…«
Er verstummte. Richard vollendete unbekümmert: »Wenn Bruder Ludwig glaubt, ich hätte nicht auf seine langweiligen Lektionen geachtet, weil ich gezeichnet habe, und mich deswegen aufruft.« Er hielt ein wenig inne, dann fuhr er mit genügendem Respekt fort, um jeden zu täuschen, der nicht so erfahren war wie der Abt: »Ehrwürdiger Vater, ich liebe die Wissenschaften und schätze Bruder Ludwigs Unterricht, doch was soll ich machen? Wenn ich schweige, denkt er, ich sei unaufmerksam, und wenn ich also spreche und etwas zu dem sage, was er vorträgt, ist er auch unzufrieden. Ich möchte ein gehorsamer Schüler sein, aber wie?«
Der Abt bemerkte den Unterton von Ironie sehr wohl, anders als Bruder Ludwig, der durch diese zerknirscht wirkende Rede ein wenig besänftigt schien.
»Es sind nur deine ketzerischen Ansichten, Richard«, sagte er kompromißbereit. »Es ziemt sich einfach nicht, zu behaupten, die Kreuzritter seien manchmal wahre Schlächter gewesen, oder die Erde könne unmöglich flach sein. So etwas ist unchristlich und…«
»Aber Bruder Ludwig«, rief Richard, plötzlich wieder ohne jede Demut, »schon der berühmte Venezianer Marco Polo hat behauptet, daß die Erde gekrümmt sein müsse, Bruder Andreas hat davon erzählt. Und die Araber sind sich sogar ganz sicher, daß es so ist. Und es ist eine Tatsache, daß bei der Eroberung von Jerusalem die gesamte Bevölkerung niedergemetzelt wurde.«
Ludwig entgegnete unwillig: »Die Araber sind Heiden, und die Bevölkerung von Jerusalem bestand aus Arabern und Juden, also.«
»Aber Bruder Ludwig«, sagte der Abt tadelnd, »Ihr werdet Euch doch nicht mit einem Kind streiten, noch dazu mit einem Eurer Schüler?«
Er fragte sich langsam, ob Bruder Ludwig überhaupt schon geeignet war, Jungen in diesem Alter zu unterrichten. Am besten, man machte dieser Szene ein Ende, bevor der Mönch noch mehr von seiner Autorität verlor. Der Abt wandte stirnrunzelnd seine Aufmerksamkeit Richard zu.
»Du kannst gehen, Richard«, sagte er, doch bevor sich ein Lächeln auf Richards Gesicht breitmachen konnte, fügte er hinzu, »doch wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, daß du Bruder Ludwig gegenüber nicht gehorsam bist, bleibst du die nächsten Monate Samstag und Sonntag hier. Nun verschwinde schon.«
Richard kniete hastig nieder, um den Ring des Abtes zu küssen, und eilte davon. Der Abt schaute ihm nach und schüttelte den Kopf.
»Frater«, sagte er, »was habt Ihr Euch nur dabei gedacht?«
Bruder Ludwig fühlte das dringende Bedürfnis, sich zu rechtfertigen. Er gestand sich ein, daß er gleich ohne den Jungen hierher hätte kommen sollen.
»Ehrwürdiger Abt«, stieß er hervor, »dieses Kind ist mir einfach unheimlich. Ich könnte schwören, daß er mir nicht die geringste Aufmerksamkeit schenkt, und dennoch muß man ihm nie etwas wiederholen. Es ist, als begriffe er alles beim ersten Mal. Wie soll man so einen Schüler behandeln? Und dann diese ketzerische Redeweise…«
»Ja«, entgegnete der Abt abwesend, »jeder sagt mir, daß er ein hervorragendes Gedächtnis hat, besonders für Sprachen. Aber, Bruder«, er richtete die Augen wieder auf Ludwig, »wenn seine Argumente ketzerisch sind, so müßt Ihr ihn belehren, wie es einem Lehrer zukommt. Was Ihr eben getan habt, war einen Streit mit ihm anzufangen, als sei er in Eurem Alter! Das untergräbt die Disziplin!«
Sie schwiegen beide. »Richard kann schwierig sein«, murmelte der Abt schließlich, »gerade wegen seiner Begabung. Doch das hängt natürlich damit zusammen, daß seine Mutter eine Sarazenin ist.«
Ludwig verschluckte sich und mußte husten. »Seine Mutter«, ächzte er, als er wieder zu Atem kam, »ist eine Heidin?«
»Eine Bekehrte«, antwortete der Abt hastig. »Sie versteht mit Kräutern umzugehen und gilt als die beste Hebamme und Heilerin hier in Wandlingen. Manche sagen sogar offen, sie gingen lieber zu ihr als zu einem Bader oder zu einem Medicus. Da sie hier lebt, hat Richard die Erlaubnis, sie regelmäßig zu besuchen. Eine erstaunliche Frau, aber wie ich schon sagte, eine Bekehrte, und bei diesen Bekehrten weiß man nie, ob sie nicht manchmal, gewiß ohne Absicht, in ihren früheren Irrglauben zurückfallen oder Kleinigkeiten von ihm übernehmen. Ich wollte schon längst einmal jemanden zu ihr schicken, um die Stärke ihres Glaubens zu prüfen.«
Bruder Ludwig sah nachdenklich aus. »Mit Eurer Erlaubnis werde ich vielleicht auch allen zukünftigen Schwierigkeiten mit Richard aus dem Weg gehen können.«
Der Abt lächelte zufrieden. Eben dies hatte er beabsichtigt. Jeder rühmte ihm Richard als einen der ungewöhnlichsten Schüler, den das Kloster je gehabt hatte, und er hoffte, ihn für den Orden gewinnen zu können. Huldvoll streckte er die Hand zum Kuß aus, verabschiedete den Bruder und wandte sich dann wieder der Bulle zu, die er demnächst im Kloster vorlesen lassen mußte.
»…die Personen selbst, nachdem sie in obigem für schuldig befunden … nach ihrem Verbrechen zu strafen … an Leib und an Vermögen zu strafen. Gegeben in Rom zu St. Peter, im Jahr der Menschwerdung des Herrn 1484 … im ersten Jahr unserer päpstlichen Regierung.«
Die Sonnenstrahlen tanzten über das Blatt, während der Abt sich mit zusammengezogenen Brauen daranmachte, die Bulle des Papstes noch einmal von vorne zu lesen.
Das kleine Haus, in dem Zobeida Artzt und ihr Sohn Richard wohnten, lag nahe der Stadtmauer, in einer nicht sehr vorteilhaften Gegend, da viele Wandlinger ihren Abfall in dieser Umgebung liegen ließen. Doch eine andere Möglichkeit hatte es für Zobeida, die immer noch mit Mißtrauen betrachtete Fremde, nach dem Tod ihres Gemahls nicht gegeben. Daß man ihr überhaupt gestattete, innerhalb der Stadtmauern zu leben, lag nur an ihrem überragenden Können als Hebamme, mit dem sie sich auch mit der Zeit eine geachtete Position in der Gemeinde verschafft hatte. Mittlerweile hätte sie wahrscheinlich ein besser gelegenes Haus erwerben können, vielleicht sogar wieder den großen Kaufmannshof, in dem sie mit Markus Artzt gelebt hatte, doch Zobeida hielt an ihrem Heim unter den ärmeren Bürgern Wandlingens fest, aus purem Eigensinn und Stolz, wie viele meinten.
Richard war froh darüber. Als er an diesem Freitag spätnachmittags nach Hause kam, blieb er einen Augenblick auf der Schwelle stehen, denn seine Augen mußten sich erst an das Dämmerlicht im Inneren gewöhnen. Er atmete tief ein. Es roch vertraut nach Gewürzen, nach Wärme, nach Kräutern, Düfte, die er immer mit seiner Mutter in Verbindung bringen würde. Sie war nicht da, doch sie hatte ihm die Nachricht hinterlassen, sie sei von Emmerich Kühn geholt worden, weil seine Frau in den Wehen lag.
Richard liebte dieses Haus, und jedesmal, wenn er eine Woche Klosterleben hinter sich hatte, wanderte er hier ein wenig ziellos umher, nur um alle vertrauten Gegenstände wieder zu begrüßen, die so sehr von der Kargheit des Klosters abstachen. Sein Vater, Markus Artzt, war ein erfolgreicher Kaufmann gewesen, und überall standen Dinge, die er von seinen Reisen mitgebracht hatte – bunte, edle Stoffe, von denen seine Mutter einige zu Kissen verarbeitet hatte, die sie der Sitte ihres Volkes gemäß auf dem Boden ausbreitete; andere Stoffballen jedoch behielt sie nur, um sich an ihrer Schönheit zu erfreuen.
Da gab es ein Schachbrett aus Persien mit feingeschnitzten Elfenbeinfiguren, die sogar von einem noch ferneren Land, dem legendären Cathay, stammen sollten. Richard kannte nicht viele Gegenstände, die aus Elfenbein waren, eigentlich überhaupt keine, außer den Figuren und einer Schnitzerei im Kloster, die eine Reliquie umschloß, und er strich liebkosend über ihre warme, glatte Oberfläche. Richard wünschte, er könnte sie benützen, doch seine Mutter beherrschte dieses Spiel nicht, und sonst gab es niemanden in Wandlingen, der es ihm hätte beibringen können.
Neben dem Schachspiel galt seine Liebe den weichen Teppichen mit ihren verschlungenen Mustern, die jedoch, wie seine Mutter ihm erklärt hatte, niemals etwas Bestimmtes abbilden durften, denn der Koran verbot jede bildliche Darstellung. Einer der Punkte, dachte Richard, wo das Christentum vernünftiger ist. Die Gemme mit dem Profil einer Frau, kunstvoll aus einem Halbedelstein geschnitten, die sein Vater aus Italien mitgebracht hatte, genügte schon, um ihm ein derartiges Verbot als völlig unsinnig erscheinen zu lassen.
Er bemühte sich, nicht auf das kleine goldene Kreuz zu sehen, das neben der Gemme lag; längst nicht so zart gearbeitet, hatte es dennoch eine gewisse Schönheit; es stammte aus Augsburg. Es handelte sich um das einzige Erinnerungsstück an die Familie seines Vaters in diesem Haus. Jene Familie, die seine Mutter haßte. Was Richard von ihr wußte, erfüllte ihn mit tiefer Abneigung: die Artzt’ waren Angehörige des Augsburger Stadtpatriziats, seit Generationen schon, stellten Bürgermeister und Stadtschreiber, besaßen viele Häuser in dieser schwäbischen Stadt, die wegen ihres Reichtums in aller Munde war – und sie hatten Markus aus der Familie verstoßen, weil er die Sarazenensklavin geheiratet hatte, die er auf dem Sklavenmarkt in Venedig erworben hatte.
Nach einem erbitterten Streit mit seinen Eltern hatte Markus Augsburg für immer verlassen, was wohl für alle die beste Lösung war. In Augsburg erfuhr niemand, daß ein Mitglied der Familie Artzt eine Heidin zu seiner Gemahlin gemacht hatte, und Markus und Zobeida, die damals schon schwanger war, zogen nach Wandlingen. Richard hatte sich diese Geschichte Stück für Stück aus gelegentlichen Äußerungen seiner Mutter zusammenreimen müssen, denn Zobeida sprach nicht häufig von der Familie ihres Gemahls, und an seinen Vater hatte er nur ein paar vage, verschwommene Erinnerungen. Früher hatte er sich manchmal gewünscht, wie Perseus ein Held zu werden. Perseus, dessen Mutter von ihrem Vater verstoßen worden war. Dann würde er wie Perseus siegreich zu dem großmächtigen, arroganten Großvater gehen, ihm nur einen vernichtenden Blick zuwerfen – und dann im Jubel der Menge weiterziehen.
Doch das waren kindische Träume, und langsam wurde er zu alt dafür.
Er schürte das Feuer unter einem großen Kessel mit heißem Wasser, den seine Mutter bereitgestellt hatte. Baden galt unter Christen abwechselnd als teuflisch und wohltuend. Zur Zeit sah man es wieder einmal als wohltuend an, und für die reichen Patrizier der großen Städte war es selbstverständlich, eine Badestube im Haus zu haben. Im kleinen, etwas rückständigen Wandlingen jedoch war man noch immer mißtrauisch und hielt sich, wenn überhaupt, an den Fluß. Richard hingegen nahm bei seiner Heimkehr immer als erstes ein Bad; seine Mutter hatte ihn mit dieser Gewohnheit der arabischen Völker großgezogen.
Die Feuerstelle war so gebaut, daß er mit einigem Geschick das erhitzte Wasser leicht in den hölzernen Badezuber kippen konnte, den er geholt hatte. Richard zog sich hastig aus und ließ sich dann zufrieden in der nassen Wärme nieder, die ihn angenehm schläfrig machte. Was wohl die anderen sagen würden, wenn sie ihn jetzt sähen? Er konnte es sich vorstellen.
Er war nicht eigentlich unbeliebt in der Klosterschule, aber er hatte auch keine wirklichen Freunde, und das Bewußtsein, daß seine Mutter eine Fremde war, hatte ihn für die anderen Schüler, die entweder dem reicheren Bürgertum oder dem Landadel der Umgebung entstammten, immer schon andersartig erscheinen lassen. Dabei war ihm die offen feindselige Haltung, welche die Nachbarn früher an den Tag gelegt hatten, immer noch lieber als die Seitenblicke und das versteckte Getuschel, das ihm bisweilen im Kloster begegnete.
Nicht, daß Richard sich je sehr um die Freundschaft der anderen Kinder bemüht hätte. Er hielt einen großen Teil seiner Altersgenossen für stumpfsinnige Jasager und zog die Gesellschaft seiner Mutter der ihren bei weitem vor. Und er liebte die Erzählungen ihrer weichen, musikalischen Stimme, die meist viel interessanter waren als die albernen Streiche, mit denen sich Thomas oder Kuno die Zeit vertrieben.
Er hatte sich gerade abgetrocknet und war in ein frisches Hemd und eine Hose geschlüpft, als seine Mutter zurückkehrte. Schnell lief er auf sie zu, küßte sie auf die Wange und sagte auf arabisch: »Herrin, warum verschwendet Ihr Euren Glanz nur an diese unwürdige Hütte!«
Zobeida lachte. Sie sah etwas müde und erschöpft aus. »Was ist heute geschehen?« fragte sie zurück. »Hast du etwas angestellt? Ich hatte schon auf dich gewartet, als Emmerich Kühn kam.«
Richard erzählte ihr von der Unterredung mit dem Abt und brachte sie noch einmal zum Lachen, als er heftig gestikulierend Bruder Ludwig parodierte.
»Diese Ketzerei kann ich nicht dulden, Richard! Was fällt dir ein, zu behaupten, ein Apfel sei rund? Er ist mitnichten rund, denn Hieronymus von Nirgendwo bezeichnet ihn als grünen Schlag, und daraus geht eindeutig hervor, daß er flach ist! Du wagst es doch hoffentlich nicht, an Hieronymus zu zweifeln! Du Ungläubiger, du Ketzer, du Nichts, du…«
Während sie mit ihrem Sohn lachte, entspannte sich Zobeida von den Anstrengungen der Wehen, bei denen sie geholfen hatte. Mathilde Kühn hatte eine weitere Fehlgeburt gehabt. Ihr Mann schlug sie so regelmäßig, wie er ihr Bett teilte, und behandelte sie nicht besser als einen Packesel. Er hatte die Nachricht mit einem Fluch entgegengenommen und war ins nächste Wirtshaus verschwunden, während Mathilde mühsam den Trank zu sich nahm, den Zobeida ihr bereitet hatte, um ihre Schmerzen etwas zu lindern.
»Gott haßt mich«, flüsterte sie, als Zobeida ihren Kopf hielt, und Trude, Mathildes ältere Schwester, hatte ihr sofort widersprochen und versichert, daß Gott sie liebe und das nächste Kind bestimmt lebend zur Welt käme.
Später, während sie Zobeida aus dem Haus begleitete, hatte Trude ängstlich gefragt: »Sie wird doch einmal ein gesundes Kind gebären, oder?«
Zobeida hatte in einem Anflug von Bitterkeit geantwortet: »Nicht, solange man sie bei ihrem Gemahl läßt. Ich habe Euch schon vor ein paar Wochen gesagt, daß sie wieder eine Fehlgeburt haben wird. Ihr solltet sie zu Euch nach Hause nehmen.«
Doch beide Frauen wußten, daß dies unmöglich war. Der Mann war der Gebieter, und Zobeida wie Trude, so sehr sie sich sonst auch unterscheiden mochten, waren mit dieser Ansicht großgeworden. In der Tat, dachte Zobeida, besaß Mathilde Kühn als Gemahlin eines freien Stadtbürgers nicht mehr Schutz als sie, Zobeida, in ihrer Zeit als Sklavin gehabt hatte.
Sie aßen zu Abend, und Zobeida ertappte sich einmal dabei, wie sie, als ihr Sohn ihr von seinen Schulabenteuern erzählte, mehr dem Klang seiner Stimme als seinen Worten lauschte. Es war schon nicht mehr eine richtige Kinderstimme, sondern erinnerte sie mehr und mehr an seinen Vater. Sie warf Richard einen liebevollen Blick zu. Bis auf die Haare glich er Markus überhaupt nicht; merkwürdigerweise wirkte sie noch abendländischer als er.
Zobeida hatte ihre Mutter nicht gekannt, wußte aber, daß sie eine Tscherkessensklavin gewesen war, und daß sie, Zobeida, von ihr das üppige blonde Haar und die hohen slawischen Wangenknochen geerbt haben mußte. Zobeidas Augen waren schwarz wie die ihres Sohnes, sie besaß einen großzügigen Mund und eine Gestalt, die sie zu einer der Hauptattraktionen jener Versteigerung in Venedig gemacht hatte, bei der Markus ihr begegnet war.
»Das Schicksal geht seltsame Wege«, sagte sie in Gedanken daran, »wäre mein Vater, Ibn Zaydun, nicht gestorben und hätte mich sein Neffe nicht verkauft, dann wäre ich nie nach Venedig gekommen. Und doch dachte ich am Tage des Verkaufs, mein Leben sei zu Ende.«
Zobeida war das Lieblingskind ihres Vaters, des Arztes Ibn Zaydun, gewesen, ihres blonden Haares und ihrer lebhaften Auffassungsgabe wegen, beides eine Seltenheit, die er zu würdigen verstand, denn er hatte keinen Sohn. Er lehrte seine kleine Tochter vieles über Arzneien, brachte ihr sogar Lesen und Schreiben bei, was fast ein Skandal war, und empfand die Freude eines Lehrers und Sammlers über ein seltenes Stück.
Zu wärmeren Gefühlen war er nicht fähig, und die anderen Töchter, die ihm Sklavinnen geboren hatten, interessierten ihn überhaupt nicht, obwohl er sie versorgte. Zobeida war sein Geschöpf, etwas noch viel Besseres als der sprechende Papagei oder der gelehrige Affe, den er besaß, und ihre Eigenwilligkeit entzückte ihn wie die eines Falken, den er aufsteigen ließ. Da diese distanzierte Freundlichkeit die einzige Art von Zuneigung war, die Zobeida in ihrer Kindheit kennenlernte, brachte sie ihrem Vater leidenschaftliche Liebe entgegen und war untröstlich, als er starb.
Bald sollte sie entdecken, daß es ihm nie in den Sinn gekommen war, dafür zu sorgen, das von einer Sklavin geborene Mädchen nach seinem Tod freizugeben, und so war Zobeida im Erbe seines Neffen inbegriffen. Der Neffe Ibn Zayduns war ein gutaussehender, heißblütiger junger Mann; er nahm die anziehende Halbtscherkessin sofort in sein Bett, und Zobeida machte in ihrer Trauer zum zweiten Mal den Fehler, jemandem ihre Liebe zu schenken, der diese längst nicht im selben Umfang erwiderte.
Als ihr neuer Herr in Geldschwierigkeiten geriet, wurde auch diese Illusion einer Liebe zerstört, denn er wollte sie kurzerhand an einen seiner Freunde verkaufen, und als er seine Geliebte daraufhin zum ersten Mal aufsässig und wütend erlebte, war er eher entsetzt als erzürnt. Er verkaufte sie auf dem Sklavenmarkt, was ihm als Strafe für ihre Unverfrorenheit zu genügen schien, wünschte ihr im übrigen Glück und vergaß sie.
Der Sklavenhändler, der Zobeida gekauft hatte, brachte sie mit einer Reihe weiterer Sklaven nach Venedig, denn die Kaufleute vom Rialto, die sich rühmten, eine der bedeutendsten Reliquien der Christenheit zu besitzen, und sich infolgedessen auch für eine der frömmsten Städte auf Erden hielten, fanden durchaus nichts dabei, gleichzeitig auch einen der größten Umschlagplätze für Sklaven aus aller Herren Länder zu unterhalten.
Der Sklavenmarkt war eine hervorragende Schule in der Kunst zu überleben. Schlage, bevor du geschlagen wirst, räche alles, was man dir zufügt, im selben Maß, denn sonst wird man es dir noch einmal antun – es sei denn, dein Herr tut es dir an. Als Zobeida an den Franken mit dem harten, schwer auszusprechenden Namen Markus Artzt verkauft wurde, war sie entschlossen gewesen, nur noch auf sich selbst zu achten. Auf dieser Welt sollte man keinem Menschen trauen und ganz gewiß keinen lieben.
Es hatte lange gedauert, bis sie glauben konnte, daß Markus sie mit all der Liebe und Zärtlichkeit überschüttete, nach der sie ihr ganzes Leben lang gehungert hatte, und bis sie sich auch in ihn verliebte. Es wurde von ihrer Seite aus allerdings eher eine zärtliche Freundschaft und Achtung als Liebe. Ihren Vater hatte sie angebetet, seinem nichtsnutzigen Neffen ihre ganze Leidenschaft geschenkt, und sie fühlte sich bisweilen schuldig, weil sie ausgerechnet diesem einen Mann, der ihretwegen seine Familie aufgegeben hatte, kein ebenso großes Maß an Zuneigung entgegenbringen konnte.
Als er auf einer seiner Reisen verscholl und die Nachricht kam, er sei wahrscheinlich von Straßenräubern erschlagen worden, trauerte sie aufrichtig um ihn. Aber es brach ihr nicht das Herz. Sie hatte ihre Aufgaben, die denen eines Arztes gleichkamen, und sie hatte ihren Sohn. Richard gehörte ihr, er war ihr Fleisch und Blut, er würde sie niemals verraten, und für ihn empfand sie die leidenschaftliche Liebe, die sie für seinen Vater nicht hatte aufbringen können. Er war alles für sie, und sie sorgte dafür, daß sie auch alles für ihn wurde – Mutter, Vater, Spielkamerad, Lehrerin, Freundin. Zobeida wäre es nie in den Sinn gekommen, noch einmal zu heiraten, sie war glücklich nur mit ihrem Kind.
»Und wenn mein Vater sich in Augsburg nicht mit seinen Eltern zu Tode gelangweilt hätte, wäre er auch nicht nach Venedig gekommen«, sagte Richard jetzt und kniff ein Auge zusammen.
»Was ist mit Euch, Mama? Ich dachte, man dürfte nicht zu oft ›wenn‹ sagen?«
Zobeida zwang ihre Gedanken in die Gegenwart zurück. »Das muß dir eine sehr kluge Frau beigebracht haben«, neckte sie. »Übrigens hatte Markus nicht nur seine Eltern, er hatte auch eine Schwester, die jedoch viel jünger war als er. Aber du hast recht – man soll nicht zuviel in der Vergangenheit stöbern.«
Sie sprach nicht gerne über die Familie Artzt. Denn Markus hatte ihr sehr viel mehr erzählt, als sie jemals an seinen Sohn weitergegeben hatte; sie fürchtete instinktiv, daß die stolzen Patrizier sich eines Tages überwinden und ihr Richard wegnehmen würden. Also verschwieg sie vieles und beschwichtigte ihr Gewissen damit, daß sie Richard getreu Markus’ Wünschen als Christ erzog, daß sie sogar selbst vorgab, diesen Glauben zu teilen, obwohl sie ihn insgeheim für lächerlich hielt.
»Sehen wir lieber in die Zukunft«, sagte Zobeida leichthin. »Du solltest nicht absichtlich deinen Lehrer ärgern, mein Sohn, das ziemt sich nicht in deinem Alter.«
»Aber Mama«, protestierte Richard, »er ist so ein Esel, und Ihr habt doch selbst darüber gelacht.«
Zobeida versuchte, streng auszusehen. »Mea culpa«, sagte sie, einer der wenigen lateinischen Ausdrücke, die sie kannte. »Trotzdem, wenn du eines Ta ges eine Universität besuchen willst, brauchst du Empfehlungen von allen deinen Lehrern, so sagte man mir jedenfalls.«
»Aber er ist so langweilig – jeder findet das. Das einzige Mal, daß wir nicht alle in seiner Gegenwart fast eingeschlafen sind, war, als er an die Reihe kam, mit uns ins Badehaus des Klosters zu gehen. Er zierte sich entsetzlich, und schließlich kam heraus, daß er ein riesiges feuerrotes Muttermal am Rücken hat.«
»Armer Mann. Ich hoffe nur«, sagte Zobeida streng, »du hast nicht über ihn gelacht. Es gehört nicht viel dazu, sich über schüchterne Leute lustig zu machen.«
Richard machte ein reuiges Gesicht, konnte aber nicht widerstehen, hinzuzufügen: »Trotzdem bin ich froh, wenn ich erst eine Universität besuchen kann und nicht mehr das Kloster, wo jederzeit ein Bruder Ludwig als Lehrer droht.«
»Der vielleicht deine künftigen Doctores kennt.«
Richard zog eine Grimasse. »Ich werde doch nicht hier im Reich studieren«, widersprach er. »Ich werde überall hinreisen, in alle Länder, auch in Eure Heimat, Mama, und studieren werde ich dort oder in Italien. Es heißt, daß es in Italien die gelehrtesten Schulen gibt, seit die arabischen Universitäten in Spa nien für Christen nicht mehr zugänglich sind.«
Es war eine von Richards Lieblingsbeschäftigungen, sich zukünftige Reisen auszumalen, und er zweifelte nicht einen Augenblick daran, daß seine Mutter mit ihm kommen würde. Schließlich konnte sie ihre Heilkünste überall anwenden – was also sollte sie in Wandlingen?
Er holte sich Feder und Papier, um die Umrisse der Länder zu zeichnen, in die sie ziehen würden, und sie träumten gemeinsam von den fremden Städten, Landschaften und Tieren. Richard würde die Sprachen der Länder bald beherrschen, wie er auch nicht lange gebraucht hatte, um Lateinisch, Griechisch, Arabisch zu lernen, und Zobeida bedauerte, wenn sie an Italien dachte, ihm nicht mehr als ein paar mundartliche venezianische Ausdrücke vermitteln zu können – denn daß dieses Land am Anfang ihrer großen Reise stehen würde, hatten sie längst beschlossen.
Richard zeichnete schließlich auch die Gesichter einiger Menschen, die sie kannten, wofür er ein ausgesprochenes Talent besaß. Seine Darstellungen übertrieben, doch sie erfaßten das Wesentliche, und sie lachten beide über den trunksüchtigen Emmerich Kühn oder die keifende Lieselotte Schmidt. Dann wurde Zobeida wieder ernst.
»Dieser Mann ist böse«, sagte sie und deutete auf Emmerich Kühns Konterfei. »Es wäre ein Segen für seine arme Frau gewesen, wenn nicht das Kind, sondern er gestorben wäre. Wenn ich nicht Angst gehabt hätte, daß sie verblutet, hätte ich mich diesmal geweigert, Emmerich zu Hilfe zu kommen.«
Sie seufzte.
»Sowie sie einigermaßen gesund ist, wird er sie wieder schwängern und wieder schlagen, und sie wird noch eine Fehlgeburt erleiden, denn sie ist nicht sehr stark. Und eines Tages werde ich sie sterben sehen. So ungerecht ist das alles, mein Sohn, und so sinnlos.«
Um sie abzulenken, malte Richard hastig einen grotesken Bruder Ludwig, stellte ihn als Giftpilz dar, der sich drohend über eine Ameise beugte. Er fand ohnehin, daß Bruder Ludwig Ähnlichkeit mit einem Pilz hatte. Ludwig war nicht eigentlich dick, doch auch nicht schlank, und seine in Aufregung zitternden Wangen verliehen ihm einen schwammigen Gesamteindruck. Zobeida warf einen Blick auf sein Kunstwerk und lächelte wieder. »Ist das dein neuer Lehrer? Oh, Richard!«
Es wurde ein wunderbarer, von warmer Heiterkeit erfüllter Abend, und als Richard schließlich zu Bett ging, dachte er, daß er wahrhaftig ein gesegnetes Schicksal hatte. Sie würden für immer und ewig glücklich sein. Eine Welt voller Wissen und Abenteuer wartete. Wie herrlich war es doch zu leben!
Bruder Ludwig keuchte, als er schließlich vor dem Haus Artzt stand. Lange Fußmärsche waren nichts für ihn, und seine Erhitzung mochte daran schuld sein, daß er, ohne anzuklopfen, durch die angelehnte Tür trat. Er hatte sich einen Wochentag ausgesucht, um mit Richards Mutter zu sprechen, und schon einige würdevolle Sätze für die Sarazenin zurechtgelegt, die er sich dunkel, klein und üppig vorstellte, wie Heidenweiber eben sein sollten. Doch nun blieb er auf der Schwelle stehen und erstarrte, sich sofort bewußt, welchen Höflichkeitsfehler er gemacht hatte.
Die Frau, die ihm ihren Rücken zuwandte, war bereits angekleidet, und dafür dankte er jetzt Gott. Doch ihr Haar fiel ihr noch frei über die Schultern, und er konnte die Augen nicht davon abwenden – es war nicht dunkel, sondern blond, ein reiches, üppiges Silber, wie er es noch nie gesehen hatte. Es erweckte in ihm das Verlangen, es zu berühren, nur um festzustellen, ob es wirklich so weich war, wie es schien, und er bekreuzigte sich hastig.
»Frau Artzt?« fragte er unsicher. Das konnte doch nicht die Sarazenin sein!
Sie drehte sich um, ohne zu erschrecken. »Ihr hättet anklopfen sollen, Bruder«, sagte sie leicht vorwurfsvoll, aber freundlich. »Wartet einen Augenblick.«
Mit ein paar geübten Griffen steckte sie ihr Haar fest und verbarg es unter einer Haube. Nun gab es nichts mehr, um ihn zu verstören, nichts, außer diesem Gesicht, das bis auf die Brauen so dem ihres Sohnes glich, doch bei ihr in Schönheit gemildert war, nichts außer den dunklen Augen, in denen man ertrinken konnte, der berückenden Gestalt, die ihn beträchtlich verwirrte …
Ludwig wies seine Gedanken zurück. Was hatte er nur? Er hatte doch, weiß Gott, schon hübsche oder sogar schöne Frauen gesehen! Es lag gewiß nur daran, daß sie so anders aussah, als er sich eine Heidin aus dem Morgenland vorgestellt hatte, nur das konnte es sein.
Zobeida betrachtete ihn prüfend. »Fehlt Euch etwas, Bruder Ludwig?« fragte sie. »Habt Ihr vielleicht Schmerzen?«
»Woher kennt Ihr meinen Namen?« stammelte er töricht.
»Mein Sohn hat mir von Euch erzählt«, meinte sie leichthin, und bot ihm an, sich doch zu setzen, was er dankbar tat.
Seine Knie zitterten. »Euer Sohn«, murmelt er. »Frau Artzt, ich will mit Euch über Euren Sohn sprechen.«
Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich jäh. »Hat er etwas getan?« fragte sie besorgt.
»Ja…, vielmehr, nein, eigentlich nicht. Seht, Frau Artzt«, er fand allmählich zu der kleinen Rede zurück, die er vorbereitet hatte, »Richard äußert Zweifel, wo er keine haben sollte, und widerspricht bei Dingen, die als heilige Wahrheit gelten. Nun frage ich mich, ob er hier von Euch auch wahrhaft christlich erzogen wird, Ihr seid doch getauft?«
»Gewiß«, erwiderte sie spürbar erleichtert, was ihn etwas aufbrachte, denn er ahnte, daß die gesenkten Lider einen spöttischen Blick verbargen. Streng fragte er sie nach ihrem Katechismus, prüfte das Glaubensbekenntnis, die Zehn Gebote, erkundigte sich nach regelmäßigen Messebesuchen und fand alles zu seiner Zufriedenheit. Eine gottesfürchtige Frau, die ihr Leben nur in Wandlingen verbracht hatte, hätte nicht besser antworten können. Warum nur das Gefühl, daß sie sich leise über ihn lustig machte? Immer schon hatten die Mädchen und Frauen über ihn gespottet, und wie gut war es gewesen, der Gegenwart dieser Geschöpfe zu entrinnen, die ihm nur das Gefühl der Unbeholfenheit vermittelten. Ihm war heiß, er schwitzte, und die Luft flirrte vor seinen Augen.
Plötzlich fühlte er die kühle, leichte Hand der Sarazenin auf seiner Stirn. »Es geht Euch nicht gut, Bruder Ludwig«, stellte Zobeida sachlich fest, »wartet, ich hole Euch etwas zu trinken.« Ihre Haut war zart und roch ein wenig nach Kräutern. Warum hatte sie ihn nur berührt!
Er trank widerspruchslos, was sie ihm in die Hand drückte, und während sie ihm Ratschläge erteilte, hörte er ihr nicht zu, sondern beobachtete die Bewegungen ihres Mundes, weich und doch fest geformt.
Ludwig geriet von einer Verwirrung in die andere und beschloß, in den nächsten Ta gen zu fasten. Wie gut, daß die Ankunft eines bedeutenden Mannes erwartet wurde, so daß man im Kloster viel zu aufgeregt war, um seinen Zustand bemerken zu können.
Er würde dem Abt über seinen Besuch berichten müssen, und der Abt besaß scharfe Augen, doch auch er war beunruhigt durch den angekündigten Besuch des Bruders Heinrich von den Dominikanern, jenes Heinrich Institoris, der in der Bulle des Papstes ausdrücklich genannt worden war. Niemand würde Zeit und Lust haben, das Verhalten des Bruder Ludwig zu untersuchen, und wenn Bruder Ludwig sich entschlossen hatte, zu fasten, warum nicht?
»Ich danke Euch, Frau Artzt«, sagte er abrupt und stand auf, noch ein wenig schwankend. »Doch jetzt muß ich gehen. Gehabt Euch wohl, achtet auf das Christentum Eures Sohnes und seid nochmals bedankt für Eure Hilfe!«
Er flüchtete geradezu aus dem Haus, und Zobeida sah ihm verwundert nach. Sie erzählte Richard nichts von Bruder Ludwigs Untersuchung, weil sie es für unwichtig hielt und ihn nicht gegen seinen Lehrer aufbringen wollte.
Kapitel 2
Als Zobeida am folgenden Sonntag mit Richard die Messe im Kloster St. Georg besuchte, hatte sie den Mönch bereits wieder vergessen. An diesem Sonntag würde ein Gast des Klosters predigen, und es wurde erwartet, daß die Eltern der Schüler, die in oder um Wandlingen lebten, vollzählig in St. Georg erschienen. Man tuschelte bereits allerlei über den Dominikaner in seiner schwarzweißen Kutte, der gemeinsam mit dem Abt die Messe las. Er wirkte gütig und ehrfurchtgebietend mit seinem weißen Bart und sehr selbstbewußt.
Man sagte, er sei ein sehr wichtiger Mann, einer der beiden Inquisitoren, denen der Papst die heilige Inquisition in deutschen Landen übertragen hatte, zusammen mit einem dritten, Johannes Gremper, der ihnen jedoch untergeordnet war. Unter den Mönchen des Klosters gab es jedoch einige, die weniger beeindruckt waren.
»Domini canes«, flüsterte Bruder Albert, der Latein und Griechisch unterrichtete, dem neben ihm sitzenden Bruder Franz spöttisch zu. Zwischen Dominikanern und Benediktinern herrschte seit Alters her Mißtrauen, und man wußte im Kloster, daß der Abt alles andere als begeistert über diesen Besuch gewesen war. Während man die Benediktiner wegen ihrer Lehrtätigkeit und ihres Reichtums rühmte, hatte der Orden der Dominikaner die Inquisition zu seinem Privileg gemacht.
Die Dominikaner nannten sich beileibe nicht nur nach dem heiligen Dominikus, sondern wiesen auch ständig stolz auf die Nebenbedeutung ihres Namens hin – domini canes, die Hunde des Herrn, die Hunde, welche die Herde schützten vor allem Fremden, welche die schwarzen Schafe aussonderten.
Wie erwartet, hatte Bruder Heinrich das Hexenwesen zum Gegenstand seiner Predigt gemacht. Er begann damit, daß ihm und seinem Mitbruder Jakob, der zur Zeit im Rheinländischen weilte, durch die Bulle des Papstes die Ausrottung dieser Unmenschen besonders ans Herz gelegt worden war, und zitierte aus dem Alten Testament: »Hexen und Zauberer sollst du nicht leben lassen!«
Es gebe natürlich überhaupt keinen Zweifel an der Existenz von Hexenkunst an sich, doch es habe sich gezeigt, daß die Frauen in viel höherem Maße für dieses Übel anfällig seien als die Männer, was kaum verwunderlich wäre.
»Steht nicht in der Heiligen Schrift«, fragte Bruder Heinrich, »klein ist jede Bosheit neben der Bosheit des Weibes? Und Chrysostomus sagt: Was ist das Weib anderes als die Feindin der Freundschaft, eine unentrinnbare Strafe, ein notwendiges Übel, eine natürliche Versuchung, ein wünschenswertes Unglück, eine häusliche Gefahr, ein Mangel der Natur, mit schöner Farbe gemalt. Auch Vincentius meint: Ich fand das Weib bitterer als den Tod, und selbst ein gutes Weib ist unterlegen der Begehrlichkeit des Fleisches.«
Richard bewegte sich unruhig auf seiner Bank. In St. Georg wurde auch Rhetorik unterrichtet, und gemessen an dem, was von den Schülern verlangt wurde, fand er diesen berühmten Dominikaner eher mittelmäßig. Außerdem schien Heinrich Institoris seine Beispiele direkt aus einem Handbuch für Prediger zu nehmen, das sich auch in der Klosterbibliothek befand. Richard unterdrückte ein Gähnen. Seine Gedanken schweiften ab, er fragte sich, wie eine Hexe ihren Zauber wohl bewerkstelligen würde – wenn es denn Hexen gab. Er hatte vage Vorstellungen von Zaubersprüchen, plötzlich aufwallenden Nebeln und dergleichen. Plötzlich spürte er eine leichte Berührung an der Schulter. Seine Mutter schüttelte lächelnd den Kopf, Richard errötete und versuchte, sich wieder auf die Predigt zu konzentrieren.
Bisher hatte der Dominikaner eher zurückhaltend gesprochen. Doch nun wurde seine Stimme drängend, donnerte über die Köpfe der Gemeinde hinweg.
»Ist es ein Wunder, daß dieses schwache, schuldbeladene Geschlecht, das seit Eva immer wieder der Verführung des Bösen erlegen ist, einen Pakt mit dem Satan eingeht, dem Satan, der sich auf die Schlingen der Wollust versteht? Kein Mann kann so anfällig dafür sein, wie ein Weib, denn die Weiber sind von Natur aus unersättlich gierig nach den Versuchungen des Fleisches, die Männer dagegen selbstbeherrscht. Eva wurde aus einer Brustrippe geschaffen, das heißt, eine jede Frau ist von Natur aus gekrümmt und dem Manne zugeneigt. Aus diesem Mangel geht auch hervor, daß, da das Weib nur ein unvollkommenes Tier ist, es immer täuscht. Es heißt nicht umsonst: Wenn ein Weib weint, es den Mann zu täuschen meint.«
Er holte tief Atem und fuhr höhnisch fort: »Wenn es auch den Frauen an höherem Verstand fehlt, um die Listen des Bösen zu durchschauen, so besitzen sie eine niedere Tücke und Leidenschaft und Gemütserregung im Übermaß. Das Weib schäumt infolge seiner Natur vor Zorn und Unduldsamkeit, wenn es den haßt, den es vorher geliebt; und wie die Meeresflut immer brandet und wogt, so ist eine solche Frau unduldsam. Prediger 25: Es ist kein Groll über dem Groll des Weibes. Und wahrlich, die Hauptursache, die der Vermehrung der Hexen dient, ist der ständige Zwist zwischen verheirateten und nicht verheirateten Frauen und Männern; ja auch unter den heiligen Frauen, wie man im Buch Genesis sieht: Wie soll es dann erst bei den übrigen sein. Und wenn die Frauen es schon so unter sich treiben, wieviel mehr gegenüber den Männern! Und wie sie aus dem ersten Mangel, dem des Verstandes, leichter als Männer den Glauben ableugnen, so suchen, ersinnen und vollführen sie infolge des zweiten Punktes, der außergewöhnlichen Leidenschaften, verschiedene Rache, sei es durch Hexerei, sei es durch andere Mittel. Daher ist es kein Wunder, daß es eine solche Menge Hexen in diesem Geschlecht gibt; es ist geradezu dafür bestimmt.«
Richard blickte auf den sich ereifernden weißbärtigen Dominikaner auf der Kanzel und langweilte sich. Hexen waren ein Thema für Abende, an denen man sich gegenseitig einschüchtern wollte, und die Tirade gegen die Frauen war mit ihren ständigen Wiederholungen einfach ermüdend. Was für ein Unsinn! Er war bereit, zu wetten, daß der Dominikaner in seinem Leben noch nie eine Frau näher kennengelernt hatte. Er sah sich um und bemerkte erstaunt, daß die übrige Gemeinde gebannt den Worten des Predigers lauschte. Auf den Gesichtern der Menschen lag ein schwer deutbarer Ausdruck. Was war es? Befriedigung? Sehnsucht? Vielleicht auch Selbstgefälligkeit, und ganz sicher Angst. Es erschreckte ihn etwas, und er zog es vor, wieder zu Bruder Heinrich zu sehen.
»Apokalypse 6: Ihr Name ist Tod. Doch eine Frau ist noch schlimmer als der Tod. Bitterer als der Tod, weil dieser natürlich ist und nur den Leib vernichtet; aber die Sünde, vom Weibe begonnen, tötet die Seele durch Beraubung der Gnade und ebenso den Leib zur Strafe der Sünde. Nochmals bitterer als der Tod, weil der Tod des Körpers ein offener, schrecklicher Feind ist, das Weib aber ein heimlicher, schmeichelnder Feind. Ein Netz heißt ihr Herz, und die Hände sind Fesseln zum Festhalten. Wenn sie die Hand anlegen zur Behexung einer Kreatur, dann bewirken sie, was sie erstreben, mit Hilfe des Teufels.
Schließen wir: Alles geschieht aus fleischlicher Begierde, die bei ihnen unersättlich ist. Sprüche am Vorletzten: Dreierlei ist unersättlich und das vierte, das niemals spricht: Es ist genug, nämlich die Öffnung der Gebärmutter.«
Wäre Richard älter gewesen, dann hätte er den Ausdruck der Gemeinde zu deuten gewußt, als Bruder Heinrich daran ging, die Praktiken zu schildern, nach denen die Frauen gierten, dann hätte er das leise Stöhnen, das sich breitmachte, erkannt. Er stellte selbst fest, daß ihm heiß wurde. Die weihrauchgeschwängerte Luft, die sich mit dem Geruch ungelüfteter, schweißdurchtränkter Kleider und dem Atem der Gemeinde mischte, schien sich ihm plötzlich würgend wie eine Schlinge um den Hals zu legen.
Das Gesicht des Predigers war gerötet und glänzte, als er die Arme hochwarf und rief: »Darum haben sie auch mit den Dämonen zu schaffen, um ihre Begierden zu stillen. Daher ist es auch folgerichtig, die Ketzerei nicht die der Hexer zu nennen, sondern der Hexen, damit sie den Namen bekomme a potiori; und gepriesen sei der Höchste, der das männliche Geschlecht vor solcher Schändlichkeit bis heute so wohl bewahrte; da er in demselben für uns geboren werden und leiden wollte, hat er es deshalb auch so bevorzugt. Gelobt sei Jesus Christus!«
»In Ewigkeit, Amen«, murmelte die erschauernde Gemeinde.
Richard war froh, aus der erhitzten Atmosphäre der Kirche herauszukommen, und er bemerkte überrascht, daß seine Mutter zitterte. War sie zornig, oder hatte der alte Graubart ihr Furcht eingejagt? Doch es war immer noch Frühling, das schöne Wetter hatte angehalten, und der »Hund des Herrn« ließ sich leicht vergessen. Wie unsinnig doch seine Worte gewesen waren! Noch zwei Wochen, dann reiste er ab, nach Brixen, wie man hörte, und in einem Monat würde niemand mehr an den Inquisitor denken.
Für Bruder Ludwig hatte die Predigt, von der er sich Beruhigung erhofft hatte, ungeahnte Folgen. Er war nicht imstande, der gelehrten Diskussion zwischen den Confratres Franz und Albert zu folgen, die über die einzelnen Argumente des Dominikaners sprachen.
»Er ist zweifelsohne ein Eiferer«, meinte Albert, »die domini canes waren das immer. Früher haben sie Ketzer verbrannt, und jetzt scheinen sie die Hexen für sich entdeckt zu haben. Was, glaubt Ihr, wird…«
Ludwig hörte nicht zu. In ihm hallten noch die Worte des Inquisitors wider, als seien sie für ihn gesprochen: »Ihr Anblick ist schön… Sie sticht und ergötzt zugleich; daher wird auch ihre Stimme dem Gesang der Sirenen verglichen, welche durch ihre süße Melodie die Vorübersegelnden anlocken… Die Blume der Liebe ist die Rose, weil unter ihrem Purpur viele Dornen verborgen sind.« Bei den ausführlichen Beschreibungen der Laster des Weibes gaukelte ihm seine Phantasie das Bild der Sarazenin vor, und das Wort »unersättlich« begleitete ihn überallhin. Das Fasten hatte nicht geholfen, nicht im geringsten. Am Nachmittag schließlich verließ er heimlich das Kloster und machte sich erneut auf den Weg zu ihrem Haus.
Er wurde von einem leicht verwunderten Richard willkommen geheißen, und der Gruß, den Zobeida aussprach, klang auch nicht sehr begeistert. Sie waren freundlich zu ihm, doch mit jeder Geste schienen sie auszudrücken, daß sie lieber alleingelassen werden wollten, daß er ihre Vertrautheit störte.
»Frau Artzt«, stammelte er, »Frau Artzt, Ihr müßt mir helfen. Ich… ich brauche noch etwas von dem Trank, den Ihr mir neulich gabt.«
»Ihr braucht eher etwas kühles Wasser«, erwiderte Zobeida.
Bruder Ludwig wurde hinauskomplimentiert, und als er sich auf dem Rückweg zu seinem Kloster befand, verwünschte er seine eigene Schwäche. Wenn Fasten nicht half, dann würde er zu dem noch stärkeren Mittel der Flagellation greifen.
Im Gegensatz zu Bruder Ludwig kam Bruder Albert mit seinen Schülern ausgezeichnet zurecht. Nicht nur für Richard war sein Griechischunterricht einer der Höhepunkte des Tages, um so mehr, da sie zur Zeit die Odyssee lasen. Bruder Albert hatte eine Art, die Abenteuer des Odysseus so wirklichkeitsnah wie die des Marco Polo erscheinen zu lassen. Die Frage nach den heidnischen Göttern umging er dabei elegant, indem er von der »wunderbaren Einbildungskraft der Griechen« sprach.
»Wir waren bei der Zauberin Kirke stehengeblieben«, sagte Bruder Albert mit seiner sonoren Stimme, »die Odysseus’ Männer in Schweine verwandelt hatte. Ich konnte ja nicht ahnen, daß dieses Thema auf einmal so beliebt wird.«
Durch die Schülerreihen ging ein leises Gelächter. Albert fuhr fort: »Hermes sagte zu Odysseus: ›Alle verderblichen Künste der Zauberin will ich dir nennen.‹ Ich bin sicher, unsere geschätzten Confratres von den Dominikanern würden so ein Angebot zu würdigen wissen. Aber das Folgende zeigt, daß sich ihre, ich meine, unsere christliche Behandlungsweise von Zauberinnen doch wesentlich von denen der Heiden unterscheidet. Richard, übersetze bitte.«
Richard konnte nicht widerstehen; er imitierte den Tonfall des Dominikaners am letzten Sonntag und deklamierte mit tiefer Stimme: »Spring auf die Zauberin los und drohe sie gleich zu erwürgen. Diese wird in der Angst zu ihrem Lager dich rufen. Und nun weigre dich nicht und besteige das Lager der Göttin…«
»Das genügt«, unterbrach Bruder Albert und hüstelte. »Ich denke, die Verderbnis der Griechen ist nun jedem klar. Kein Wunder, daß die Römer sie schließlich besiegten. Sie konnten einfach nicht mit ihren Zauberinnen umgehen.«
Diesmal dauerte es einige Zeit, bis die Schüler sich wieder beruhigt hatten. Richard stellte sich eine Diskussion zwischen dem Inquisitor und Bruder Albert vor. Er sah förmlich, wie Albert mit seiner geschliffenen Rhetorik diesen lächerlichen Dominikaner auf Treibsand setzte.
Kuno Hilpert, der Sohn eines der reichsten Bürger der Stadt, meldete sich und fragte: »Aber ich habe immer gehört, daß der Glaube der Heiden ein Beweis dafür ist, daß es Hexen und Zauberer schon immer gegeben hat.«
Bruder Albert verschränkte die Arme ineinander. »Möchte vielleicht einer von euch darauf antworten?«
Richard wartete nicht, bis er aufgerufen wurde, er platzte heraus: »Die Heiden haben auch an Götter, Titanen und die Medusa geglaubt. Ist das vielleicht ein Beweis?«
Kuno fiel offensichtlich nichts mehr ein, doch Bruder Albert, der bei sich dachte, es könne Richard nicht schaden, etwas von seiner Selbstsicherheit zu verlieren, schüttelte den Kopf.
»Richard, du enttäuschst mich. Das war ein Gegenargument, das noch nicht einmal die Sophisten gelten lassen würden. Überlege, und wenn du darauf kommst, wo dein Fehler liegt, veranschauliche uns das an einem weiteren Beispiel.«
Richard spürte, wie alle Augen auf ihn gerichtet waren. Er haßte es, zu versagen, und biß sich auf die Lippen. Sicher meinte sein Lehrer nicht einfach, daß Kuno im Einklang mit den Lehren der Kirche stand? Er überdachte ihren raschen Wortwechsel noch einmal, starrte auf Bruder Albert, der ihn ungerührt musterte, und hatte auf einmal eine Erleuchtung.
»Selbstverständlich kenne ich meinen Fehler«, entgegnete er so lässig wie möglich. »Wenn Alexander zu Bethos sagt: ›Es wird heute regnen‹, ist das eine Aussage. Wenn Alexander außerdem sagt: ›Heute werde ich auf einer Wolke reiten‹, ist das eine andere. Die zweite Aussage ist offenkundig unwahr, aber daraus folgt nicht, daß auch die erste Aussage unwahr ist.«
Einige der Schüler schauten ein wenig verwirrt drein, doch Bruder Albert nickte befriedigt. »Ausgezeichnet. Aber«, er zwinkerte Richard zu, »ich will doch nicht hoffen, daß du mit deinem Beispiel sagen willst, daß du die Aussage, es gäbe Hexen, für unwahr hältst?«
»Niemals«, versicherte Richard im Brustton der Überzeugung.
Auch die Geißelungen bescherten Bruder Ludwigs Nächten keinen Frieden. Er verschwieg dem alten Bruder Hermann, bei dem er beichtete, seine sündigen Gedanken, und wurde darauf von noch heftigeren Gewissensbissen gequält, denn so empfing er den Leib des Herrn in Sünde. Trotzdem befand er sich bald darauf wieder im Städtchen und folgte Zobeida heimlich, während sie von einem Haus zum anderen ging, um ihre Kranken zu versorgen.
Doch wenn sie ihn nicht bemerkte, ein anderer tat es. Ludwig beobachtete, wie sie sich gewaltsam aus dem Griff eines Mannes losmachte, den er als Emmerich Kühn zu erkennen glaubte, und wollte ihr schon zur Hilfe eilen. Nichts hätte ihm größere Freude bereitet, doch Emmerich Kühn machte keine Anstalten, Zobeida weiter zu belästigen, sondern sah ihr nur nach. Als sie außer Hörweite war, rief er höhnisch: »He, Ihr da, Mönchlein! Ihr könnt aus dem Schatten kommen!«
Ludwig erschrak und suchte Zuflucht in der Autorität des Priestertums. Er trat hervor und versuchte, gelassen zu wirken. »Was habt Ihr mit dieser Frau zu schaffen, Kühn?« fragte er harsch. Der Schreiner spuckte aus.
»Die da ist ein übles Weib. Sie hetzt meine Frau gegen mich auf, und irgend etwas hat sie auch gemacht, so daß ich seit Tagen mein eigenes Weib nicht mehr besteigen kann. Könnt Ihr Euch das vorstellen? Aber versucht mal, aus der etwas herauszukriegen. Frech wird sie, das ist alles. Heidenweib! Ungläubige, verdammte!«
»Sie ist getauft«, murmelte Ludwig und wollte weitergehen. Die Gesellschaft des Schreiners war ihm widerwärtig, und er verlor Zobeida aus den Augen.
Kühn grinste höhnisch. »Getauft, wie? Das glaubt Ihr doch selbst nicht, Pater, daß die eine Christin ist! Aber ich wette«, sein Grinsen wurde breit, »im Bett wäre sie nicht schlecht. Man sagt, diese Art Weiber verstünde sich besonders gut darauf. Was meint Ihr, Pater?«
»Ihr seid betrunken, Meister Kühn, und solltet drei Ave Maria beten, weil Ihr in meiner Gegenwart solche Reden geführt habt«, sagte Ludwig, doch selbst in seinen eigenen Ohren klang es falsch und heuchlerisch. Er wandte sich um und floh, vom schneidenden Gelächter des Schreiners begleitet.
»Ihr seid mir immer wieder gefolgt«, sagte Zobeida, und blickte auf den Mann hinab, der unglücklich an ihrem Tisch saß. »Warum tut Ihr das, Bruder Ludwig?« Natürlich kannte sie den Grund. Es hatten sich schon mehrmals Männer in sie verliebt, obwohl sie versuchte, es gar nicht erst dazu kommen zu lassen, und sich so streng und zurückhaltend kleidete wie sonst nur eine alte Frau. Doch wenn die Männer so direkt herausgefordert wurden, es auszusprechen, drückten sie sich gewöhnlich, flohen und beendeten ihre Vernarrtheit, zumindest die Schüchternen, zu denen sie Bruder Ludwig zählte.
Ludwig indessen war an einem Punkt angelangt, wo er nicht mehr fliehen konnte. Wie schon einmal sagte er mit zitternder Stimme: »Ihr müßt mir helfen, Frau Zobeida…« Es war das erste Mal, daß er ihren Namen laut aussprach, den er durch Fragen erfahren und seitdem tausendmal leise gewispert hatte. Zobeida. Zobeida Zobeida Zobeida…
»Wie kann ich Euch helfen«, sagte Zobeida kopfschüttelnd, »wenn Ihr mir nicht sagt, was Euch fehlt, und statt dessen Euer Übel verschlimmert? Geht zurück in Euer Kloster, Bruder Ludwig, und nehmt ein kaltes Bad.«
Diese Abfuhr brachte ihn auf die Beine. Mit mehr Energie, als er sich selbst zugetraut hatte, griff er nach ihr und zog sie an sich, preßte sie gegen seinen Körper, über den Schauer liefen. »Ich liebe Euch!«
Zobeida blieb völlig ruhig. Sie sträubte sich nicht, sondern versteifte sich und sagte kalt: »Ihr liebt mich nicht, Pater, Ihr begehrt mich. Doch sei es, wie es will, ich kann Euch nur raten, schleunigst in Euer Kloster zurückzukehren und ein wenig über Euer Gelübde nachzudenken.«
Doch sie hatte sich wieder verschätzt. Ludwig hielt ihre mangelnde körperliche Gegenwehr für Zustimmung, hörte kaum, was sie sagte, sondern versuchte, ihr Kleid aufzureißen. Zobeida stieß ihn zurück, doch der korpulente Mönch, aufgestachelt von seiner Begierde, verfügte über erstaunliche Kräfte. Seine Hände, sein saurer Atem waren überall. Andererseits unterschätzte er eine Frau, die durch die harte Schule eines Sklavenmarktes gegangen war. Zobeida befreite sich schließlich durch einen gezielten Kniestoß, griff nach einem Holzscheit und betrachtete den sich krümmenden Ludwig verächtlich.
»Kommt noch einmal hierher«, stieß sie zwischen den Zähnen hervor, »und ich richte Euch so zu, daß Ihr niemals mehr vor den Augen Eures Abts erscheinen könnt!«
Die Augen des Mönchs flackerten, und sie hörte ihn mit sich überschlagender Stimme schreien: »Das wird Euch noch leid tun!«, bevor er aus dem Haus stürzte.
Bruder Ludwig hatte nichts Bestimmtes im Sinn, er spürte nur den Schmerz der Zurückweisung und das Begehren, das sich allmählich in Galle verwandelte. Schließlich endete er in den Gassen von Wandlingen, taumelte in eine Schenke und begann dort, sich zu betrinken. Wie konnte er sich nur so vergessen! Das war nicht mit rechten Dingen geschehen. Sie hatte ihn dazu gebracht, sie hatte ihn gereizt. Weiß Gott, wenn er ein schmucker Kerl wie Bruder Albert gewesen wäre, hätte sie sich geradezu auf ihn gestürzt!
Nur daran konnte es liegen; sagte Bruder Heinrich nicht, daß die Frauen voller Wollust waren? Schlechtes Weib. Hure. Alles war ihre Schuld. »Ich würde Euch raten, in Euer Kloster…« Wie konnte sie es wagen?
»Von Grund auf schlecht«, schrie er plötzlich, so daß sich die anderen Gäste in der Schenke nach ihm umsahen. Ein betrunkener Mönch, nun ja, das kam vor. Einer jedoch erkannte ihn und gesellte sich zu ihm.
»Bruder Ludwig. Ihr seid doch Bruder Ludwig?«
Ludwig rülpste, als er Emmerich Kühn ausmachte. »Ihr hattet recht«, murmelte er undeutlich, »vollkommen recht. Böses Weib. Ungläubige. Böse.«
Kühn nickte mitfühlend. »Die Sarazenin, wie? Ich habe ihr schon immer mißtraut. Sie hat Augen wie der Teufel, habt Ihr das schon bemerkt? Sie könnte direkt eine Hexe sein, so wie sie. Was habt Ihr, Pater?«
Ludwig starrte ihn an. Mit einem Mal war die Trunkenheit aus seinen Augen verschwunden. »Sagt das noch einmal.«
»Sie könnte direkt eine Hexe sein… Mein Gott, Pater, meint Ihr etwa.«
Ludwig ließ eine Hand auf die Schulter des Schreiners sinken.
»Das erklärt alles«, sagte er fieberhaft, »jede Kleinigkeit. Denkt nach, sind Euch nicht auch Merkwürdigkeiten an ihr aufgefallen?«
Angefeuert vom Wein, stimmte Emmerich Kühn eifrig zu. »Stimmt schon, Bruder Ludwig, stimmt schon. Ich hab’s Euch doch erzählt, meine Frau.«
Es dauerte lange, bis Ludwig die Schenke wieder verließ, und noch länger, bis er St. Georg erreichte. Der Bruder Pförtner betrachtete ihn mißbilligend.
»Wo wart Ihr nur, Bruder, daß Ihr erst jetzt zurückkehrt?«
Er hörte Bruder Ludwig lachen, zum ersten Mal, seit dieser aus Speyer gekommen war. »Bei einer Hexe, Bruder. Bei einer Hexe.«
»Ihr seid wirklich betrunken und solltet Euch schämen. Das wird Euch einen Verweis des Abtes einbringen.«
Ludwig hatte ursprünglich vorgehabt, den Inquisitor sofort aufzusuchen, doch mit dem Rest von klarem Verstand, der ihm geblieben war, erkannte er, daß ihn Bruder Heinrich vielleicht für nicht weniger betrunken halten würde als der Pförtner. Er verbrachte die verbleibenden Stunden einer unruhigen Nacht in seiner Zelle und fand sich noch vor der Morgenmesse bei Bruder Heinrich ein.
Der Dominikaner war hellwach; er machte sich gerade einige Notizen. Bücherstaub hing in der Luft. Bei Ludwigs Eintreten hob er den Kopf.
»Verzeiht, Frater«, sagte Ludwig heiser, »aber ich möchte etwas von Euch wissen. Wie erkennt man Eurer Meinung nach eine Hexe?«
»Da gibt es Verschiedenes«, erwiderte Heinrich Institoris und stand auf. »Warum fragt Ihr?«
»Weil ich glaube…« An seiner Schläfe pochte hämmernd eine Ader. Ludwig fuhr mit der Zunge über die Lippen und begann von neuem: »Weil ich glaube, daß sich hier in Wandlingen ein Hexenweib befindet. Ich habe sie selbst gesehen.«
»Setzt Euch doch«, sagte der Inquisitor teilnehmend, »und erzählt mir mehr davon. Ich hatte, ehrlich gesagt, nicht gehofft, in Eurem Kloster solche Mitarbeit zu finden. Einige Klöster und Pfarreien gelten als verantwortungslos dem Hexenwesen gegenüber, und deswegen haben Bruder Jakob und ich beschlossen, gleichsam als Missionare durch das Reich zu ziehen, da uns der Heilige Vater dazu die Befugnis verliehen hat. Also, was ist nun mit Eurer Hexe? Warum haltet Ihr sie für eine solche, und wie heißt sie?«
»Ihr Name«, erwiderte Bruder Ludwig stockend, »ist Zobeida Artzt. Sie ist von Geburt Sarazenin, doch gibt sie vor, nunmehr an unseren Herrn Jesus zu glauben.«
»Hinter bekehrten Heiden verbergen sich oft die Schliche des Teufels«, stimmte der Dominikaner beifällig zu.
Ludwig versuchte, möglichst gelassen fortzufahren, doch es brach aus ihm heraus: »Sie hat mich behext, Frater. Sie hat in meinem Herzen die Begierde nach ihr geweckt, und ich war fast bereit, mein Gelübde zu brechen.« Er barg sein Gesicht in den Händen.
»Nun«, hörte er Bruder Heinrich sagen, »wie Ihr wißt, sind die Weiber von Natur aus schlecht. Woher kommt Euch der Gedanke, daß es sich um einen teuflischen und keinen menschlichen Verführungsversuch handelt? Hat sie in Eurer Gegenwart etwas getan, das nach Zauberei aussah?« Ludwig zögerte.
»Als ich sie zum ersten Mal sah, mischte sie mir einen Trank, der.«
»Das ist eindeutig«, unterbrach ihn der Inquisitor erfreut, »Hexen verwenden immer Zaubertränke. Doch fahrt fort, Bruder.«
In Ludwigs Augen fügte sich nun alles zu einer Kette, und er fühlte selbst fast die Freude des Entdeckers.
»Sie kannte auch meinen Namen, obwohl ich ihn nicht genannt hatte. Ich sah sie nie beten oder das Kreuz schlagen, wie eine gottesfürchtige Christin es tun sollte.«
»Ist sie verheiratet?« fragte der Inquisitor.
»Verwitwet. Sie betätigt sich als Hebamme, und man ruft sie, wenn Pflege…«