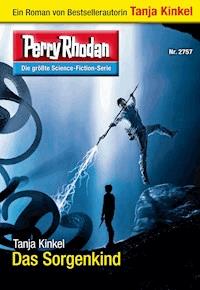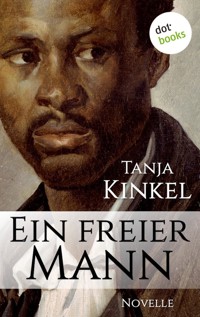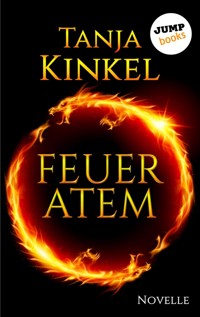Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Neil LaHaye, erfolgreicher amerikanischer Journalist, als Pulitzerpreisträger berühmt für seine systemkritischen Themen, steckt in einer Lebenskrise: seine Leser hat er verloren, seine Frau ihn verlassen. Nach einem gründlich missratenen Liebesabenteuer beschließt er, einen Bestseller über Aids, die Pest des 21ten Jahrhunderts zu schreiben. Gleich zu Beginn seiner Recherche stößt Neil auf merkwürdige Zusammenhänge, die auf einen gewissen verschollenen Dr. Sanchez und seinen Arbeitgeber, den mächtigen Pharmakonzern Livion hinweisen. Sein journalistischer Instinkt sagt ihm, dass er einem skandalösen Komplott der Pharmaindustrie auf der Spur ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2003
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Epilog
Danksagung
TANJA KINKEL
GÖTTER-DÄMMERUNG
Roman
1. Auflage 2003
© Frankfurter Verlagsanstalt GmbH,
Frankfurt am Main 2003
Alle Rechte vorbehalten
Schutzumschlag- und Einbandgestaltung:
Bertsch & Holst, Frankfurt am Main
Herstellung: Thomas Pradel, Frankfurt am Main
eISBN: 978-3-62702-109-2
1 2 3 4 5 – 07 06 05 04 03
Für meine Eltern,
die diesen Roman mitgetragen haben.
Es ist immer das gleiche lähmende Gefühl, mit dem sein Traum beginnt, der Albtraum, der sich seit seiner Kindheit in ihn gekrallt hat und ihn nicht mehr loslässt, der Traum, der sich nur hin und wieder für ein Jahr oder zwei ruhig verhält und dann wieder drohend seine Zähne zeigt. Es ist immer das Gleiche. Da ist der Geschmack von Eiscreme auf den Lippen, Zitroneneis, für das er eine halbe Stunde bis zur Tankstelle gelaufen ist, weil es sonst in Morrow nirgendwo welches gibt. Die schwüle Hitze des Sommers in Louisiana. Da ist der Geruch von vertrockneten Magnolienblättern aus dem Frühjahr, Kaffee und Tabak. Lavendel und Kölnisch Wasser, überall, und dahinter das, was es überdecken soll, der Gestank von Arznei und Fäulnis.
»Owen sagt, du warst nicht mehr in der Kirche, um für mich zu beten«, flüstert die Stimme seiner Mutter, und weil es ein Traum ist, hört er sie und hört gleichzeitig seinen Vater klagen, wie alles anders hätte werden können, wenn sie ihn nicht verlassen hätte. Vater ist wieder betrunken und weigert sich, Mutter anzusehen. Er hält die geschwollene Hand seiner Mutter in der Linken, aber die Hand seines Vaters zerrt an seiner Rechten. Er sitzt an der Seite der Mutter auf der Couch, die mit Großmutters so sorgfältig genähtem Quilt ausgelegt wurde, aber die Decke besteht nicht mehr aus Stoffstücken. Nein, es ist ein Flickenteppich aus Papier; und aus seinen Fingerspitzen, über die aufgeschwemmte Hand seiner Mutter und die verknorpelte seines Vaters, fließt schwarze Tinte, so klebrig wie die Reste des Zitroneneises auf seinen Lippen, aber er kann seine Hände nicht losreißen, und die schwarze Tinte hört nicht auf zu fließen. »Das ist nicht genug, Neil«, sagt seine Mutter. »Ich brauche einWunder.«
»Du Idiot hast dich immer für was Besseres gehalten«, zischt sein Vater. »Es ist deine Schuld. Du siehst doch, was du anrichtest mit dieser Schreiberei!«
Seine Mutter legt ihre Linke leicht auf sein Haar, lässt ihre Finger darüber gleiten, und diese selbstverständliche zärtliche Geste ist die schlimmste von allen, denn er weiß genau, dass jetzt Hautfetzen zurückbleiben werden und Nägel sich langsam in seinen Schädel arbeiten. Und doch kann er sich nicht losmachen. Das würde sie verletzen.
»Hilf mir«, bittet seine Mutter inständig, und er wendet sich ab, um ihre Tränen nicht zu sehen, und über ihre Schulter hinweg sieht er Deirdre, seine Frau, die im Türrahmen steht, durch den Licht fällt, hell und kalt wie der Norden. Deirdre steckt die Hand nach ihm aus, und er will aufstehen und kann nicht, will aufstehen, um die Hand zu ergreifen.
»Versteh mich«, beginnt er,»bitte …«, und wie jedes Mal schüttelt seine Frau langsam den Kopf und weicht Schritt für Schritt zurück, bis das fahle, kalte Licht im Raum jenseits der Tür sie verschluckt. Er kann nicht sehen, dass sie die Tür schließt, aber er hört etwas ins Schloss fallen und weiß im gleichen Moment, er hat sie für immer verloren.
Er war wach. Spürte einen fremden Geschmack auf seinen Lippen. Es hatte etwas Verstörendes: Das waren nicht die Zigaretten; er rauchte seit ein paar Monaten nicht mehr, aber es wunderte ihn nie wirklich, wenn er doch manchmal der Versuchung nachgab. Leichter wäre es für ihn, nicht zu rauchen, wenn nicht überall diese lächerlichen Verbotsschilder hingen. Von seinem inneren Anarchisten war über die Jahre vielleicht nicht mehr viel geblieben, Verbote aber lockten ihn wieder hervor.
Es war kein Zitroneneis, auch nicht der billige Fusel, den Ginny ihren Gästen servierte. Anders als mit den Zigaretten hatte er mit Alkohol nie ein Problem gehabt, und er fand es auf seine eigene Weise amüsant zu beobachten, wie der Rest einer Gesellschaft sich durch ständig steigernde Lustigkeit gegenseitig übertreffen wollte, während ihn Alkohol eher ruhig machte. »Das ist der Snob in dir«, hatte Matt einmal bemerkt und natürlich Recht gehabt.
Er fühlte sich benommen und desorientiert, doch wieder einzuschlafen, war keine Lösung. Nicht nach seinem Traum. Wieder fuhr er mit der Zunge über Zähne und Lippen, seine Verwirrung wuchs. Parfüm und Schweiß, eine Mischung, die ihm neu war. Ein unbekannter Geschmack in seinem Mund, ein fremder Geruch auf seiner Haut. Ein teures Parfüm, so wie man es verwendet, wenn man den eigenen Körpergeruch verbergen will. Der Name, er versuchte sich an ihren Namen zu erinnern. Ein Bild schob sich stattdessen in sein Gedächtnis, der schönste Po, den er seit langem gesehen hatte. Nur das Tattoo darauf hatte ihn gestört; chinesische Schriftzeichen, die ihn unweigerlich an die Speisekarte eines chinesischen Restaurants denken ließen. Aber es waren hinreißende Formen, die er ganz seinem Tastsinn überlassen hatte. Und dennoch wusste er: Es war wieder eine Nacht gewesen, die er bereuen würde.
Die Erkenntnis kam, wie üblich, zu spät.
Verstört setzte er sich auf. Im grauen, kühlen Licht, das durch das Dachlukenfenster in sein Schlafzimmer fiel, sah er, dass er allein war. Er versuchte nicht allzu erleichtert zu sein. Ihre blonden Haare hatten ihn ein wenig an Deirdre erinnert. Er hatte sie bei Ginny getroffen, aber ihr Name fiel ihm immer noch nicht ein. Ihr Verschwinden ersparte ihm zumindest die Peinlichkeit einer morgendlichen Unterhaltung.
Auf dem Boden, nicht unweit seiner zerknüllten Jeans, lag ein dünnes ledernes Etwas. Erst beim zweiten Hinschauen erkannte er sein Portemonnaie. Was ihm das Erkennen erschwerte, war der Umfang. Neil stand auf und fischte das dünne Lederding vom Boden auf. Leer. Nicht nur die Scheine, nein, auch die Kreditkarten. Er stutzte einen Moment lang, dann musste er lachen.
Sie war wirklich hungrig gewesen.
Das Lachen packte und schüttelte ihn und ließ ihn mit einem Gefühl der Erleichterung zurück. Eigene Dummheit. Im Grunde hätte er wütend sein müssen. Aber wie jedes andere intensive Gefühl seit Jahren ließ sich auch sein Ärger nicht einfach hervorkitzeln. Immerhin fiel ihm ein, dass er zumindest die Kreditkarten sperren lassen sollte. Er versuchte sich zu erinnern, wo er die Nummer der Bank gelassen hatte. Irgendwo in seinem Arbeitszimmer, in dem Haufen, der seinen Schreibtisch dekorierte, aber wo?
Die Uhr neben seinem Bett zeigte ihm, dass es kurz nach neun war. Zu früh für irgendwelche Studenten, um unangemeldet bei ihm aufzutauchen, denn er hatte heute keine Termine vereinbart. Ohne sich anzuziehen, ging er in sein Büro hinüber, das wie sein Schlafzimmer direkt unter dem Dach lag. Matt hatte ihn für verrückt erklärt. Sich für viel Geld in diesem alten Haus einzumieten, das noch nicht einmal über eine vernünftige Klimaanlage verfügte, um dann im Sommer halb zu ersticken, erschien ihm so unlogisch wie das meiste, was Neil in der letzten Zeit tat.
»Du vergisst, wo ich herkomme«, hatte Neil erwidert, und in dem übertriebensten Cajun-Akzent, zu dem er in der Lage war, hinzugefügt: »Für uns Jungs aus dem Süden wird es bei euch Eskimos nie richtig heiß, Mister.«
Ganz im Gegenteil, dachte er jetzt, während er den Container unter seinem Schreibtisch hervorzog und in den Schubladen wühlte. Es war Februar, und in Neuengland lief das auf Schnee hinaus. Abdichtungen hin, Abdichtungen her, er bildete sich ein, den frostigen Wind sogar hier zu spüren.
Die Schubladen waren eindeutig durchsucht worden, und nicht von ihm. Er fragte sich, warum er nichts, aber auch gar nichts gehört hatte, bis auf das leise Schnappen des Türschlosses, falls das nicht auch zu seinem Traum gehört hatte. So arbeiteten Profis. Sein Briefbeschwerer fiel ihm ein, und er schaute hastig auf die Tischplatte. Kein silberner Pelikan zwischen den Zetteln. Er unterdrückte einen Fluch, und langsam meldete sich der Ärger, auf den er die ganze Zeit gewartet hatte. Das war nicht irgendein Briefbeschwerer gewesen, sondern ein Geschenk zum Collegeabschluss. Sein Notebook, das er immer auf Reisen mitnahm, stand auch nicht neben dem Schreibtisch; wahrscheinlich würde er das Gerät auch sonst nirgendwo entdecken. Wenigstens war der reguläre Computer zu sperrig für das Miststück gewesen. Er überlegte, ob er irgendwelche Dateien auf dem Notebook hatte, die nicht auf dem Festgerät oder Disketten gesichert waren. Vorerst fiel ihm zu seiner Erleichterung nichts ein, aber bei seinem Glück würde sich das schnell ändern.
Wenigstens fand er sein Adressbuch. Es enthielt zwar die Nummern fast aller Antiquariate von Cambridge, aber nicht die seiner Bank. Da ihm eindeutig die Lust fehlte weiterzusuchen, entschied er sich für den einfachsten Weg und rief Deirdre an. Ihre Nummern, die private, die ihres Büros und die ihres Handys, waren alle in seinem Telefon gespeichert; er brauchte sie nur abzurufen. Sie selbst hatte jede einzelne Nummer eingegeben, als sie die Kinder das erste Mal bei ihm allein ließ.
»Ich kenne dich«, hatte sie gesagt. »Falls etwas passiert, will ich nicht, dass du mir später erzählst, du hättest dich in der Aufregung nicht mehr an all die Zahlen erinnern können. Du rufst mich auf der Stelle an.«
Um diese Uhrzeit arbeitete sie natürlich schon. Als sie sich mit »Büro von Senator Cunningham« meldete, die Stimme geübt in freundlichem Optimismus, spürte er die alte Versuchung, sie zu verletzen und zu fragen, ob alle Senatoren ihre Angestellten zum Training zu Ansagediensten schickten, damit sie auch wirklich unpersönlich klängen. Er schluckte die Worte hinunter, was ihm nicht weiter schwer fiel. Die Scheidung lag nun schon fast zwei Jahre zurück, und die Bitterkeit darüber kostete wie jedes andere heftige Gefühl dieser Tage Mühe.
»Deirdre«, sagte er ohne jede weitere Einleitung, »mir sind meine Kreditkarten abhanden gekommen. Frag mich bitte nicht, wie. Ich weiß, dass ich mir die Nummern irgendwo notiert habe, aber ich finde sie nicht. Ganz zu schweigen von der Durchwahl meiner Bank. Kannst du mir aushelfen?«
Um das Schweigen am anderen Ende zu füllen, fügte er hinzu: »Sonst bleibt mir nächsten Monat wirklich nur noch die Ausrede mit dem Scheck, der irgendwo bei der Post liegen muss, was den Unterhalt für die Kinder angeht.«
Sie seufzte. »Neil«, sagte sie, »es sind jetzt bald zwei Jahre.«
»Ich weiß«, erwiderte er und stellte fest, dass seine Stimme unerwartet heiser klang.
»Das bezweifle ich. Es kommt mir eher so vor, als ob du den Eindruck hast, geschieden sein bedeutet, nur noch die Vorteile einer Ehe zu haben und keine der Verpflichtungen. Ich bin nicht länger dein Mädchen für alles. Dir dein Leben bequemer zu machen, ist nicht mehr mein Job.«
»Glaub mir«, gab er zurück, schärfer, als er beabsichtigt hatte, »ich weiß sehr gut, was dein Job ist. Und wo deine Prioritäten liegen.«
Er hörte, wie sie rasch Luft holte. Die Anschuldigung, die er nicht aussprach, die ungesagten Worte, die als kleine elektronische Funken irgendwo zwischen Cambridge und Washington durch ein Gewirr von Kabeln tanzten, kleine grüne Funken, weil Grün für ihn die Farbe der Enttäuschung war. Nein, er würde Deirdre nicht um Verzeihung bitten.
»Also gut, ich erledige die Sache mit den Kreditkarten«, sagte sie nach einem kurzen Zögern, spröde und sachlich, als erteile sie einem unerwünschten Reporter Auskunft über den Terminplan ihres Senators. Nun, er war so etwas wie ein unerwünschter Reporter. Mit immer noch gültigem Presseausweis, dank gelegentlicher Artikel für die UPI.
»Ich wusste, dass du die Nummern noch hast«, sagte er. »Danke.«
»Dieses eine Mal noch. Aber wenn du mich das nächste Mal anrufst, dann bitte nur noch wegen der Kinder.«
»Nicht einmal ein Dankesanruf, wenn meine neuen Karten kommen?«, fragte er, aber sie weigerte sich, auf seinen spöttischen Tonfall einzugehen.
»Neil«, entgegnete sie, und er wusste, dass sie sich immer noch auf die Worte bezog, die nicht zwischen ihnen gefallen waren, »es war deine Schuld. Du bist derjenige, der den Karren in den Dreck gefahren hat, aus reiner Sturheit. Und wenn du glaubst, du bringst mich dazu, ein schlechtes Gewissen zu haben, nur weil ich rechtzeitig mit den Kindern abgesprungen bin, dann täuschst du dich.«
Sie legte auf. Das Freizeichen hallte unerwartet laut in seinen Ohren. Das Schlimmste war, dass er sie verstand. Er wünschte sich, sie und ihre Meinungen könnten ihm gleichgültig sein. Nicht Hass war der Tod der Liebe, dachte Neil, Gleichgültigkeit war es. Vielleicht würde es ihm leichter fallen, sämtliche Gefühle ihr gegenüber endgültig zu verlieren, wenn sie sich so weit verändert hätte, dass er an ihr nur noch den Namen erkannte. Doch ihre Ansichten, ihre Reaktionen, all das war ihm so vertraut wie der Körper, der auch nach zwei Kindern und fünfzehn Jahren Ehe immer noch der jener jungen Frau war, die ihn und Matt kurz vor dem Vietnam Memorial beim Joggen überholt hatte. Wenn er wollte, konnte er sich ihre Leggins ins Gedächtnis zurückrufen und die Art, wie ihr zu einem Pferdeschwanz gebundenes Haar auf den Schultern wippte, seine eigene Verblüffung, dass eine Frau schneller war. An jenem Tag hatte er keinen Blick auf ihr Gesicht werfen können; sie war einfach zu schnell. Er hatte sich damit getröstet, dass sie trotz der aufregenden Figur wahrscheinlich durchschnittlich und langweilig aussehen würde, verbissen, und mit Sicherheit eine unangenehme Stimme hatte, dass es besser wäre, nur die kurze Vision einer griechischen Göttin, die in einem etwas zu engem T-Shirt und grauen Leggins durch das Grün der Mall lief, im Gedächtnis zu behalten, als von der Wirklichkeit enttäuscht zu werden.
Aber in der darauf folgenden Woche holte sie ihn wieder ein, obwohl er durchaus in Form war und sein altes College-Training wieder etwas aufpoliert hatte. In der dritten Woche blickte er ständig über die Schulter, immer in der Hoffnung, sie würde auftauchen. Matt machte sich so lange über ihn lustig, bis Neil stehen blieb und alles um sich vergaß, als er Deirdre das erste Mal wirklich zu Gesicht bekam. Es war das Versprechen einer wunderbaren Zukunft, das ihn an diesem Tag anblickte, und nach all den Jahren war er sich immer noch nicht sicher, ob er oder sie dieses Versprechen zuerst gebrochen hatte.
Neil zuckte mit den Achseln. Die Kälte des Bostoner Morgens vertrieb die Erinnerung an die sonnendurchwärmten Tage in Washington. Er kehrte in sein Schlafzimmer zurück, schnappte sich Boxershorts und eine frische Jeans und ging in das Badezimmer, um zu duschen. Im Vorbeigehen sah er aus den Augenwinkeln sein Spiegelbild und blieb einen Moment stehen. Er war für einen Mann von Anfang vierzig noch gut in Form; das war es nicht, was ihn erschreckte. Was ihn verstörte, war, dass der Kerl dort im Spiegel, der dunkelhaarige Mann mit den angegrauten Schläfen, der dringend einen Haarschnitt brauchte und dessen leicht vornübergebeugte Schultern verrieten, dass er den überwiegenden Teil seines Lebens sitzend verbrachte, ihm so bekannt vorkam. Es war sein Vater, der ihm da entgegenschaute, sein verachteter und verabscheuter Vater, der seine Träume Stück für Stück verkauft hatte und alle Welt dafür verantwortlich machte, nur nicht sich selbst.
Er musste sein Leben ändern.
* * *
»Warum Boston?« Matt hatte ihn das gefragt, als er zum ersten Mal von seiner Absicht sprach, nach seiner Scheidung nach Massachusetts zu ziehen. »Natürlich verstehe ich, dass du von Washington wegwillst, aber was hat eine Südstaatenpflanze wie du in Neuengland zu suchen?«
Er hatte eine witzige und inhaltslose Antwort gegeben und über den Unterschied zwischen Boston und Cambridge geflachst. Für die Wahrheit war in der gespannten Neutralität, zu der seine Freundschaft mit Matt zuletzt geworden war, nicht immer Platz.
Natürlich spielte das Angebot aus Harvard die entscheidende Rolle. Es kam zu einem Zeitpunkt, als er vom beliebten Journalisten und erfolgreichen Autor Neil LaHaye zum berüchtigten Journalisten und gefürchteten Autor Neil LaHaye mutiert war, was sich auch auf seinem Bankkonto bemerkbar machte. Als Gastdozent an eine der besten amerikanischen Universitäten eingeladen zu werden, war ein unerwarteter Lichtblick. An die provozierenden Fragen im Anschluss an jede seiner Lesungen und Signierstunden war er gewöhnt. Nach dem 11. September jedoch hatte sich etwas geändert: Zum ersten Mal waren Morddrohungen aufgetaucht. Statt mit seinem neuen Buch die übliche Talkshow-Runde machen zu können, wurde er aus den meisten Sendungen schon im Vorfeld wieder ausgeladen. Bei einer Signierstunde hatte eine Frau rote Farbe über ihm ausgeleert. Das alles wäre noch keine Katastrophe, wenn er wenigstens wie früher mit seinen Artikeln und Büchern die Menschen erreicht hätte. Sie in ihrem Ärger auch zum Nachdenken zu bringen, wenn er sie schon nicht auf seine Seite ziehen konnte. Doch anders als früher hielten sich die feindseligen Reaktionen nicht mit den positiven die Waage. Sein Buch über die inhaftierten Taliban in Guantánamo war noch nicht einmal ein Erfolg bei den Kritikern, sondern von den wenigen Medien, die es besprachen, als ein Versuch, »unsere nationale Tragödie auszubeuten«, verrissen worden. Gleichzeitig zerbrach seine Ehe. Von einer Elite-Universität umworben zu werden, war, wenn er sich selbst gegenüber ehrlich sein wollte, Balsam für seine Seele gewesen.
»Dir ist hoffentlich klar, dass sie dich als ihren Alibi-Roten betrachten«, hatte Matt gestichelt.
»Sicher. Und mir ist ebenso klar, warum sie dich nicht gefragt haben – du läufst schon seit Jahren in rotweißblauem Einerlei herum.«
Aber die Möglichkeit, sich durch Seminare für übereifrige oder gelangweilte Studenten eine weitere Einkommensquelle zu verschaffen, gab es auch anderswo, und Cambridge war sehr teuer. Nein, die Entscheidung für Harvard hatte weniger mit Logik als mit einem Gefühlswirrwarr zu tun, das er selbst kaum überblicken konnte.
Die Schönheit von Boston, dem kühlen, eleganten Boston, traf ihn jedes Mal, wenn er mit der U-Bahn aus Cambridge kommend den Charles überquerte. Eine koloniale Eloge in rotem Ziegel und Backsteinpflaster, die sich harmonisch mit der Moderne aus Glas und Metall verband. Während seiner ärmlichen Kindheit in Louisiana hatte er von solchen Städten geträumt, während er Onkel Owen ein weiteres Mal half, die Bodendielen aufzureißen und neu zu legen, weil die Feuchtigkeit, die Würmer und die Insekten sie zerfressen hatten. Boston brachte es fertig, im Vergleich sogar Washington wie einen Emporkömmling wirken zu lassen, und das war ihm nach seinem vergifteten Abschied von der Hauptstadt sehr bewusst und sehr willkommen.
Ein wenig Aberglaube war auch dabei. Boston hatte ihm Glück gebracht. In Boston hatte er einen der wichtigsten Zeugen für das Buch aufgestöbert, das ihn und Matt berühmt gemacht hatte. Für Neil, der in einem Landstrich aufgewachsen war, in dem der Glaube an das Übernatürliche so fest verankert war wie die Angewohnheit, auf alles Lästige zu schießen, war es nie möglich gewesen, nicht automatisch nach guten und schlechten Vorzeichen zu urteilen, ganz gleich, wie oft er sich selbst darüber lustig machte.
Boston bot ihm schlicht und einfach eine Zuflucht. Weniger Boston selbst als Harvard, eine akademische, elitäre Welt für sich, in der Skepsis gegenüber der jeweiligen Regierungspolitik nicht gleich als unpatriotisch verschrien, sondern eine gepflegte Tradition war. Nach dem pausenlosen Schwall an Feindseligkeit in Talkshows, bei Signierstunden und in bösartigen Leserbriefen, die ihm sein Verlag weitergeleitet hatte, lockte die Aussicht auf so eine Umgebung sehr.
Umso mehr, er gestand es sich ungern ein, weil Deirdre für ihr Leben gerne in Harvard studiert hätte. Es war ihr nicht möglich gewesen, und da sie ihm mehr als einmal erzählt hatte, wie sie seinerzeit vergeblich und unter Tränen auf eine Zusage gewartet hatte, wusste er genau, dass dieser unerfüllte Traum für sie ein wunder Punkt war. So schäbig und rachsüchtig er sich dabei fühlte, er konnte die dunkle Befriedigung bei der Vorstellung nie ganz unterdrücken, dass sie jedes Mal, wenn sie die Kinder zu ihm nach Cambridge schickte, an diese Niederlage denken musste.
Nimm dich zusammen, LaHaye, dachte Neil abgestoßen, als ihm bewusst wurde, dass er sich schon wieder dem Selbstmitleid näherte. The show must go on. Wie Deirdre richtig bemerkt hatte, waren seit der Scheidung bereits zwei Jahre vergangen. Es gab geschiedene Paare, für die eine Trennung wesentlich schlimmere Folgen hatte; er und Deirdre bekriegten sich weder um Zahlungen noch um die Tage, die Julie und Ben bei ihm verbrachten. Aber ihre Scheidung hatte auch nichts mit Geld zu tun gehabt. Es war ein Beruf gewesen, der den Ausschlag gegeben hatte, doch nicht seiner.
Deirdre arbeitete für einen Senator, der sich zum Ziel gesetzt hatte, irgendwann Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Ihr Senator schätzte sie, aus gutem Grund. Deirdre konnte einem auf Anhieb das College, den Geburtstag und den Hochzeitstag jedes wichtigen Mitglieds der Regierung und der Opposition nennen, sie wusste, wo man sich sehen lassen konnte und welche Orte ein auf sein Image bedachter Politiker lieber meiden sollte. Sie brachte es sehr schnell fertig, die häufig wechselnden Lobbyisten nach Ohrenbläsern und Könnern zu unterscheiden. Durch ihre Ehe mit Neil kannte sie die in Washington ansässige Presse gut genug, um sie, falls nötig, um den Finger zu wickeln.
Ja, Senator Cunningham schätzte Deirdre sehr, aber er hatte unmissverständlich klargemacht, dass die zukünftige Leiterin seines Wahlkampfteams unmöglich mit einem Mann verheiratet sein konnte, der, wie der Senator sich ausdrückte, »in einer Zeit, in der Amerika Einigkeit und Stärke beweisen muss, seinen Dolch in Amerikas Rücken stößt.«
»Warum kannst du nicht einmal«, sagte Deirdre in seiner Erinnerung, erschöpft und verbittert, »an mich und die Kinder denken. Ich meine, es gibt Dutzende von Themen, über die du schreiben könntest. Gerade jetzt. Warum schreibst du nicht über tapfere Feuerwehrleute, die ihr Leben gegeben haben, um andere zu retten? Du könntest über Passagiere in den Flugzeugen schreiben, die von den Terroristen entführt wurden. Du meine Güte, weißt du nicht mehr, wie wir damals die Passagierlisten durchgegangen sind und Angst hatten, einer unserer Freunde könnte dabei sein? Aber nein, du schreibst stattdessen über einen dreckigen Haufen Barbaren auf Kuba, die für meinen Geschmack in diesem Lager noch viel zu gut behandelt werden.«
»Weißt du, wie du dich anhörst? Diese Wahlkampfrhetorik höre ich morgens, mittags und abends in den Nachrichten, ich brauche das nicht auch noch daheim.«
»Vielleicht solltest du dir dann ein anderes Zuhause suchen«, gab Deirdre hart zurück und besiegelte damit das Schicksal ihrer Ehe.
Es fehlte sonst nichts in seiner Wohnung. Neil fragte sich, ob er Anzeige erstatten sollte. Er konnte sich nicht dazu aufraffen. Im Grunde würde es mehr schaden als nutzen. Was der Dekan der Fakultät sagen würde, ließ sich denken, wenn er in der Zeitung las, der umstrittene Autor N. L., derzeit Dozent in Harvard, habe eine Nacht mit einer Professionellen verbracht, von der er noch nicht einmal den Namen wusste, und sei nur in der Lage gewesen, der Polizei eine Tätowierung auf ihrem Hintern zu beschreiben, nachdem sie ihn ausgeraubt hatte.
Immerhin, es würde ein paar Tage dauern, bis ihm wieder Kreditkarten zur Verfügung standen. Bargeld hatte er auch keines. Er machte sich einen Kaffee und trank ihn schwarz, was sonst nicht seine Art war. Das bittere Koffein vertrieb den Rest des faden Geschmacks in seinem Mund, und er begann mehr und mehr, sich wie ein Idiot zu fühlen. Frustriert beschloss er, Tony Blixton anzupumpen, das Mitglied der anglistischen Fakultät, mit dem er sich noch am besten verstand. Tonys Büro lag nicht weit entfernt, in der Hilliard Street.
»Du meine Güte, Neil«, sagte er, als Neil die ganze Geschichte erzählt hatte, »klar helfe ich dir mit Geld aus, aber ganz ehrlich, wir haben doch nicht mehr die Siebziger. Was ist, wenn sie nun AIDS hat?«
»Dann sterbe ich als verkanntes Genie, und du kannst meinen Nachruf schreiben«, entgegnete Neil und bereute es sofort, als Tony das Gesicht verzog. »Tut mir Leid. Mir ist auch nicht wohl bei der Sache.«
Tony wurde von seinen Studenten allgemein »der Totengräber« genannt, weil die Aufgabe, Nachrufe auf verstorbene Fakultätsmitglieder für die Universitätspublikationen und die Presse zu verfassen, unweigerlich an ihm hängen blieb. Warum das so war, wusste niemand, doch Neil argwöhnte, dass Tony auf diese Weise einen versteckten, verkümmerten literarischen Ehrgeiz befriedigte. Nachrufe bekrittelte niemand.
Mit ausreichend Geld und Ratschlägen versehen, auf die er hätte verzichten können, nahm Neil die Red Line in die Innenstadt. Die morgendliche Stoßzeit war lange vorüber, also gab es statt der üblichen Studenten nur Touristen und die Anzeigen in der U-Bahn zu betrachten.
Er stieg früher aus, als er ursprünglich geplant hatte, an der Park Street, und wanderte durch die Altstadt von Boston hinunter bis Faneuil Hall. Wer auch immer die Idee gehabt hatte, aus den drei verfallenen Hallen ein Zentrum für kulinarische Schnellgenüsse zu machen, verdiente Neils Meinung nach einen Orden. Das dichte Gewebe aus Gerüchen und Jazzmusik, das ihn hier empfing, heiterte ihn jedes Mal auf.
»Aber Dad«, hatte Ben bei seinem letzten Besuch genörgelt, »warum können wir denn nicht zu McDonald’s gehen? Das ist doch gleich da drüben.«
»Weil du hier in Boston bist, mein Sohn. Iss frisch gefangenen Fisch. Iss chinesische Nudeln, die vor deinen Augen gekocht werden, und keinen Mist aus der Gefriertruhe. Iss meinetwegen auch Pizza, egal, wie lange wir uns dafür anstellen müssen. Aber an den goldenen Zitzen Amerikas kannst du anderswo saugen.«
»Dad, du spinnst«, war ihm Bens Schwester Julie ins Wort gefallen. »Und ich bin mir sicher, dass Mom dir nicht erlaubt, vor Ben Zitzen zu sagen. Vor mir natürlich auch nicht.«
»Zitzen ist ein absolut kinderfreier Ausdruck, nicht zu verwechseln mit …«
Bei seinem verunglückten Versuch, vor seinen Kindern den coolen Vater abzugeben, war er jäh unterbrochen worden, als er einen Stoß an der Schulter erhielt.
»He, Mister«, hatte eine fette Frau gerufen, die Platz für drei Personen beanspruchte, einen Teller mit Austern in der Hand hielt und ihn empört anstarrte. »Passen Sie doch auf, wenn Sie einfach so stehen bleiben. Mir wär fast was runtergefallen.«
Dann waren ihre Augen zu Ben und Julie gewandert, und sie hatte missbilligend mit der Zunge geschnalzt. »Sind das Ihre? Die sind viel zu dünn; die Kinder heutzutage kriegen ja nichts Gescheites mehr zu essen.«
Angesichts von Julies gekränkter und Bens verwirrter Miene hatte Neil nicht widerstehen können und erwidert: »Tja, das muss daran liegen, dass für sie nichts mehr übrig ist, weil die Erwachsenen schon alles weggegessen haben.«
Das Gelächter der Kinder war die Sache wert gewesen. Doch er dachte sofort an seinen Vater und wie er in ihrem Alter mit dessen endlosen Baseball-Geschichten gequält worden war, wenn er ihn besuchen musste.
Neil kaufte sich mit Tonys Geld etwas frisch gebratenen Fang des Tages und setzte sich dann auf eine der grünen Bänke, um die Leute zu beobachten und den Musikern zuzuhören. Heute war kein Jazz an der Reihe; stattdessen mühte sich ein Junge, den Neil mit einem Blick als einen Studenten mit nicht genügend Studiengeld einordnete, redlich an Who wants to live forever ab, mit einer Gitarre, die er eher schlecht als recht meisterte.
Wider Willen musste Neil an Tonys »Wir haben doch nicht mehr die Siebziger« denken. Tony hatte Recht. In den Siebzigern war er der hungrige Jugendliche gewesen, hungrig nach Wahrheit, Gerechtigkeit, und begierig danach, es allen zu zeigen. Hungrig, um der Wahrheit die Ehre zu geben, nach Erfolg und Bewunderung. In den Siebzigern hätte ein Mädchen, das ihn bestahl, ihn entweder dazu gebracht, ihr nachzustellen und sich sein Geld wiederzuholen, oder dazu, einen flammenden Artikel über soziale Ungerechtigkeit zu schreiben. Vermutlich zu beidem.
Aber sie hatte wirklich einen schönen Hintern gehabt.
»Who wants to live forever, who dares to love forever«, schmetterte der Junge und klang weniger wie Freddy Mercury als wie ein verirrter Chorsänger. »Forever is hard to live, if love must die.«
Kaum hatte er an Queen gedacht, da meldete sich Tonys Stimme schon wieder. »Was ist, wenn sie AIDS hat?« Neil zog eine Grimasse. Für ihn bedeutete Krankheit in erster Linie Krebs, den Krebs, an dem er seine Eltern hatte sterben sehen. Krankheit bedeutete ausgefallene Zähne bei einer knapp dreißigjährigen Frau, die Notwendigkeit, eine Perücke zu tragen, zitternde Hände und seine eigene kindliche Stimme, die ihr vorlas, weil seine Mutter am Ende nicht mehr lesen konnte. Als Neil alt genug war, um den Zusammenhang zu den Atomtests zu verstehen, die im Heimatstaat seines Vaters stattgefunden hatten, ehe seine Mutter ihren Mann verließ, hatte er sich nie auch nur flüchtig gefragt, wie viel Strahlung er selbst abbekommen hatte, ob er den Krebs in sich trug. Er wusste, dass er gesund war. Zum Erstaunen aller Ärzte war ihm alles, selbst die üblichen Kinderkrankheiten wie Röteln oder Masern erspart geblieben, sogar, als sämtliche Cousins und Cousinen, mit denen er aufwuchs, rotfleckig und fiebrig im Bett lagen. Krankheit bei anderen war ihm dagegen vertraut, und mit dem langen, langen Tod lebte er Wange an Wange, bis seine Mutter schließlich brüllend vor Schmerz starb. Um sich selbst hatte Neil sich nie Sorgen machen müssen oder wollen.
Die jährlichen Pflichtbesuche bei seinem Vater waren niederdrückend gewesen, aber auf andere Weise. Wenn sein Vater nicht gerade das Schuldbewusstsein darüber ertränkte, dass er mit seiner Frau unbedingt Atomexplosionen beobachten musste wie eine Attraktion in einem Vergnügungspark, versuchte er Neil zu dem Sport-Ass zu machen, das er selbst nie gewesen war. All das trug dazu bei, in Neil die Furcht zu wecken, eines Tages als Versager zu enden, aber nicht, jung zu sterben.
Vielleicht, überlegte Neil, während er in Gedanken das Gitarrenspiel des Jungen durch das Original von Queen ersetzte, war es die Jugend gewesen, die ihn immer vor den Gedanken an den Tod beschützt hatte. Wer jung ist, lebt für immer.
Who wants to live forever?
»Dämliche Frage, was?«, sagte jemand neben ihm, und Neil stellte fest, dass sich ein Mann in einem abgeriebenen grünen Anorak zu ihm gesetzt hatte.
»’ne kleine Spende, Bruder? Dann lebe ich zumindest bis übermorgen. Wenn schon nicht für immer.«
Die braune Hand, die sich ihm entgegenstreckte, war ausgemergelt und zitterte. Neil schaute hoch und blickte in das Gesicht eines alten Mannes, der vom Leben längst aufgesaugt, ausgespien und zerstört worden war. Wieder tauchte das Bild seines Vaters vor ihm auf. Der Mann, der ihn gerade angebettelt hatte, roch nicht nach Alkohol, doch die zitternden Finger mit ihren fleckigen Spitzen kamen nicht vom Alter. Drogen vielleicht. Neil unterdrückte ein weiteres Mal den Wunsch nach einer Zigarette.
»Tut mir Leid, Bruder«, entgegnete er. »Zurzeit lebe ich selbst auf Pump.«
Der Alte schnaubte ungläubig und machte Anstalten, sich von der Bank zu erheben, als er plötzlich innehielt.
»Neil?«, fragte er zögernd. »Neil LaHaye?«
Das war’s dann, dachte Neil. Offenbar lesen auch drogensüchtige Bettler Bücher. Er wollte gerade aufstehen, als der andere fortfuhr.
»Mensch, Neil, ich bin’s. Ted. Ted Sandiman.«
Das Schlimmste war, dass er sich wirklich nicht lange den Kopf zerbrechen musste. Ted Sandiman hatte nie zu seinen Freunden oder Feinden gehört; in der Zeit, in der Neil seine restlichen Schuldgefühle wegen seines damals verstorbenen Vaters beschwichtigte und im College bis zum Umfallen Baseball trainierte, war Ted mit ganzem Herzen Athlet gewesen, der es nur dank seines Sporttalents in das gleiche College geschafft hatte. Die Rivalität zwischen ihnen hatte so lange bestanden, bis Neils Schuldgefühle in der Hitze gewonnener Spiele verschwunden waren, und war ohne persönliche Feindseligkeit gewesen. Dazu war Ted Sandiman schlicht und einfach zu nett. Ein Junge aus Iowa, mit einem offenen Lächeln für jedermann, nicht dumm, nicht klug, ein begnadeter Sportler, dem jeder eine große Zukunft und ein Alter mit Wohlstand im Kreise einer großen Familie prophezeite.
»Mindestens vier Kinder«, war seine Devise, zu einem Zeitpunkt, an dem das Motto der anderen lautete: »Möglichst viel Sex«. Ted Sandiman, freundlich genug, um auch nach einem Homerun noch daran zu denken, dem Pitcher ein paar nette Worte zu sagen.
»Ted?«, wiederholte Neil, zu frappiert, um sich eine angemessenere Begrüßung einfallen zu lassen. Er versuchte vergeblich, den Jungen aus den College-Zeiten in Einklang mit dem Wrack neben sich zu bringen. »Was … was machst du in Boston?«
»Sterben«, sagte der andere unverblümt. »Wonach sieht’s denn sonst aus?« Er sackte in sich zusammen. »Jetzt aber ernsthaft, Neil – du hast keine Mäuse? Ich brauche …«
Seine Finger zitterten etwas heftiger.
»Ernsthaft, Ted«, entgegnete Neil und bemühte sich um Normalität in seinem Tonfall, »wirklich nicht. Mir hat in der Nacht eine Blondine mein ganzes Geld geklaut, und es wird dauern, bis Ersatz da ist. Aber wenn du willst, lade ich dich mit dem, was mein Kollege mir geliehen hat, zum Essen ein.«
Ted räusperte sich. »An Essen hab ich eigentlich nicht gedacht.«
Neil beschloss, das Normalitätsspiel sein zu lassen.
»Hör mal, ich will hier nicht den Heuchler spielen und dir Predigten halten«, sagte er. »Wir machen uns alle auf unsere eigene Art fertig. Aber was auch immer es bei dir ist, H, Ecstasy, Crack – ich habe keine Lust, dir den Selbstmord zu finanzieren.«
Zu seiner Überraschung brach Ted in Gelächter aus, das rasch zu einem heiseren, trockenen Husten wurde.
»Und das von jemandem, der mal einen Pro-Sterbehilfe-Artikel geschrieben hat«, erwiderte der ehemals beliebteste Baseball-Spieler der College-Mannschaft, als er wieder zu Atem kam. »Siehst du, ich habe einiges von deinem Zeug gelesen. Nicht schlecht, aber für mich spielt es keine Rolle mehr, Neil. Hat keine Rolle mehr gespielt, seit sie mir den Bescheid gegeben haben.«
»Krebs?«, fragte Neil automatisch.
»AIDS, Mann. Und jetzt erzähl mir, wieso nicht das große H den Wettkampf mit dem großen A in meiner Schrottmühle von einem Körper gewinnen soll.«
Nur ein Zufall, sagte sich Neil, als er wieder in seiner Wohnung saß und seine nächste Vorlesung vorbereitete. Nichts als ein Zufall. Tragisch, die Sache mit Ted, aber nirgendwo stand geschrieben, dass ehemalige Kameraden aus College-Tagen, die einmal grenzenlosen Optimismus verkörpert hatten, von tödlichen Krankheiten verschont blieben.
Wann hatte die Sorge um AIDS eigentlich angefangen, schlichtweg jeden zu erfassen? Für ihn waren es nicht die Statistiken gewesen, auch nicht der plötzliche Tod von Deirdres Vorgängerin bei Senator Cunningham, sondern die sich später bewahrheiteten Gerüchte um Freddie Mercury, die AIDS von einer weiteren erschreckenden Nachricht zu einer aufrüttelnden Wirklichkeit machten. So ungerecht und oberflächlich, dachte Neil, aber wenn das Idol deiner Jugend stirbt, auch wenn du ihm nie begegnet bist, trifft dich das tief, tiefer als der Tod einer Bekannten, über die sich deine Frau in regelmäßigen Abständen beim Abendessen beschwert hat, bis ins Herz trifft es dich.
Selbst der allgegenwärtige Terror der Gegenwart, die Furcht, durch Bomben, Milzbrand, Pocken oder durch eine andere heimtückische Waffe zu sterben, die von Terroristengruppen eingesetzt wurde, hatte die tief sitzende Angst vor AIDS nicht ersetzt. Acquired Immune Deficiency Syndrome. Die Syphilis des 21. Jahrhunderts. Und nun Ted, wie ein lebendiges Gespenst, so kurz nach Tonys Bemerkung. Zufall. Nichts als ein widerwärtiger Zufall.
Er rief Ginny an und erkundigte sich, ob sie sich an den Namen der Frau erinnerte, die er gestern Abend bei ihr an der Bar kennen gelernt hatte.
»Der blonde Lopez-Verschnitt?« Ginny schnalzte missbilligend mit der Zunge. »Neil, lass die Finger von der. So, wie du gestern Abend drauf warst, hast du das wahrscheinlich nicht gemerkt, aber die ist rumgekommen, wenn du verstehst, was ich meine, und nicht zu knapp.«
»Na ja, dass sie aus dem Kloster kam, habe ich auch nicht gedacht«, gab er zurück und versuchte seine aufsteigende Panik zu ignorieren, »aber ich würde schon gern wissen, wo sie steckt. Sagen wir mal so, sie hat da ein paar Sachen eingesteckt, die ihr nicht gehören.«
»Tut mir Leid für dich«, erwiderte Ginny amüsiert. »Sie war so ein-, zweimal da, immer allein zuerst, aber nicht sehr lange.«
»Aber du musst sie doch irgendwie angesprochen haben?«
»Tja, ich glaube nicht, dass sie unter ›Baby‹ oder ›Honey‹ im Telefonbuch steht. Hör mal, Neil, ich rufe dich an, falls sie noch mal hier aufkreuzt, aber wenn du mich fragst, die haben wir hier zum letzten Mal gesehen.«
Mit einem Mal kehrte eine Erinnerung an die Nacht zurück; das blonde Mädchen, die Regentropfen, die von ihrem durchnässten Haar in den tiefen Ausschnitt ihres Pullovers rannen. Der bittere Geschmack ihrer Lippen und die erfahrenen, zu erfahrenen Hände.
Aber ihr Name fiel ihm immer noch nicht ein.
Nachdem er aufgelegt hatte, horchte Neil in sich hinein, kämpfte mit der Vorstellung, die Unbekannte von gestern könnte ihn mit AIDS angesteckt haben. Es war ein Gefühl in der Magengrube wie die Flügelschläge des Vogels, der sich einmal in Onkel Owens Netzen verfangen hatte. In gewisser Weise beruhigte ihn das. Er war noch lange nicht bereit, Tony seinen Nachruf schreiben zu lassen. Nicht, dass Tony je die Chance bekommen würde. Wenn überhaupt etwas, dann war es das Wahrscheinlichste, dass Miss Tattoo ihm einen Tripper angehängt hatte, was zwar Ärger bedeuten würde, aber nicht weiter tragisch war. Auf jeden Fall war ein Besuch beim Arzt angesagt.
Seine Arbeit half ihm, sich abzulenken; er konnte sich einige Stunden auf die Zusammenhänge von Satire und Zivilisationsekel im politischen Roman konzentrieren. Aber als er am Nachmittag spazieren ging, kehrte das Gespenst zurück wie ein Ball, den man mühsam unter der Wasseroberfläche gehalten hatte.
Wenn Cambridge mit etwas reichlich gesegnet war, dann mit Buchhandlungen und Bibliotheken. Er musste sich informieren. Wenn schon aus keinem anderen Grund als sich das ruinierte Wrack im grünen Anorak, zu dem Ted Sandiman geworden war, irgendwie zu erklären.
Beim Betreten der dreistöckigen Filiale von Millennium wurde er peinlich daran erinnert, dass er in dieser Umgebung alles andere als anonym war. Schon kurz hinter dem Eingang passte ihn eine seiner Studentinnen ab.
»Hey, Dr. LaHaye«, sagte sie fröhlich, und Neil, der bereits mehr als einmal klargestellt hatte, dass er keinen Doktortitel führte, machte sich nicht mehr die Mühe, sie zu korrigieren.
»Wegen meiner Seminararbeit … also, ich hab’s mir überlegt. Mein alter Herr bringt mich um, wenn ich dieses Semester nicht schaffe, aber ich brauch schon ein paar Monate, um mich durch so eine Wahnsinnsbibliographie zu arbeiten, also dachte ich …«
Er hörte nur mit halbem Ohr hin und erinnerte sich wieder, warum er am Morgen Tony und niemand anderen aufgesucht hatte. Tony verfügte über eine unschätzbare Eigenschaft in dem kleinen, in sich geschlossenen Treibhaus, das Harvard darstellte; er war diskret und behielt Dinge für sich, wenn man ihn darum bat.
Als ihn auch noch das Mädchen am Informationsstand mit Namen begrüßte, beschloss Neil, auf den Erwerb von Büchern zum Thema AIDS in Harvard zu verzichten. Ohnehin ein lächerlicher Impuls. Aber Ted, dachte er. Ted war ein lebender Mensch, eine Realität, keine Hypothese.
Ted wiederzufinden, erwies sich als nicht so einfach. In der Dämmerung, die sich am Spätnachmittag allmählich über die Stadt herabsenkte, schien das winterliche Boston ihn verschluckt zu haben. Neil lief zwischen den alten Markthallen mit ihren griechischen Säulen und den immer hungrigen Besuchern hin und her und konnte ihn nicht mehr entdecken. Nun, vielleicht versuchte Ted inzwischen sein Glück an einem der Touristenorte. Bei Obdachlosenasylen oder Krankenhäusern anzurufen, wäre auch eine Möglichkeit. Aber so schwach, wie er heute Morgen schien, konnte Ted nicht weit entfernt sein; der Mann hatte nicht mehr die Kraft für längere Strecken.
Neil ließ Faneuil Hall und die Hafengegend hinter sich und machte sich auf den Weg hügelaufwärts. Bei Bostons historischen Stätten mit ihren Touristengruppen fiel für Bettler das meiste ab, und irgendwo entlang des rot markierten Unabhängigkeitspfads würde er Ted auftreiben.
Die Menschen, die sich in der Kälte dichter zusammenscharten und durch die alten Straßen drängten, hoben sich mit ihren braunen, gelben und blauen Mänteln wie farbige Tupfer vor den eleganten Torbögen aus blassem Sandstein ab und den Ziegelfassaden, deren Rot von der Zeit zu einer selbstverständlichen Zurückhaltung abgeschliffen worden war. Sie lachten und schwatzten miteinander, und Neil wurde einmal mehr bewusst, warum er an Boston hing. Es war keine Museumsstadt, durch die man sich nur flüsternd und unbehaglich bewegte, und auch kein Disneyland an der Ostküste. Es war Amerika, Amerikas Vergangenheit und seine Gegenwart. Das Amerika, das als erstes Nein zu einer überholten europäischen Ordnung gesagt hatte, und das Amerika, das nicht davor scheute, die Schönheit der Vergangenheit anzuerkennen und etwas Neues aus ihr zu machen. Es war das Amerika, in dem auch die ständige Furcht vor neuen Attentaten keine leer gefegten Straßen und duckmäuserische Zurückgezogenheit erreichen konnte, weil sich seine Bevölkerung nicht in ein fremdes Korsett zwängen ließ. Das war das Amerika, an das er glaubte und für das er schrieb.
Er fand Ted auf dem kleinen Friedhof zwischen dem Public Garden und der King’s Church, zwischen den Grabsteinen zweier Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, in der einen Hand eine der kleinen Flaggen, wie sie hier überall herumstanden, die andere vor sich ausgestreckt.
Er schaute auf und erkannte ihn. »Hey, Neil«, sagte er müde. »Nett von dir, dass du vorbeischaust.« Seine Stimme kratzte, als besäße er nicht mehr die Kraft, sie aus der Kehle zu pressen. Neil hatte nicht gewusst, was er eigentlich von Ted wollte, aber in diesem Moment verfestigte sich eine unbestimmte Vorstellung zu einem Entschluss.
»Hey, Ted«, erwiderte er. »Meine Einladung gilt noch. Wie wär’s mit einem Essen zu Ehren der College-Liga von 1985?«
»Bin nicht sehr hungrig«, murmelte Ted, »das hab ich dir doch schon erklärt.«
»Okay, dann vergiss das mit dem Essen. Wie wär’s, wenn du für eine Weile bei mir einziehst?«
Ted blinzelte. »Ist das ’n Witz?«
»Nein«, gab Neil zurück. Einen drogensüchtigen AIDS-Kranken bei sich einzuquartieren, war sicherlich nicht das Verhalten, das von Dozenten der Fakultät erwartet wurde. Aber die Vorstellung, sein Gespenst aus der Vergangenheit wie Müll den Straßen von Boston zu überlassen, konnte er nicht ertragen.
»Warum willst du so was tun?«, fragte Ted, nicht ablehnend, aufgebracht oder erzürnt, sondern aufrichtig verwundert. »Ich meine, klar, ich hab versucht, dich anzupumpen, aber du weißt genauso gut wie ich, dass wir nie die dicksten Freunde auf dem College waren.«
Der alte Neuengland-Friedhof mit seinen grauen Grabsteinen, die mit Skeletten verziert waren, war für ein solches Gespräch nicht der richtige Ort. Aber gab es den überhaupt?
»Vielleicht, weil du mir einen Gefallen damit tust«, sagte Neil. »Ich bin geschieden und kann mich an das Alleinsein immer noch nicht gewöhnen.«
Es war ebenso sehr Lüge wie Wahrheit. Wieder sah er den jungen, vor Kraft strotzenden Ted Sandiman vor sich, den begnadeten Spieler seiner College-Zeit, das weite Leben, das noch auf sie alle wartete. Voll Hoffnung auf seine Zukunft, gutmütig, ohne den Groll, der Neil bereits damals angetrieben hatte. Der Ted der Gegenwart, mit einer schrumpligen, fahlen Haut, mit zitternden Händen und tief eingefallenen Augen, musterte ihn und stand mit einiger Mühe auf.
»Warum nicht«, sagte er schließlich achselzuckend.
»Eine Zeit lang hab ich alles mitgemacht«, erzählte Ted, als sie später in Neils Wohnung saßen. Er aß von den Orangen, die Neil gekauft hatte; ein warmes Essen lehnte er nach wie vor ab. »Tabletten, in der richtigen Reihenfolge, zur richtigen Uhrzeit. War verdammt teuer. Geändert hat es letztendlich nichts. Nicht wirklich. Im Gegenteil, dadurch hat’s meine Familie gemerkt.«
Neil wollte nach der Familie fragen, unterdrückte das jedoch. Später vielleicht.
»Wodurch hast du’s entdeckt?«
»Wenn deine Zunge und deine Backen auf einmal bläuliche Flecken haben, dann geht man besser zum Arzt«, entgegnete Ted trocken. Er sog eine weitere Orangenscheibe in sich hinein und lutschte an ihr, als handle es sich um einen Bonbon. Seine Stimme war kaum verständlich, als er fortfuhr:
»Mit der Karriere war’s sofort vorbei. Keiner geht mit einem Infizierten in einen Duschraum. Im Spiel wird man nicht mehr aufgestellt.« Mit einem Seitenblick auf Neil fügte er hinzu: »Du hast wohl auch zwei Duschen hier, wie?«
»Nein, ehrlich gesagt.«
Das riss Ted aus seiner Lethargie.
»Hast du keine Angst?«, fragte er verblüfft.
Neil meinte sich dunkel zu erinnern, dass man sich nicht durch öffentliche Toiletten oder Händeschütteln infizieren konnte, aber Duschen? Unwillkürlich runzelte er die Stirn.
»Du hast gar nicht über die praktische Seite nachgedacht, stimmt’s?«, fuhr Ted fort, und ein schwaches Lächeln glitt über sein Gesicht. »Mann, du hast dich seit dem College nicht verändert.«
Es klang nicht anklagend, sondern nostalgisch. »Deswegen nehm ich dir auch ab, dass dich eine Bordsteinschwalbe beklaut hat. Das ist der alte Neil. Erst einem aus der Patsche helfen und dann merken, dass die Hand mit Teer bekleckert ist.«
Unwillkürlich fiel Neils Blick auf Teds ausgedörrte Finger, die zitterten, als er nach einer weiteren Orangenscheibe griff. Er fragte sich, ob es an der Krankheit oder den Drogen lag. Ted roch nach altem Schweiß, altem Schnaps und jener unnennbaren Ausdünstung, die regelmäßige Medikamenteinnahmen hinterließen und die Neil aus seiner Kindheit nur allzu vertraut war. Wenn er die Augen schloss, konnte er seine Mutter sehen, wie sie sich die Hände wusch, wieder und wieder, als wollte sie die Krankheit mit fortwaschen.
Seine Cousins, die noch zu klein waren, um zu begreifen, dass Krebs nicht ansteckte, hatten sich geweigert, Süßigkeiten anzunehmen, die seine Mutter ihnen anbot.
»Das ist die schmeichelhafte Interpretation«, gab Neil so gelassen wie möglich zurück. »Es gibt Leute, die sagen, dass ich ein Idiot bin, der zu gern den Gutmenschen spielt.«
»Vor allem, wenn du dabei noch einen Promi fertig machen kannst, den du auf dem Kieker hast«, ergänzte Ted. »Klar. Das auch. Aber bei mir gibt’s niemanden fertig zu machen und niemanden zu retten. Neil, du kannst auch schlicht und einfach nett sein, red nicht weiter drum herum.«
»Wenn wir schon bei Ehrlichkeiten sind – was genau ist passiert, Ted? Nicht die Infektion. Aber warum bist du nicht daheim bei deinen Leuten oder lässt dich anständig in einem Krankenhaus versorgen?«
An ein heiles Familienleben in allen Krisenfällen glaubte er natürlich nicht. Doch Ted Sandiman, der Familienmensch aus Iowa, als Bettler leuchtete Neil immer weniger ein, je länger er darüber nachdachte.
»Wie ich schon sagte«, entgegnete Ted nach einem kleinen Schweigen, »die Behandlung ist teuer.«
»Ted, du warst gut. Wirklich gut. Du musst doch etwas auf die Seite gelegt haben aus deiner Zeit als Profi, und außerdem hätte sich doch jeder Anwalt die Finger danach geleckt, dich zu vertreten, wenn sie dich wirklich wegen AIDS rausgeschmissen haben. Beliebter Sportler herzlos im Stich gelassen und so weiter.«
Teds Kopf sank zwischen seine Schultern, und irgendwie fühlte sich Neil an seinen Sohn Ben erinnert, Ben, wenn er etwas angestellt hatte. Plötzlich vermisste er seine Kinder und das mit einer Intensität, dass er aufstehen musste, um die Whiskeyflasche aus dem Kühlschrank zu holen. Als er zurückkehrte, in der einen Hand die Flasche, in der anderen zwei Gläser balancierend, murmelte Ted beinah unhörbar:
»Die haben mich nicht wegen HIV rausgeworfen, sondern wegen der Drogen.«
Schweigend schenkte Neil ihnen beiden ein und setzte sich wieder zu ihm. Ted griff nach dem Glas, ohne aufzuschauen.
»Deswegen bin ich auch weggegangen. Ich wollte nicht, dass Miriam den Absturz noch mitmachen muss. Miriam ist meine Frau. Sie hat sich so geschämt wegen der Drogen, und ich hatte ihr geschworen, clean zu werden. War ich auch, mehr als ein Jahr schon, bis dann der Test kam.«
Er schluckte. »Mann, sie hätte mich schon längst verlassen sollen. Aber sie hat zu mir gestanden. Wir hatten sogar ein Baby bekommen, wollten ganz von vorn anfangen. Das ist der letzte Grund. Ich will nicht, dass sich mein kleiner Junge an seinen Dad als AIDS-kranken Ex-Junkie erinnert, dass er mich so sterben sieht.«
Der Alkohol brannte in seinem Mund, als Neil den Kopf schüttelte.
»Also haust du einfach ab, nimmst wieder Drogen und stirbst im Schnellverfahren.«
»Was weißt du schon«, antwortete Ted für seine Verhältnisse heftig, griff nach der Flasche und schenkte sich nach.
»Meine Mutter hatte Krebs«, sagte Neil. »War nicht schön, das mitzuerleben, aber wenn sie mich stattdessen verlassen hätte, um irgendwo allein zu sterben, das wäre noch viel schlimmer gewesen.«
Abrupt hob Ted den Kopf. In den Augen glomm etwas.
»Und was ist mit deinem Vater?«, gab er zurück. »Ich kann mich erinnern, dass du einmal gesagt hast, er hätte dir einen Gefallen getan, wenn er früher abgekratzt wäre, wenn du ihn nie kennen gelernt hättest. Es war nach dem Spiel gegen Jenborough.«
Ein ebenso unerwarteter wie meisterhafter Hieb. Die Gewissheit, der gutmütige Ted würde solche kindischen Ausrutscher auf sich beruhen lassen, zerrann in Sekundenschnelle. Ted war nicht mehr der optimistische Junge aus dem College, sondern einsam, verbittert und todkrank.
»Schon möglich«, sagte Neil gedehnt und versuchte, nicht darüber zu spekulieren, was Julie und Ben einmal über ihren Vater zu ihren Schulkameraden sagen würden.
Ted sackte wieder in sich zusammen.
»Mann, Neil, tut mir Leid.«
Eine Zeit lang tranken sie schweigend.
»Okay«, sagte Neil schließlich. »Du willst deine Frau und dein Kind nicht belasten. Aber auch auf die Gefahr hin, dummes Zeug zu reden, wird die Behandlung nicht heutzutage von tausendundeiner staatlichen Behörde subventioniert? Oder haben sie das schon wieder abgeschafft?«
»Du kapierst es nicht. Ich will nicht mehr behandelt werden. Hab ich alles schon hinter mir. Meine Haut sah aus wie ein Büffelhintern, und jeder hat mich gleich als das erkannt, was ich bin. Da dachte ich mir, das kriege ich auch anders und angenehmer. Wenn ich sowieso sterben muss.«
Mit der linken Hand wies er auf Neil.
»Würdest du auch machen, wetten?«
Würde ich nicht, dachte Neil. Ich würde kämpfen. Aber er hielt es für sinnlos, das laut auszusprechen.
»Weißt du, was das Schlimmste ist?«, fragte Ted abrupt. »Wenn du das Zeug nicht nimmst, meine ich. Und ich rede jetzt nicht von Miriam und meinem kleinen Jungen und dass ich sie nicht mehr wiedersehen werde. Das ist mehr als übel – das ist unerträglich. Nein, ich meine, was das Schwerste ist, wenn du dich so durch die Tage schleppst.«
Durch das Fenster erkannte Neil, dass es wieder begonnen hatte zu schneien. Der Winter zog sich in diesem Jahr lange hin. Er fragte sich, wann endlich der Frühling in Boston eintreffen würde und ob er Ted mit seiner Einladung auch nur im Geringsten geholfen hatte.
»Klär mich auf.«
»Zwei Sachen. Die eine ist, dass ich Angst habe. Unlogisch, ich weiß. Aber ich bring’s einfach nicht fertig, mir absichtlich den goldenen Schuss zu setzen, und dann versuch ich für ein paar Tage, es ganz und gar sein zu lassen. Und dann kommt die Geilheit. Es ist verrückt, als ich noch in der Mannschaft war und es Groupies gab, so viel man wollte, da hab ich nur an Miriam gedacht. Und da war ich noch gesund. Aber jetzt, wo ich ein Wrack bin, schaue ich jeder Zicke hinterher, die an mir vorbeigeht, und will es mit ihr treiben. Bis ich wieder genügend Geld für eine Spritze habe. Dann ist die Geilheit weg, eine Zeit lang jedenfalls.«
Wenn sie so weitermachten, würden sie in dieser Spirale aus Grübeleien und fruchtlosem Bedauern versinken. Neil musste endlich das Thema wechseln, die guten Erinnerungen hervorkramen. Er zerbrach sich den Kopf, aber bis auf Sport fielen ihm keine Gemeinsamkeiten ein, und über Baseball zu reden, konnte Ted auch nur an seine kaputte Karriere erinnern. Die politische Lage war auch kein besseres Thema; mit Diskussionen über den Sinn und Unsinn des letzten Irak-Kriegs war Ted nicht geholfen, und mutmaßlich waren ihm solche Fragen mittlerweile auch gleichgültig, wenn sie ihn denn je beschäftigt hatten. Neil versuchte sich daran zu erinnern, ob Ted am College je Interesse für Politik bekundet hatte, aber er kam sich vor wie jemand, der verzweifelt verblichene Graffiti auf einer alten Wand zu entziffern versucht. Dann packte ihn eine Idee, deren Einfachheit ihn um ein Haar den Kopf schütteln ließ. Natürlich. Das hatten alle gemeinsam.
»Apropos Zicken«, bemerkte er, »hast du gehört, was aus Norma ›Für euch geb ich doch nicht den Cheerleader ab‹ Radcliffe geworden ist?«
Ted schüttelte den Kopf, aber an seinem Gesichtsausdruck ließ sich ablesen, dass er sich sehr wohl an die stolze Collegeschönheit erinnerte.
»Sie organisiert Schönheitswettbewerbe für Pudel in Palm Springs.«
»Du nimmst mich auf den Arm!«
»Nein, ich schwör’s dir. Tja, das erklärt natürlich einiges. Wir waren eben alle nicht ihr Typ.«
»Zu wenig Locken«, stimmte Ted zu und prustete. »Trotzdem«, fuhr er fort, »sie hätte toll im Cheerleader-Dress ausgesehen.«
»Frauen«, sagte Neil sinnierend. »Wie war eigentlich dein erstes Mal?«
An der Lampe, die seine Küche beleuchtete, musste eine der beiden Glühbirnen ausgewechselt werden, aber Neil war in den letzten Tagen zu faul gewesen, sich darum zu kümmern. Im Schein der verbliebenen Birne und bei Teds grauer Hautfarbe war es schwer erkennbar, doch es schien ihm, dass Ted errötete.
»Komm schon. Das weißt du garantiert noch. So was bleibt einem im Gedächtnis, ganz egal, wie mies man sich fühlt.«
Er hielt sein Glas in der Hand, ohne daraus zu trinken, und betrachtete die braungoldene Flüssigkeit.
Ted räusperte sich. »Du zuerst.«
»Hm. Rosie Dulac. Sie zog mich später damit auf, dass ich mich nur in sie verknallt hätte, weil sie das einzige Mädchen in der Nachbarschaft war, das garantiert nicht mit mir verwandt war. Da lag sie falsch. Zwei Jahre älter als ich und nichts als Kurven und Grübchen. Vierzehn Grübchen insgesamt. Ich habe sie alle gezählt. Rote Haare; einer von den Dulacs muss mal eine Irin geheiratet haben.«
»Bei mir war’s Betsy Triffest aus der Fünfunddreißigsten«, fiel Ted ein, der sein Zögern offenbar überwunden hatte. »Ein Hintern, auf dem man Nüsse knacken konnte.«
»Ted Sandiman, du überraschst mich. Wir dachten doch alle, du wärest die einzige männliche Jungfrau auf dem College.«
»Ich hab nur nicht so viel herumgeprahlt wie ihr anderen. Konnte ich auch nicht. Betsy war verheiratet, und ihr Typ trieb in unserer Gegend Schutzgelder ein.« Er grinste. »So hab ich Betsy überhaupt kennen gelernt. Meine Mom hat mich und meine kleine Schwester zu ihr geschickt, weil sie dachte, Betsy hat ein Herz für Kinder, die wird ihren Kerl vielleicht beschwatzen, bei unserer Imbissbude nicht ganz so gierig zu sein. Na ja, und Betsy, die hatte schon ein Herz, aber nicht nur für Kinder.«
»Rosie hatte da einen Trick«, sagte Neil, der merkte, wie Ted auftaute. »Sie nahm eine Kirsche mitsamt Kirschstängel in ihren Mund, und nach einer Weile schob sie den Stängel wieder hinaus. Mit einem Knoten.«
»Beim ersten Mal war ich froh, dass ich direkt vom Sportplatz kam und meinen Baseballschläger dabeihatte. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ihr Kerl aufkreuzt. Na ja – fast die ganze Zeit dachte ich daran. Okay, eigentlich nur die ersten Minuten.« Ted seufzte. »Mann, das waren gute Tage.«
Irgendwo zwischen immer handfesteren Beschreibungen und Whiskey ließ sich Ted überreden, etwas anderes als Orangen zu essen, und dabei zeigte sich, dass er einige seiner Zähne verloren hatte. Neil bestellte beim Pizzaservice, und als er den Eindruck hatte, dass Ted beim Schwärmen über seine Verflossenen der verlorenen Ehefrau gefährlich nahe kam, lenkte er das Gespräch auf die legendärsten Spiele ihrer College-Zeit.
»Wenn Ferguson damals nicht …«
»Weißt du noch, wie du den Ball von Cady …«
»Keine Frage, das wäre ein Homerun geworden, wenn …«
Die Pizza traf ein, und während Neil noch den würzigen Geschmack der Salami über dem warmen Käse genoss, entdeckte er, dass er einen Fehler gemacht hatte. Ted wurde übel, und er fing an zu würgen. Bald hing er über dem Toilettenrand und erbrach sich, obwohl er, soweit Neil erkennen konnte, kaum etwas Festes zu sich genommen hatte. Als er einen Lappen befeuchtete, um Ted das Gesicht abzuwischen, ergriff Ted seine Hand.
»Neil«, sagte er. »Ich … ich kann hier nicht bleiben.«
Dass Ted als Hausgast nicht die beste Idee war, die er je gehabt hatte, war Neil inzwischen schon klar geworden. Morgen würde er den größten Teil des Tages in den Universitätsgebäuden verbringen, und so ging es den ganzen Rest der Woche. Und es konnte sehr gut sein, dass sein alter Kamerad sich dann entschied, zu verschwinden und die Einrichtung um ein paar Gegenstände zu erleichtern.
»Wenn ich bleibe«, fuhr Ted fort, als könne er Gedanken lesen, »dann brauchst du bald noch mal neue Kreditkarten. Deswegen bin ich zuerst mitgekommen. Ich bin nicht der, den du kennst, Neil. Das bin ich schon lange nicht mehr. Der nette Ted, das war der andere mit dem gesunden Körper. Ist schon meine Schuld, das, was ich jetzt bin. Das weiß ich.«
Neil erwiderte nichts und löste schweigend Teds Griff von seiner Hand. Dann wischte er ihm das Gesicht ab, mit der ökonomischen Routine, die ihn die Pflege seiner Mutter gelehrt hatte.
»Ich möchte etwas haben«, stieß Ted hervor, »was ich mir nicht verderbe.«
»Was ist mit deiner Schwester?«, fragte Neil plötzlich.
»Una? Die ist verheiratet, und ihr Mann ist ein Dreckskerl.«
»Trotzdem«, sagte Neil. »Sie ist deine Schwester, Ted. Denk daran, was Robert Frost geschrieben hat: Zuhause ist der Ort, wo sie dich aufnehmen müssen, wann immer du aufkreuzt. Und dann wüsste deine Frau wenigstens, wo du bist. Hast du dir schon mal überlegt, dass die Ungewissheit jetzt für sie genauso schlimm ist wie das andere?«
Bis der Morgen anbrach, hatte er Ted, der sich geweigert hatte zu schlafen, sondern auf die Straße zurückwollte, so weit gebracht, sich auf den Weg nach Iowa zu machen. Er kaufte ihm die Fahrkarte für einen Greyhound und wartete, bis der Bus mit Ted darin abgefahren war. Teds Gesicht, hinter der matten Scheibe kaum zu erkennen, war nicht mehr das Zerrbild einer Vergangenheit; er sah sich selbst. Er fragte sich, ob die Jungen aus den College-Zeiten, die sie gewesen waren, einen von ihnen beiden erkannt hätten, wenn sie ihnen vorhin auf der Straße begegnet wären.
Auch in der folgenden Nacht konnte er nicht schlafen. Teds verbrauchte Stimme klang ihm im Ohr und, in noch verstörenderer Weise, die seines Vaters, der während Neils jährlichen Besuchen in Nevada früher oder später in ein »Aber woher hätte ich das über die Strahlen wissen sollen?« ausbrach, meistens gefolgt von einem »Schau mich nicht so an, Junge, sonst fährst du gleich wieder nach Louisiana zurück!«
Gegen Mitternacht beschloss er, einen alten Bekannten anzurufen, der ihn und Matt seinerzeit mit ein paar noch lebenden Strahlenopfern in Verbindung gebracht hatte. Kalifornien lag drei Stunden zurück, was auf eine akzeptable Uhrzeit für einen Anruf hinauslief.
Nach einigem höflichen Geplaudere erkundigte er sich nach dem Namen eines guten Virologen am MIT in Cambridge.
»Das ist nicht mein Fachgebiet, aber Hugh Beresford hat einen guten Ruf. Oder Ethan Giles, aber der ist nicht eben der Umgänglichste. Er wird zum Tier, wenn man ihn von seiner Arbeit abhält.«
Bei dem Namen Giles klingelte etwas bei ihm. Im letzten Semester gab es einen Studenten dieses Namens, ein nervöser Junge, der Literatur gewählt hatte, um sich nicht ständig mit seinem Vater in Naturwissenschaften vergleichen zu müssen. Neil gab nicht gerne Einzelunterricht, aber mit dem Druck, unter dem der Junge stand, konnte er sich identifizieren; mit einigen Nachhilfestunden war es ihm gelungen, Giles junior über die Runden und in das nächste Semester zu bringen.
»Könntest du Ethan Giles morgen anrufen«, fragte er den Kalifornier, »und klären, ob er mir eine Audienz gewährt? Ich rufe ihn auch an, aber ich hätte gern vorher etwas Schützenhilfe.«
»Geht in Ordnung.«
Nach dem Gespräch konnte er immer noch nicht einschlafen. Unruhig setzte er sich an seinen Computer und ging ins Internet. Zunächst versuchte er über Google etwas über Ted zu finden, doch vergeblich; Ted hatte es wohl auch vor seiner Krankheit nie bis in die großen Nationalligen geschafft. Oder er hatte einen anderen Namen benutzt, eine Möglichkeit, die Neil, der selbst seit Beginn des Colleges den Mädchennamen seiner Mutter führte, durchaus nicht ausschloss.
Den Rest der Nacht verbrachte er damit, sein Wissen über HIV auf einen neuen Stand zu bringen. Irgendwann landete er in einem Chatraum, der offenbar von Medizinern benutzt wurde. Er fühlte sich an seine Besuche in Ländern erinnert, von deren Sprache er nur ein paar wenige Ausdrücke beherrschte. Was er dort erfuhr, war nicht eben beruhigend.
<Oh, es gibt natürlich neue Medikamente>, antwortete ihm ein Chatteilnehmer unter dem Pseudonym Galen. <Aber um ehrlich zu sein, in den letzten fünf Jahren sind nur zwei wirkliche Verbesserungen bei neuen Wirkstoffen auf den Markt gekommen. Alle anderen Mittel waren Pseudoinnovationen – Kombinationen bekannter Substanzen, die nicht besser und möglicherweise sogar etwas gefährlicher sind als die vorherigen Formen.>
<Von den immer größeren Nebenwirkungen ganz zu schweigen>, fiel ein anderer ein. <Die sind zwischenzeitlich weltweit die vierthäufigste Todesursache. Im Fall AIDS liegt der Prozentsatz garantiert noch höher, aber du wirst mit Sicherheit keinen Arzt finden, der zugibt, sein Patient sei an der Behandlung gestorben.>
<Warum kommen die Ärzte damit durch?>
<Anwälte und Verbraucherschutzorganisationen sind weitaus erfolgreicher mit Sammelklagen gegen die Pharmaindustrie; bei einzelnen Ärzten lassen sich keine wirklich hohen Summen herausholen, die eine Spitzenanwaltskanzlei mobilisieren würden.>
<Aber wenn diese neuen Medikamente keine positiven Auswirkungen hätten, dann wären sie doch nicht auf dem Markt.>
<Kommt drauf an, von welchem Markt du sprichst>, gab Galen zurück. <Wenn ein Mensch in Afrika mit erhöhter Temperatur herumläuft, dann kann er Malaria, Tuberkulose, eine ganz normale Magen-Darm-Infektion oder eben AIDS haben. Behandelt man aber einen Malaria-Kranken mit AIDS-Mitteln, dann stirbt er. Andererseits ist aber Afrika ideal, um auf Risiko zu setzen und im Zweifelsfall auf AIDS zu behandeln, wenn man neue Medikamente ausprobieren will. Schließlich können sich die armen Hunde da unten nicht beklagen.>
Etwas erwachte in Neil, das nichts mehr mit ungeformten Befürchtungen über eine mögliche eigene Infektion zu tun hatte: Sein journalistischer Instinkt regte sich.