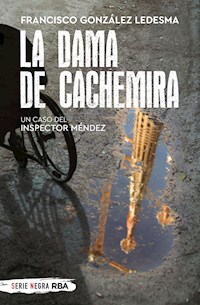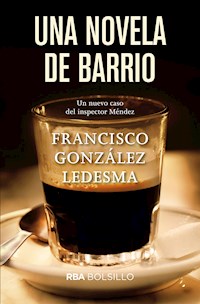9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der arme Paquito war eine wahrhaft gute Seele. Voller Mitleid für die Benachteiligten half er einem orientierungslosen Rollstuhlfahrer erst über die Straße, dann in ein abgelegenes Viertel, schließlich zum Straßenstrich. Dann war Paquito tot. Auch die alte Dame war nicht mehr am Leben, als der ehrgeizige Makler sie im wunderschönen Erkerzimmer ihrer abbruchreifen Stadtvilla fand. Ricardo Méndez ist mit ganzer Seele dabei, wenn die gebrochenen Herzen eine Spur des Todes hinterlassen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
1 Paquitos Tod
2 Das Haus der gotischen Vögel
3 Der Junge
4 Der letzte Widerstand
5 Der Andere
6 Die friedfertigen Erinnerungen von Señor Cid
7 Die Beucher
8 Méndez wird fündig
9 Die ganze Dunkelheit der Nacht
10 Die Welt der Hinterhofbalkone
11 Amores
12 Die Frau der Stille
13 Alles, was dir nie beschieden war, Esther
14 Ich trage jetzt einen Maulkorb, sagte Méndez
15 Ins Wasser geschrieben
16 Die aus Stunden gemachte Frau
FRANCISCO GONZÁLEZ LEDESMA
DIE RACHEDERTRÄUMERIN
KRIMINALROMAN
Aus dem Spanischen von Sabine Giersberg
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der spanischen Originalausgabe:»LA DAMA DE CACHAMIRA«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1986 by Francisco González Ledesma
Published by arrangement with UnderCover Literary Agents
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2011 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Kirsten Brandt, Offenbach
Umschlaggestaltung: Gisela Kullowatz
Umschlagmotiv: shutterstock/Tupungato
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-1030-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für María Rosa, die es nach all den Jahren immer noch versteht, sich die ersten Träume einer Braut zu bewahren
1 PAQUITOS TOD
Nun, Paquitos Tod kam mehr oder weniger überraschend, zumindest waren die Umstände außergewöhnlich. Mit dem Rollstuhl hatte alles angefangen, dem Fortbewegungsmittel für einen Behinderten, der eigentlich noch ganz gut in Form war; er hatte kräftige Arme und einen Stiernacken, nur die Beine versagten ihm den Dienst, gelobt sei der Herr, was soll man da machen. Der Rollstuhl stand nachts unter kahlen Bäumen im sanften Nieselregen auf dem einsamen Bürgersteig, inmitten der Gleichgültigkeit der Stadt. Verrammelte Balkone, leere Straßen, tote Uhren, die Welt einer vergangenen Zeit. Paquito sah den einsamen Bürgersteig und den reglosen Rollstuhl mit dem seltsamen Mann darin, der vielleicht von einer Welt träumte, die nach seinem Maß geschneidert war (die vierundzwanzig Minuten von Le Mans, die fünfhundert Meter von Indianapolis, die Sofa-Olympiade), einer Welt, die seine Kraft und seine Räder zu tragen vermochten: Mit ein wenig Glück wirst du den »Was-hätte-sein-können-Pokal« gewinnen, Junge, und damit du ihn dir ins Regal stellen kannst, wirst du die Stadtverwaltung dazu bringen, dir eine Rampe zu bauen. Doch der Mann, der vielleicht gerade diesem Traum nachhing, verharrte dort, ohne sich zu rühren, und wartete auf etwas so Einfaches wie eine helfende Hand. Oder vielleicht auf etwas so Schwieriges wie darauf, dass seine Träume, einer nach dem anderen, in der Dunkelheit starben.
Paquito spürte seine Einsamkeit, den ersten Übergang zur Leere, die versteinerte Traurigkeit.
»Was machen Sie denn hier? Geht es Ihnen nicht gut?«
»Verzeihung. Wenn Sie mir vielleicht helfen könnten … Ich habe mich nicht getraut, die Straße zu überqueren, nachher springt auf halbem Weg die Ampel auf Rot. Das ist mir schon mal passiert, und wenn die Autos angerast kommen, können sie nicht rechtzeitig bremsen, wissen Sie, es geht zu schnell.«
»Wie recht Sie haben. Im Dunkeln merken die Leute es erst, wenn man schon unter dem Auto liegt«, sagte Paquito lächelnd.
»Wenn Sie mich hinüberbringen könnten … Zu zweit sieht man uns besser, und im Notfall könnten Sie mich rasch weiterschieben.«
»Aber natürlich. Wollen Sie direkt hier auf die andere Seite? Sollen wir die Straße an der Ampel überqueren?«
»Ja. Sehen Sie, jetzt ist gerade Grün.«
Der Asphalt, der seiner eigenen Einsamkeit Glanz abgerungen hat, die Ampel, die blinzelnd auf das drängende Gelb umschaltet, das Aufblitzen der Lichter eines bremsenden Wagens in den Schaufenstern eines Ladens für Kellnerbedarf, einer Perücken- und Kunsthaarwerkstatt und eines Dessousgeschäfts, das schon im nächsten Jahr Korsetts für Herren wie für Damen anbieten wird. Die auf dem anderen Bürgersteig aufsetzenden Räder des Rollstuhls, klack, klack, das davonfahrende Auto, und wieder eine einsame Windbö, ein wimmerndes Kind in einem vergessenen Zwischenstock, Herbstblätter, die durch eine namenlose Straße wehen. Schön, Paquito, hier spielst du die barmherzige Schwester, den Lieblingsjünger von San Juan de Dios, indem du die Bürde der Nacht vor dir herschiebst, die deine eigene ist, und die Bürde des Rollstuhls, die zum Glück die des anderen ist. Den Bürgersteig hast du erreicht, klack, klack: weiter geht’s.
»Schlechtes Wetter, was?«
»Ja, Herbst eben.«
»Wie konnte man Sie nur um diese Zeit hier so allein im Rollstuhl stehen lassen?«
»Wissen Sie, ich brauche niemanden. Manchmal gehe ich abends in die Kneipe und später wieder nach Hause. Das ist kein Problem. Aber heute macht mir die Straße Angst, denn bei dem Regen können die Autos nicht bremsen. Man riskiert Kopf und Kragen.«
»Ah, ich verstehe.«
»Würde es Ihnen etwas ausmachen, mich noch ein Stück zu schieben? Ich bin schon fast zu Hause.«
»Aber nein, überhaupt nicht. Wo wohnen Sie?«
»In dieser kleinen Gasse. Hinter dem Gitter, gleich am Anfang. Vorsicht, da vorn ist der Boden uneben, da bleibe ich immer mit den Rädern hängen.«
Los, geh weiter, Lieblingsjünger von San Juan de Dios, schieb den Rollstuhl durch das tiefe Schlagloch voller abgestorbener Blätter und Papierfetzen, auf die jemand eine Partitur, ein Manifest für die Unabhängigkeit oder eine Geschenkliste für eine Hochzeit gekritzelt hat; ein Loch, in dem du die Haare eines Vollweibs, feine Katzenspuren und städtische Feuchtgebiete findest. Die Gasse ist ein langer industrieller Darm, der zu einem Stapel leerer Kisten, vergitterten Fenstern und einer Werkstatt in der Krise führt, in der nur noch Hoffnungen produziert werden. Dort parkt ein Auto mit einem Pärchen, das zu allem bereit ist, rien ne va plus, und der Fahrer wird nach dem Orgasmus bestimmt das Zeitliche segnen. An den Wänden hängen Stücke von Nacht, auf den Balkonen des ersten Stocks Fetzen von Stille und auf einem Flachdach Damenwäsche auf einer Leine. Abrupt springt der Motor des Autos an, wir fahren woandershin, Kleine, irgendwohin, wo es ruhiger ist: Wer weiß, ob der Kerl im Rollstuhl nicht einer von der neuen Mobilen Brigade ist, die sind mit den neuesten technischen Errungenschaften ausgestattet. Der ist mir nicht geheuer.
»An allen dunklen Plätzen stehen Autos mit Pärchen«, murmelte Paquito. »Am Ende erfinden sie noch Modelle mit Bidet.«
»Ja. Die Gasse ist bei den Transvestiten beliebt. Sie bringen ihre Freier hierher.«
»Machen sie viel Lärm?«
»Nein, überhaupt nicht, das wäre schlecht fürs Geschäft.«
Der Rollstuhlfahrer deutete auf eine Tür im finstersten Teil der Gasse. Er murmelte: »Dort ist es.«
»Gut, dann sind Sie ja jetzt zu Hause. Viel Glück.«
»Danke, mein Freund.«
Auf einmal stand der Rollstuhlfahrer auf. Von wegen Rollstuhl! Keine nachgebenden Beine, kein Körper, der einem das letzte Mitleid abrang, weil er zusammensackte oder vornüberfiel. Nur die kräftigen Arme, der Stiernacken, der bösartige Blick über Einsamkeit und Nacht hinaus. Instinktiv wich Paquito einen Schritt zurück.
»Aber … was hat das zu bedeuten?«
»Rück sofort alles raus, was du hast, du Idiot. Mach schon: deine Brieftasche, die Uhr, die Ringe, alles …«
»Hören Sie, das ist wirklich eine … eine …«
Die Klinge des Messers drängte Paquito sanft gegen die Wand. Ein träger Blitz flammte auf, als ein Regentropfen auf der Klinge zerplatzte.
»Eine Sauerei? Nun ja, Pech für dich. Beschwer dich bei deinem Vater. Und jetzt her mit den Sachen, oder ich stech dich ab.«
Paquito begriff, dass der andere im Gegensatz zu ihm bewaffnet war und dass ihm niemand helfen würde; die Nacht, die Einsamkeit, die leeren Kisten und irgendeine Katze ohne Erinnerung wären die einzigen Zeugen seines Widerstands. Er sank in sich zusammen. Sein Mund wurde trocken, er bekam weiche Knie, er spürte einen Stich ins Herz, als hätte sich ein Köder darin verfangen. Es hatte keinen Zweck zu kämpfen.
»Gut …«, presste er mit dünner Stimme hervor, »Sie brauchen mir das Messer nicht so unter die Nase zu halten. Ich gebe Ihnen alles, was ich bei mir habe …«
»Dann beweg dich, Beeilung … Beeilung!«
Paquito zog seine Brieftasche heraus (drei brandneue Fünftausenderscheine, sämtliche Papiere, eine Todesanzeige, die Überbleibsel einer vertrockneten Herbstblume). Er legte die Uhr ab (eine goldene Longines, die viele Stunden vergangener Zeiten – also erprobte, vertrauenswürdige Stunden – angezeigt hatte). Behutsam zog er die Krawattennadel heraus (am oberen Ende eine einzelne, kalte, ferne Perle, wie das Auge eines Fischs aus gutem Hause). Er streifte den Siegelring ab (verschlungene Initialen, ein Datum, ein Versprechen, die Erinnerung an eine Hochzeit, kurz: eine schöne Erinnerung voller Vergessen) und übergab alles dem neuen Vertreter des sozialen Friedens, dem Apostel des Messers.
»Hier, bitte. Das ist alles.«
»Das soll alles sein? Von wegen. Du trägst doch noch einen Ring. Her damit, du Idiot, oder ich schneide dir den Finger ab.«
Er hatte die Stahlklinge sinken lassen. Neben ihr schimmerte, wie die letzte Träne Christi, ein großer, roter Rubin an Paquitos linker Hand; ein Ring ohne Datum, ohne jedes Versprechen und damit auch ohne jedes Vergessen. Paquito krümmte sich.
»Nein, nicht den«, sagte er.
»Her mit dem Ring, du Wichser!«
»Ich flehe Sie an … Das ist das Einzige, worum ich Sie bitte. Was bedeutet er Ihnen schon? Ich kann ihn nicht ablegen. Er ist mir heilig, es ist ein Familienerbstück.«
»Ein waaaas?«
»Ein Familienerbstück.«
Wütend schlug der Räuber mit der linken Hand auf ihn ein und drängte ihn an die Wand. Mit der rechten drückte er ihm das Messer spürbar an den Hals. Er zischte leise: »Zieh ihn aus …«
»Ich kann nicht. Tun Sie es doch.«
Paquito wusste nur zu gut, dass der andere dazu beide Hände benötigen würde und somit das Messer wegstecken müsste. Aber wenn er glaubte, sich durch diesen Schachzug besser verteidigen zu können, irrte er. Ein weiterer Schlag traf sein Gesicht. Das Messer drang noch ein wenig tiefer in seinen Hals und hinterließ eine Blutspur.
»Ich hab gesagt, du sollst ihn ausziehen, du Missgeburt. Ich sag’s nicht noch mal.«
Paquito schloss für einen Moment die Augen.
Aus seinem Mund kam ein gurgelndes Geräusch, dann wimmerte er: »Bitte …«
»Gib mir die Hand.«
Das Messer hob sich. Es sah aus, als würde es ihm gleich den Finger abtrennen. Und noch einmal geschah in der Nacht das Wunder des trägen Blitzes, als stünde die Zeit plötzlich still, das Wunder des Regentropfens, der nicht auf das Messer selbst, sondern auf seinen Glanz fiel. Die Stahlklinge senkte sich wieder.
»Du wirst noch viel mehr verlieren, du Wichser. Entweder du ziehst ihn jetzt aus oder …«
Paquitos Stimme war nur mehr ein hysterisches Geheul: »Nein!«
Er versteckte die Hände hinter dem Rücken, um zu verhindern, dass der andere den Ring auch nur berührte.
Da verlor der Rollstuhlmann die Nerven. Der brutale Schnitt zerfetzte Paquitos Kehle, den Kragen des blütenweißen Hemds – unverkennbar Vehils Vidal –, den Knoten der Krawatte – das neueste Modell von Gonzalo Comella –, den zarten, mit Eau de Rochas benetzten Adamsapfel. Blut spritzte hoch und befleckte die Wand wie Spucke, traf Paquitos Nase, füllte seine Mundhöhle. Das gurgelnde Geräusch drang durch die Gasse und all ihre Nächte, durchbrach die Stille all ihrer Katzen. Paquito verharrte einen Moment wie festgenagelt an der Wand, die Augen weit aufgerissen, die Lippen schlaff herunterhängend, während seine Hände hinter dem Rücken wie wild am Mauerwerk kratzten. Dann sackte er langsam in sich zusammen, starrte mit einem letzten Ausdruck des Erstaunens in die Leere, und die Luft füllte sich für ihn mit dem Glitzern des Stahls, das sich in den Regentropfen eines Niemandshimmels brach. Ein lackartiger Widerschein in der Ecke, ein verlöschendes Licht, ein in der Ferne einer anderen Stadt bellender Hund. Dann das Nichts.
Der Mann, der ihm soeben die Kehle durchgeschnitten hatte, umklammerte das Messer noch fester und wollte ihm gerade den Finger mit dem Ring abschneiden, als ein Auto mit quietschenden Reifen in die Gasse einbog. Hinter den aufblitzenden Scheinwerfern saßen ein weiterer Transvestit, der bereit war, alles zu verkaufen, und ein weiterer Schwächling, der bereit war, alles zu kaufen; und wenn der Transvestit und der Schwächling sähen, was vor sich ging, würde sich ein Geschrei erheben, ein Warnruf in die Einsamkeit – sieh mal, was der da macht, Schatz, zeig, dass du ein Mann bist, ihm nach, auf die Motorhaube mit ihm, und dann gib’s ihm. Doch bevor es zu diesen Nettigkeiten kam, ließ der Räuber das Messer fallen und floh, flink wie eine Ratte, in die andere Richtung. Er merkte nicht, dass die beiden im Auto ihn gar nicht gesehen hatten und den Toten natürlich auch nicht. Es gab Dringlicheres zu tun. Der Transvestit hatte zu dem Kerl gesagt: Zeig mir, dass du ein Mann bist, Schatz, jetzt sofort, nimm mich auf der Motorhaube, hart, und gib’s mir. Und der Schwächling hatte geantwortet: Aber Schatz, bei dem Regen?
Wie das Leben so spielt, war Méndez als Ehrengast auf einer Benefizveranstaltung eingeladen, einer dieser Festivitäten, bei denen ein Armer auf der Suche nach einem Reichen und ein Reicher auf der Suche nach einem Armen unter Beifallsbekundungen feiern, dass sie sich gegenseitig gefunden haben.
»Das ist eine großartige Gelegenheit«, hatte sein Chef auf dem Kommissariat zu ihm gesagt. »Sie werden sich mit Delikatessen vollstopfen können.«
Es war in der Tat eine wunderbare Gelegenheit, sich mit dem Leben zu versöhnen, wieder einmal den Geschmack früherer Zeiten zu kosten – und zudem gratis: Cariñena aus der Karaffe, eine hausgemachte Tortilla oder eine Sardine, die noch vor einem Monat fröhlich im Hafenbecken umhergeschwommen war, Würste, die noch den Stempel der Tollwutimpfung trugen, im städtischen Pissoir herangereifte Oliven. Diese lukullische Sause, dieser kapitalistische Überfluss, diese städtische Verschwendung wurde auf großen Buffets den bewundernden Blicken des Publikums dargeboten, bevor das eigentliche Fest und die Verteilung der Gaben an die Armen begannen, die ihren Reichen gefunden hatten. Die auf die Calle Nueva hinausgehenden Rundbogenfenster tauchten die Platten und Teller in ein graues, wässriges Licht, das an Weihnachten mit weinendem Kind und abwesendem Vater erinnerte. Ein Plattenspieler in der Ecke gab ein Lied von Manolo Escobar zum Besten, an einer Wand hingen drei Fahnen, die spanische, die katalanische und eine undefinierbare, die ihrem verdächtigen Aussehen nach durchaus aus Afghanistan hätte stammen können, bei genauerem Hinsehen aber ihr Geheimnis durch die Inschrift »Benefiz-, Freizeit- und Chorgesellschaft Die Freunde des Stadtteils« preisgab. An der gegenüberliegenden Wand war auf einem großen, handgemalten Plakat eine Mutter mit einem Kind abgebildet, die hoffnungsfroh in die Zukunft und auch zu einem Schriftzug mit der radikalen Forderung »Kampf dem Hunger und Mitleid mit den Hungrigen« hinüberblickten.
»All das ist das Ergebnis einer großen Sammelaktion im Volk«, erklärte einer der Organisatoren dem Inspektor, »und der kleine Imbiss wurde selbstlos von einigen Damen aus dem Viertel zubereitet.«
»Das rieche ich«, sagte der alte Polizist. »Die Sardine kommt bestimmt aus der Calle de San Olegario.«
»Ja, so ist es. Sie haben eine gute Nase.«
»Und die Tortilla stammt aus der Kneipe der Pension, in der ich wohne. Jede Wette.«
»Wie haben Sie das erraten, Señor Méndez?«
»Sie hat so ein gewisses Etwas.«
»Greifen Sie zu, greifen Sie zu. Ganz frisch gemacht. Noch warm und saftig.« Der Organisator machte eine ausladende Handbewegung, mit der er vergeblich den gesamten Raum zu erfassen versuchte, das Aufgebot an Fossilien, die vom letzten Abendmahl übrig gebliebenen Brötchen, die getrockneten Sardinen und die in Frieden ruhenden Muscheln, die einst Teil von Mutter Natur gewesen waren. Dann sagte er: »Sehen Sie sich nur diese Köstlichkeiten an.«
Angesichts der verbürgten Herkunft der Speisen war Méndez schon das Wasser im Munde zusammengelaufen. Als würdiger Repräsentant der versammelten Obrigkeit – ein Gemeindevertreter, ein Gesandter der Caritas, ein Abgeordneter der Autonomieregierung, eine Puffmutter im Ruhestand, ein ehemaliger Chefredakteur der Tageszeitung und ein Wachtmeister der Guardia Civil – mischte er sich während der kleinen Stärkung unter die bedürftigen Volksmassen. Seine offizielle Anwesenheit fiel nicht sonderlich auf, denn der eigentliche Akt, angefangen von der Aufforderung »Bitte, Herrschaften, greifen Sie zu«, bis zum Verzehr des Buffets, dauerte genau dreieinhalb Minuten.
Der Organisator von vorhin trat wieder auf ihn zu.
»Und, Señor Méndez?«
»Alle Achtung.«
»Köstlich, was?«
»Ich hab eine Muschel erwischt.«
»Die Muscheln sind ausgezeichnet, Señor Méndez. Man sagt ihnen eine aphrodisierende Wirkung nach.«
»Ja, ich spüre es schon. Es ist wirklich erstaunlich. Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn ich zwei gegessen hätte. Vielleicht hätte man mich anbinden müssen.«
»Und das Brot? Haben Sie von dem Brot versucht?«
»Aber ja. Ausgesprochen lecker.«
»Fein. Sie glauben nicht, wie sehr mich das freut. Doch wenn Sie und die anderen Würdenträger nichts dagegen haben, würde ich jetzt gerne zur Verteilung der Hilfsgüter kommen. Herrschaften, stellen Sie sich bitte in einer Reihe auf! Halten Sie Ihren Kupon bereit, und dass sich ja keiner vordrängelt! Alles schön geordnet, bitte!«
Die Zuwendungen bestanden aus materiellen Gütern unterschiedlichster Art, schnöder Mammon in Umschlägen, Gutscheine für die Apotheke, aber auch Kinderwagen, Matratzen, Schulbücher für die Kleinen und Schals für die Väter, alles verteilt nach einem peniblen Bericht über die Bedürftigkeit, der schon vor Monaten erstellt worden war und den man sicherheitshalber am Tag zuvor noch einmal überprüft hatte. Am Ende, als alles verteilt und das planmäßige Happy End gekommen war, stand in einer Ecke völlig unbeachtet, wie ein nutzloser Gegenstand, wie die Erinnerung an einen Toten, ein Rollstuhl.
2 DAS HAUSDERGOTISCHEN VÖGEL
Alfredo Cid rutschte unbehaglich auf dem Rücksitz seines erstklassigen schwarzen Jaguars mit grauem Lederpolster herum und befahl dem Chauffeur, an der nächsten Ecke abzubiegen. Das Unbehagen war natürlich nicht physischer Natur, denn der Jaguar war so komfortabel ausgestattet, dass er selbst die sensiblen Pobacken und Nieren eines Alfredo Cid schonte. Es war moralischer Natur (die Anzahl an rein moralischen Problemen, die man in einem Jaguar haben kann, ist unerschöpflich), denn Cid kam es äußerst ungelegen, ausgerechnet an diesem Morgen mit einer protzigen Karosse vorzufahren. Er hätte lieber den weit bescheideneren Corsa genommen oder den R-25, der zwar auch nicht billig war, aber weniger die Aufmerksamkeit der Massen auf sich zog. Doch seine Frau hatte den Corsa genommen, und den R-25 fuhr sein Sohn, und somit war er des höchsten Guts eines Mannes beraubt, nämlich der Freiheit, zwischen zwei guten Dingen wählen zu können. (Alfredo Cid war, völlig zu Recht, der Überzeugung, dass die Wahl zwischen zwei Übeln keine wahre Freiheit sei.) Und weil er zudem außerstande war, den Jaguar sicher durch das städtische Chaos zu steuern, hatte er auch noch den Chauffeur rufen müssen. All das – so wurde ihm jetzt bewusst – gab ein negatives Bild ab, es war ein Fehler, ein Anschlag auf die Vorstellung von Demokratie.
Aber das war jetzt nicht mehr zu ändern. Er deutete auf das Haus und sagte: »Dort ist es.«
»Das Haus an der Ecke?«
»Ja. Das mit dem großen Garten.«
»Soll ich direkt vor der Zufahrt parken? Sonst ist nichts frei.«
»Nein, auf keinen Fall. Bieg in die Zufahrt ein, als wolltest du auf das Grundstück. Genau so. Gut. Jetzt nimm den Schlüssel vom Tor und schließ auf. Man kann direkt in den Garten hineinfahren. Was für ein Garten, ach … es ist eine Schande, was für eine Platzverschwendung die Leute früher betrieben haben.«
Der Garten war in der Tat riesig und umgab das ganze Haus. Auf zwei Seiten ging er auf den Lärm der Straße und die wie im Notfalleinsatz vorbeirasenden Autos hinaus. Im hinteren Teil und vom Zugang aus rechter Hand (wie es in der pedantischen Notariatsurkunde hieß) war er von der feindlichen Welt anderer Häuser umzingelt, von Grenzmauern, offenen Lichthöfen, Küchen- und Badfenstern, aus denen die Matronen des Viertels morgens nach dem Aufstehen auf die Straße spähten und am Mittag die Sonne genossen. Alfredo Cid wusste, dass es damit bald vorbei sein würde: Der Garten würde verschwinden, die Lichthöfe wären die längste Zeit offen gewesen und würden nicht mehr von der Sonne begrenzt, sondern von einer Wand und anderen winzig kleinen Fenstern mit anderen Matronen, denen ebenfalls der Blick auf die Straße verwehrt war. Doch wäre damit auch der Platzverschwendung ein Ende gesetzt, und das ist einer der größten Gefallen, die ein Mann der Stadt tun kann, die er liebt.
Der Chauffeur öffnete ihm die Autotür und fragte: »Soll ich den Wagen hier stehen lassen?«
»Ja, klar. Warte auf mich.«
Während er auf das Haus zuging, dachte Alfredo Cid erneut, dass ihm das Bild des allmächtigen Kapitalisten, der in seinem Jaguar vorfährt, alles dem Erdboden gleichmachen will und sich über die Rechte der anderen hinwegsetzt, nicht gut zu Gesicht stand. Auch wenn jeder weiß, dass es diese Rechte gar nicht gibt, dachte Cid, oder dass man sie keineswegs achten muss, sollte man zumindest den Eindruck erwecken, als täte man es; das ist das große demokratische und juristische Ziel, das die modernen Gesellschaften erreicht haben. Jede Regierung, die etwas auf sich hält, weiß, dass sie die Henker im Amt belassen muss, aber dass sie unbedingt einen Image-Berater brauchen.
Verärgert über sich selbst, weil er sich nicht an die Grundregel gehalten und die technischen Errungenschaften der Demokratie nicht genutzt hatte, eilte Alfredo Cid die Treppen des herrschaftlichen Hauses hinauf. Es war ein Klinkerbau, aber nicht so quadratisch wie die Kästen heutzutage, die lediglich nach dem Lot hochgezogen wurden. Es hatte verschnörkelte Säulen – eine billige Hommage an Gaudí und Puig y Cadafalch –, Arkaden für längst beendete Literaturzirkel und Mauernischen für längst entschwundene Heilige. Man fand Mosaike aus Manises, von einem Kunsthandwerker aus Ripoll geschmiedete Gitter, von den Nibelungen inspirierte Wasserspeier, farbige Ornamente auf dem Dach und fantastische Buntglasfenster, die unmöglich legaler Herkunft sein konnten; bestimmt hatte sie der Polizeichef von Chartres höchstpersönlich gestohlen. Dazu die Stille, die uralten Bäume, in denen bestimmt noch gotische Vögel hausen, dachte Cid.
Und die eigenartigen Lichtreflexe in den Scheiben der Mansarden, hinter denen noch irgendwo die Gesichter der Kinder des neunzehnten Jahrhunderts lauerten, die – zu seinem Glück – längst gestorben waren. Sepiafarbene Fotos im Familienalbum, ein Fleck an der Wand von einem nicht mehr vorhandenen Bild, ein Teeservice, das niemand mehr benutzt, und weiter hinten im Zimmer das Regal mit den antiken Vasen, das keiner mehr anrührt.
Die Stille des Gartens wurde im Innern des Hauses noch dichter. Es war die Stille der Empfangsräume ohne Besucher, der Esszimmer ohne Kinder, der Schlafgemächer ohne Sünde, eine Stille, die vom letzten Ave Maria Barcelonas zu stammen schien, du bist gebenedeit unter den Weibern, in einer Stadt, in der keine Glocken mehr läuten. Und inmitten der Stille der unaufhaltsam weitermarschierende Alfredo Cid.
»Ist da jemand?«
Im Salon der große Kamin mit seiner ausladenden Marmorkonsole unter dem in die Wand eingelassenen Spiegel aus Muranoglas, untrennbar mit dem Haus verbunden, wie ein Nabel. Kruzitürken!, dachte Cid, diesen Spiegel wird man nicht retten können, selbst wenn ich die Jungs fürs Feine dransetze, ausgewählte Arbeiter, die noch keinen Gewerkschaftsausweis als Schlächter haben. Das waren goldene Zeiten, als die Abrissarbeiter einem noch alles gerettet haben, als man noch zur Geduld mahnen konnte, weil ein Tag mehr oder weniger keine Rolle spielte, Zeiten, in denen die Ziegel der Wände einzeln herausgeholt und gesäubert wurden, damit man sie für andere, noch nicht erbaute Häuser verwenden konnte. Jetzt würde alles zerstört werden, sogar der prächtige Marmorkamin, der so groß war, dass man darin ein Osterlamm oder den unehelichen Sohn des Hausmädchens und des Hausdieners hätte braten können. Auch das Dach würde keiner retten, Kruzitürken!, trotz der Holzverzierungen, die aus einer abgetakelten Galeone aus der Zeit der Entdeckung Amerikas stammen könnten. Heutzutage nutzte man von einem alten Haus nur das frei gewordene Grundstück, so wie man von einem toten Mann nur die frei gewordene Frau nutzt.
»Señora Ros! Sind Sie nicht da?«
Die Treppe mit dem Geländer aus massiver Eiche; gut, das kann ich noch retten, wenn ich das Haus abreißen lasse – nachdem ich die Holzwürmer vertrieben habe, die heute noch darin wohnen. Deshalb bin ich schließlich hier: eine letzte persönliche Aufforderung. Eine letzte Frist. Außerdem: Falls Sie es noch nicht wussten, Señora Ros, hier ist Platz für fünfzig Wohnungen mit Garage, Abstellraum, Klimaanlage, Luxusherd, Sicherheitstüren, Blick auf den Taxistand, gehobener Standard. Das Wort gehoben würde in allen Werbeanzeigen erscheinen, es machte etwas her. Das Treppengeländer nehme ich mit, ich werde es in die Maisonettewohnung unter dem Dach einbauen lassen, auf die hat schon einer vom Opus Dei ein Vorkaufsrecht erworben, er will sich ganz oben eine Kapelle einrichten.
»Also, Señora Ros, es ist besser, wenn wir reden. Hören Sie auf mit dem Versteckspiel!«
Das Ende der Treppe. Hola, geschafft, ich bin angekommen. Zwei Geschosse, die Küche unten und das Esszimmer oben. Wer lässt sich so was einfallen? Und die Schlafzimmer sind wirklich schön, groß, die Fenster gehen auf den Garten hinaus, auf die jahrhundertealten Bäume und die gotischen Vögel. Eine derartige Noblesse kann sich heutzutage keiner mehr leisten: große Räume, in denen man umgeben von Frauen ruhen, im Kreise seiner Kinder sterben kann, Räume, auf deren Teppich eine Wappenlilie prangen sollte. Gut, angekommen, dachte Alfredo Cid wieder, irgendwo hier muss Señora Ros mit ihren vergilbten Kalendern stecken. Er blieb vor der halb geöffneten Tür stehen; dahinter lag der größte Raum des Hauses, aus dessen Fenstern man in der Tat auf Bäume aus dem Neolithikum und Vögel blickte, die bestimmt schon mumifiziert waren. Wie angewurzelt stand er da, die Hände an den Türpfosten gestützt, und Kälte kroch ihm die Beine hoch, während er die tote Frau anstarrte.
3 DER JUNGE
Méndez stand an einem der Fenster, durch die das graue, wässrige Licht hereinfiel wie am Morgen des letzten Sonntags, ein Licht aus den Eingeweiden der Calle Nueva, und betrachtete neugierig den Rollstuhl am anderen Ende des Raumes.
»Was macht der denn da?«, fragte er den Organisator, der für alle Fälle in seiner Nähe geblieben war.
»Keine Ahnung. Das wundert mich auch.«
»Ist er nicht abgeholt worden?«
»Nein, wie man sieht. Merkwürdig, denn wir haben diesen neuen Stuhl für einen Behinderten gekauft, dessen alter schon ziemlich klapprig ist. Er hat ihn bitter nötig.«
»Tja, seltsam, dass er nicht gekommen ist …«
Der Organisator kratzte sich am Ohr.
»Ich würde den armen Mann ja anrufen und ihn fragen, was los ist, aber er hat kein Telefon. Wie soll er auch die Telefonrechnung bezahlen, wenn er nicht mal seinen Strom bezahlen kann? Das überprüfen wir immer. Er hat kein Geld. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke … Ich kann ihn doch erreichen. Ich rufe denjenigen an, der ihn mir empfohlen hat.«
»Und wer hat ihn empfohlen?«
»Ein Journalist.«
»Ein gewisser Carlos Bey?«
»Nein. Wie kommen Sie gerade auf den?«
»Weil er in der letzten Zeit bei irgendeiner Wohltätigkeitsgeschichte engagiert war.«
»Nein, der war es nicht, nein«, sagte der Organisator. »Warten Sie mal … Ach ja. Es handelt sich um einen gewissen Amores.«
Méndez zuckte zusammen.
»Wie bitte?«
»Wie schon gesagt: ein gewisser Amores.«
»Hören Sie … Haben Sie die Adresse von diesem armen Teufel im Rollstuhl?«
»Ja, die Adresse habe ich. Ist hier ganz in der Nähe, im Viertel, aber ich werde es weder heute noch morgen schaffen vorbeizugehen. Wieso?«
»Weil rasches Handeln angesagt ist«, brummte Méndez.
»Ich wüsste, ehrlich gesagt, nicht warum. Ich gehe nicht davon aus, dass Sie einen Hundert-Meter-Hürdenlauf für Rollstuhlfahrer planen.«
»Aber ich weiß warum. Der arme Kerl hat keine Ahnung, aber wer mit Amores in Kontakt kommt, ist vom Pech verfolgt. Vielleicht ist er schon tot.«
»Was sagen Sie da?«
»Geben Sie mir sofort die Adresse.«
Méndez notierte sie und rannte zur Tür, die er keuchend erreichte. Für einen Zehn-Meter-Spurt war der verdiente Polizist noch gewappnet. Zwölf Meter brachten ihn bereits in arge Bedrängnis, und fünfzehn konnten das Ende bedeuten.
Doch das Glück war ihm hold, denn der Raum maß nach Angaben des Architekten sechzehn Meter, was bedeutete, dass es exakt vierzehn Meter fünfundsiebzig waren. Das war knapp.
Úrsula maulte: »Du kannst mich mal, Méndez.«
Úrsula hatte am Eingang einer Bar einen Lotteriestand, bestehend aus einem Stuhl und einem Schild, also ein gesichertes Dasein. Zudem würde sie eine erstklassige Beerdigung bekommen, die schon zur Hälfte abbezahlt war, somit hatte sie also auch ihre Zukunft gesichert. Sie bezog eine Rente für ihren Mann, der beim Brand eines Kinos umgekommen war, nachdem er um Erlaubnis gebeten hatte, zum Arzt gehen zu dürfen. Darüber hinaus besaß sie eine Sammlung an Amuletten, hatte einen Sohn, der sie an Weihnachten besuchte, und einen blinden Liebhaber, der sie an Regentagen besuchte, wenn man nicht auf der Straße betteln konnte. Úrsula hatte auch ein optimal genutztes Zimmer, denn wenn sie sich nicht selbst darin aufhielt, vermietete sie es stundenweise an unerfahrene und darum zu allem entschlossene Pärchen.
Natürlich hatte Úrsula in den Jahren der Wirtschaftsblüte ein weit lukrativeres und gesellschaftlich angeseheneres Gewerbe betrieben – welches auch mit einem Stuhl am Eingang einer Bar zu tun hatte –, und daher rührte eine gewisse Feindseligkeit gegenüber Méndez, der Úrsulas Meinung nach alle beschützt hatte bis auf sie, obwohl man ja eigentlich weiß, dass ein ehrenwerter Polizist dafür Sorge tragen sollte, dass alle Frauen gleich behandelt werden, wenn es darum geht, dem Gesetz ein Schnippchen zu schlagen.
Also wiederholte sie dumpf: »Du kannst mich mal.«
»Ich habe dich lediglich gefragt, ob du Antonio Pajares kanntest, Kleine. Jetzt stell dich nicht so an.«
»So weit hast du es also gebracht. Du bist ja nicht wiederzuerkennen, Méndez. Vor Kurzem noch so unbeweglich, dass man dich höchstens rausgeschickt hat, um die Blinden zu verhaften, die gefälschte Lotterielose verkauft haben.«
»Und selbst von denen ist mir noch einer durch die Lappen gegangen«, gestand Méndez. »Aber man weiß ja, dass man nach all den Jahren mal bei einem Einsatz versagt. Ich habe getan, was ich konnte.«
»Fahr zur Hölle, Bulle. Ist dir eigentlich klar, wie tief du gesunken bist? So tief, dass du jetzt sogar schon Gelähmte verhaftest. Prima … Nimm dich in Acht, Méndez, hör auf meine Worte: Treib Sport, bring dich auf Trab, oder der geht dir auch noch durch die Lappen. Du bist am Ende.«
»Ich bin nicht gekommen, um ihn zu verhaften«, sagte Méndez sanft wie ein Missionar. »Ich will nur wissen, ob er hier wohnt. Diese Häuser sind ein Albtraum, und ich will nicht Wohnung für Wohnung abklappern, verstehst du? Treppensteigen ermüdet mich.«
»Leidest du jetzt auch noch an Hirnerweichung? Auch das noch. Alle Wohnungen abklappern, sagst du? Was glaubst du wohl, wo ein armer Teufel lebt, der auf den Rollstuhl angewiesen ist? Unter dem Dach? Oder denkst du, der Hauseigentümer lässt ihm im Treppenhaus einen Lift einbauen?«
»Einen Lift mit Bidet«, bemerkte die Frau auf dem Nachbarstuhl, »mit Bidet und allem Pipapo.«
Méndez trat den strategischen Rückzug an.
»Stimmt«, murmelte er vor sich hin. »Er muss im Erdgeschoss wohnen, klar. Wo habe ich nur meinen Kopf.«
Und er machte sich aus dem Staub.
Natürlich hatten nicht alle, die gelähmt waren, das Glück, im Erdgeschoss zu wohnen, das wusste er nur zu gut. Einige waren zu Gefangenschaft verurteilt (zwanzig Jahre und ein Tag ohne Freigang, ohne Besucher), in einer Vierzig-Quadratmeter-Wohnung oder auf einem Balkon mit einer Geranie, einem Vogel, einer kaputten Jalousie, einem tropfenden Wasserhahn und einer trällernden Nachbarin. Eines Tages würde die Geschichte dieser letzten Form der Einsamkeit geschrieben werden, dachte Méndez, aber nicht von ihm. Vielleicht könnten die Nachbarin und der Vogel sie einander erzählen, ganz allein für sich.
Méndez ging unauffällig weiter.
Ein Freund, der gelähmt war – Méndez konnte sich noch lebhaft daran erinnern –, war eines Nachts von seiner Frau dabei erwischt worden, wie er sich im Hauseingang Liebesdienste angedeihen ließ; daraufhin war sie kurzerhand mit ihm aus dem Parterre in ein kleines Zimmer unter dem Dach desselben Hauses gezogen, das der Gelähmte nicht mehr verlassen konnte und wo er und ein arabischer Nachbar sich heimlich Beleidigungen an den Kopf warfen. Die Frau hatte auf diese Weise die eheliche Treue retten wollen, doch Méndez hegte den Verdacht, dass der Ehemann und der Araber in irgendeinem romantischen Eckchen des Dachgeschosses zueinander gefunden hatten, gelobt sei die Weisheit des Propheten, der stets Mittel und Wege findet.
Méndez hatte den Hauseingang erreicht, einen dunklen Ort voller übler Gerüche, aber auch ein Ort prallen Lebens. Ein Hund schnappte nach ihm, eine Alte fragte, wo er hinwolle, ein junges Mädchen bot ihm exklusiv eine neue Sexpraktik an, ein Gemeindepolizist, der in den Briefkästen herumgeschnüffelt hatte, ergriff schleunigst die Flucht. Kurzum: Im Treppenhaus regierte der Alltag, die altbewährte Fröhlichkeit. Méndez wusste sofort, wo der Gelähmte wohnte, als er hinter einer Tür im Erdgeschoss einen Hund erbärmlich jaulen hörte, der wohl seit den Zeiten der Arche Noah nicht mehr rausgekommen war. Entweder war sein Besitzer nicht da, oder er konnte das Haus selbst auch nicht verlassen, um den Hund auszuführen. Méndez klingelte.
Die ältere Frau, die ihm öffnete, hielt eine Bratpfanne in der Hand und erhob sie zum liebenswürdigen Gruße: »Scheißbulle.«
Sie versuchte, die Tür zu schließen, doch mit der Geschicklichkeit eines Veteranen, der schon in den Genuss des »Reptilienfonds« von Canalejas kam, hatte Méndez seinen Fuß hineingeschoben.
»Ich will Antonio Pajares lediglich einen Besuch abstatten«, sagte er. »Ich habe nicht die Absicht, ihn zu verhaften.«
»Antonio besuchen? Seit wann macht sich die Polizei die Mühe, den armen Antonio zu besuchen? Scheren Sie sich zum Teufel! Sie wollen bloß meinen Jungen hopsnehmen. Hauen Sie ab! Das ist meine Wohnung, Sie mieses Schwein!«
Méndez wusste nicht, wer der Junge war, und es war ihm auch egal, aber er notierte sich im Geiste den Namen und die Anschrift, falls im Viertel eine Anzeige vorlag. An einem solchen Ort konnte alles Mögliche passieren, angefangen von der Vermietung eines Zimmers für zwei armenische Sodomiten bis zur Herstellung von Atombomben für die Regierung von Tansania. Er stieß die Tür auf und trat ein. Schließlich war es nicht weiter schwierig, die Frau mit ihrer Pfanne zu überwältigen.
Der Gelähmte saß in einem ramponierten Sessel, drehte mit der einen Hand am Radio und hielt mit der anderen den jaulenden Hund fest. Im Gegensatz zu der Frau wirkte er seltsamerweise erleichtert über Méndez’ Besuch.
»Ah«, sagte er, »Sie sind wegen der Anzeige da.«
»Ja, klar, wegen der Anzeige«, bestätigte Méndez und fügte mit einem Seufzer hinzu: »Ich bin heilfroh, dass Sie wohlauf sind; Sie wissen nicht, wie froh ich darüber bin.«
»Warum sollte ich nicht wohlauf sein? Bis jetzt hat mich noch niemand angegriffen. Man hat mir nur den Rollstuhl gestohlen.«
»Man hat ihn gestohlen?«
»Ja. Deshalb konnte ich den neuen nicht abholen, den man mir bei diesem Wohltätigkeitsverein spendieren wollte. Wie hätte ich dorthin kommen sollen? Zu Pferd? Oder vielleicht huckepack auf dem Rücken der Alten?«
»Ist sie Ihre Mutter?«
»Nein. Meine Tante. Sie hat vor dreißig Jahren meine Mutter umgebracht und zehn Jahre im Gefängnis gesessen, stellen Sie sich das vor.«
Méndez hob eine Augenbraue. Er hatte sein ganzes Leben im Viertel zugebracht, aber manche Dinge hatte er noch nie gesehen oder gehört.
»Und warum wohnen Sie bei ihr?«, fragte er.
Der Gelähmte zuckte die Achseln und hob leicht die Hände, ohne jedoch den Hund loszulassen.
»Was soll ich machen? Sie ist alles, was ich noch an Familie habe. Vielleicht finden Sie ja ein anderes Nest für mich.«
»Natürlich … die Familie. Und warum hat sie das getan?«
»Sind Sie etwa wegen dieses Falls hier, Inspektor? Wegen dieser ollen Kamelle? Das ist dreißig Jahre her, Mann. Ich dachte, Sie seien wegen der Sache mit dem Rollstuhl da. Das ist nämlich erst gestern passiert, noch ganz frisch.«
»Nein. Ich will nicht in der alten Sache ermitteln, natürlich nicht«, sagte Méndez und fügte salbungsvoll hinzu: »Der Fall wird schon in den entsprechenden Archiven ruhen, also dort, wo die Obrigkeit ihn aufgehoben sehen will. Niemand würde es wagen, ihn dort noch einmal auszugraben, und wenn sie die Anzahl an Archivaren verdoppeln müssten. All die Arbeit, der ganze Staub, die ganze Sauerei. Ich habe rein aus Neugier gefragt.«
»Sie hat es wegen meines Vaters getan«, erwiderte der Gelähmte kaum hörbar.
»Haben die drei zusammengelebt? In derselben Wohnung?«
»Ja.«
Wieder hob Méndez die Augenbraue.
»Verstehe«, sagte er leise, in verändertem Tonfall. »Du bist also ›der Junge‹?«
»Sie nennt mich immer so, ist so ein verdammter Tick von ihr. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Ich bin schon gut fünfunddreißig, und was ist? Nichts. Ich bin und bleibe der Junge.«
»Und was hast du in der letzten Zeit gemacht, Junge?«
»Fangen Sie jetzt auch noch damit an? Na ja, man muss ja schließlich von was leben, nicht wahr? Man hat mich vom Losverkauf abgezogen, so eine Schweinerei, macht man das mit einem Kerl wie mir, der sich nicht bewegen kann? Jetzt lebe ich von dem, was gerade so anfällt.«
»Tombolas in Bars, hier und da jemanden verpfeifen, Hütchenspiele …«, mutmaßte Méndez.
»Wie gesagt, was sich einem redlichen Mann so bietet. Normale Sachen, bei denen niemand zu Schaden kommt. Und beim Hütchenspiel muss ich mich ganz schön anstrengen, weil ich es auf einem Tisch machen muss. Ich kann mich nicht auf der Straße hinknien, so gern ich das auch wollte.«
»Auch mal das ein oder andere Heroinbriefchen, klar, aber selbstverständlich ohne dass jemand zu Schaden kommt«, murmelte Méndez.
»Nein, keine schmutzigen Sachen, hören Sie. So weit kommt’s noch. Vielleicht mal ein bisschen Gras.«
»Na schön, Junge, na schön … Sag deiner Tante, dass dich keiner verhaften will. Und sag ihr, dass ich nur wegen des Rollstuhls gekommen bin. Wann wurde er dir gestohlen?«
»Das habe ich doch schon gesagt: gestern. Und die Alte rennt sofort hin und erstattet Anzeige. Nicht dass er noch viel wert gewesen wäre, aber ich brauche ihn. Sie sehen ja, ich schaffe es nicht mal, den neuen abzuholen. So ein Mist.«
Méndez schwieg einen Moment und sagte dann: »Das ist wirklich eine Unverschämtheit, einen Rollstuhl zu stehlen, und noch dazu einen alten. Wo kommen wir denn da hin? Am Ende werden sie noch einen Lkw mit Gummis klauen. Wo hattest du ihn denn abgestellt, Junge?«
»Im Eingang, aber nur diese Nacht. Ein Freund sollte ihn am nächsten Morgen in aller Herrgottsfrühe abholen, um den Sitz wieder festzumachen, der hatte sich gelöst.«
»Vielleicht hat ihn sich ein anderer Gelähmter aus dem Viertel geschnappt. Fälle gibt’s … Wohnen hier noch andere Krüppel?«
»Ja klar. Haufenweise. Aber ich kenne doch meinen Rollstuhl. Hier hat den niemand, denn wer sich den unter den Nagel gerissen hat, dem schiebe ich die beiden Räder in den Arsch und drehe sie rum, da können Sie einen drauf lassen.«
Méndez strebte auf die Tür zu, bevor der andere detailliert auf diesen neuen erotischen Reiz und all die damit verbundenen Möglichkeiten einging.
Was ihm ursprünglich so große Sorgen bereitet hatte (die Beteiligung von Amores, die einen unmittelbaren Tod befürchten ließ), hatte sich als erbärmlicher Raub oder mieser Scherz erwiesen, weiter nichts. Ausnahmsweise war im Gefolge von Amores mal keine unbeerdigte Leiche aufgetaucht. Folglich war die Sache für Méndez uninteressant geworden; er war fast ein wenig enttäuscht. Von der Tür aus rief er dem Jungen noch zu: »Ich werde dafür sorgen, dass die vom Wohltätigkeitsverein dir den neuen Rollstuhl bringen, denn wie ich sehe, brauchst du ihn dringend. Unterdessen hake ich mal nach, ob der alte inzwischen gefunden wurde. Dann hast du beide. Den alten kann man bestimmt noch mal reparieren.«
»Klar. Vielleicht schenke ich ihn an Sie weiter.«
Méndez war nicht beleidigt über das freundliche Angebot des Jungen. Im Gegenteil. Höflich erwiderte er: »Danke.«
Sein Rheuma machte ihm inzwischen arg zu schaffen. Außerdem weiß man ja nie, was man am Ende noch alles braucht.
Da war sie, die Gasse. Schmutzig, grau, gestapelte leere Kisten, in den Fenstern aufgehängte Wäsche, Katzen, die aus der Ferne alles beobachteten, und schließlich die verrammelten Türen einer Werkstatt, in der nicht einmal mehr Hoffnungen produziert wurden. Bei Tageslicht wirkte die Gasse noch enger und unwirtlicher als in der Nacht, obwohl die Wagen von Polizei und Staatsanwaltschaft ihr zugegebenermaßen einen gewissen offiziellen Glanz verliehen. Es war sogar eine Streifenpolizistin vor Ort – recht mager, aber nach Méndez’ Ansicht trotzdem was für’s Auge und bestimmt auch noch ziemlich griffig –, die den Verkehr regelte
Als er an dem Gitter vorbeiging, das die Gasse teilweise absperrte, hörte er jemanden sagen: »Der Untersuchungsrichter ist eben erst gekommen, dabei ist das Verbrechen schon heute Nacht passiert.«
Méndez näherte sich dem Tatort. Er musste seine Hundemarke nicht zeigen, denn alle Polizisten Barcelonas kannten ihn und wahrten gebührende Distanz. Der mit dem Fall betraute Inspektor musterte ihn von Weitem mit einem erstaunten und zugleich verschlossenen Ausdruck, so wie man jemanden ansieht, der auf einem Hochzeitsbankett erscheint und um Almosen bettelt. Dann wandte er ihm den Rücken zu.
Hinter dem Inspektor erkannte man die leicht gebeugte Gestalt des Untersuchungsrichters im schwarzen Mantel mit Samtkragen, in der rechten Hand eine alte Mappe, die aussah, als wäre sie heiß geliebt und bestens dazu geeignet, die ersten Verse Antonio Machados oder den Liebesbrief eines Halbwüchsigen an seine jüngste Tante aufzubewahren. Eine ferne Nostalgie schwebte über der Gestalt, die Nostalgie eines Kleinstadtkasinos, eines Kreuzes an einem Weg in Kastilien. Noch weiter hinten stand ein Sekretär, der, statt sich Notizen zu machen, die Frauenwäsche auf den Leinen betrachtete und Rückschlüsse auf die Rundungen der Trägerinnen zog. Dann fiel Méndez’ Blick auf einen dicken Fotografen in Jeans und Lederjacke, der gelangweilt Fotos schoss. Danach auf einen Beamten der Nationalpolizei, der ständig sein Barett zurechtrückte. Den abgedeckten Leichnam. Und zuletzt auf den Rollstuhl.
Taktvoll schüttelte Méndez seine Reverskragen, wie er es immer bei feierlichen Gelegenheiten tat, die eine gewisse Würde verlangten.
»Wann ist das passiert?«, fragte er.
»Heute Nacht. Etwa gegen zwei Uhr früh«, erwiderte der Inspektor herablassend.
Der Junge hatte noch keinen blassen Schimmer, was mit seinem Rollstuhl geschehen war, und schon hatte jemand ein Verbrechen damit verübt, dachte Méndez. Das muss man sich mal vorstellen.
»Wer hat Sie informiert?«, fragte der Inspektor, ohne ihn eines Blickes zu würdigen.
»Auf dem Revier hat man mir gesagt, hier sei ein Mord geschehen. Wissen Sie, ich habe nur die Spur eines Rollstuhls verfolgt. Als ich hörte, dass bei der Leiche einer aufgetaucht sei, dachte ich, ich schaue mal vorbei.«
»Ja. Eine merkwürdige Geschichte.«
»War der Tote vielleicht gelähmt?«, fragte Méndez.
»Ach was! Er war ein ganz normaler Mann, wir haben ihn bereits identifiziert. Er heißt Francisco Balmes, aber von seinen Freunden wurde er Paquito genannt.«
»Was hat er beruflich gemacht?«
»Er war Modeschmuckvertreter, aber wie es aussieht, hat er nicht übermäßig viel gearbeitet und folglich auch nicht viel verdient. Verheiratet, keine Kinder, wohnhaft in der Calle del Rosal, in der Nähe der Paralelo. Wie Sie sehen, bin ich bereits tätig geworden und habe schon ein paar Dinge herausgefunden, noch bevor der Untersuchungsrichter da war, Méndez.«
Dann setzte er nach: »Wollten Sie etwas sagen?«
»Nein, nein. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, dass ich ein großer Bewunderer all jener bin, die in sich den Ruf des Diensteifers vernehmen.«
»Apropos Diensteifer … Was tun Sie hier, Méndez?«
»Ach, im Grunde nichts. Ich bin nur wegen des Rollstuhls da, aber das habe ich Ihnen ja bereits gesagt.«
Er ging ein paar Schritte weiter, sah sich aber nicht den Rollstuhl, sondern den Toten an. Er hob die Decke an, warf einen kurzen Blick auf ihn und deckte ihn mit mütterlicher Sorgfalt wieder zu, als wollte er vermeiden, dass er sich erkältete.
»Also, für einen Vertreter, der wenig verdient, macht er einen sehr eleganten Eindruck«, sagte er und trat auf den Inspektor zu. »Gut gekleidet, teure Schuhe, die Sohlen sind abgenutzt und voller Schlamm, was darauf hindeutet, dass er zu Fuß unterwegs war und nicht im Rollstuhl.«