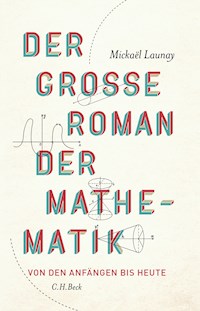17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
«Es gibt Dinge, die den meisten Menschen unglaublich erscheinen, sofern sie nicht Mathematik studiert haben.»
Archimedes
Manchmal genügt schon ein einfacher Perspektivenwechsel, um die komplexesten Phänomene zu begreifen. Mickaël Launay, Autor des Bestsellers
Der große Roman der Mathematik, nimmt seine Leserinnen und Leser mit auf eine spannende mathematische Reise, die in den Gängen der Supermärkte beginnt und in den schwindelerregenden Tiefen der Schwarzen Löcher noch lange nicht endet. Sein so unterhaltsames wie intelligentes Buch lässt niemanden mit seinen kleinen und großen Fragen nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest im Regen stehen. Heben Sie noch einmal den Blick und schauen Sie sich um: Nach der Lektüre sehen Sie die Welt – Ihre Welt – womöglich ganz anders.
Wenn wir die Welt begreifen möchten, wenn wir neugierig auf das uns umgebende Universum sind, dann riskieren wir, durcheinandergebracht zu werden. Im Grunde haben die großen Wissenschaftler der Geschichte vor allem gegen die bestehende Ordnung rebelliert. Die Wissenschaft ist das ideale Terrain, um Dinge in Frage zu stellen, und die Mathematik bietet uns hierfür ein wirkungsvolles Werkzeug. Mathematik bedeutet, hinter die Kulissen der Welt zu treten. Wir schleichen uns hinter die Bühne und schauen uns die riesigen Zahnräder an, die unsere Welt bewegen. Es ist ein faszinierendes, aber auch verwirrendes Schauspiel. Die Realität widersetzt sich unseren Sinnen und unserer Intuition. Sie will nicht dem Bild entsprechen, das wir von ihr haben. Sie stellt unsere Annahmen und innersten Überzeugungen auf den Kopf. Unscheinbare Details können große Geheimnisse verbergen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mickaël Launay
Die Regenschirm-Formel
oder Die Kunst, die Welt mit klarem Verstand zu betrachten
Aus dem Französischen von Ursula Held
Mit Illustrationen von Chloé Bouchaour
C.H.Beck
Zum Buch
«Es gibt Dinge, die den meisten Menschen unglaublich erscheinen, sofern sie nicht Mathematik studiert haben.» – Archimedes
Manchmal genügt schon ein einfacher Perspektivenwechsel, um die komplexesten Phänomene zu begreifen. Mickaël Launay, Autor des Bestsellers «Der große Roman der Mathematik», nimmt seine Leserinnen und Leser mit auf eine spannende mathematische Reise, die in den Gängen der Supermärkte beginnt und in den schwindelerregenden Tiefen der Schwarzen Löcher noch lange nicht endet. Sein so unterhaltsames wie intelligentes Buch lässt niemanden mit seinen kleinen und großen Fragen nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest im Regen stehen. Heben Sie noch einmal den Blick und schauen Sie sich um: Nach der Lektüre sehen Sie die Welt – Ihre Welt – womöglich ganz anders.
«Mickaël Launay führt vor, wie man seinem Publikum Mathematik spielerisch unterjubelt.»
Sibylle Anderl, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Über den Autor
Mickaël Launay hat Mathematik studiert und über Wahrscheinlichkeitstheorie promoviert. Mitte 30, hat er bereits zahlreiche Projekte entwickelt, um insbesondere junge Leute für Mathematik zu begeistern, darunter den millionenfach angeklickten YouTube-Kanal «Micmaths». Sein in 15 Sprachen übersetztes, vielfach preisgekröntes Buch «Der große Roman der Mathematik» (C.H.Beck, 2019) war ein internationaler Bestseller.
«Der Mann, der macht, dass Sie die Mathematik lieben.» – France Info
Einleitung
Im Jahr 1980 gaben Mitarbeiter des Grenobler Forschungsinstituts für Mathematikdidaktik einer Schülergruppe folgendes Rätsel auf:
Auf einem Schiff sind 26 Schafe und 10 Ziegen. Wie alt ist der Kapitän?
Eine komische Frage. Was kann das Alter des Kapitäns mit der Anzahl Schafe und Ziegen zu tun haben? Doch von den knapp zweihundert befragten Kindern im Alter von sieben bis acht Jahren hatten 75 % eine Antwort parat. Viele zählten einfach die genannten Zahlen zusammen und erhielten 36. Als derselbe Test aber bei Neun- bis Zehnjährigen durchgeführt wurde, gab es meist Protest und viele Schüler verweigerten die Antwort. Nur noch 20 % lieferten widerspruchslos ein Ergebnis. In den zwei Jahren hatte sich also ein kritischer Geist herausgebildet. Die älteren Kinder bewiesen Scharfblick und konnten den Sinn ihres Tuns hinterfragen.
Als ich selbst in dem Alter dieser Kinder war, hatte ich eine gewisse Freude an solchen Fallstrick-Rätseln. Fragen, die das Gehirn rattern lassen, aber im Grunde eher Scherze als mathematische Probleme sind. Eines meiner Lieblingsrätsel lautete:
Ein Orchester aus 50 Musikern spielt Beethovens 9. Sinfonie in 70 Minuten. Welche Zeit braucht ein Orchester aus 100 Musikern für dasselbe Stück?
Zum Glück hängt die Dauer einer Symphonie nicht von der Anzahl der Musiker ab und es bleibt bei 70 Minuten. Besonders gut gefiel mir auch die Frage: Was ist schwerer? Ein Kilo Federn oder ein Kilo Blei? Auch hier gilt natürlich: Ein Kilo bleibt ein Kilo.
Was ich damals nicht wusste: Wenn man anfängt, den Sinn der Dinge zu hinterfragen, führt einen das womöglich viel weiter, als man sich vorstellen kann. Mit der Zeit entdeckte ich immer mehr Unterschwelliges im Sinn der Worte, ich sah immer mehr Unzulänglichkeiten in meinem Verständnis der Welt. Natürlich stolpert man als Erwachsener nicht in dieselben Fallen wie als Kind. Wir sollten aber nicht glauben, dass wir vor allen Irrtümern gefeit wären, die uns auflauern. Unsere Intuition kann uns täuschen, unsere Annahmen können sich als falsch herausstellen. Als inzwischen 35-Jähriger kann ich sagen, dass seit meiner Grundschulzeit nicht ein Jahr meines Lebens vergangen ist, in dem ich nicht über Dinge ins Stutzen gerate wäre, die ich zu wissen glaubte.
Wenn wir die Welt begreifen möchten, wenn wir neugierig auf das uns umgebende Universum sind, dann riskieren wir, durcheinandergebracht zu werden. Im Grunde haben die großen Wissenschaftler der Geschichte nichts anderes getan als die Kinder, die sich weigerten, das Alter des Kapitäns zu benennen. Sie haben angezweifelt, was ihnen vor Augen lag, und sich bemüht, weiter zu schauen. Sie haben gegen die bestehende Ordnung rebelliert. Die Wissenschaft ist das ideale Terrain, um Dinge infrage zu stellen, und die Mathematik bietet uns hierfür ein wirkungsvolles Werkzeug.
Mathematik bedeutet, hinter die Kulissen der Welt zu treten. Wir schleichen uns hinter die Bühne und schauen uns die riesigen Zahnräder an, die unsere Welt bewegen. Es ist ein faszinierendes, aber auch verwirrendes Schauspiel. Die Realität widersetzt sich unseren Sinnen und unserer Intuition. Sie will nicht dem Bild entsprechen, das wir von ihr haben. Sie stellt unsere Annahmen und innersten Überzeugungen auf den Kopf. Unscheinbare Details können große Geheimnisse verbergen und kindliche Scherzfragen erweisen sich manchmal als überraschend tiefgründig.
Ich habe noch ein Rätsel:
Wenn vier Hühner in vier Tagen vier Eier legen, wie viele Eier legen dann acht Hühner in acht Tagen?
Ich lasse Sie eine Weile darüber nachdenken, wir kommen darauf zurück. Eines kann ich aber jetzt schon verraten: Als ich mit zehn Jahren zum ersten Mal über diese Frage nachgrübelte, ahnte ich nicht, dass sie mir eines Tages helfen würde, die berühmteste Formel aller Zeiten zu begreifen.
Wenn Sie mir also eine Weile folgen möchten, schlage ich vor, dass wir mit dem Abenteuer beginnen. Es kann gut sein, dass der Weg manchmal schwerfällt, schließlich ändert man nicht mit einem Fingerschnipp seine Denkweise. Es gilt, Zweifel zu überwinden und Gedanken reifen zu lassen. Aber bleiben Sie dran, die Freude am Begreifen macht die eingegangenen Mühen tausendmal wett. Hinter dieser Seite beginnt unsere Reise in die Mathematik, auf der wir einige der schönsten verborgenen Mechanismen unserer Welt entdecken werden. Heben Sie noch einmal den Blick und schauen Sie sich an, was Sie umgibt: Nach unserer Erkundung sehen Sie die Welt – Ihre Welt – womöglich ganz anders.
1.
Das Supermarkt-Gesetz
Das Benfordsche Gesetz
Reisen in das Reich der Mathematik beginnen manchmal an ganz unscheinbaren Orten.
Zu Beginn wollen wir uns in den Laden an der Ecke begeben. Sicher gibt es einen bei Ihnen in der Nähe, in dem Sie regelmäßig einkaufen. Ob es sich dabei um einen Riesensupermarkt oder einen Dorfladen handelt, spielt keine Rolle. Man muss dort nur eine Auswahl der täglich benötigten Grundnahrungsmittel finden.
Die Szene ist Ihnen bekannt. Sie sind Hunderte, vielleicht gar Tausende Male hier gewesen. Sie kennen die Gänge, die Regale, das rhythmische Piepen an der Kasse. Kunden laufen auf und ab und sammeln mechanisch Milchkartons oder Konserven ein. Wir aber wollen dieses Mal nichts kaufen: Wir sind als Beobachter hier.
Denn an diesem Ort versteckt sich ein besonders faszinierendes mathematisches Goldstück. Und zwar direkt vor unseren Augen. All die Jahre hat es dort gelauert und sich nicht einmal getarnt: Sie können es jetzt in diesem Moment sehen. Eine kleine Absonderlichkeit. Eines dieser unauffälligen Details, die wir direkt vor der Nase haben und die uns doch meist entgehen. Einen aufmerksamen Beobachter können sie jedoch durchaus stutzig machen. Greifen wir also zum Smartphone oder Notizblock und schauen auch wir genauer hin.
Sehen Sie sich einmal die Preise an, die sich in den Regalen aneinanderreihen: 2,30 € … 1,08 € … 12,49 € … 3,53 € … All diese Zahlen erscheinen uns vollkommen zufällig, wenn wir sie rasch hintereinander lesen. 1,81 € … 22,90 € … 0,64 € … Die Preisspanne reicht von wenigen Cents bis zu Dutzenden Euros. Aber auf diese Information haben wir es gar nicht abgesehen. Vergessen wir ganz einfach die Kommas, Nullen und alle nachfolgenden Zahlen. Bei jedem Preis schauen wir nur auf die erste Ziffer, denn nur sie ist für unser Experiment entscheidend.
Da haben wir etwa ein Netz Rosenkohl für 1,54 €: Notieren wir eine 1. Ein paar Regale weiter sehen wir einen Deostick für 3,49 €: Ins Heft kommt eine 3. Ein Camembert à 250 Gramm für 1,99 €. Also wieder eine 1. Eine beschichtete Pfanne für 45,90 €: Zum ersten Mal zwei Stellen vor dem Komma, aber das spielt keine Rolle, es geht uns nur um die erste Zahl und wir notieren also eine 4. Eine Tüte Erdnüsse für 0,75 €: Die erste für uns wichtige Zahl ist die 7.
Schlendern wir also eine Weile durch die Gänge und lassen unsere zufällige Zahlenreihe anwachsen: 1 3 1 4 7 9 2 2 1 7 9 8 1 1 3 1 1 1 8 1 1 2 1 2 1 1 9 1 4 7 1 6 1 5 9 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 6 … Irgendwann werden wir stutzig: Unsere Zahlengirlande sieht irgendwie seltsam aus. Die Ziffern sind ungleich verteilt, die Reihe besteht hauptsächlich aus Einsen und Zweien und wird nur hier und da von einer 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 unterbrochen. Als wenn wir unbewusst nur auf die niedrigsten Preise geschaut hätten. Da stimmt doch was nicht.
Jetzt sind wir als gewissenhafte Statistiker gefragt. Vermeiden wir jede Art von Voreingenommenheit, gehen wir ganz systematisch vor. Dazu wählen wir beliebig einzelne Regale aus und schreiben dieses Mal ohne Ausnahme alle Preise aller Produkte auf. Das ist mühselig, aber wir möchten der Sache ja auf den Grund gehen.
Eine Stunde später ist unser Heft mit einer Zahlenpolonaise angefüllt, die sich über mehrere Seiten zieht: Zeit für eine Bilanz. Nach dem Durchzählen ist das Urteil unwiderruflich, die Tendenz hat sich bestätigt. Wir haben die Preise von über eintausend Produkten notiert und beinahe ein Drittel beginnt mit einer 1! Ein gutes Viertel beginnt mit einer 2, und je höher die Zahl, desto seltener taucht sie auf.
Wir kommen damit auf folgende Verteilung:[1]
Nun ist nicht mehr an Zufall oder eine unbewusste Auswahl der Produkte zu glauben. Die Ahnung ist zur Tatsache geworden, der wir uns beugen: Die ersten Ziffern der Preise in einem Supermarkt sind nicht gleichmäßig verteilt. Kleine Zahlen sind deutlich stärker vertreten.
Wie kommt es zu diesem Ungleichgewicht? Auf ebendiese Frage wollte ich hinaus. Welchem Gesetz der Supermärkte, des Handels oder der Wirtschaft folgen Supermarktpreise, um dieses seltsame Ergebnis hervorzubringen? Warum sind die ersten Ziffern nicht gleich verteilt? Ist die Mathematik nicht verpflichtet, allen Zahlen die gleiche Aufmerksamkeit zukommen zu lassen? Mathematik müsste doch unvoreingenommen und vorlieblos sein. Und doch bestätigen die Fakten das genaue Gegenteil. Im Supermarkt hat die Mathematik ihre Günstlinge. Sie heißen 1 und 2.
Wir haben beobachtet. Wir haben festgestellt. Jetzt heißt es: nachdenken, analysieren und Schlüsse ziehen. Die Daten haben wir gesammelt, nehmen wir sie nun genauer unter die Lupe.
Im März 1938 veröffentlichte der US-amerikanische Ingenieur und Physiker Frank Benford The Law of Anomalous Numbers (Das Gesetz der anomalen Zahlen). In dem Artikel untersuchte er numerische Daten aus über zwanzigtausend verschiedenartigen Erhebungen. In seinen Tabellen findet man etwa die Länge der Flüsse der Welt, die Bevölkerungszahlen verschiedener amerikanischer Städte, die Masse der bekannten Atome, zufällig aus Informationsbroschüren entnommene Zahlen oder auch mathematische Konstanten. Und bei allen diesen Daten macht Benford die gleiche Beobachtung wie wir: Die ersten Ziffern sind nicht gleichmäßig verteilt. Etwa 30 % der Zahlen beginnen mit einer 1, 18 % mit einer 2. Der Prozentsatz nimmt stetig ab, bis wir bei der Ziffer 9 anlangen, mit der nur 5 % der Werte beginnen.
Benford ist nicht auf die Idee gekommen, seine Statistik im Supermarkt zu überprüfen. Aber Sie werden zugeben, dass seine Resultate den unseren auffällig ähneln. Natürlich weicht die prozentuale Verteilung etwas ab, aber im Ganzen ist die Übereinstimmung doch frappierend.
Benfords Studie beweist, dass die von uns gesammelten Daten kein Einzelereignis sind. Sie sind nicht spezifisch für die Funktionsweise eines Supermarkts, sondern fügen sich in eine viel weitreichendere Tendenz ein. Nach der Veröffentlichung von Benfords Artikel beobachteten viele Wissenschaftler ebendiese Verteilung in zahlreichen, ganz unterschiedlichen Kontexten.
So zum Beispiel in der Demografie. Von den 203 Ländern, die unser Planet Erde zählt, haben 62, also 30,5 %, eine Bevölkerungsmenge, die mit einer 1 beginnt – vom bevölkerungsreichsten Land China mit 1,4 Milliarden Menschen über Mexiko mit 122 Millionen Menschen, dem Senegal mit 13 Millionen bis zum Inselstaat Tuvalu mit 10.800 Einwohnern. Dagegen gibt es nur 14 Länder, deren Bevölkerungszahl mit einer 9 beginnt – das entspricht 6,9 %.
Oder bevorzugen Sie die Astronomie? Von den acht Planten, welche die Erde umkreisen, haben vier einen äquatorialen Durchmesser, der mit einer 1 beginnt. Jupiter misst 142.984 Kilometer, Saturn 120.536, die Erde 12.756, Venus 12.104. Die Sonne hat einen Äquator von 1.392.000 km. Falls Ihnen eine Probe aus neun Himmelskörpern zu klein erscheint, können wir gerne Zwergplaneten, Satelliten, Asteroiden und Kometen hinzufügen und gelangen doch zur selben Feststellung: Die 1 überwiegt.
Wenn man einmal auf das Phänomen aufmerksam geworden ist, hagelt es Beispiele. Man nehme eine Liste mit Zahlen aus einem beliebigen Kontext, schaue sich die ersten Ziffern an und wieder steht es einem vor Augen. Die Benford-Verteilung taucht immer und überall auf. Weit entfernt davon, eine Ausnahme zu sein, erscheint sie als natürliche, allgegenwärtige statistische Regel. Und paradoxerweise ist die gleichmäßige Verteilung, die uns doch viel selbstverständlicher und intuitiver vorkommen könnte, offenbar nicht in der Welt vorhanden.
Angesichts dieser Größenordnung können wir also nicht mehr von einer Absonderlichkeit im Supermarkt sprechen. Was wir hier entdeckt haben, ist eine vollwertige Regel, die nicht nur in zahlreichen menschlichen Tätigkeitsfeldern auftaucht, sondern der Natur selbst innewohnt und ihren innersten Aufbau bestimmt. Mit ihrer Entdeckung gewinnen wir einen tiefen Einblick in unsere Welt und ihre Funktionsweise.
Der Einfluss der Benford-Verteilung ist so stark, dass wir sie reproduzieren, ohne uns dessen bewusst zu sein. Die Menschen, die in Supermärkten die Preise festlegen, sprechen sich nicht ab und haben meist noch nie von einem Frank Benford gehört. Und doch – als würden sie von einer Macht gelenkt, die größer ist als sie – folgen sie dieser Regel. Genauso wie die Einwohnerzahl der Länder, die Länge der Flüsse und der Durchmesser der Planeten.
1938 nannte Frank Benford die von ihm beobachtete Verteilung das «Gesetz der anomalen Zahlen». Doch ist das Gesetz so allgegenwärtig, dass der Name uns unpassend erscheint. Eine Anomalität ist immer subjektiv, sie existiert nur für diejenigen, die sich darüber wundern. Für die Natur dagegen ist die Verteilungsregel offenbar selbstverständlich und vollkommen gebräuchlich. Das Benfordsche Gesetz ist nur so lange anomal, wie wir es nicht verstanden haben. Und wir haben die ernste Absicht, es zu verstehen.
In welche Richtung geht es nun weiter? Wie können wir den Schleier der Anomalität heben und das Rätsel in eine Tatsache verwandeln?
Das Benfordsche Gesetz ist nicht schwer zu verstehen, aber es ist auch nicht in wenigen Zeilen erklärt. Die zugrunde liegende Mathematik ist einfach, aber tiefschürfend. Hier wird keine Aha-Lösung angeboten à la: «Ach, so ist das! Jetzt hab ich’s!»
Nein, wir müssen unser Verständnis der Zahlen und unsere Art zu zählen ganz neu denken. Wenn uns das Benfordsche Gesetz nicht einleuchtet, dann deshalb, weil wir in die falsche Richtung denken. Wir müssen lernen, mit anderen Augen auf das zu schauen, was uns wohlbekannt vorkommt. Wir müssen uns selbst infrage stellen.
Eine Reise in die Welt, die uns Frank Benford eröffnet, übersteht man nicht unbeschadet. Sein Gesetz verändert uns. Wenn Sie es einmal begriffen haben, wird Ihre Denkweise eine andere sein.
Multiplikatives Denken
Viele Situationen im Alltagsleben raunen uns insgeheim zu, dass wir mit Zahlen Probleme haben. Dass da irgendetwas hakt.
An dieser Stelle möchte ich eine kleine Anekdote erzählen.
Vor einigen Jahren saß ich mit Freunden bei einem Spieleabend und es kam die Idee auf, uns selbsterdachte Quizfragen aus der Welt der Wissenschaft zu stellen. Es wurden also zwei Teams gebildet und wir testeten gegenseitig unser Wissen – von der Mathematik über die Biologie und Informatik bis zur Geologie. Für jede Frage überlegten sich beide Teams eine Antwort, und diejenigen, die der richtigen Lösung am nächsten waren, bekamen den Punkt. Einfache, eindeutige Spielregeln also. So schien es zumindest, bis nach einigen Runden eine astronomische Frage eine unerwartete Auseinandersetzung hervorrief.
Die Frage lautete, wie groß der Abstand zwischen Erde und Mond sei.
In unserem Team kannte niemand die exakte Antwort, aber nach einer kurzen Besprechung einigten wir uns schließlich auf 800.000 km. Im gegnerischen Team schien es zu größeren Diskussionen zu kommen, dann aber verkündete man auf einen Schlag die Antwort: 10 km!
Offenbar kannte die andere Seite sich noch weniger mit Astronomie aus als wir. Der Gipfel des Mount Everest, des höchsten Bergs der Erde, liegt auf knapp 9 km. Wenn der Mond nur 10 km entfernt wäre, könnte man den Erdtrabanten dort oben gleichsam berühren! Eine absurde Antwort. Den Punkt sah ich klar bei uns.
Doch die Auflösung erwies sich als ziemlich beunruhigend. Tatsächlich ist der Mond 384.000 km von der Erde entfernt. Durch einfache Subtraktion stellte sich heraus, dass wir uns um 416.000 km vertan hatten, während das gegnerische Team nur 383.990 km danebenlag.
Ich blinzelte ungläubig und rechnete alles noch einmal im Kopf durch: Es stimmte. Ich machte sogar eine kleine Zeichnung auf einer Papierserviette, um mich endgültig zu überzeugen.
Es gab keinen Zweifel: Die Antwort des anderen Teams war näher an der Wahrheit als unsere. Sie hatten gewonnen. Ich musste die Rechnung noch mehrmals im Kopf durchgehen, doch es war nichts einzuwenden. Die Mathematik hatte ein klares Urteil gesprochen.
Aber finden Sie nicht auch, dass die Situation etwas Ungerechtes hat? Mag sein, dass ich wie ein schlechter Verlierer dastehe, aber haben Sie nicht auch den Eindruck, dass unsere Antwort trotz der eindeutigen Zahlen die überlegtere war? Sie war doch viel gerechtfertigter und im gewissen Sinne weniger falsch als die der anderen.
Warum kommt es uns in diesem Fall so vor, als würde die Mathematik uns widersprechen? Warum entscheidet das Rechenergebnis für die weniger einleuchtende Antwort?
Vielleicht lautet die angemessenere Frage: Haben wir die Mathematik, deren wir uns bedienen, eigentlich richtig begriffen? Denn die Mathematik irrt sich nie – es ist nur so, dass die Menschen sie manchmal unpassend anwenden.
Wenn man ein bisschen gräbt, fallen einem viele ähnlich geartete Situationen ein. Eine Katze zum Beispiel ist im Durchschnitt 25 cm groß, ein Labrador etwa 60 cm, und bestimmte Bakterien messen ein Tausendstel Millimeter. Man kann also sagen, dass eine Katze größenmäßig näher an einem Bakterium ist als an einem Labrador. Denn zwischen der Katze und dem Bakterium sind es 25 cm Unterschied, zwischen der Katze und dem Hund aber 35 cm.
Doch noch einmal: Das Urteil der Zahlen widerspricht unserer natürlichen Wahrnehmung der Realität. Katze und Hund gehören demselben Kontext an. Sie spielen zusammen oder treten zumindest in Beziehung. Sie sehen sich, riechen sich und wissen von der Existenz des anderen. Eine Katze aber, die nicht zufällig Biologie studiert hat, weiß nicht, dass es Bakterien gibt. Die Kleinstlebewesen gehören nicht zu ihrer Welt, sie sind nicht sichtbar, nicht wahrnehmbar.
Diese Sichtweise führt uns zu vielen anderen Zusammenhängen, die der Intuition entgegenstehen und doch mathematisch exakt sind. Die Oberflächentemperatur der Sonne ist näher an 5 °C als an 15.000 °C. Die Einwohnerzahl von Paris ist näher an der von einem Dorf mit zwölf Leutchen als an der New Yorks. Wenn man den Mars wiegt, wird man feststellen, dass seine Masse näher an der eines Tischtennisballs ist als an der Masse der Erde.
Wie beim Benfordschen Gesetz stoßen wir uns auch bei diesen Gegenüberstellungen an den Zahlen, weil wir verkehrt denken. Denn wir wenden mathematische Werkzeuge an, die wir in diesem für sie unpassenden Kontext nicht begreifen.
Wie aber lassen sich intuitive Vorstellungen in die Mathematik einbringen? Die Antwort hierzu liegt in dem Konzept der Größenordnung.
Die Grundidee ist einfach, hat aber eine erschreckend große Wirkung. In Größenordnungen denken heißt, mit Multiplikationen statt mit Additionen zu denken.
Wenn man etwa die Zahlen 2 und 10 vergleichen möchte, kann man dies auf zwei verschiedene Arten tun. Nämlich additiv: Wie viel müssen wir zu 2 dazutun, um 10 zu erhalten? Antwort: 8. Oder multiplikativ: Mit was muss man 2 malnehmen, um 10 zu bekommen? Hier lautet die Antwort: 5. Den additiven Abstand zwischen zwei Zahlen erhält man durch Subtraktion: 10 – 2 = 8. Den multiplikativen Abstand durch Division: 10 ÷ 2 = 5.
Wenn man sagt, dass zwei Mengen dieselbe Größenordnung haben, dann sind sie sich aus multiplikativer Sicht nahe.
Die Vorstellung mag einem anfangs seltsam erscheinen, aber wenn man einmal begonnen hat, multiplikativ zu denken, wird einem schnell bewusst, dass dieser Ansatz in zahlreichen Alltagssituationen viel eher unserer Intuition entspricht.
Kehren wir zu unserem Wissenschafts-Fragespiel zurück. Hätte ich damals klar gesehen, hätte ich Einspruch gegen den Punktgewinn der anderen einlegen können, denn: Der Mond ist 384.000 km von der Erde entfernt, unser Team schätzte die Distanz aber auf 800.000 km, also etwa das Zweifache. Dividiert man, so stellt man fest, dass unsere Antwort genau 2,08 Mal zu groß war. Das gegnerische Team aber hatte 10 km geantwortet, was 38.400 Mal kleiner als der tatsächliche Abstand ist! Aus dieser Sicht hätten natürlich wir gewonnen, und zwar haushoch. Diese Entscheidung entspricht viel eher unserer spontanen Wahrnehmung.
Das Gleiche gilt für alle vorangegangenen Beispiele. Multiplikativ gesehen ist die Größe der Katze näher an der des Hundes als an der Größe der Bakterie, die Masse des Planeten Mars näher an der Masse der Erde als an der eines Tischtennisballs, und die Einwohnerzahl von Paris näher an der von New York als an der eines zwölfköpfigen Dorfes und so weiter.
Wenn wir – in welchem Kontext auch immer – zwei Zahlen miteinander vergleichen, denken wir meist spontan multiplikativ. Wenn Ihr Supermarkt ein Produkt, das 200 Euro kostet, um 8 Euro verteuert, wird Sie das sicher ärgern, aber noch viel wütender würde Sie machen, wenn dieselben 8 Euro auf ein Produkt aufgeschlagen würden, dass nur 2 Euro kostet. In diesem Fall betrüge die Teuerung das Fünffache. Das wäre mehr als ein Ärgernis, das wäre glatter Betrug. Und doch ist die Preiserhöhung dieselbe.
Der additive Vergleich ist ein bloßes Gedankenspiel. Er entspricht nicht unserem intuitiven Denken, er wird unserem Gefühl übergestülpt und lenkt unsere mögliche Interaktion mit der Welt. Auch unsere Sinne, mit der wir unsere Umwelt wahrnehmen, scheinen multiplikativ zu funktionieren.
Wenn ich Ihnen die Augen verbinden und Ihnen einen Gegenstand von 10 g in die eine und einen Gegenstand von 20 g in die andere Hand geben würde, könnten Sie mir sofort sagen, welcher der beiden schwerer ist. Wenn Sie aber ein Gewicht von 10 kg und ein Gewicht von 10,10 kg heben müssten, würde es Ihnen viel schwerer fallen, beide auseinanderzuhalten. Und doch ist der Gewichtsunterschied derselbe, nämlich 10 g. Oder sagen wir lieber: Die additive Differenz ist dieselbe, denn aus multiplikativer Sicht ist die Abweichung enorm: Um von 10 g auf 20 g zu kommen, nimmt man das Doppelte, während es im zweiten Fall nur einen Unterschied von 0,1 % zwischen den Massen gibt.
Für unser Sehen gilt das Gleiche. Haben Sie schon einmal am helllichten Tag das Licht angemacht? Wenn die Sonne das Zimmer bereits in Licht taucht, verändert sich dadurch gleichsam nichts. Die Lichtmenge erscheint dieselbe, ob die Lampe nun leuchtet oder nicht. Wenn Sie das Licht aber bei Nacht anschalten, durchbricht es die Dunkelheit und erfüllt das Zimmer. Es lässt Sie erkennen, was einen Augenblick zuvor unsichtbar im Finsteren lag.
Und doch liefert die Lampe ja nachts nicht mehr Licht als tagsüber. Sie gibt in beiden Fällen gleich viele Strahlen ab. Aus additiver Sicht wird also in beiden Situationen dieselbe Lichtmenge hinzugefügt. Aber unsere Augen nehmen nicht den additiven, sondern den relativen, also multiplikativen Zusammenhang wahr. Am helllichten Tag ist das Licht der Lampe winzig im Vergleich mit der Sonne, nachts aber dominiert es.
Gehen Sie Ihre Sinne – Tasten, Sehen, Schmecken, Hören, Riechen – einmal genauer durch. Überlegen Sie auch, wie Sie vergangene Zeit, zurückgelegte Wege und die Intensität Ihrer Empfindungen wahrnehmen. Alle diese auf uns einströmenden Eindrücke lassen sich viel besser einordnen, wenn wir multiplikativ statt additiv denken.
Unser Sinn für Zahlen
Um Ihr Gefühl für Zahlen zu testen, schlage ich ein kleines Experiment vor. Schauen Sie sich untenstehende Linie an, auf der zwei Punkte markiert sind: Tausend und eine Milliarde.
Und nun versuchen Sie, möglichst spontan folgende Frage zu beantworten: An welche Stelle auf dieser Linie würden Sie eine Million setzen? Befürchten Sie nicht, einen Fehler zu machen, es gibt keine falsche Antwort. Wir wollen nur herausbekommen, wie Ihr Instinkt für große Zahlen funktioniert.
Also, haben Sie den Finger auf den Punkt gelegt, an dem sich Ihrer Ansicht nach die Million befindet? Dann schauen wir mal, was das zu bedeuten hat.
Wahrscheinlich sind Ihnen nach dem Lesen der Frage mehrere Gedanken durch den Kopf gegangen. Bestimmt hatten Sie gleich im ersten Moment eine spontane Eingebung. Eine unreflektierte Idee. Und dann haben sich Ihre Überlegungen nach und nach verfeinert. Sie haben Ihre Erinnerung danach befragt, was Sie über die Zahlen Tausend, eine Million und eine Milliarde wissen, und sicher hat sich Ihr Finger dann ein wenig bewegt. Oder auch erheblich verschoben. Nach links oder nach rechts? Vielleicht ist Ihnen auch durch den Kopf gegangen, worum es bisher ging. Hatten Sie vielleicht den Eindruck, die Frage wäre nicht präzise genug formuliert und es gäbe da einen Fallstrick? Haben Sie additiv oder multiplikativ gedacht? Und ändert das etwas an Ihrer Entscheidung?
Die Gedankengänge sind individuell verschieden, aber eine der häufigsten Reaktionen besteht darin, die Million anfangs etwa auf der Mitte zwischen Tausend und einer Milliarde zu platzieren. Oder auch ein wenig links davon, da einem rasch bewusst wird, dass eine Million eigentlich näher an Tausend als an einer Milliarde sein muss. Und je länger die Überlegung voranschreitet, desto weiter nach links verschiebt sich der Millionenpunkt und landet schließlich nahe der Tausend.
Und wo steht er nun richtig? Die Antwort mag überraschen, aber in diesem Maßstab klebt die Million förmlich an der Tausend. Die beiden Punkte sind mit bloßem Auge kaum zu unterscheiden, sie verschmelzen mit der Null, wenn man diese links hinzufügt.
Natürlich ist eine Million absolut gesehen eine große Zahl, aber man muss ja bedenken, dass eine Milliarde noch das Tausendfache von ihr ist! So erscheint in diesem Maßstab selbst eine Million als kleine Größe. Wenn Sie auf der Null stehen würden und die Milliarde wäre einen Kilometer entfernt, dann befände sich die Million nur einen Meter und die Tausend gerade einmal einen Millimeter neben Ihnen. Aus der Ferne erscheint es dann so, als würden Null, Tausend und eine Million gleichsam übereinanderliegen.
Und doch gilt hier das Gleiche wie bei der Entfernung von Erde und Mond: Das Urteil der traditionellen Mathematik widerspricht unserer Intuition. Wenn man nämlich die Zahlen in Ziffern schreibt, sieht es eben doch so aus, als würde sich die Million in der Mitte zwischen Tausend und einer Milliarde befinden:
Tausend:
1000
Million:
1.000.000
Milliarde:
1.000.000.000
Eine Million hat drei Nullen mehr als die Tausend und drei Nullen weniger als die Milliarde. Rein optisch, ohne Rücksicht auf den Zahlenwert, nur mit Blick auf die Länge der geschriebenen Zahl, könnte man also durchaus versucht sein, die Million in die Mitte zu setzen. Es ist somit auch unser Zahlensystem, das uns multiplikativ denken lässt. Der optische Eindruck wäre ein ganz anderer, wenn wir römische Ziffern schreiben oder Striche aneinanderreihen würden. In unserem Einheitensystem mit Zehnern, Hundertern, Tausendern, usw. entspricht das Hinzufügen einer Null der Multiplikation mit zehn, wodurch eine Verwirrung zwischen Addition und Multiplikation entsteht.
Wenn wir die Zahlen nun einfach auf einer multiplikativ angelegten Achse darstellen, dann liegt die Million genau in der Mitte zwischen Tausend und einer Milliarde. Nach rechts wie nach links beträgt der multiplikative Abstand 1000.
Seltsamerweise ist dieses Phänomen der großen Zahlen in einem gewohnteren Zahlenbereich nicht wahrnehmbar. Wenn ich Sie gebeten hätte, die 50 auf einer Achse von 1 bis 100 einzutragen, hätten Sie sie, ohne zu zögern, in die Mitte gesetzt.
Selbst aus unseren Zahlworten spricht der Konflikt zwischen additiver und multiplikativer Denkweise. Die Zehner nämlich haben alle Eigennahmen: zwanzig, dreißig, vierzig … Mit jedem Schritt zählt man 10 dazu, der Abstand ist additiv.
Bis zur Hundert funktioniert die Sprache additiv.
Wenn wir aber darüber hinausgehen, stolpern wir ins Reich der Multiplikation. Für die 200 oder die 300 gibt es kein eigenes Wort, wir sagen einfach «zwei Hundert» oder «drei Hundert» – so als hätten wir vorher von «zwei-zehn» oder «sieben-zehn» statt von «zwanzig» und «siebzig» gesprochen. Neue Namen treten nun im multiplikativen Rhythmus auf – Tausend, Million, Milliarde, Billion, Billiarde … – und bezeichnen jeweils eine tausendmal größere Zahl.
Setzten wir diese Zahlen auf eine klassische additive Achse, würden sich alle an die Null drängen und im Vergleich zur letzten winzig erscheinen. Gegen eine Billion ist eine Milliarde verschwindend klein, die Billion aber wiederum ist unbedeutend gegenüber einer Billiarde und so weiter.
Der Übergang im Zahlenvokabular geschieht gleichsam unbemerkt, wenn wir als Kinder in der Schule den Zahlenraum kennenlernen. Und doch hat er immensen Einfluss auf unsere Denkweise. Unsere Mengenwahrnehmung ist weder intuitiv noch objektiv. Sie ist tief geprägt von der Art und Weise, wie wir Mathematik erlernt haben.
Wäre es denn möglich, unser Wissen und unsere kulturelle Prägung einen Moment abzulegen, um zu einer ursprünglichen Zahlenwahrnehmung zurückzukehren? Wie würden wir denken, wenn wir nicht seit der Kindheit mit vorgefertigten Zahlensystemen zu tun gehabt hätten?
Um das herauszufinden, wäre es interessant, Menschen zu befragen, die dieser Prägung entgangen sind. Man könnte zum Beispiel mit Kindern sprechen, die noch so jung sind, dass sie nicht besonders tief in die Zahlenlehre vorgedrungen sind. Oder aber man wendet sich an autochthone, isolierte Völker, deren Zugang zu Zahlen so weit von unserer Vorstellung entfernt ist, dass sie von unseren Konditionierungen und Vorannahmen frei sind.
In den 2000er Jahren haben Forscherteams verschiedene Untersuchungen zu dieser Thematik durchgeführt. Dazu wurden Tests ersonnen, die meiner oben gestellten Frage nach der Position der Million gar nicht unähnlich sind. Diese legte man US-amerikanischen Kleinkindern vor, aber auch Angehörigen des Munduruku-Volks, das im Regenwald Nordbrasiliens lebt. Die Sprache der Munduruku besitzt keine Wörter, um Zahlen über 5 auszudrücken – somit unterscheidet sich ihre Mengenwahrnehmung radikal von der unseren.
Den Probanden wurde eine von zwei Zahlen begrenzte Achse gezeigt, und sie wurden gebeten, dieser Spanne weitere Zahlen hinzuzufügen. Natürlich mussten diese Zahlen so dargestellt werden, dass sie auch für absolut mathematikfremde Menschen verständlich waren. Hierzu testete man verschiedene Methoden, etwa eine Visualisierung mit Punktetafeln oder auch eine Hörbarmachung mit einer Reihe von Signalen. Sobald die Regeln verstanden waren, konnte der Test beginnen.
Die Ergebnisse fielen übereinstimmend und eindeutig aus: Die Zahlen der Kinder und der Munduruku wurden intuitiv eher multiplikativ als additiv wahrgenommen. Auf einer Skala von 1 bis 10 ordneten die Munduruku die restlichen Zahlen folgendermaßen an:
Natürlich ist das nicht ganz richtig. Der Test funktioniert sehr intuitiv und es ist nicht ganz leicht, mit einem Blick eine bestimmte Anzahl Punkte zu erfassen. Man sieht, dass ein Großteil der Befragten die 5 hinter die 6 gesetzt hat! Aber dieser Fehler soll uns nicht interessieren. Viel wichtiger ist die Beobachtung, dass sich die kleinen Zahlen am Anfang ausbreiten, während sich die größeren am Ende häufen – als wären kleine Zahlen wie 1 oder 2 bedeutender als große wie 8 oder 9. Die kleinen nehmen fast den ganzen Raum ein, während die großen sich drängen müssen.
Finden Sie nicht auch, dass diese Darstellung an das Benfordsche Gesetz erinnert? Ist das nur Zufall oder verbirgt sich hier eine wichtige Entdeckung? Im Moment ergibt sich keine spontane Verbindung zwischen beiden Phänomenen, aber behalten wir die Idee im Kopf – wir haben später Gelegenheit, darauf zurückzukommen.
Die oben beobachtete Tendenz bestätigt sich in allen durchgeführten Varianten des Tests, also auch bei größeren Zahlen bis 100 und den befragten Kindern. Zum Beispiel setzen Kinder die 10 auf einer Achse von 1 bis 100 oftmals in die Mitte. Ein ziemlich verblüffendes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass die 10 tatsächlich genau zwischen 1 und 100 liegt, wenn man multiplikativ denkt.
Und wenn wir das Ganze noch weiterführen?
Im Laufe des 20. Jahrhunderts haben verschiedene Experimente bewiesen, dass sich die multiplikative Wahrnehmung von Zahlen auch außerhalb der menschlichen Interaktion feststellen lässt. Sie ist wohl nicht nur im Gehirn des Homo sapiens verankert.
Viele Tiere haben einen natürlichen Sinn für Mengen: Ob es nun darum geht, die Nahrungsvorräte zu schätzen oder die Anzahl der Fressfeinde, die es zu meiden gilt. Im Vergleich zu den Möglichkeiten des Menschen arbeitet dieser Sinn nur annähernd und begrenzt, deswegen ist er aber nicht weniger erstaunlich.
Bei Untersuchungen mit Tieren sind die Versuchsprotokolle und die Auswertung der erhaltenen Ergebnisse viel weniger eindeutig und sollten mit Vorsicht genossen werden. Mit Pferden, Vögeln oder Schimpansen kann man eben nicht klar kommunizieren, man kann ihnen die Regeln des Experiments nicht erklären oder ihnen begreiflich machen, was durch das Erfüllen der Aufgabe erreicht werden soll. Dennoch wurden erstaunliche Beobachtungen gemacht und es erscheint gut möglich, dass bestimmte Tiere Zahlen multiplikativ wahrnehmen.
Folgendes zum Beispiel ließ sich bei einem Versuch mit Ratten feststellen. Hierzu setzte man eine Handvoll der Nager in Käfige, in denen sich zwei Hebel befanden. Die Forscher ließen die Ratten in regelmäßigen Abständen eine Reihe von Signaltönen hören. Manchmal zwei, manchmal acht. Wenn das Signal nur zwei Mal ertönte, erhielten die Ratten Futter, wenn sie auf den ersten Hebel drückten. Bei acht Tönen lieferte der zweite Hebel die Belohnung. Nach einer Zeit des Anlernens verstanden die Nager schließlich das Prinzip und aktivierten je nach Anzahl der Töne den richtigen Hebel.
Erst jetzt, nachdem die Tiere mit den Hebeln umzugehen wussten, konnte das eigentliche Experiment beginnen. Denn was würde passieren, wenn man die Ratten ein Signal hören ließ, das weder aus zwei noch aus acht Tönen bestand? Bei drei Tönen liefen die Ratten nach kurzem Zögern zum ersten Hebel, so wie sie es zuvor bei zwei Tönen getan hatten. Bei fünf, sechs oder sieben Tönen entschieden sie – wie bei dem achtstelligen Signal – für den zweiten Hebel. Bei vier Tönen aber zeigten sie sich vollkommen verwirrt! Die eine Hälfte der getesteten Ratten lief zum ersten Hebel, die andere zum zweiten. Als würde die Zahl vier auch für sie genau zwischen der zwei und der acht liegen und ihre Entscheidung daher willkürlich machen.