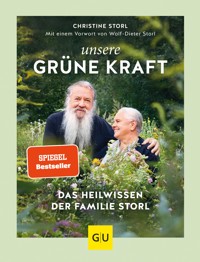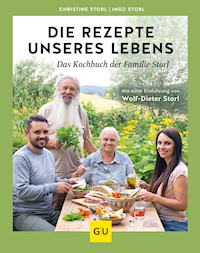
21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Liebe zur Natur, zahlreiche Reisen und traditionelle Bräuche prägen bis heute die Küche der Familie Storl. Für dieses Buch haben Christine und Ingo Storl die emotional verwurzelten Familienrezepte zusammengetragen und sie gewähren tiefe Einblicke in das Leben und die Geschichte der Storls. Neben Lieblings- und Heimatrezepten aus allen Storl-Generationen finden sich in ihrem kulinarischen Schatz auch international geprägte Köstlichkeiten und Rezepte für die schnelle Küche, für den Vorrat oder zu besonderen Anlässen. Persönliche Anekdoten und Hintergrundwissen von Wolf-Dieter Storl über die Zutaten begleiten diese besondere Rezeptsammlung. Ein Kochbuch, das die Geheimnisse der Storlschen Küche und ihr Bewusstsein für die Natur festhält.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Unsere eBooks werden auf kindle paperwhite, iBooks (iPad) und tolino vision 3 HD optimiert. Auf anderen Lesegeräten bzw. in anderen Lese-Softwares und -Apps kann es zu Verschiebungen in der Darstellung von Textelementen und Tabellen kommen, die leider nicht zu vermeiden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Impressum
© eBook: 2023 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
© Printausgabe: 2023 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
GU ist eine eingetragene Marke der GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, www.gu.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Bild, Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Projektleitung: Lisa Seibel
Lektorat: Dorothea Steinbacher
Korrektorat: Andrea Lazarovici
Bildredaktion: Lisa Seibel, Matias Kovacic, Natascha Klebl (Cover)
Covergestaltung: ki 36 Bettina Stickel Editorial Design, München
eBook-Herstellung: Vicki Braun
ISBN 978-3-8338-8836-6
01. Auflage 2023
Bildnachweis
Coverabbildung: Bernhard Haselbeck
Illustrationen: Birgit Kohlhaas
Fotos: Rolf Brenner, Bernhard Haselbeck, Marina Jerkovic, Dorothea Steinbacher, Ingrid Lisa Storl, Storl/privat
Syndication: www.seasons.agency
GuU 8-8836 03_2023_04
Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.
Die GU-Homepage finden Sie im Internet unter www.gu.de
www.facebook.com/gu.verlag
LIEBE LESERINNEN UND LESER,
wir wollen Ihnen mit diesem E-Book Informationen und Anregungen geben, um Ihnen das Leben zu erleichtern oder Sie zu inspirieren, Neues auszuprobieren. Wir achten bei der Erstellung unserer E-Books auf Aktualität und stellen höchste Ansprüche an Inhalt und Gestaltung. Alle Anleitungen und Rezepte werden von unseren Autoren, jeweils Experten auf ihren Gebieten, gewissenhaft erstellt und von unseren Redakteur*innen mit größter Sorgfalt ausgewählt und geprüft.
Haben wir Ihre Erwartungen erfüllt? Sind Sie mit diesem E-Book und seinen Inhalten zufrieden? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Und wir freuen uns, wenn Sie diesen Titel weiterempfehlen, in ihrem Freundeskreis oder bei Ihrem Online-Kauf.
KONTAKT ZUM LESERSERVICE
GRÄFE UND UNZER VERLAG Grillparzerstraße 12 81675 München
Wichtiger Hinweis
Die Gedanken, Methoden und Anregungen in diesem Buch stellen die Meinung bzw. Erfahrung der Verfasserin dar. Sie wurden von der Autorin nach bestem Wissen erstellt und mit größtmöglicher Sorgfalt geprüft. Sie bieten jedoch keinen Ersatz für persönlichen kompetenten medizinischen Rat. Jede Leserin, jeder Leser ist für das eigene Tun und Lassen auch weiterhin selbst verantwortlich. Weder Autorin noch Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen praktischen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.
Vorwort
Als ich nach Europa kam, konnte ich kaum kochen. Ein paar meiner absoluten Lieblingsgerichte – Cookies, Hamburger, Egg Sandwich – hatten Mutter und Großmutter mir beigebracht. Aber in der Schule galt unter uns Mädchen Kochen als uncool. Wir mussten damals ein Jahr das Fach Kochen belegen, während die Jungs ein Jahr Schreinern lernten. Diese Ungerechtigkeit hat uns das Kochen noch mehr verleidet. Ich weiß nicht, wie wir uns das für die Zukunft vorstellten – dachten wir, wir würden das ganze Leben lang im Restaurant essen?
Rückblickend finde ich es natürlich sehr schade, dass wir damals das Kochen nicht schätzten. Doch auch heute stelle ich fest, dass immer weniger junge Leute kochen können. Eigentlich, finde ich, sollte Kochen für alle ein verpflichtendes Schulfach sein!
Jedenfalls lernte ich dann in der Schweiz meinen Mann kennen, der mir erzählte, dass man aus Brennnesseln eine Suppe kochen kann. Das versuchte ich gleich, aber heraus kam eine Art salziger Brennnesseltee, der, wenn ich ehrlich bin, ungenießbar war.
Wir machten bald die Bekanntschaft eines alten Mannes, Arthur Hermes, der allein im Wald lebte und eine ungewöhnliche Art zu kochen hatte, die er »planetarisches Kochen« nannte. Wolf-Dieter hat das ja auf den folgenden Seiten beschrieben. Jeder Wochentag war einem Planeten und jedem Planeten ein Gemüse zugeordnet. Wir haben dann zwar selbst nicht so gekocht, dennoch hat dieses Erlebnis mir die Tür geöffnet zu der Erkenntnis, dass Kochen eine hohe Kunst sein kann. Und mehr noch: dass Kochen eine der schönsten Beschäftigungen überhaupt ist – Zutaten bewusst auszusuchen und sorgfältig zu verarbeiten und dann ein wohlschmeckendes Ergebnis zu erhalten!
Seit der Zeit habe ich dazugelernt. Einige der Rezepte, die Eingang in unser Repertoire und auch in dieses Buch gefunden haben, stammen von meiner Schwiegermutter. Sie war eine leidenschaftliche Köchin, und in ihrem »Klein-Deutschland« in Ohio lernte ich die gutbürgerliche deutsche, also eigentlich die sächsische Küche kennen. Vom Hefekuchen über Quarkklitscher bis zum weihnachtlichen Gänsebraten kamen so viele köstliche Gerichte auf den Tisch, dass ich mir eifrig ihre Rezepte aufgeschrieben habe, wenn wir zu Besuch waren. Unsere Oma ist jetzt schon eine Weile im Himmel, und sie wäre sicher unglaublich stolz darauf, dass ihre Rezepte hier verewigt sind.
Aber auch unser Sohn Ingo hat sehr zur Verfeinerung unserer Küche beigetragen. Als die Kinder noch zur Schule gingen, waren meine Tage voll mit dem Hin- und Herkutschieren der beiden, jeweils viele Kilometer auf einer rumpeligen, im Winter schlecht geräumten Bergstraße. Und überhaupt war es eine große Herausforderung, das tägliche Leben zu bewältigen in einem Land, dessen Sprache ich kaum beherrschte und dessen Sitten mir nicht vertraut waren. Das Resultat war unter anderem, dass es in der Küche immer recht einfach, man könnte auch sagen: fantasielos zuging – nach dem Motto: Hauptsache, es gibt was zu essen. Als Ingo ins Teenageralter kam, fing er an, immer mehr selber zu kochen, und bei ihm fehlte die Fantasie kein bisschen – im Gegenteil: Unser Essen wurde immer interessanter und schmeckte immer besser! Das hat bis heute angehalten, und ohne seinen Einsatz hätte dieses Buch nicht entstehen können. Wenn es bei uns zu Hause darum geht, etwas besonders Gutes oder etwas Neues zu kochen, ist mittlerweile Ingo der Chef, und ich bin die Sous-Chefin. Dafür und für seine Unterstützung bei diesem Kochbuch bin ich ihm sehr dankbar!
Nun wünsche ich allen Leserinnen und Lesern viel Freude mit unseren Rezepten!
Christine Storl
Einführung von Wolf-Dieter Storl
»Wir essen nicht nur das, was sich materiell vor unseren Augen ausbreitet, sondern wir essen mit das Geistige, das sich hinter dem Materiellen verbirgt.«
Rudolf Steiner
»Brahman ist Nahrung. Nur wer sich gewahr ist, dass er Gott isst, isst wirklich.«
Taittireya Upanischad
John, der Mathelehrer an unserer Highschool, schmiss den Job hin, für den er wirklich nicht geschaffen war, und wurde Park-Ranger. Was ihn interessierte, war die Natur, insbesondere die Wildpflanzen. Das verband uns. Im Sommer trat er seine neue Stelle in der unberührten Wildnis, an der Westflanke des Teton-Gebirges in Wyoming, an. Er lud mich ein, den Sommer mit ihm in seiner Ranger-Blockhütte zu verbringen. Wir fuhren die lange Strecke von Ohio bis zu dem Nationalpark und wanderten zwei Tage durch verwunschene Landschaft, die würzig nach Steppenbeifuß und Ponderosa-Kiefern roch und in der Gabelböcke und Eselhasen (jack rabbits) munter herumsprangen, Präriehunde (prarie dogs), eine Art Erdhörnchen, warnend bellten, wenn man sich ihren Kolonien näherte, und Kojoten bei Sonnenuntergang wie ein Geisterchor mit ihren hohen Stimmen heulten. Die Ranger-Hütte war unversehrt. Im vorhergehenden Jahr waren Bären eingebrochen und hatten die dort gelagerten Büchsen mit Gemüse und Fleischkonserven mit ihren starken Zähnen aufgebissen und ausgeschleckt. »Ihre Nasen sind so gut, dass sie trotz Blech den Inhalt riechen können«, sagte John. Diesmal war der Nahrungsmittelvorrat, der mit dem Hubschrauber angeliefert worden war und für drei bis vier Monate reichen sollte, intakt. Wir waren hungrig nach der Wanderung. John öffnete gleich eine Dose und löffelte den Inhalt, ohne ihn aufzuwärmen oder in einen Teller zu füllen. Das machte er in den folgenden Tagen jedes Mal, wenn er Hunger hatte. Ich war verdutzt.
»Wir könnten doch den Büchseninhalt erst mal warm machen, auf zwei Teller verteilen und dann am Tisch gemeinsam essen«, sagte ich.
»Warum den Firlefanz? Das ist nicht nötig; egal ob heiß oder kalt, die Nährstoffe bleiben dieselben«, gab er zurück. Für ihn war, wie für viele Amerikaner in der damaligen Zeit, Essen vor allem ein Auftanken der Körpermaschine. Das galt als sachlich und wissenschaftlich. Hauptsache, man bekam genügend Kalorien, Proteine, Vitamine und Mineralstoffe. Wichtig war die diesbezüglich ausgeglichene Kost (balanced diet). Dazu gehörte Fleisch, etwas Gemüse und ein Grundnahrungsmittel (staple), bestehend vor allem aus Mais oder Kartoffeln. Aus dem Essen einen Genuss zu machen, etwa wie die Franzosen, die ein fast erotisches kulinarisches Abenteuer mit mehreren Gängen veranstalten, widersprach der puritanischen Ethik der weißen angelsächsischen protestantischen Bevölkerung des Mittelwestens.
Ich erzähle das nicht wertend, ich rümpfe nicht die Nase, wie manche Europäer es tun, wenn ich über die amerikanische Esskultur berichte. Als Kulturanthropologe kann ich sagen, es ist lediglich eine von vielen Möglichkeiten, Mahlzeiten und den Umgang mit Nahrungsmitteln zu gestalten.
Wolf-Dieter mit Mutter und Besuch, Ende der 1950er-Jahre.
Miteinander Essen und Trinken verbindet die Menschen. Auch die Amerikaner wissen, dass das gemeinschaftliche Essen ein Akt ist, der Familie, Sippe und Freunde zusammenschweißt. Ein Kumpan oder Kumpel – aus dem Lateinischen cum, »mit«, und panis, »Brot« – ist jemand, mit dem man Brot teilt, ein Brotgenosse, und eine Kompanie ist eine eng verbundene Handelsgesellschaft oder militärische Einheit. In dem Amerika, das ich in den 1950er-Jahren als Junge kennenlernte, waren es die gemeinsamen Mahlzeiten, insbesondere das Abendessen (supper), das die Familienmitglieder fest verband. Allgemein galt der Vater als der Brotgewinner, der Fürsorger (provider), die Mutter dagegen als diejenige, die die Kinder und den Haushalt versorgt und das gemeinsame Essen bereitet. Diese normative Aufteilung der sozialen Rollen änderte sich in den 60er-Jahren, als mit den Kosten des Vietnamkrieges der Wohlstand weniger wurde und es der Lohnarbeit nicht nur des Mannes, sondern auch der Frau bedurfte, um den gewohnten Lebensstandard zu halten. Das sprengte die Familien. Außer am Sonntag oder an Feiertagen wurde kaum mehr gemeinsam gegessen, keiner hatte Zeit, wirklich zu kochen. Beim abendlichen Fernsehen machte man schnell ein TV-Dinner im Ofen oder in der Mikrowelle heiß und löffelte es beim Glotzen. Das Fertiggericht war in Aluminiumfolie eingepackt und wurde schnell – während eines Werbeblocks oder des Toilettenbesuchs – heiß gemacht. Manche begnügten sich mit Snacks, also Kartoffelchips, Popcorn oder gar etwas Süßem.
JUNKFOOD
Auch Fast-Food-Filialen wurde damals beliebt. Bald, Anfang der 70er-Jahre, kam noch das Drive-in-Restaurant hinzu, in dem man nicht einmal das Auto verlassen musste, um über ein Mikrofon das Essen zu bestellen. Da verlor man keine Zeit. Das kam den Angestellten und den Geschäftsleuten entgegen, denn ohne lange Wartezeit konnten sie in der kurz bemessenen Mittagspause ihre Hamburger, Pommes frites (french fries), heiße Pizza, chicken wings, cheeseburgers, milkshakes, beef burgers und andere, oft mit Geschmacksverstärker versehene Magenfüller bestellen. Auch für working moms (werktätige Mütter) war es einfach, den Kindern einige Münzen zu geben und sie zur Imbissfiliale zu schicken. Inzwischen kochen Großkonzerne für die Menschen. Rund 40 Prozent der US-Bürger essen täglich Fast Food. Jugendliche und Männer mehr als Frauen, schwarze und indigene Minderheiten mehr als alle anderen.
Eine Auswirkung dieser Entwicklung ist Fehlernährung. Ein hoher Zucker- und Fettanteil haben dazu geführt, dass die Amerikaner stark übergewichtig sind und viele an Diabetes leiden. Zur gleichen Zeit ist ein neuer Markt für Nahrungsergänzungsmittel, Mineralien und Vitaminpillen entstanden. Es werden auch viele Kochbücher verkauft, denn je weniger selber gekocht wird, umso beliebter werden diese.
HAMBURGERS
Die Idee des Hamburgers – eine gegrillte Scheibe gepresstes Hackfleisch, in getoastete Brötchen gepackt und garniert mit Salat, Zwiebel-, Tomaten- und Gewürzgurkenscheiben, Ketchup, Mayonnaise und Senf – ist Teil des American Way of Life. Bratklopse – mundartlich Buletten, Frikadellen, Fleischpflanzerl, Fleischküchle, Hacktäschli, Hackhuller oder (in Westsachsen) Gewiegteklöseln genannt – hatten die Siedler aus der Alten Welt, insbesondere der Nordseeküste, nach Amerika mitgebracht. Als ich im Mittelwesten aufwuchs, hatte jede kleine Ortschaft und jede Nachbarschaft einen kleinen selbstständigen Hamburgerstand. Es waren meistens ältere Paare im Ruhestand, die diese Imbisse vor ihrem Haus oder in der Garage betrieben und sich damit ein wenig Zusatzgeld verdienten. Manche dieser Mom and Pop Stands machten besonders leckere Hackfleischbuletten, sodass man gewillt war, fünf oder zehn Meilen extra zu fahren, um sie zu genießen.
Das änderte sich Anfang der 1960er-Jahre, als Raymond Albert »Ray« Kroc in das Bulettenbraterei-Geschäft einstieg. Er kaufte den Imbiss der McDonald-Brüder in Kalifornien und entwickelte ein effizientes, standardisiertes, rationalisiertes Vertriebssystem für Fast Food. Unter seinem Nachnamen hätte er wohl keinen Erfolg gehabt, denn Kroc wird automatisch mit crock assoziiert und das bedeutet »Blödsinn« oder gar »ein Kübel Jauche« (a crock of shit). Mit einem sauberen Namen und einem soliden Geschäftsmodell wurde die Fast-Food-Kette ein internationaler Erfolg. Als Ray Kroc 1984 starb, hatte McDonald’s 7500 Filialen und nahm 8 Milliarden Dollar pro Jahr ein. Andere Konzerne, wie Burger King oder Burger Chef, übernahmen das Geschäftsmodell. Heute gibt es 40 000 McDonald’s-Standorte, allein 1480 in der Bundesrepublik. Vorbei ist es mit den rustikalen Mom and Pop Hamburger Stands, die einst so beliebt waren. Dennoch gehören hamburgers bei den Amerikanern noch immer zum Alltag, auch bei der Familie meiner Frau.
FESTESSEN
Es sind die nationalen Feiertage, an denen die Familien noch zusammenkommen und an denen in den USA noch gekocht wird. Dazu gehört der Nationalfeiertag (4th of July), der mit einem Barbecue im Freien, am offenen Grill, zelebriert wird, wobei der Vater, auch wenn er sonst ein Pantoffelheld ist, wie einst der keltische Häuptling den Braten tranchiert und verteilt, derweil die Mutter Maisbrot, Salat und Beilagen auftischt.
Thanksgiving Day, eine Art Erntedankfest, wird in den USA reichlich spät im Jahr, nämlich am vierten Donnerstag im November gefeiert. Auch hier versammelt sich die ganze Familie und schmaust. Im Mittelpunkt der Festmahlzeit steht ein riesiger gestopfter Truthahn (turkey), der mit Cranberry-Sauce, Süßkartoffeln, Ofenkartoffeln und Mais serviert wird. Zum Nachtisch gibt es pumpkin pie (Kürbiskuchen) oder pecan pie (Pekannusskuchen) – alles indigene amerikanische Nahrungsmittel, die schon die Indianer kannten! Das Fest soll nämlich an die puritanischen Pilgerväter (pilgrim fathers) erinnern, jene englischen Bootsflüchtlinge, die von den Wampanoag-Indianern im Winter 1620/21 vor dem Verhungern gerettet wurden. Daran, dass die Puritaner kurze Zeit später die Indianer vertrieben und auszurotten versuchten, wird aber nicht erinnert.
Auch Weihnachten, Geburtstage oder der Tag, an dem ein junger Mann vom militärischen Einsatz aus Übersee wieder heimkommt, sind wichtige Anlässe für die Amerikaner, ein Festessen zu kochen.
Als Einwanderer haben wir in unserer Familie diese Feste weniger gefeiert, sondern eher die traditionellen mitteleuropäischen. Da gab es zu Weihnachten auch keinen gemästeten Truthahn, sondern die Weihnachtsgans. Den Kürbiskuchen habe ich jedoch lieben gelernt. Schon allein deswegen pflanze ich in unserem Selbstversorgergarten die robusten Hokkaido-Kürbisse an.
Wolf auf dem Arm seines Großvaters, zwischen Mutter und Großmutter und weiteren Anverwandten.
HUNGERZEITEN
Heutzutage wird ungefähr die Hälfte der Lebensmittel weggeworfen. Hunger und Nahrungsmittelmangel kennt man nur aus den Medien. Besonders in den Wohlstandsgesellschaften in Europa und den USA ist das der Fall. Vielleicht erzählen die ganz Alten, die Großmütter oder Großväter, von den Hungerzeiten nach dem Krieg, als es in den Städten kaum etwas zu essen gab und man aufs Land ging zum »Hamstern«, um Wertsachen, etwa Silberbesteck, bei den Bauern gegen einige Kartoffeln einzutauschen.
In der sowjetischen Besatzungszone, in der wir lebten, war der Hunger verheerend. Da gruben mein Opa und die Vertriebenen, die wir in unsere Villa aufgenommen hatten, den Rasen um, um einen Gemüsegarten anzulegen. Die Lauben, in denen man es sich in guten Zeiten am Sonntag bei Kaffee und Kuchen gemütlich gemacht hatte, wurden zu Kaninchen- und Hühnerställen umfunktioniert. Essbare Wildkräuter wurden gesammelt und Pilze, die unter den Hecken wuchsen.
Kaum ein heutiger Zeitgenosse weiß, wie schrecklich es ist, als Kind mit leerem Magen ins Bett zu gehen. Eines Nachts träumte ich, dass mir eine »Bemme«1 vor der Nase vorbeischwebte. Gierig biss ich zu, die Zähne klackten aufeinander, ich wachte auf und musste bitterlich weinen.
Einmal konnte mein Großvater auf dem Schwarzmarkt etwas Stoff gegen ein Stück Butter eintauschen. Das Stück wurde sparsam und wie ein Heiligtum behandelt. Erst zwei Jahre später, nachdem wir im Herbst 1947 schwarz über die Grenze in die Westzone geflohen waren, erfuhr ich, dass Butter nicht ranzig schmeckt. Aber auch im Westen konnte der tägliche Kalorienbedarf der Bevölkerung nicht gedeckt werden. Da gab es Lebensmittelkarten, Hamsterfahrten, Tauschhandel auf dem Schwarzmarkt, wo Zigaretten und einzelne Kaffeebohnen Zahlungsmittel waren. Überall, auf Brachflächen und in den Schrebergärten, versuchten die Menschen, Kohl, Möhren und anderes Gemüse anzubauen. Wie im Osten ging man im Herbst in die Wälder und sammelte Heidelbeeren, Brombeeren, Preiselbeeren und Pilze aller Art, um zu überleben. Es schien so, als ob Mutter Natur Mitleid hatte, denn immer waren die Körbe voll. Unser Frühstück bestand aus Brotscheiben, die wir mit Zuckerrübensirup bestrichen, den wir aus der Zuckerrübenfabrik holten.
Diese Erlebnisse waren für mich prägend. Immer haben mich essbare Wildpflanzen und das Gemüsegärtnern interessiert. Als Neunjähriger befreite ich hinter dem Haus, in dem wir wohnten, eine kleine Fläche vom Schutt und pflanzte eine Kartoffel, eine Kohlpflanze und anderes essbares Grünzeug. Ich düngte die Pflänzchen mit »Pferdeäppeln«, die ich auf dem Heimweg von der Schule von den Straßen aufsammelte und in meinem Schulranzen verstaute. Damals nach dem Krieg gab es noch viele Pferdewagen und kaum Kraftfahrzeuge auf den Straßen.
UNERMESSLICHER WOHLSTAND
Großen Eindruck machten die »Care-Pakete«, die uns die Verwandten meines Vaters aus Ohio immer wieder schickten. Die rochen ganz merkwürdig, und das Essen, das darinnen war, hatte einen ungewöhnlichen Geschmack. Sie waren es auch, die uns nach Amerika einluden, wo, wie sie sagten, alles größer und besser (bigger and better) ist.
Und das war es auch. Im Gegensatz zu dem Nachkriegseuropa, in dem das Wirtschaftswunder noch nicht in Gang gekommen war, konnte man meinen, man sei im Schlaraffenland gelandet. Es war ein echter Kulturschock, das erste Mal in einem Supermarkt einkaufen zu gehen! Auf einem riesigen Parkplatz stellte die Tante ihren Straßenkreuzer ab. Wie die anderen Kunden schob sie einen riesengroßen Einkaufswagen durch die Halle und füllte diesen mit ganzen Bergen von Lebensmitteln, mit Steaks, Hähnchen, weichen Weißbroten und Schachteln mit den komischen Maisflocken, die man jeden Morgen zum Frühstück aß. Vieles, was da eingeladen wurde, kannte man nicht oder kaum, zum Beispiel Obstsorten wie Bananen, Orangen oder Pampelmusen. Zu Hause kamen diese dann in riesige, vollgestopfte Kühlschränke und Tiefgefriertruhen. In Europa gab es damals keine solche Kühltechnik, eventuell einen kühlen Keller. Auch Supermärkte kannte man da nicht, sondern nur kleine Krämerläden, wo man sich anstellte und lediglich für den täglichen Bedarf einkaufte. Das bisschen Mehl, Graupen oder Nudeln nahm man in Tüten aus spitz zusammengerolltem Zeitungspapier mit. Wurst – wenn es überhaupt welche gab – holte man beim Fleischer, Brot gab es beim Bäcker, Gemüse auf dem Markt oder beim Gemüsehändler, Heringe im Fischgeschäft. Wenn meine Mutter Milch brauchte, wurde ich mit einem Krug losgeschickt; die Milch wurde da direkt hineingefüllt. Dasselbe galt für das abendliche Bier, auch da schickte man Kinder mit Krügen, um das Bier zu holen.
In Amerika war es ganz anders. Meine Eltern konnten kaum glauben, wie billig die Nahrungsmittel waren. Für einen Dollar konnte man die Einkaufstasche mit Brot, Milch und anderen Lebensmitteln füllen. Knochen und Innereien – Leber, Nieren, Lunge und so weiter – gab es umsonst; die holten sich Hundebesitzer, Trapper oder auch die Schwarzen, die damals getrennt von den Weißen in Ghettos leben mussten. Die Afroamerikaner machen aus den Innereien, aus Schweinsfüßen, -schnauzen, -ohren und -schwänzen, die die Weißen nicht mögen, dann ihre Chitlins, die Teil des sogenannten soul food (Nahrung für die Seele) sind. (Schweizer hätten sich gefreut, kostenlos Wädli, Füessli, Öhrli, Schwänzli und Schnorrli für ihr traditionelles Gnagi-Gericht zu bekommen). Auch Brot und Gebäck gab es in den 1950er-Jahren in Amerika kostenlos, wenn es einen Tag alt war. Bäckereien wie in der Alten Welt gab es nicht, nur große Brotfabriken. Dort holten sich die Farmer säckeweise Backwaren vom Vortag als Schweine-, Hühner- oder Pferdefutter. Auch wir besorgten uns jede Woche einen großen Sack voll mit Brot, weichen Milchbrötchen und übersüßem Gebäck aus der Fabrik. Es war so viel drin, dass man es kaum aufessen konnte.
Über das Brot wunderten wir uns. Der Standardlaib war so leicht, watteweich und fluffig, dass man ihn zwischen den Händen auf die Größe einer dicken Scheibe zusammenpressen konnte. Die Scheiben zerrissen, wenn man sie mit kalter Butter schmieren wollte. Nur wenn sie im Toaster geröstet wurden, konnte man die Butter auftragen. Das Gerät, das man Toaster nannte, kannten wir auch noch nicht. Wir vermissten das deutsche Landbrot, das Vollkornbrot, Roggenbrot und Pumpernickel. Diese schweren Brotsorten waren unsere Leibspeise gewesen, sie gehörten zu unserer ethnischen Identität. Zwar gab es sogenanntes pumpernickel, aber das war lediglich dunkel gefärbtes, weiches Industrie-Weißbrot.
Weißbrot war ja einst, im feudalen Europa, die Speise der Fürsten und Herrscher. Es waren die Engländer, die als Erste eine Vorliebe für Weißbrot entwickelten. Anthropologen fanden inzwischen heraus, dass diese Vorliebe mit hohem Zuckerkonsum einhergeht. In Kolonialzeiten wurde die Insel mit Zucker überschwemmt. Bei hohem Zuckerkonsum fehlen dem Körper die Enzyme, die für die Verdauung von Vollkornbrot nötig sind.2 Der Zuckerabhängige neigt zu Korpulenz, Zahnproblemen und Störung der Bauchspeicheldrüse. Im Gegensatz zum Nachkriegseuropa waren süße Speisen – Pancakes mit Sirup zum Frühstück, Gebäck, candy bars (Schokoriegel), zuckrige Softdrinks – in Amerika allgegenwärtig und die daraus resultierenden gesundheitlichen Probleme ebenfalls. Da meine Zähne kariesfrei waren, wurde ich schon als Junge öfters gefragt, ob ich schon ein künstliches Gebiss hätte.
Unvorstellbar für mich war es, dass wir Kinder, wenn wir mal Hunger oder Durst hatten, einfach in die Küche der Nachbarn gehen konnten und, ohne zu fragen, in die Cookie-Dose langen, oder ein popsicle (Eis am Stiel) aus dem Gefrierfach ein Stück Kuchen, einen gebratenen Hühnerschenkel, etwas Obst, einen bunten, übersüßten Softdrink oder was auch immer aus dem vollgestopften Kühlschrank holen konnten. Man brauchte nicht einmal artig Danke zu sagen.
Leider zerstritten wir uns irgendwann mit unseren Verwandten; die kulturellen Unterschiede – darunter auch die das Essen betreffenden – waren einfach nicht überbrückbar. Mein Vater bekam einen Job als Eisenbahntelegrafist in einem kleinen Nest im ländlichen Ohio. Dort konnte man den unbeschreiblichen Wohlstand förmlich riechen. Da es damals keine öffentliche Kehrichtentsorgung gab, verbrannten die Einwohner ihren Müll, auch was auf den Tellern übrig geblieben war, in alten Öltonnen hinter ihren Häusern. Am Abend schwelte der bläuliche Rauch brennender Abfälle durch das Dorf. Es roch vor allem nach verbranntem Fleisch. Ein normales Abendessen (supper) bestand aus Steaks oder Braten, mit ein bisschen Kartoffelmus und etwas Gemüse als Verzierung. Die Fleischportionen bedeckten fast den ganzen Teller; kein Mensch konnte so viel auf einmal essen.
HEIMATLICHE LEBENSMITTEL
Im Laufe der Zeit passten wir uns an und fügten uns in den American Way of Life ein. Bei den Mahlzeiten jedoch versuchten meine Eltern an der mitteleuropäischen Esskultur festzuhalten. Sie nahmen einmal in der Woche die lange Fahrt in die Stadt Cleveland – hin und zurück rund 100 Meilen – auf sich, wo es verschiedene ethnische Stadtviertel gab. Neben den Stadtteilen, in denen sich polnische, slowenische und italienische Immigranten niedergelassen hatten, gab es auch ein Viertel, in dem deutschsprachige Einwanderer lebten – mit Metzgern, bei denen man Thüringer Leberwurst, Bratwurst oder Jagdwurst kaufen konnte und Bäckereien mit »richtigem« Brot und Brötchen.
Eine der für Soziologen sichersten Methoden, die ethnischen Wurzeln einer Familie herauszufinden, ist es, in ihre Küche zu schauen. Noch lange Zeit nachdem man sich in Bezug auf Kleidung, Benehmen, Sitten und Sprache der Mehrheitsgesellschaft angepasst hat, bleibt die Esskultur erhalten. Bei den Nachkommen der Nordwesteuropäer spielen Hafer (für porridge), Roggen, Gerste (für Bier) und Schweinefleisch eine wichtige Rolle; bei Einwanderern aus dem Mittelmeerraum sind es Weizen, Wein, Oliven und Ziegen- oder Schafskäse. Bei den Familien meiner polnischen Schulkameraden gab es Brot, Quark, Wurst und Gurken zum Frühstück; ansonsten Piroggen (Teigtaschen), Brotsuppe, viel Schweinefleisch, Borschtsch aus selbst angebauten Roten Beten, und besonders verehrt, man könnte fast sagen heilig, war die Kielbasa, die würzige Wurst.
Das Frühstück unserer angloamerikanischen Nachbarn bestand aus zuckersüßen Getreideflocken mit Milch, gebuttertem Toast, eventuell auch Pancakes mit Ahornsirup, knusprig gebratenem Speck (bacon), gebratenen Würstchen (sausage links) und Orangensaft. Bei uns dagegen gab es vor allem Brötchen mit Butter und Marmelade, eventuell auch mit Käse- und Wurstscheiben und einem gekochten Ei – ein sogenanntes continental breakfast. Mittags gab es oft die typisch sächsischen Kochgerichte, und zum Abendbrot aß man Brotschnitten mit Wurst und Käse. Im Gegensatz zu den meisten Nachbarn aß nicht jeder für sich, sondern wir setzten uns bei den Mahlzeiten gemeinsam an den mit einer frischen Tischdecke gedeckten Tisch. Auch lief bei uns nicht der Fernseher oder das Radio, während wir aßen.
Wie andere Einwanderer besannen auch wir uns besonders an Feiertagen auf die ethnischen Traditionen. Der heiligen Weihnachtszeit ging der Advent voraus, wobei im Dezember jeden Sonntagnachmittag, feierlich bei Kaffee und Kuchen, eine weitere Kerze am Adventskranz angezündet wurde. Unsere Nachbarn kannten dieses Ritual nicht. In der Adventszeit roch es gut in der Küche, es wurden Kekse gebacken und auch der Stollen zubereitet. Wenn etwas den Sachsen heilig ist, dann ist es der Stollen, ein süßes Hefebrot mit viel Butter, Rosinen und Mandeln. Jede Hausfrau hat ihr eigenes Familienrezept dafür. In Sachsen war es Brauch, dass die Frauen mit Liebe den Teig zubereiteten und kneteten und den geformten Stollen dann zum Bäcker brachten, um ihn dort backen zu lassen. Er wurde nach dem Backen abgeholt, in ein Tuch eingewickelt und für die Festtage aufbewahrt. Das ging in Ohio natürlich nicht, meine Mutter musste ihn in der Bratröhre selber backen. Wie bei vielen Thüringern und Sachsen war dieses Gebäck ein heiliges Gut. Es stellte, ohne dass man es ausdrücklich hervorhob, das Christkind als süßes, kleines, neugeborenes, in Tücher gewickeltes Wickelkind dar. Erst am Nachmittag des Heiligen Abends, wenn die vier roten Kerzen am grünen Adventskranz das letzte Mal angezündet waren, wurde der Stollen angeschnitten und bei gutem Kaffee, der aus Meißner Porzellantassen getrunken wurde, feierlich verspeist. Nach dem Stollenessen, wenn es draußen dunkelte, wurden die Wachskerzen am Weihnachtsbaum angezündet, der Vater las das Weihnachtsevangelium vor und sagte das Weihnachtsgebet auf, dann folgte die Bescherung und schließlich ein köstliches Abendessen mit belegten Broten.
Zwiesprache mit dem Thanksgiving-Truthahn
Weihnachten wäre nicht Weihnachten für uns gewesen ohne den Gänsebraten. Auch diesen kannten unsere Nachbarn nicht, sie schmausten am Christmas Day einen Truthahn. Wir besorgten unsere Gans von polnischen Freunden, die einen Bauernhof hatten. In die ausgenommene Gans kam ein Beifußzweig als Würze. Die Gans wurde mit grünen Klößen und Rotkohl serviert. »Die Klöße müssen schwimmen!« (in der leckeren Bratensauce), hieß es. Das Verspeisen der Gans zur Wintersonnenwende oder wie bei den Kelten in der Zeit der Totengeister (Samhain) im November – die heutige Martinsgans – hat uralte kulturelle Wurzeln. Wurzeln, die bis in die jüngere Steinzeit zurückgehen. Die Gans war ein Symbol des schamanischen Fluges, sie galt als einer der Vögel der paläolithischen Göttin, die wir aus dem Märchen als Frau Holle kennen; auch der Beifuß, der als Pionierpflanze schon in der Mammutsteppe in der Eiszeit wuchs, gehörte den Schamanen und dem Seelenflug.3