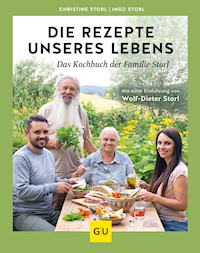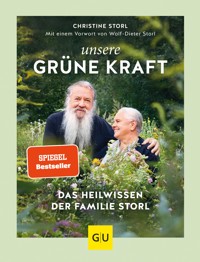
15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Alternativmedizin
- Sprache: Deutsch
Pflanzen können ihre Lebenskraft an uns Menschen weitergeben. Der Ethnobotaniker Wolf-Dieter Storl und seine Frau Christine kennen sich mit den Heilwirkungen von Pflanzen, Hausmitteln und den traditionellen Heilmethoden der Naturvölker sehr gut aus und vertrauen ganz auf diese grüne Kraft, die sie in Wald, Wiese, Garten und Küche finden. In Ihrer Familie haben sie viele positive Erfahrungen mit den natürlichen Heilkräften gesammelt. Dieses Buch stellt ihre pflanzlichen Verbündeten – die wichtigsten Heilpflanzen der Familie Storl, ihre besten Hausmittel und überlieferte Heilanwendungen – für alle Alltagsbeschwerden vor. Christine Storl erzählt wie die Familie diese grüne Kraft selbst nutzt und sie verrät uns die uralten Rezepturen, die sie weiter entwickelt und verfeinert hat. Alle praktischen Anwendungen werden anschaulich gezeigt. So kann jeder die Storlschen pflanzlichen Verbündeten auch für sich selbst nutzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Unsere eBooks werden auf kindle paperwhite, iBooks (iPad) und tolino vision 3 HD optimiert. Auf anderen Lesegeräten bzw. in anderen Lese-Softwares und -Apps kann es zu Verschiebungen in der Darstellung von Textelementen und Tabellen kommen, die leider nicht zu vermeiden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Impressum
© eBook: GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, München, 2019
© Printausgabe: GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, München, 2019
Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung und öffentliche Zugänglichmachung, auch auszugsweise, sowie die Verbreitung durch Film und Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Zustimmung des Verlags.
Projektleitung: Cornelia Nunn
Lektorat: Dorothea Steinbacher
Bildredaktion: Cornelia Nunn, Esther Herr, Natascha Klebl
Covergestaltung: independent Medien-Design, Horst Moser, München
eBook-Herstellung: Gabriel Mlesnite
ISBN 978-3-8338-7013-2
2. Auflage 2019
Bildnachweis
Fotos: Ingrid Lisa Storl; Alamy; Rolf Brenner; Frank Brunke; GAP/Jonathan Buckley; Andrea Jones; Gary Smith; Jo Whitworth; Bernhard Haselbeck; iStock; Mauritius Images; Shutterstock; Dorothea Steinbacher; Storl/privat
Syndication: www.seasons.agency
GuU 8-7013 10_2019_01
Aktualisierung 2019/001
Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.
Die GU-Homepage finden Sie im Internet unter www.gu.de
www.facebook.com/gu.verlag
LIEBE LESERINNEN UND LESER,
wir wollen Ihnen mit diesem E-Book Informationen und Anregungen geben, um Ihnen das Leben zu erleichtern oder Sie zu inspirieren, Neues auszuprobieren. Wir achten bei der Erstellung unserer E-Books auf Aktualität und stellen höchste Ansprüche an Inhalt und Gestaltung. Alle Anleitungen und Rezepte werden von unseren Autoren, jeweils Experten auf ihren Gebieten, gewissenhaft erstellt und von unseren Redakteuren/innen mit größter Sorgfalt ausgewählt und geprüft.Haben wir Ihre Erwartungen erfüllt? Sind Sie mit diesem E-Book und seinen Inhalten zufrieden? Haben Sie weitere Fragen zu diesem Thema? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung, auf Lob, Kritik und Anregungen, damit wir für Sie immer besser werden können. Und wir freuen uns, wenn Sie diesen Titel weiterempfehlen, in ihrem Freundeskreis oder bei Ihrem online-Kauf.
KONTAKT
GRÄFE UND UNZER VERLAG LeserservicePostfach 86 03 1381630 MünchenE-Mail: [email protected]
Telefon: 00800 / 72 37 33 33*Telefax: 00800 / 50 12 05 44*Mo-Do: 9.00 – 17.00 UhrFr: 9.00 bis 16.00 Uhr (*gebührenfrei in D,A,CH)
WICHTIGE HINWEISE
Manche der in diesem Buch vorgestellten Pflanzen sind regional geschützt. Bitte informieren Sie sich bei den Behörden Ihres (Bundes-)Landes über die geltenden Vorschriften. Wild wachsende Pflanzen, die nicht unter Naturschutz stehen, dürfen in der Regel genutzt werden; sammeln Sie jedoch nur einzelne Pflanzen, sodass der Bestand geschont wird.
Die Gedanken, Methoden und Anregungen in diesem Buch stellen die Meinung bzw. Erfahrung der Verfasserin dar. Sie wurden von der Autorin nach bestem Wissen erstellt und mit größtmöglicher Sorgfalt geprüft. Sie bieten jedoch keinen Ersatz für kompetenten persönlichen medizinischen Rat. Jede Leserin, jeder Leser ist für das eigene Tun und Lassen auch weiterhin selbst verantwortlich. Weder Autorin noch Verlag können für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den im Buch gegebenen praktischen Hinweisen resultieren, eine Haftung übernehmen.
HEILEN IST WEIBLICH
VON WOLF-DIETER STORL
»Ich habe viel in der Krankheit gelernt, das ich nirgends in meinem Leben hätte lernen können.«
Goethe
Es muss tatsächlich so etwas wie eine weibliche Intuition geben, was das Heilen und das Finden und Handhaben der passenden Heilmittel – Kräuter, Wasser, Hitze, Kälte oder Heilerde – betrifft. Es scheint ein spontanes Wissen, ein gewisser Spürsinn zu sein, über den viele Frauen, insbesondere Mütter und Großmütter, verfügen. Das ist etwas anderes als das studierte, angelesene Wissen der offiziell sanktionierten Schulmediziner und Ärzte.
GROSSMÜTTERMEDIZIN
Die »Großmüttermedizin« ist ursprünglicher, unmittelbarer als die gelehrte Biomedizin (so nennt sich die Schulmedizin heutzutage); sie gründet in der liebenden Umsorgung der Kinder und Familienangehörigen, auch der Haustiere und des Viehs im Stall; sie wurzelt in den örtlichen kulturellen Überlieferungen und macht Gebrauch von den lokal verfügbaren Heilschätzen, dem Wasser, der Wärme und insbesondere der Heilkräuter. Die offizielle Medizin beruht dagegen auf schriftlichen Traditionen, die ihre Wurzeln in der Antike, in der Klostermedizin und schließlich in der objektivierenden naturwissenschaftlichen Methode der Aufklärung haben. Sie besteht aus Gelehrtenwissen; ihre ideologische Grundlage sind eher die sogenannten universellen ethischen Werte anstelle von unmittelbarer persönlicher Umsorgung und Zuwendung. Diese weibliche, heilerische Intuition ist mir in meinem Leben des Öfteren begegnet, etwa bei meiner Großmutter, die immer einen Kräutertee, vor allem Kamille, zur Hand hatte und dazu den richtigen Spruch sprach – das therapeutische Machtwort! –, der einen davon überzeugte, dass die Krankheit oder das Leiden auf dem Rückzug war. Manchmal war es ein Spruch, der sich eingängig reimte, ein »Heil-Mantra«, wie:
»Heile, heile Segen, morgen kommt Regen, übermorgen Sonnenschein, dann wird das Weh vorüber sein.«
Oder auch:
»Ach mein lieber Sonnenschein, musst doch nicht so traurig sein; Oma (Mutti) pustet ganz geschwind, da vergeht das Weh bestimmt.«
Das Pusten ist eine der uralten magischen Heilmethoden, die schon die steinzeitlichen Schamanen kannten. Der Mediziner Eckhart von Hirschhausen erzählt in seinem Buch »Wunder wirken Wunder«, wie seine Mutter, wenn er mal böse hingefallen war, auf die schmerzende Stelle pustete und sagte: »Schau mal, Eckhart, da fliegt das Aua zum Fenster hinaus.« Da gab es keinen Grund zu zweifeln – sofort merkte er, wie es ihm besser ging.
Besonders die Großmütter können auf diese Weise die Selbstheilungskräfte in Gang setzen. Die Großmutter, die ja sogar der Mutter sagen kann, wo es langgeht, ist für Kinder wie eine Göttin, wie die Frau Holle selber. Da gibt es nicht den geringsten Zweifel, dass die Oma und die Kräuter, die sie verwendet, die Macht haben, alles Übel zu vertreiben. Sie besitzt auch die Erfahrung und Intuition, die beim Heilen oft notwendiger sind als lediglich angelesenes Wissen.
Familie Storl im Jahr 2000. Auch die Hunde werden mit Kräutern gesund gehalten.
DAS INTUITIVE HEILWISSEN DER FRAUEN
Vor vielen Jahren, als wir gerade auf einen Berg im Allgäu gezogen waren und uns weder ein Auto noch sonst etwas leisten konnten, gingen wir in den Wald, um Brombeeren zu sammeln. Diese würden wir, wie auch anderes Wildobst, einmachen. Das taten wir nicht zum Spaß oder aus Langeweile – für uns waren die Früchte, die die großzügige Natur uns schenkte, überlebenswichtig. Während wir im dem dornigen Dickicht im Akkordarbeitstempo unsere Körbe füllten, spielte der kleine Sohn, der noch Windeln trug, alleine irgendwo auf dem Waldboden. Plötzlich hörten wir ihn wie am Spieß schreien. So schnell wie möglich kämpften wir uns durch die stacheligen Ranken und sahen, wie der Kleine, umschwirrt von wütenden Wespen, direkt auf einem Erdwespennest stand. Meine Frau griff das Kind und riss die Windeln von ihm ab – es waren schon einige der Tiere unter die Windeln gekrochen –, sprang mit ihm zu einer Quelle, die einige Schritte entfernt war, und packte ihn sofort in kalten Schlamm. Das war die richtige Idee, denn auf diese Weise verteilt sich das Wespengift nicht so schnell im Körper. Nie wäre ich auf diese Idee gekommen, aber bei ihr war das eine ganz spontane Reaktion. Sie gab mir das schreiende Kind zum Tragen und wir hasteten im Laufschritt zu dem fast einen Kilometer entfernten Haus zurück. Der schreiende Junge schwoll wie ein Hefekloß immer mehr auf. Verzweifelt versuchte ich mein Hirn anzustrengen, was da zu machen wäre. Gerbstoffe! Ja, wir müssten ihn in einem gerbstoffhaltigen Sud baden, denn die Tannine neutralisieren Insektenstichgifte. Entlang des Weges wuchsen keine geeigneten Kräuter; die Weide war abgegrast. Was hatten wir an gerbstoffhaltigen Kräutern im Haus? Keine. Zuletzt fiel uns dann doch noch die Packung Schwarztee ein, die wir im Regal hatten. Noch nie hatten wir so schnell ein Feuer gemacht wie damals. Die ganze Packung Tee schütteten wir in den Topf, ließen ihn aufkochen, gossen ihn in das Wasser einer kleinen Sitzbadewanne und steckten das aufgedunsene, schreiende Kind hinein. Es wirkte schnell. Die Schwellung ging zurück. Nun konnten wir die Stiche zählen, es waren über zwanzig. Ich machte mir Sorgen, wie die kleine Leber die Toxine verkraften könne. Aber schon am nächsten Tag fing er wieder an zu spielen.
Was mich im Nachhinein verwunderte, war die schnelle und korrekte Intuition meiner Frau, das Kind sofort in kalten Schlamm zu packen. Mit all meinem Kopfwissen wäre ich nicht darauf gekommen. Aber das widerfährt mir öfters. Manchmal fragt mich ein Freund oder Bekannter, was er bei diesem oder jenem Leiden machen könnte, ob es da ein Heilkraut gebe? Ehe mir dazu etwas einfällt, gehen mir Massen von Daten durch den Kopf. Wenn ich dann Christine frage, kommt oft eine spontane, recht einfache, aber passende Antwort.
So erging es zum Beispiel einem Arzt, der an der Universitätsklinik in München arbeitete und mit dem wir gut befreundet waren. Der arme Mediziner entwickelte einen schlimmen Dauerhusten, den er nicht loswurde. Er konsultierte einen auf Pneumologie spezialisierten Kollegen, und dieser wiederum zog verschiedene mögliche, zum Teil recht erschreckende Krankheitsbefunde in Betracht. Unser ärztlicher Freund bekam es mit der Angst zu tun. Da er der Phytotherapie nicht ganz abgeneigt war, fragte er mich, was es für mögliche pflanzliche Alternativen geben könnte. Ja, da gab es viele Möglichkeiten, etwa lindernde Hustenmittel, wie den saponin- und schleimhaltigen Eibisch, der, kalt angesetzt, die gereizten Schleimhäute beruhigt. Aber nein, besser wäre beim chronischen Husten der Huflattich. Sein lateinischer Name Tussilago bedeutet ja »Hustenlinderer«, und er wird ja auch bei Lungenemphysem und Silikose (Staublunge) eingesetzt. Na ja, dann gäbe es ja auch die Königskerze, deren Blüten als Tee bei chronischen Bronchitiden helfen. (Sogar die Kommission E, die Heilpflanzen nach wissenschaftlichen Kriterien untersucht, hat der Königskerze eine positive Monografie bescheinigt.) Weiter kämen Spitzwegerich, Bibernellenwurzel, Seifenkrautwurzel, Gundermann, Isländisch Moos, Engelwurztee oder Quendel als desinfizierende, auswurffördernde, krampfstillende Lungenmittel infrage. Nicht zu vergessen das Meerträubel (Ephedra), welches die traditionelle chinesische Medizin (TCM) als Ma Huang kennt. Ja, welches sollte unser Freund nehmen?
»Versuch’s mit Knoblauchmilch«, sagte Christine ganz spontan und machte damit dem Grübeln ein Ende, »zwei oder drei Knoblauchzehen, je nach Größe, zerreiben und langsam in Milch erhitzen, kurz sieden lassen, aber nicht kochen.« Und das war es dann auch. Intuitiv hatte sie das richtige Mittel gewählt. In kürzester Zeit war der Husten vorbei und unser Freund war einen Schritt weiter in der Befürwortung natürlicher Medizin. Heilkunde ist eben nicht nur Wissenschaft, sondern auch eine Kunst.
Das mit dem Knoblauch macht wirklich Sinn, denn die Knolle enthält das schwefelhaltige Allicin, einen wirksamen Keim- und Pilztöter. Dieses leichtflüchtige Lauch-Öl wird vor allem über die Lunge ausgeschieden und ist deswegen für die unangenehme »Knoblauchfahne« verantwortlich. Beim Ausscheidungsprozess über die Atemorgane wird die Lunge gereinigt.
Der Herd oder die Feuerstelle werden seit Urzeiten von den Frauen gehütet.
URALTE WEIBLICHE HEILTRADITION
Selbstverständlich gibt es auch hervorragende Heiler männlichen Geschlechts, aber eigentlich waren Heilen und Krankenpflege immer eine weibliche Domäne, und das, so die kulturanthropologische Forschung, seit der Altsteinzeit. Über 90 Prozent unseres Daseins als Homo sapiens lebten wir als Wildbeuter. Bei den heutigen Jäger- und Sammlervölkern funktioniert die natürliche Arbeitsteilung nach Geschlecht – ganz allgemein gesprochen – noch immer so: Die Männer jagen. Sie verfolgen und erlegen das Wild und schleppen das Wildbret ins Lager. Die Frauen dagegen sammeln die essbaren und heilsamen Wurzeln, Sprosse und Wildkräuter. Die Frauen der Gemeinschaft, die Mütter mit Säuglingen in der Tragschlinge, die Schwangeren, die jungen Mädchen und auch die alten erfahrenen Großmütter, die die Sammelplätze seit Langem kennen, unternehmen gemeinsame Sammelexkursionen. Es sind meist fröhliche, ausgelassene Ausflüge, Teil der weiblichen Kultur. So heißt es bei den australischen Aborigines: Männer töten, Frauen bringen Leben hervor. »Wir tragen Pflanzstöcke (dibble sticks), keine Speere. Wir sind Frauen, keine Männer«, erklärte eine Aborigine-Frau der Anthropologin Catherine Berndt.
Kulturanthropologen konnten ermitteln, dass bei den Wildbeutern, den Hortikultur und Hackbau betreibenden Völkern 80 bis 90 Prozent der Nahrung von den Frauen herbeigeschafft werden. Dabei wird zwischen Nahrungs- und Heilpflanzen nicht kategorisch unterschieden. Wie ethnografische Untersuchungen bestätigen, wurde das pflanzliche Wissen von einer Frauengeneration hinweg zur anderen Generation weitergegeben. Und das seit Jahrtausenden.
Als die Menschen vor rund 10 000 Jahren sesshaft wurden, waren es immer noch die Frauen, die sich um das Pflanzenwissen kümmerten. Sie bestellten die Gärten, säten und pflanzten, hackten die Beete und ernteten; auch die Heilpflanzen gehörten zu ihrer Domäne. Die Männer halfen zwar bei der schweren Arbeit, beim Brandroden oder eventuell beim Bewässern. Wenn sie sich um Pflanzen kümmerten, dann vor allem um solche, die berauschen oder das Bewusstsein verändern können; auch Pfeilgifte oder Fischgifte waren das Anliegen der Männer.
Als Musterbeispiel gelten die Irokesen, deren Gärten und Felder Besitztum der matrilinearen Clans waren. Die Männer als Jäger und Krieger sicherten das Umfeld der Dörfer. Eine Himmelsfrau brachte der Überlieferung nach die drei wichtigsten Feldfrüchte – Mais, Bohnen und Kürbisse – wie auch die Ackerbegleitpflanzen, die als Suppengrün oder Heilpflanzen verwendet wurden, auf die Erde.
Die Pflanzenwelt galt ganz allgemein als weiblich. Bei den keltischen Walisern nannte man die Vegetationsgöttin Blodeuwedd; bei den Germanen war sie die Nana, bei den Griechen die Blumenbraut Persephone.
Nicht nur sicherten die Frauen die pflanzliche Ernährungsbasis – auch das Pflegen der Kinder, der Kranken, Verwundeten und gebrechlichen Alten war bei den alten Völkern die alltägliche Aufgabe der Frauen.
Wir können also sagen, dass die botanischen Kenntnisse und das Wissen um die Heilkraft der Vegetation tiefe Wurzeln haben. Pflanzenwissen prägte sich allmählich bis ins weibliche Unterbewusste ein.
Unser europäisches kulturelles Erbe ist in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Auch bei den Bewohnern unseres Erdteils war es vor allem die Frau, die die heilsamen Kräuter kannte und anwendete. Homer erwähnt, dass die schöne Helena eine hervorragende Heilerin war. In der Ilias (11: 740) erzählt er: »Agamede, mit dem blonden Haar, eine Heilerin war sie, und kannte wohl die Kräuter alle, die auf der Erde wuchsen.«
Vor allem bei den Waldvölkern, den Kelten, Germanen, Slawen und Balten, war es die Hausfrau, die für die Gesundheit der Menschen und Tiere in Haus und Hof zuständig war. Etymologisch bedeutet das Wort Frau, wie auch Freya (die Göttin des Lebens), übrigens »Herrin« – die Hausfrau ist also die Herrin des Hauses. Sie war die Feuerhüterin; der Herd galt als die Herzmitte des Hauses und das Feuer darin als die mikrokosmische Sonne. Der Rauchfang über der Herdstelle galt als der Zugang zu den jenseitigen Welten. Durch den Kamin kamen auch die Geister, ebenso wie der Storch (Adebar, der Glücksbringer), der die Seelen der Kinder brachte. Und in der Meditation, der Versenkung oder in der tiefen Trance flogen die Seelen – die später als Hexen verteufelten Schamaninnen – durch den Rauchfang in die anderen Welten. Am Feuer, das die Stube erwärmt, am heiligen Herd, wurde nicht nur die Nahrung zubereitet, sondern auch die Heilmittel. Hier wurden der Kräutertee gebraut und die Heilsalbe gerührt.
Überhaupt spielte Wärme – wir würden sagen Überhitzungstherapie (Hyperthermie) – in Form von heißen Bädern, Saunas, Banjas (in Russland) und Wickeln – oder das Auflegen heißer Steine (oder Wärmeflaschen) in der Heilkunde der Völker eine wesentliche Rolle bei der Behandlung von Krankheiten. In unserem Haushalt ist das noch immer der Fall.
TRADITIONELLE NATURHEILMITTEL AUS KRÄUTERN
Hier nun ein kurzer Überblick der von der weiblichen Kultur vermittelten traditionellen Heilmittel. Sie sind noch immer der Kern der Volksmedizin. Zwar sind im Mittelalter alkoholische Tinkturen, Schnäpse und Elixiere über die von der Alchemie besessene Mönchskultur hinzugekommen, auch Theorien über Humore (Körpersäfte), Hitzegrade und die planetarische Zugehörigkeit der Kräuter, aber im Grunde genommen waren folgende Heilmittel und Herstellungsarten die ursprünglichsten:
Tee
Der Tee, der heiße Aufguss, war heilig: Die Schale mit dem Wasser galt als die weibliche Komponente, die Hitze des Feuers als die männliche. Es ist ein Verbinden mit dem Ursprung. Im Glauben dieser Waldvölker ging die Welt aus den beiden Ur-Elementen Feuer und Wasser hervor. Die Kräfte der Heilpflanze werden durch die Kraft der Hitze herausgelöst und durch das aufnehmende Wasser an den Organismus vermittelt.Der Kräutertee wurde (und wird noch heute) zu den drei sakralen Tageszeiten getrunken: Die erste Schale am Morgen, wenn der neue Tag erwacht und die Morgenandacht vollbracht ist; die zweite zur Mittagszeit, wenn die Sonne im Zenit steht; die dritte Schale am Abend, wenn der Tag sich verabschiedet und die Seele sich auf die dunkle Hälfte des Tageslaufs, auf den Gang in die Anderswelt, das Land der Träume, vorbereitet.
Kräuteraufgüsse sind bis heute bei uns die bevorzugten Heilmittel der europäischen Volksmedizin.
Heilbiere
Auch das Brauen der Heilbieregehörte zu den Aufgaben der Hausherrin. »Neun« Kräuter kannte sie, wobei die Zahl Neun, also drei mal drei, eine magische Zahl ist. Mit den Bieren, die – abgesehen von besonderen Feiertagsbieren – einen niedrigen Alkoholgehalt hatten, konnte die Frau das seelische Befinden der Hofgemeinschaft führen. Sie kannte Biere, die die Familienmitglieder vor Krankheit schützen, auch Biere, die die Männer anregen oder auch abregen können. Mit warmem Bier wurde das Euter kranker Kühe eingerieben. Da sie auch – als »Schamanin des Hofes« – für die Herstellung einer guten Beziehung mit den unsichtbaren Haus- und Hofbewohnern zuständig war, opferte die Hausfrau den Gärtrunk den Zwergen, Kobolden oder den Verstorbenen. Das geschah meistens draußen, unter dem Hofholunder.Die beliebtesten Bierkräuter waren alltäglich verwendete Heilkräuter wie Gundermann, Schafgarbe, Brennnessel, Rauschbeere, Porst, Beifuß (bei Frauenleiden), Wermut (bei Magenleiden), Rosmarin (bei Schwermut und betrübtem Herzen) oder Wacholder (Nierenmittel). Das Bier war meistens kein Hopfenbier. Hopfen kam erst während der Völkerwanderungszeit von den Slawen zu den Germanen und wurde dann im Mittelalter, als die Mönche und dann die Herrschaften das Braurecht an sich rissen, immer häufiger verwendet.
Als wir auf den Berg ins Allgäu zogen, wollten wir weiterhin dieser Tradition der Heilbiere folgen. Wir lebten weit abseits und hatten weder genügend Einkommen noch ein Auto, mit dem wir Kisten mit dem Gebräu aus dem Tal nach oben hätten transportieren können. Gottfried Härle, ein junger Braumeister, der in seiner Leutkirchner Brauerei hervorragende, bekömmliche Biere braute, war sogar so nett, uns Brauhefe zu schenken, damit Christine uns das »flüssige Brot« brauen konnte. In Ladakh, wo wir einige Zeit bei tibetischen Bauern wohnten, braute die Bauersfrau jeden Tag wunderbares Gersten-Chang. Wir kamen auf die Idee, das auch bei uns zu machen. Dieses Bier, ungefiltert und mit niedrigem Alkoholgehalt, ist eine gesunde Nahrungsergänzung, es enthält viel Vitamin B, unterstützt die Verdauung, mindert die Gefahr der Nierensteinbildung; der Harvard-Professor Walter Willet behauptet sogar, dass Menschen, die täglich einen halben Liter Bier trinken, ihr Herzinfarktrisiko halbieren. Und die kräuterkundige Äbtissin Hildegard von Bingen rät den wahren Christenmenschen: Cervisiam bibat! (Man trinke Bier!) Übrigens war das auch der Rat einer alten Frau, als Christine geboren wurde und ihre Mutter zu wenig Milch für den Säugling hatte, denn der Gerstensaft stimuliert die Ausschüttung des Hormons Prolactin, das den Milchfluss bei Stillenden auslöst.
Leider mussten wir auf Selbstgebrautes verzichten. Der Brauvorgang schlug fehl, da es in dem alten, mit Holz beheizten Haus unmöglich war, die Temperatur, die für die Hefegärung wichtig ist, in den Griff zu bekommen; nachts wurde es immer zu kalt.
Kräuterbrötchen und Wecken
Neben Tees und Heilbieren wurden Heilpflanzen, getrocknet oder frisch, in Brotteig geknetet und gebacken. Diese Kräuterbrötchen oder Weckenwaren eine beliebte volksmedizinische Art und Weise zu heilen. Hildegard nannte diese mit getrockneten Wurzeln, Samen und Gewürzen hergestellten Heilmittel »Küchlein«. Heilkräftige »Gebildekuchen« in Tier-, Pflanzen- oder Menschenform gab es schon im altgermanischen und keltischen Heidentum. Der Brauch wurde von den Christen übernommen und überlebte als heilkräftige, mit Kreuzzeichen versehene Oster- und Weihnachtsbrote. Es gab auch heilsame Kräuterwecken, die einem Heiligen geweiht waren, wie etwa das Agatha-Brot, das Sankt-Sebastians-Brot oder das Sankt-Erharts-Brot. Brote mit Dill oder Fenchel sollten gegen Verzauberung wirken. Später, in den Handelsstädten, wurden dann die ebenfalls als heilwirksam geltenden Gewürz-, Pfeffer- und Lebkuchen gebacken. Um der Verdauung zu helfen, bäckt man bis zum heutigen Tag Brot mit Kümmel. Vielerorts werden noch zur Mittsommerzeit »Hollerküchlein« aus den Blüten des Schwarzen Holunders in Bierteig gebacken. Im Allgäu wurde das Schmalz, in dem die Blütenkuchen frittiert wurden, als Heilsalbe bei rissiger Haut und kleinen Wunden verwendet.Selbst gemachte Salben, etwa die Ringelblumensalbe, sind ebenso wie Kräuteröle, Tinkturen und Teekräuter wichtige Bestandteile der Hausapotheke.
Salben
Salben zum Einreiben spielten ebenfalls eine wichtige Rolle in der Heilkunde der Großmütter. Salbenrühren war ein heiliges Geschäft, denn was die Frau dachte und fühlte, rührte sie mit in die Salbe hinein. Oft wurde das Rühren mit dem Singen von Liedern begleitet – Liedern, die zum Segen von Familie und Angehörigen beitrugen. Das Rühren musste hauptsächlich im Uhrzeigersinn geschehen, also im Einklang mit dem Lauf der Sonne. Zwischendurch wurde die Richtung geändert, ehe man wieder zur Sonnenläufigkeit zurückkam. Gänzlich entgegen dem Sonnenlauf zu rühren würde der Überlieferung nach Unheil bringen.In alten Zeiten nahm die Hausfrau vor allem Schweineschmalz oder Butter (Anke, Smör) als Salbengrundlage. In besonderen Fällen kamen auch Bärenfett, Dachsfett oder Hirschtalg infrage. Murmeltiersalbe für die Gelenke ist noch heute beliebt. Schweinefett war einst begehrt, da es dem menschlichen Körperfett ähnlich ist und die pflanzlichen Wirkstoffe über die semipermeable Hautmembran gut eindringen lässt. Im Zeitalter der Agrarindustrie ist das Fett unglücklicher, mit Chemikalien und Antibiotika vollgestopfter Rüsseltiere zur Salbenherstellung problematisch. Da nimmt man lieber das Fett von glücklichen Bio-Schweinen, so wie es uns die große Kräuterfrau Maria Treben (1907–1991) beim Kochen ihrer Ringelblumensalbe vormacht. Anstelle von Butter, Butterschmalz oder Tierfetten verwenden viele Kräuterfrauen heutzutage lieber pflanzliche Fette, deren Vorhandensein der globale Handel ermöglicht: Jojoba-, Kokos- und Olivenöl, Kakaobutter oder Mandelöl, dazu Bienenwachs zum Härten.