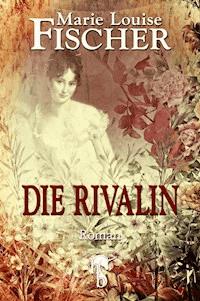
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bayern im Jahre 1799: Lucille verschwindet nach der Geburt ihres kleines Sohnes Thomas, der aus der Beziehung mit dem Hofmarksherrn Anselm von Deinharting hervorgegangen ist, spurlos. Sowohl Thomas als auch Antoinette, die als Lucilles Tochter gilt, bleiben allein in Deinharting zurück und werden großzügig in den Deinhartinger Familienkreis aufgenommen. Doch die Zeiten sind unruhig: Um Napoleons Expansionsdrang zurückzuhalten, haben die Österreicher Bayern besetzt. Es kommt zu blutigen Kämpfen, und von den Gräueln des Krieges bleibt auch die Familie Deinharting nicht verschont. Das Schicksal bringt Anselm von Deinharting wieder in den Bannkreis Lucilles, der »Rivalin«, die mehr denn je entschlossen ist, ihn seiner Frau Elisabeth abzuringen. Band 2 der Deinharting-Trilogie von Marie Louise Fischer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 715
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Marie Louise Fischer
Die Rivalin
Roman
Es war noch dunkel und bitterkalt, ein früher Morgen im Februar des Jahres 1799.
Der Hofmarksherr Anselm von Deinharting fror trotz des Bärenfells, das er sich um die Schultern gehängt hatte. Er tastete nach seiner Lederflasche und nahm einen Schluck Obstler; der scharfe, reine Schnaps brannte im Magen und breitete eine wohltuende Wärme in seinem ganzen Körper aus. Hasso, die mächtige Dogge, die in Hab-Acht-Stellung zu seinen Füßen saß, zitterte vor Kälte und Spannung. Herr und Hund hatten sich in den riesigen Wurzeln einer uralten Tanne, die sich zu einem höhlenartigen Sessel ausgeformt hatte, eingerichtet. Beide warteten auf Büchsenlicht. Anselm von Deinharting betrieb die Jagd nicht mehr wie noch vor wenigen Jahren zum Zeitvertreib und zum Schutz der Wiesen und Felder. Die Zeiten hatten sich geändert. Mehr als hunderttausend Österreicher standen in Bayern. Jedes Haus in seinem Dorf Deinharting und sogar in dem wenige Meilen entfernten Städtchen Taufbeuern hatte Einquartierung, und all diese hungrigen Männer wollten verpflegt sein. Wenn das Essen auf der hofmarksherrlichen Tafel auch nicht knapp geworden war – denn die Bauern und der Vogt mussten liefern, gleich wie sie es schafften –, so war doch ein gutes Stück Wild jetzt in der Küche hoch willkommen.
Der Platz, den sich der Hofmarksherr für die Jagd gewählt hatte, lag hoch im Alpenwald unterhalb einer Felswand und war nur nach einem steilen Aufstieg zu erreichen. Aber er liebte ihn besonders. Vor Jahren, unter der Herrschaft seines Großvaters, des ersten Anselm von Deinharting, hatten stürzende Felstrümmer den jungen Baumbestand erschlagen. So war eine Schneise entstanden, durch die das Wild wechseln musste, wenn es die Sicherheit der jenseitigen dicht beasteten Fichten erreichen wollte. Um der guten Jagdgelegenheit willen hatten die Vorfahren Anselm von Deinhartings darauf verzichtet, hier wieder aufzuforsten, und auch er selber hatte es nie in Erwägung gezogen. Zu beiden Seiten der Gasse standen die Stämme so dicht, dass das anwechselnde Wild sich auf engen Durchblicken zwar ankündigte, aber erst in der nur zwanzig Schritt breiten Schneise voll in Erscheinung treten konnte. Das machte das Ansitzen besonders spannend.
Noch sah Anselm von Deinharting nichts. Während draußen schon der Tag graute, herrschte hier nahe der Felswand und unter den dichten Kronen der hohen Bäume noch völlige Dunkelheit. Umso angespannter lauschte er, aber nichts war zu hören als das Knacken der Äste unter der Schneelast.
Es war die dichte, gefrorene Schneedecke, die als Erste den schwachen Lichtschimmer auffing, der durch die Bäume fiel und wie von sich aus zu leuchten anfing. Dann begannen sich die Umrisse der Latschenbüsche auf der Felswand abzuheben.
Anselm von Deinharting gewahrte eine Bewegung zwischen den Stämmen und legte an.
Aus der linken Baumkulisse trat, misstrauisch sichernd, das Leittier, ein starker Rehbock. Es dauerte, bis er sich entschloss, die Gasse zu überqueren. Seine Hufe brachen durch den Schnee. Das Rudel folgte langsam, die schwereren der Tiere behindert durch den gefrorenen Schnee, die anderen leichtfüßig darüber trippelnd.
Der Hofmarksherr nahm einen einjährigen Bock ins Visier, der, vom Leittier gerade noch geduldet, mit dem Rudel zog. Aber noch ehe er abdrücken konnte, zerriss der Knall eines Schusses die morgendliche Stille.
Das Rudel stob davon. Eine breite Schweißspur verriet, dass eines der Tiere gezeichnet war.
Fluchend sprang ein Mann aus dem Wald, tat ein paar Schritte, wie um das schlecht getroffene Stück einzuholen. Sein weißer Uniformrock wirkte schmutzig auf dem Hintergrund des Schnees.
»Stehen bleiben!«, brüllte Anselm von Deinharting. »Arrêtez!« Er erhob sich in seiner vollen Größe.
Der Österreicher lud nach und legte auf ihn an.
Anselm von Deinharting wusste, dass er jetzt hätte schießen sollen. Aber es widerstand ihm, auf einen Menschen zu zielen, und er hoffte auch noch, dass der Konflikt sich mit Vernunft und ohne Gewalt würde lösen lassen.
»Das Tier wirst du mir bezahlen!«, brüllte er. »Senk die Waffe!« Doch der andere schoss – er schoss in dem Augenblick, da Hasso mit einem gewaltigen Satz auf ihn lossprang und so die seinem Herrn bestimmte Kugel mit seinem Körper auffing. Das schwere Tier stürzte aus dem Sprung in den Schnee. Es stieß einen fast menschlichen Laut der Klage aus.
Eine heiße, blutrote Welle von Zorn und Trauer überwältigte Anselm von Deinharting. Jeder Gedanke war ausgelöscht. Er zog ab, und der Österreicher, ins Herz getroffen, brach zusammen. Der Hofmarksherr hatte keinen Blick für ihn; er rannte vor, kniete sich neben den sterbenden Hund und umfing seinen Kopf mit beiden Händen. »Braver Hund«, sagte er mit einer Stimme, die ihm kaum noch gehorchte, »gut gemacht, Hasso!«
Mit einem unvergesslichen Blick unendlicher Ergebenheit sah Hasso zu seinem Herrn auf, und trotz seiner Todesqual brachte er ein schwaches Schwanzwedeln zustande, wie um zu zeigen, dass er verstand und glücklich war.
Dann brachen seine Augen, wurden stumpf, und Anselm von Deinharting wusste, dass es zu Ende war. Sanft rettete er den Kopf des Tieres in den Schnee.
Er empfand einen tiefen Schmerz, eine trostlose Leere wie bei dem Tod eines Freundes, aber er verbot sich dieses Gefühl, denn sein Verstand sagte ihm, dass Hasso doch nur ein Tier und seine Liebe nur Instinkt gewesen war. Zudem hatte der Hund begonnen, alt zu werden, und seine schönsten Jahre waren vorbei gewesen. »Ich gönne dir deinen Heldentod, Alter«, murmelte er sich aufrichtend, »aber du wirst mir fehlen … wie sehr wirst du mir fehlen!«
Tränen liefen ihm über die Wangen. Als er es merkte, versuchte er zu lächeln, brachte aber nur eine Grimasse zustande.
Dunkelrot zeichnete die Blutspur des angeschossenen Wildes den Wechsel zum Wald. Anselm von Deinharting seufzte schwer. Der Gedanke, dass die unschuldige Kreatur sich vielleicht noch Stunden quälen musste, bereitete ihm Unbehagen.
Jetzt erst wandte er sich dem Mann zu, den er erschossen hatte. Der Soldat war jung. Er hatte die Augen weit aufgerissen, verständnislos in der Sekunde seines jähen Todes. Anselm von Deinharting drückte sie ihm zu. »Dummer Kerl«, sagte er, »so etwas will Soldat sein und kann nicht einmal zielen!«
Der Mann war ihm noch nie begegnet, und er wusste nicht, ob er zur regulären Truppe gehörte, vielleicht sogar beauftragt gewesen war, wider Recht und Gesetz einen Braten zu beschaffen, oder ob es sich um einen Marodeur handelte. Als er ihn so vor sich liegen sah, mit dem dunklen Haarflaum auf den Wangen und dem blassen, kindlich verzogenen Mund, bedauerte er seine Tat zutiefst. Er gestand sich, dass er unangemessen reagiert hatte. Ein Schuss in den Arm hätte genügt, den Wilderer außer Gefecht zu setzen. So jung und sinnlos hatte er im fremden Land sterben müssen. Sicher gab es eine Mutter und vielleicht auch ein Mädchen, die um ihn weinen würden.
Anselm von Deinharting nahm die Pelzkappe ab, faltete die Hände und sprach ein stilles Vaterunser. »Gott sei deiner armen Seele gnädig!«, endete er laut und schlug das Kreuzzeichen über ihn. Nicht dass er sicher war, dass dem Toten dies auf seinem Weg in die Ewigkeit oder in das große Nichts hätte helfen können. Aber es war alles, was er für ihn tun konnte, und deshalb vollzog er den Ritus, der ihm von klein auf vertraut war.
Jetzt musste er an sich selber denken. Er hatte einen Mann erschossen, der, so oder so, zur österreichischen Einquartierung gehörte, die eigentlich eine Besatzung war. Natürlich hätte er erklären können, dass es in Notwehr geschehen war. Sein erster Gedanke war, nach Taufbeuern zur Kommandantur zu reiten und den Fall vorzutragen. Aber er war nicht sicher, dass er damit durchkommen würde. In Zeiten wie diesen pflegte Gewalt vor Recht zu gehen.
Die Österreicher würden es gewiss nicht gerne sehen, wenn ihre Leute abgeknallt wurden, auch dann nicht, wenn der zuvor begangene Übergriff offensichtlich war. Das würde ein zu schlechtes Beispiel für die Bauern abgeben, die täglich zähneknirschend erleben mussten, wie die fremden Soldaten sich an ihren Hühnern, Eiern und Kälbern gütlich taten, ganz zu schweigen davon, dass kein Weiberrock vor ihnen sicher war.
Der Hofmarksherr entschloss sich, die Sache anders aus der Welt zu schaffen. Er steckte Hasso in den großen Sack, der steif vom Blut des erlegten Wildes war, das er gewöhnlich darin zu transportieren pflegte, ließ den Toten liegen, wo er war, und machte sich an den Abstieg.
In ruhigeren Zeiten hatte am Fuße des Voralpengebirges, dort, wo der Weg schon flacher und nicht mehr von Wurzeln und Steinen behindert war, Bruna, seine schwere Norikerstute, angebunden gewartet. Seine Bauern kannten das Tier, und auch ein Fremder würde mit ihr nicht davongekommen sein. Aber seit die österreichische Soldateska das Land beherrschte, war nichts mehr sicher. Während er gewaltig ausschritt, ein großer Mann mit mächtiger Nase, vollem, leidenschaftlichem Mund, hoher Stirn und braunem, dichtem Haar, das unter der Pelzmütze hervorquoll, grübelte er darüber nach, was geschehen war. Noch nie zuvor hatte er einen Menschen getötet, ja, er pflegte seine Untertanen nur selten und dann in jähem, meist gerechtem Zorn zu schlagen. Er konnte die Tat nicht leicht von sich abschütteln. Jetzt dachte er, dass der Tod Hassos vielleicht nur ein Anlass gewesen war, den Fremden zu erschießen. Die wahren Gründe für diese Tat lagen wohl tiefer.
Er hasste die Österreicher, die ins Land gekommen waren, angeblich um Bayern vor den Neufranken zu schützen, tatsächlich aber, um es zu okkupieren. Er hasste es, nicht mehr Herr in seiner Hofmarksherrschaft, ja nicht einmal mehr in seinem eigenen Hause zu sein, denn auch Schloss Deinharting war von der Einquartierung nicht verschont geblieben. Er hasste die vertrackte politische Situation, und diesem Hass, der in seiner Seele kochte und den er ständig unterdrücken musste, war der junge Wilderer zum Opfer gefallen.
Auch als das feste kleine Turmschloss mit dem hohen geschindelten Dach vor ihm auftauchte, empfand er keine Erleichterung. Er empfand nicht mehr die Freude des Heimkommens wie früher. Es war ihm, als streckten die Bäume, die den Bau umgaben, ihre kahlen Äste in verzweifelter Anklage gegen den winterlich fahlen Himmel.
Peter Stuffer, der Pferdeknecht, ein stämmiger Mann mit einem von Licht und Luft gegerbten Gesicht und ständig zerzaustem dunkelblonden Haar, dessen hellere Spitzen in verschiedene Richtungen standen, war gerade dabei, Elisabeth von Deinhartings elegante kleine Stute an der Longe über den ungepflasterten Teil des Hofes zwischen der Rückfront und den Stallungen zu bewegen, als er den Hofmarksherrn mit seiner Last ankommen sah.
Im gleichen Augenblick entdeckte ihn die Meute der Deinhartinger Hunde, stürmte auf ihn zu und begrüßte ihn mit einer stürmischen Begeisterung, die er nur mit harten Zurufen dämpfen konnte.
Peter scheuchte die Tiere mit Peitschenschlägen zurück, die über ihren Köpfen pfiffen, und erbot sich den Sack abzunehmen; mit besorgtem Blick stellte er fest, dass Hasso fehlte, ohne jedoch eine Frage zu wagen.
Anselm von Deinharting ließ die Last, obwohl sie ihm schwer geworden war, sehr sanft von der Schulter gleiten und legte sie in die Hände des Knechtes. »Es ist Hasso«, sagte er, »er starb durch die Kugel eines Wilderers.«
Peters offenes Gesicht verdüsterte sich. »Es ist eine Schande, wie es zugeht, Herr!«
»Du hast recht, aber du solltest es nicht aussprechen.«
»Ich weiß, Herr, aber zuweilen läuft einem die Galle über.«
»Er starb einen guten Tod, wollte mich schützen.«
»Das freut mich, Herr, er war ein feiner Hund, ja, das war er.«
»Verscharr ihn, Peter, aber tu’s mit Anstand.«
»Das werde ich wohl, Herr, er hat es verdient.« In Peters herbem Gesicht arbeitete es, bevor er fragte: »Und wer war es, Herr? Wohl einer von diesen … diesen …« Er fand kein Wort, um seiner Verachtung Ausdruck zu geben.
»Ja.« Anselm von Deinharting las die unausgesprochene Frage in den Augen des Knechtes und überlegte, wie weit er gehen durfte. Zwischen ihm und Peter, der schon in seinen Kinderjahren auf das Schloss gekommen war, hatte von jeher ein besonderes Vertrauensverhältnis bestanden, das sich, als er dem Burschen gegen alle Konventionen erlaubt hatte, ein bettelarmes Mädchen zu heiraten, noch vertieft hatte. Peter würde schweigen, dessen konnte er sicher sein.
»Er ist tot«, sagte er beherrscht.
Peters Züge entspannten sich. »Das ist gut, Herr … das ist gut zu wissen!«
Anselm von Deinharting ersparte sich die Mahnung, dass darüber nicht geredet werden durfte, denn das verstand sich von selber. »Vor allem anderen«, befahl er, »verständige Feinhuber. Ich muss mit ihm sprechen. Noch heute.«
»Ja, Herr, ich reite gleich los.« Peter zögerte. »Wollen Sie nicht einen anderen Hund, Herr? Der junge Pointer wäre wohl geeignet …«
»Nein, Peter. Danke. Ich will keinen Hund. Nie mehr.«
Peter, der ihn gut verstand, verzichtete auf jedes weitere Wort und pfiff die Hunde zurück, die versuchen wollten, sich neben und hinter Anselm von Deinharting durch die Hintertür des Schlosses in die Küche zu drängen.
Noch war Frühstückszeit, dennoch siedete und brodelte es schon in den vielen kupfernen und eisernen Töpfen und Pfannen auf dem mächtigen Herd inmitten der riesigen Gewölbeküche. Margarethe Meyr hatte, assistiert von zwei jungen Bauerntöchtern, die bei ihr lernten, schon begonnen, die Mittagsmahlzeit zuzubereiten. Die Köchin erwiderte Anselm von Deinhartings Gruß mit Würde, während die Mädchen errötend knicksten und kicherten – jede von ihnen wünschte insgeheim dem Hofmarksherrn, über den man sich so viel erzählte, zu gefallen, denn sie kannten, obwohl er die fünfzig schon überschritten hatte, keinen stattlicheren Mann.
»Tut mir leid, Margarethe«, sagte Anselm von Deinharting freundlich, »heute bring' ich dir nichts.«
»Macht nichts, Herr. Das viele Wild verdirbt die feine Zunge.«
»Was soll es denn mittags geben?«, fragte er, um ihre Laune zu heben.
Margarethe zählte an den Fingern ab. »Erbsensuppe, Weiß-, Brat- und Schweinswürste, Lungenbraten mit Kraut und Kartoffeln und einen Weinkoch.«
»Klingt gut.«
»Den Speiseplan hat die gnädige Frau gemacht, es ist Arbeit genug.«
Anselm von Deinharting lächelte, weil er nur zu gut wusste, dass die Köchin sich von niemandem etwas vorschreiben ließ und von seiner jungen Frau schon gar nicht. »Du wirst es schon schaffen! Hoffentlich könnt ihr mir trotz aller Plackerei heißes Wasser zu einem Bad hinaufbringen?« Er sah auf seine Hände. »Ich hab's nötig!«
Eilfertig machten sich die Mädchen daran, heißes Wasser vom Herd in die Kannen zu schöpfen, denn die so freundlich ausgesprochene Bitte war ihnen Befehl.
»Ich danke euch.«
Erst jetzt, als er die Küche schon verlassen wollte, entdeckte er den jungen Österreicher, einen der beiden Offiziersburschen, der sich so klein wie möglich gemacht und hinter einem der Pfeiler versteckt hatte.
»Was treibt der Kerl hier?«, grollte er. »Du weißt, dass ich keine Soldaten in meiner Küche dulde!«
Die kleine, sehr dicke Köchin stemmte die Hände in die Hüften und warf sich in die Brust. »Dies ist meine Küche!«, trumpfte sie auf. »Und er hilft uns beim Töpfebürschteln! Wir haben weiß Gott genug zu tun!« Ihr Gesicht wurde noch röter als gewöhnlich.
»Er gehört in den Stall! Oder auf sein Zimmer!«
»Damit er die Hände in den Schoß legt?! Hier kann er sich nützlich machen!«
Anselm von Deinharting war nahe daran nachzugeben, denn Margarethes Kochkünste waren unübertrefflich und sie war sich ihrer Unersetzlichkeit zu Recht bewusst. Er tat es nur deshalb nicht, weil er seiner Frau den Umgang mit dieser eigenwilligen Person nicht noch mehr erschweren wollte, denn seine Schwäche würde Margarethes Anspruch nur noch stärken.
So wandte er sich an den Burschen. »Hinaus mit dir!«, brüllte er. »Verschwinde! Und lass dich nie wieder blicken!« Selbst wenn der Bursche diese Worte nicht verstand – er war Kroate und der deutschen Sprache kaum mächtig –, Ton und Gestik waren überzeugend genug. Geschwind sprang er in den Hof hinaus.
»Und wer soll jetzt die Töpfe bürsten?«, fragte die Köchin vorwurfsvoll.
»Wer wird es tun, wenn die Österreicher fort sind? Oder richtet ihr euch etwa darauf ein, dass sie bis zum Ende aller Tage bleiben werden?«
Anselm von Deinharting war jetzt so zornig, die Ader an seiner Schläfe blau angeschwollen, und klopfte so heftig, dass die Mädchen sich duckten und die Köchin kein Wort mehr zu sagen wagte.
Antoinette de Beaujeux, die junge Französin, die die Wirren der Zeit nach Deinharting verschlagen hatten, hob den Kopf, als sie Anselms schwere Schritte auf den steinigen Treppenstufen hörte. »Ich glaube, das ist er!«
Elisabeth von Deinharting lauschte ebenfalls. »Ich bin immer froh, wenn er wieder heimgekommen ist«, sagte sie.
»Ja, es ist gefährlich geworden draußen herumzustreifen«, stimmte ihr Henriette Striegel, die Zofe, zu. Sie war sehr alt und grau geworden und ihre Glieder wollten ihr nicht mehr gehorchen. So hatte sie es Antoinette überlassen, sich auf den Boden zu knien und das neue Gewand der Hofmarksherrin abzustecken, während sie selber sich damit begnügte, es zurechtzuzupfen. Die drei Frauen hielten sich in dem sogenannten oberen Erkerzimmer des Schlosses auf, in dessen prachtvollem, weiß-blauen Kachelofen ein kräftiges Feuer prasselte.
Antoinette blickte lächelnd aus ihren runden blauen Augen zu ihr auf. »Aber doch nicht für den Hofmarksherren!«, behauptete sie. »Er ist so stark … wer würde es denn wagen, sich mit ihm anzulegen?«
»Berufen Sie es nicht, Comtesse!«, warnte die Zofe. »Wenn man bedenkt, was für ein Gesindel sich herumtreibt! Es würde mich nicht wundern, wenn sie eines Nachts ins Schloss eindringen und uns allen die Hälse abschneiden würden.«
Elisabeth erschauerte. »Sag doch so etwas nicht, Henriette! Das ist auch ganz unmöglich, solange die Herren Offiziere zu unserem Schutz da sind!«
»Sind sie das wirklich?«, fragte Antoinette.
Elisabeth blickte zu ihr hinunter. »Wie meinst du das?«
»Nun, ich denke, sie sind hier, um die Neufranken zurückzuschlagen!«
»Ist das denn nicht dasselbe?«
Antoinette, die Elisabeth nicht hatte beunruhigen wollen, biss sich auf die Zunge. »Aber natürlich, ma tante, ich habe nur gescherzt.«
Die drei Frauen hatten deutsch gesprochen mit Rücksicht auf Henriette Striegel, die nur wenige Brocken Französisch beherrschte. Aber als der kleine Thomas, der in einer Ecke des Zimmers einen hohen Turm aus Holzklötzchen aufgebaut hatte, ihn jetzt mit großem Gepolter zum Einsturz brachte, fuhr Antoinette ihn in ihrer Muttersprache an, die gleichzeitig die Sprache der gebildeten Stände jener Jahre war. »Arrête! Ich bitte dich, Thomas! Was soll dieser Lärm?! Du erschreckst uns ja!«
Tatsächlich war Elisabeth nervös zusammengezuckt.
»Entschuldigen Sie, ma tante«, bat Antoinette, »er hat es gewiss nicht mit Absicht getan.«
Elisabeth zwang sich ein Lächeln ab. »Kleine Buben sind nun einmal laut«, versicherte sie entgegen ihrer wirklichen Überzeugung; zu gut erinnerte sie sich an ihren eigenen Sohn Maximilian, den ihr der Tod im blühenden Alter von zwei Jahren entrissen hatte – aber wie still, wie anmutig, wie verständig war er damals schon gewesen! Elisabeth konnte sich nicht vorstellen, dass vielleicht auch er Freude daran gefunden hätte, Lärm zu machen.
Thomas betrachtete die Frauen mit finsterem Blick. Er war ein stämmiger kleiner Bursche mit großen, pechschwarzen Augen und dunklem, vollen Lockenhaar, das ihm bis auf die Schultern fiel. Die Unterlippe vorgeschoben, verschränkte er die Arme trotzig hinter dem Rücken.
»Bau doch etwas anderes!«, bat Antoinette. »Vielleicht einen Stall oder ein Haus … ein Schloss … nein, eine kleine Menagerie für deine Tiere!«
»Mag nicht«, sagte der Junge.
Antoinette wäre gerne zu ihm hingeeilt und hätte ihn in die Arme genommen, aber sie wollte in Gegenwart der anderen nicht zu viel Aufhebens von seiner Laune machen; so sagte sie nur: »Dann lass es eben und schau uns zu!«
»Du sollst mit mir spielen!«
»Du siehst doch, dazu habe ich jetzt wirklich keine Zeit! Später, mein Liebling, später!«
»Nie hast du Zeit für mich!« Der Kleine stampfte mit dem Fuß auf.
»Das ist einfach nicht wahr und du weißt es genau. Also hör auf damit und sei lieb.«
»Wenn du meinst, dass du dich um ihn kümmern musst …«, sagte Elisabeth.
»Aber nein, ma tante, er kann sehr gut allein spielen!« Mit einem beschwörenden Seitenblick auf Thomas fügte sie hinzu: »Wenn er will!« Sie hatte die letzte Nadel in den Saum des Gewandes gesteckt, dessen Rock in weichen Falten bis zum Boden floss. »Jetzt stimmt es!« Anmutig erhob sie sich, ein schlankes Mädchen mit sehr geradem Rücken und stolz erhobenem Kopf, die durch diese aufrechte Haltung größer wirkte als Elisabeth, obwohl ihre Schultern die gleiche Höhe hatten. »Darf ich den Hofmarksherrn holen, ja?«, bat sie. »Er wird staunen!«
Elisabeth winkte ab. »Nein, nein, lieber nicht! Halt mir den Spiegel!«
Antoinette nahm den runden Spiegel mit dem reich verschnörkelten Silberrahmen und trat einen Schritt zurück, damit Elisabeth sich in dem neuen Kleid betrachten konnte. Es war ein Chemisekleid aus herrlicher Seide, unter dem Busen abgesetzt, mit reichem Dekolleté und winzigen Ärmeln, das ohne jede Verschnürung getragen wurde. Elisabeth errötete bei ihrem eigenen Anblick bis in die Wurzeln ihres hellen Haares. »Ist es nicht … schamlos?« Die Erinnerung an einen Vorfall wurde in ihr wach, den sie längst vergessen glaubte. Sie sah Lucille vor sich, die französische Geliebte ihres Mannes, wie sie ungeladen zu einem Ball auf Schloss Deinharting erschienen war, in einem im Schnitt ganz ähnlichen Kleid, wie sie es selber heute trug, nur war es schwarz wie die Nacht gewesen, und empört und im Gefühl sittlicher Überlegenheit hatte sie sie von der Schwelle gewiesen.
Sie errötete noch tiefer, während Antoinette rasch versicherte: »Aber ganz und gar nicht, ma tante … es ist nur … frei, und es ist jung!«
Forschend blickte Elisabeth das junge Mädchen an. Lucille hatte ihr sehr nahegestanden. Musste sie nicht das Gleiche denken wie sie selber? Aber in den tiefblauen Augen war nichts zu lesen. »Kann ich es wirklich tragen?«, fragte Elisabeth immer noch unsicher.
»Aber ganz gewiss«, beteuerte Antoinette.
»Es ist doch Mode so«, fügte Henriette Striegel hinzu.
»Ich weiß nicht, ob ich mich je daran gewöhnen werde.«
»Es wird Ihnen wohl nichts anderes übrigbleiben, ma tante, keine Frau trägt doch mehr ein Korsett!«
»Obwohl manch eine besser daran täte!«, ließ sich die Zofe vernehmen.
Antoinette lachte. »Da haben Sie wohl recht, Mademoiselle! Aber Sie, ma tante, können sich die Robe erlauben wie keine Zweite! Sie sind ja so zart und schlank … Sie hätten sich niemals schnüren müssen, und auch Ihr Dekolleté ist wundervoll!«
Elisabeth wusste, dass Antoinette ihr nicht schmeichelte; trotz ihrer Schlankheit war der Ansatz ihres Busens wohlgerundet und ihre Haut von einer sanften, fast durchsichtig wirkenden Weiße. »Nie hätte ich gedacht, dass sich diese ausschweifende Mode auch bei uns durchsetzen würde«, sagte sie.
»Und wie, ma tante!«, sagte Antoinette. »Ist Ihnen noch nicht aufgefallen, dass selbst bei den Trachten der Mägde und Bauersfrauen die Taillen hochgerutscht sind?«
»Wahrhaftig? Ich werde einmal darauf achten.«
»Tun Sie das, ma tante! Darf ich jetzt nicht doch den Hofmarksherrn holen?«
»Nein, nein, ich werde es ihm bei passender Gelegenheit vorführen.«
Der kleine Thomas, der sich für dieses sehr weibliche Gespräch nicht interessierte, hatte sich eine Weile die Zeit damit vertrieben, das Stuckrelief an der Decke zu betrachten, das die Muttergottes in einem Muschelwagen zeigte, der von einer Heiliggeisttaube gezogen wurde. Aber der allzu vertraute Anblick hatte ihn nicht lange fesseln können. So war er dazu übergegangen, ein imaginäres Gewehr anzulegen, wobei er lautlos mit den Lippen »piff, paff, puff« machte, bis der Eifer mit ihm durchging und er mit lautem Knallen das Abfeuern einer Waffe nachahmte.
»Thomas!«, riefen Elisabeth und Antoinette gleichzeitig.
»Ich spiele doch nur!«, verteidigte sich das Kind.
»Aber muss das denn so laut sein?«, fragte Elisabeth. »Komm mit mir, Henriette, und hilf mir beim Umziehen!«
Allein mit Thomas, kniete Antoinette sich neben den Jungen auf den Boden, zog ihn in ihre Arme und bedeckte seine bräunlichen Wangen mit zärtlichen kleinen Küssen. »Mon chéri, mon pauvre petit chéri! Ich weiß ja, dass du brav bist … ein braver kleiner Bub! Du kannst ja nichts dafür, aber Tante Elisabeth ist nun mal nervös … deshalb musst du noch braver werden!«
Thomas schmiegte sich vertrauensvoll an sie. »Warum?«
»Das habe ich dir doch schon tausendmal erzählt!«
»Will hören!«
»Weil wir keine Deinhartinger sind! Wir sind Franzosen und heißen …« Sie machte eine kleine Pause.
Gelehrig sagte Thomas: »Beaujeux!«
»Richtig. Ich bin die Comtesse de Beaujeux und du bist der kleine Monsieur de Beaujeux!« Antoinette küsste ihn wieder, weil der Gedanke ihr weh tat, dass sie ihm eines Tages würde erklären müssen, warum er als lediges Kind keinen Titel tragen durfte.
»Und warum sind wir hier?«
»Weil das französische Volk uns aus Frankreich vertrieben hat. Wir mussten froh sein, dass wir mit dem Leben davongekommen sind. Die guten Deinhartinger haben uns dann bei sich aufgenommen. Deshalb müssen wir ihnen immer dankbar sein.« Das war die Version der Geschichte, die Antoinette sich für Thomas ausgedacht hatte. Er ahnte nicht, dass er erst im Dragonerhaus zu Deinharting zur Welt gekommen und dass Anselm von Deinharting sein Vater war. Antoinette hätte es ihm liebend gerne gesagt, aber sie nahm sich nicht das Recht dazu heraus. Der Hofmarksherr hatte sich zwar als sein Vater in das Kirchenbuch eingetragen, aber auf andere Weise bekannte er sich nicht zu seinem Sohn – aus Rücksicht auf Elisabeth und seine Kinder aus erster Ehe, wie Antoinette wusste. Die beiden Töchter, Beata und Auguste, waren zu naiv, um etwas zu ahnen, und was Elisabeth von der Herkunft des kleinen Thomas dachte, war schwer zu durchschauen. Sie verlor niemals ein Wort darüber, nicht einmal zu ihrem Mann, dessen war Antoinette sicher.
»Und Papa?«, fragte Thomas wie immer, wenn sie an diesem Punkt der Geschichte angekommen war.
»Ist tot.«
»Und Mama?«
»Auch.« Diese Lüge fiel Antoinette leichter, denn sie fand, dass es besser war, seine Mutter tot zu glauben, als zu erfahren, dass sie eine abenteuerlustige Hochstaplerin gewesen war, die ihn, da sie nicht für ihn sorgen konnte, zurückgelassen hatte.
»Alle tot«, wiederholte Thomas düster.
»Nun, wir beide leben ja noch und wir haben uns lieb, nicht wahr?«
»Aber Tante Elisabeth hat mich gar nicht lieb.«
»Sie versucht, dich liebzuhaben, sie ist doch nie böse zu dir, das musst du zugeben.«
»Ich mache sie nervös.«
»Manchmal.« Antoinette dachte nach und fand es dann richtig, der Geschichte eine neue Nuance hinzuzufügen. »Weißt du, sie hat selber einmal einen kleinen Jungen gehabt, der ihr gestorben ist, und nun muss sie wohl immer, wenn sie dich sieht, an ihren eigenen Buben denken, und das tut weh.«
»Ach so«, sagte Thomas ganz befriedigt, als hätte er diese Erklärung gut verstanden.
»Deshalb musst du versuchen, immer sehr, sehr leise zu sein, wenn du bei ihr bist.«
»Ich werde still sein wie ein Mäuschen!«, versprach Thomas ernsthaft.
Antoinette küsste ihn wieder. »Ich wusste ja, dass du mein liebes, gutes Brüderchen bist!«, sagte sie und schwor sich einmal mehr, ihm und keinem anderen je zu verraten, dass sie in Wahrheit keine Geschwister waren.
Der Hofmarksherr hatte in der kleinen kupfernen Wanne, die Baptist, sein Diener, eigens zu diesem Zweck in seinem prächtig ausgestatteten Schlafzimmer aufgestellt hatte, den mächtigen, braunen, auf der Brust behaarten Körper eingeseift und gebürstet. Zum Schluss dieser Prozedur ließ er sich einen Eimer kalten Wassers übergießen, das auf die viele hundert Jahre alten Bohlen des Fußbodens schwappte.
Darüber vergaß er eine Weile seine sorgenvollen Gedanken. »Das hat gutgetan«, sagte er fast vergnügt, stieg aus der Wanne, in der er ohnehin nur hatte hocken können, und wickelte sich in das große, raue Tuch, das der Diener ihm reichte.
Dass Baptist sein Lächeln nicht erwiderte und seine üblich hochmütig-verschlossene Miene zeigte, störte ihn nicht; er war längst daran gewöhnt. Baptist, der in Wirklichkeit auf den weitverbreiteten Namen Josef getauft war, wollte damit dokumentieren, dass er auch nach über zehn Jahren Aufenthalt auf dem Lande nicht bereit war, sich in Deinharting einzugewöhnen. Der Hofmarksherr hatte ihn seinerzeit als jungen Burschen aus München mitgenommen, und Baptist war ihm gern gefolgt, überzeugt, dass der Aufenthalt nur vorübergehend sein würde. Zu kündigen und sich eine andere Stellung in dem etwa fünf Meilen entfernten München zu suchen, hatte er sich nicht entschließen können; es wäre wohl auch jetzt in seinem Alter, da er über dreißig war, nur schwer möglich gewesen. So trug er denn eine beleidigte Würde zur Schau, die schlecht zu der schon etwas verblichenen Alltagslivree in den Farben des Hauses passen wollte. Nie hätte er es sich nehmen lassen, ohne weiß gepuderte Perücke zu erscheinen.
Anselm von Deinharting trug diesen männlichen Kopfputz schon seit Jahren nur noch bei großen Festlichkeiten und offiziellen Anlässen. Gewöhnlich gab er seinem vollen braunen Haar, in das sich erst wenige Silberfäden mischten, die Freiheit, offen auf seine Schultern zu fallen oder band es lässig im Nacken zusammen. Aber jetzt ließ er sich erst einmal, in sein Badetuch gewickelt und in einem der beiden mit Gobelin bezogenen Sessel aus der Renaissancezeit sitzend, von Baptist, der den Schaum schon geschlagen hatte, kunstvoll mit dem langen Messer, das er immer wieder am Lederriemen abzog, rasieren.
Zufrieden strich er sich danach über Kinn und Wangen. »Das hat Er gut gemacht!«
Er ließ sich Kölnischwasser in die Hände schütten und rieb sich damit die leicht gerötete Haut ein.
Das Badetuch wie eine Toga umgeschlungen, trat er an den reich geschnitzten, weiß-goldenen Barockschrank, öffnete die leise quietschende Tür, holte mit sicherer Hand die Flasche mit dem Obstler heraus und nahm einen Schluck – ›ein Maulvoll‹, wie er es bei sich selber nannte. Da Elisabeth das Schlafgemach schon seit Langem nicht mehr mit ihm teilte, hatte der ganze Raum einen sehr männlichen, wohnlichen Charakter angenommen, der einer Frau leicht verwahrlost erschienen wäre. Davon zeugte die griffbereite Schnapsflasche im Schrank, der ungeordnete Fall des roten Brokats, der von dem Baldachin auf das überbreite barocke Bett herabfiel, und das nicht ganz saubere Kissen davor, auf dem Hasso genächtigt hatte.
Anselm von Deinharting stieß mit dem Fuß daran, als er an das Bett trat. »Räum Er das fort!«
Der Diener starrte ihn mit offenem Mund an.
»Hasso ist tot!«, sagte Anselm von Deinharting kurz, aber dann wurde ihm bewusst, dass eine solch lapidare Erklärung im Hause und im Dorf zu allerlei Gerüchten führen musste, und so fügte er hinzu: »Ich habe ihn erschießen müssen.«
Jetzt zeigte Baptist eine fast menschliche Regung. »Das … das tut mir leid«, stammelte er.
»Schon gut. Wer Tiere hält, muss damit rechnen, sie zu überleben.« Auf dem Bett hatte Baptist ihm saubere Kleidung zurechtgelegt.
Das Hemd war aus feinem weißen Leinen mit einem Jabot, zwei langen Stoffstreifen, die statt eines Kragens am Hals zu einer breiten Schleife oder einem Knoten zu binden waren. Darüber kam eine eng anliegende beige Hose, die bis zu den Knöcheln reichte – auch eine Errungenschaft, die die französische Revolution mit sich gebracht und die sich allmählich und unaufhaltsam auch unter den schärfsten Gegnern des neuen Regimes verbreitet hatte. Anselm von Deinharting fand sie praktisch und zog sie deshalb vor, während Baptist es sich nie nehmen lassen würde, seine Hosen nach alter Sitte unter dem Knie über den langen weißen Zwirnstrümpfen zu binden und schwarze, mit Silberschnallen verzierte Schuhe zu tragen. Sein Herr zog kurze Wollsocken über, darüber weiche braune Stiefel, die bis zur halben Wade reichten. Wegen der Kälte hatte Baptist eine Weste aus besonders dickem, gewalkten Tuch für seinen Herrn gewählt. Der braune Rock war bequem geschnitten, hatte hinten lange Schöße und war mit Hirschhornknöpfen verziert.
Ohne einen Blick in den Spiegel zu werfen, beendete Anselm von Deinharting seine Toilette, was aber durchaus nicht bedeutete, dass er ohne Eitelkeit war. Aber die Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass es seiner Erscheinung keinen Abbruch tat, wenn ihm eine Locke in die Stirn fiel, sein Jabot schief gebunden oder seine Jacke falsch geknöpft war.
Als er das Zimmer verließ, hätte er beinahe ›komm, Hasso‹ gesagt, und wieder kam der Schmerz in ihm hoch, von dem sein Verstand doch nichts wissen wollte.
Im Treppenhaus war es kalt, und er beeilte sich, den Vorplatz mit dem gotischen Netzgewölbe zu überqueren, nahm die hohen steinernen Stufen wie ein Jüngling, und mit Schwung riss er die Tür zum sogenannten kleinen Saal auf, in dem die Familie ihre gemeinsamen Mahlzeiten einzunehmen pflegte. Im gleichen Augenblick bereute er, dass er nicht Auftrag gegeben hatte, für ihn in einem anderen Zimmer zu servieren; die große Tafel war nahezu völlig abgeräumt und dennoch war er nicht allein. Der Leutnant Baron Felix von Lingen hatte sich soeben an den Frühstückstisch gesetzt. Er sprang sofort auf, als er des Hausherrn ansichtig wurde, und verbeugte sich höflich. »Einen guten Morgen, Herr von Deinharting.«
»Wünsch ich Ihnen auch, Baron«, erwiderte der Hausherr, aber es kam nicht sehr freundlich heraus; obwohl er wusste, dass er dem jungen Offizier persönlich nichts vorhalten konnte, übertrug sich sein Groll über die ungute Situation doch auf ihn.
Felix von Lingen wartete, bis der Hausherr sich gesetzt hatte, und versuchte dann, ein Gespräch in Gang zu bringen. »Bin a bisserl spät dran heute morgen«, plauderte er mit unverkennbar wienerischem Tonfall, »die Damen waren alle schon auf und davon.«
»Wie tief bedauerlich!«
Der junge Mann überhörte die Ironie. »Selbst mein Kamerad hat nicht auf mich gewartet«, beklagte er sich, »weiß gar nicht, warum er es so eilig hatte.«
»Haben Sie denn keinen Dienst?«, erkundigte sich Anselm von Deinharting, um nicht zu unhöflich zu sein.
»Nein, ist abgeblasen für heute, Herr von Deinharting. Weiß auch nicht warum. Was die hohen Herren sich so alles einfallen lassen!«
Baptist erschien mit einem Tablett, auf dem zwei Kannen standen, eine mit Kaffee, die andere mit heißer Milch, ein Korb mit dunklem Brot und eine Platte mit durchwachsenem geräuchertem Speck.
»Hab' mich direkt ein bisserl einsam gefühlt«, behauptete Felix von Lingen, »so bin ich froh, dass Sie gekommen sind. Es gibt schon nichts Angenehmeres als ein gemütliches Frühstück und einen netten Plausch.«
Anselm von Deinharting hatte sich damit beschäftigt, eine Scheibe Brot mit Speck zu belegen. Jetzt hob er, die Gabel mit einem Speckstreifen in der Hand, den Kopf, um zu ergründen, ob der junge Mann wirklich so naiv war, wie er tat, oder nicht am Ende ihn, den altbayrischen Hofmarksherrn, zum Narren halten wollte. Aber Felix von Lingens junges Gesicht war ganz arglos. Blond gelockt, mit großen Kinderaugen und einer milchweißen Haut wirkte er trotz des Uniformrocks, dessen roten Stehkragen er der Bequemlichkeit halber unvorschriftsmäßig geöffnet hatte, fast mädchenhaft. Anselm von Deinharting wurde durch seine Erscheinung ein wenig an seinen eigenen zweiten Sohn, Emanuel, erinnert, der seit vier Jahren am Hof des Kurfürsten Karl Theodor in München als Page diente. Nur hätte Emanuel es nie gewagt, so frei zu seinem Vater zu sprechen, wie der einquartierte österreichische Offizier es sich seinem Hausherrn gegenüber erlaubte. »Ich bin kein guter Gesellschafter«, sagte Anselm von Deinharting milder als sonst.
»Das nehme ich Ihnen nicht ab, Herr von Deinharting«, protestierte der junge Offizier unbekümmert, »Sie könnten gewiss interessant erzählen, wenn Sie nur wollten!« Da der Hausherr auf diese Bemerkung hin schwieg, sagte er nach einer Weile: »Die Semmeln, die es hier gibt, sind gut …«
»Wir backen sie im Haus!«
»Ah, drum! Sie sind fast so resch wie die in Wien!« Felix von Lingen brach eines der knusprigen Brötchen in zwei Teile und strich großzügig Butter darauf.
Anselm von Deinharting ärgerte sich über sich selber, weil er sich durch das anmaßende »fast« des Gastes verletzt fühlte, aber er verbiss sich eine Zurechtweisung.
»Überhaupt, die Küche auf dem Schloss ist superb! Ich hoffe nur, dass wir noch recht lange bleiben dürfen.«
Anselm von Deinharting hob die dichten Augenbrauen. »Sie brennen, scheint mir, nicht darauf, in die Schlacht zu kommen?«
»Aber ich bitt' Sie, Herr von Deinharting, wo denken Sie hin! Ich bin Offizier geworden, weil es keine andere Karriere für mich gab … aber diese Gemetzel sind doch … degoutant. Zudem noch gegen den französischen Pöbel.« Er tupfte sich mit der Serviette die Butter von den Lippen. »Natürlich will man sich auszeichnen, die zu Hause erwarten es ja von einem, aber es muss ja nicht sofort sein.«
Für Anselm von Deinharting hatte dieses Gespräch in dem prunkvollen Saal, der von seinem Großvater gleichen Namens in üppigem Barock ausgestattet worden war und in dem der junge Mann am Ende der langen Tafel ganz verloren wirkte, etwas Unwirkliches. Widerwillig musste er zugeben, dass Felix von Lingen nicht freiwillig nach Bayern gekommen war, sondern hundertmal lieber in seinem Wien geblieben wäre. Dennoch konnte er zwar Verständnis, aber keine Sympathie für ihn aufbringen. »Sie sind erstaunlich offen«, sagte er.
Felix von Lingen schenkte ihm ein gewinnendes Lächeln. »Ihnen gegenüber darf ich doch ehrlich sein, nicht wahr? Oder verachten Sie mich jetzt, weil ich nicht vor Mordlust brenne? Waren Sie Offizier?«
»Ich bin gelernter Jurist.«
»Jurist! Kolossal! Aber dazu hat es bei mir leider nicht ausgereicht.«
Anselm von Deinharting hatte sein Speckbrot vertilgt und schüttete den Kaffee nach, um so schnell wie möglich fortzukommen. Dabei verschluckte er sich, musste husten. Diensteifrig sprang von Lingen auf, lief zu ihm hin und war schon im Begriff, ihm auf den Rücken zu klopfen, als ein Blick des Hofmarksherrn ihn erstarren ließ.
»Excusez moi«, stammelte er betroffen, »ich wollte nur … ich dachte …«
»Schon gut.« Anselm von Deinharting wischte sich Mund und Finger ab, warf die benutzte Serviette achtlos auf den Tisch, schob den Stuhl zurück und stand auf. »Mahlzeit.«
Er verließ den Speisesaal mit großen Schritten, verärgert über die Keckheit des kaiserlichen Offiziers, mehr noch über sich selber, weil er nicht freundlich zu einem Menschen sein konnte, der ihm nichts Böses getan hatte und so deutlich um seine Sympathie warb.
Anselm von Deinharting verließ das Schloss durch den Vorderausgang. Neben den Waffen, Jagdtrophäen und Totenschilden, mit denen die Wände des steinernen Flurs geschmückt waren, hingen sein schwarzer, pelzgefütterter Radmantel und die Pelzmütze. Er zog sie über und nahm seine Reitgerte vom Haken, bevor er in die schneidende Kälte des Wintertages hinaustrat.
Der Himmel war bleiern grau und der Schnee auf den Feldern und Weiden wirkte stumpf. Die Linden der Allee, die schnurgerade zum Dorf führte, standen kahl und schwarz. Der Anblick war trostlos. Noch lag keine Verheißung eines kommenden Frühlings in der Luft. Es war, als wenn die strohgedeckten Bauernhäuser sich ganz klein machten, sich verkröchen, um drohendem Unheil zu entgehen. Nur der Zwiebelturm der Kirche ragte in den Himmel. Der Hofmarksherr blähte die Nüstern, sein Atem stand wie eine kleine Wolke vor seinem Gesicht. Es war zu kalt, um zu schneien, und das Land brauchte auch keinen Schnee mehr. Jetzt sollte er bald verschwinden, damit mit den Vorbereitungen der Aussaat begonnen werden konnte. Einer späten Ernte mussten hungrige Wochen, ja Monate vorausgehen. Wollte Gott, dass die Soldaten bis zum Sommer aus dem Lande waren.
In seine sorgenvollen Gedanken vertieft, schritt Anselm von Deinharting mit weit ausholenden Schritten, wie es seine Art war, über den gepflasterten Teil des Hofes und um das Schloss herum zu den Ställen, als er Beata, seine älteste Tochter, die in die gleiche Richtung eilte, vor sich auftauchen sah. Sie trug ein eng geschnittenes Reitkostüm aus schwarzem Tuch und auf dem weizenblonden Haar eine Pelzkappe, die, da sie ihre kleinen rosigen Ohren freiließ, wohl ihrer Schönheit, aber nicht als Schutz vor der Kälte dienen konnte.
»Beata!«, rief er gedämpft.
Sie fuhr herum, die Hände in einem Muff, die Reitgerte an der Schlaufe über dem Handgelenk, und errötete heiß. »Sie, Papa?«
»Was hast du vor?«
»Ich möchte ausreiten!«
»Es ist viel zu kalt für dich.«
Ihre hellen, blass bewimperten Augen hielten seinem Blick voller Trotz stand. »Aber ich brauche Bewegung, Papa!«
Er kam auf sie zu und legte seine große Hand besänftigend auf ihre Schulter. »Warte noch eine Stunde! Dann soll Peter dich begleiten.«
Die vollen, schön geschwungenen Lippen zitterten und Tränen stiegen ihr in die Augen. »Ich komme mir allmählich wie eine Gefangene vor.«
»Nicht nur du!« Die Hand um ihre Schulter gelegt, zog er sie mit sich. »Wir sind in Wahrheit nicht einmal mehr frei in unserem eigenen Hause, und ein schönes Frauenzimmer wie du muss sehr auf der Hut sein.«
Sie schüttelte seine Hand ab und blieb stehen, während er ruhig weiterschritt. Vor dem Stall bot sich ihm ein unerwartetes Bild. Peter hielt Beatas kleine braune Stute schon gesattelt am Halfter, während der Bursche des Leutnants Ferdinand von Tobler, ein krausköpfiger, windischer Kerl, prüfte, ob der Bauchgurt des Offizierspferdes auch fest geschlossen war.
Ferdinand von Tobler stand einen Schritt von den Pferden entfernt in abwartender Haltung da, den Helm unter dem Arm. Er war ein hochgewachsener, kräftiger junger Mann mit warmen braunen Augen über hohen Wangenknochen. Seinen festen, gut geschnittenen Mund zierte ein dichter, dunkelblonder Schnurrbart. Als er Anselm von Deinharting bemerkte, nahm er sofort Haltung an. »Bonjour, Herr von Deinharting!«
Der Hofmarksherr gab den Gruß zurück und wandte sich dann sofort an Peter. »Stell die Stute wieder ein! Meine Tochter reitet nicht.«
»Das bedaure ich sehr«, sagte der Leutnant ruhig, »ich hatte mir nämlich erlaubt, dem gnädigen Fräulein meinen Schutz anzubieten.«
»Sie hatten … was?«, fragte Anselm von Deinharting, der sehr wohl verstanden hatte, über so viel selbstverständliche Anmaßung aber bestürzt war.
Jetzt schoss Beata hervor, die den Auftritt bisher aus sicherer Entfernung beobachtet hatte. »Wir wollten zusammen ausreiten, Papa! Jawohl! Das können Sie mir nicht verbieten!«
»Und ob ich das kann! Du gehst jetzt sofort ins Haus. Keine Diskussion. Deine Mutter wird später mit dir reden.« Beata zögerte noch, aber der Gesichtsausdruck ihres Vaters war so furchteinflößend, sehr viel eindrucksvoller noch als seine gar nicht einmal lauten Worte, dass sie es doch vorzog, es nicht bis zum Äußersten kommen zu lassen, sich umdrehte und zum Schloss hin floh.
»Es handelt sich um ein Missverständnis!«, erklärte Ferdinand von Tobler in respektvoller Haltung, den Helm unter dem Arm. »Ich versichere Ihnen, dass meine Absichten völlig ehrenhaft sind.«
»Ich verbiete Ihnen jegliche Absichten auf meine Tochter!«, erwiderte Anselm von Deinharting kalt; die Ader an seiner Schläfe pochte immer noch bedrohlich. »Peter, du sattelst das Pferd des gnädigen Fräuleins in Zukunft nicht mehr ohne mein ausdrückliches Einverständnis.«
»Sehr wohl, gnädiger Herr.«
Der Kaiserliche Offizier setzte seinen Helm auf, schwang sich auf sein Pferd, grüßte kurz und ritt davon. Der Bursche verzog sich in den Stall.
»Soll ich Bruna für Sie satteln?«, fragte Peter.
»Tu das. Ich bin gleich zurück. Aber vorher habe ich noch etwas zu erledigen.«
Immer noch zornig, wandte der Hofmarksherr sich um und ging zum Schloss zurück.
Elisabeth war in das obere Erkerzimmer zurückgekehrt. Sie hatte sich umgezogen und trug jetzt ein dunkles Kleid mit großem weißen Kragen und Fichu, darüber einen leichten Spitzenschal. Mit Antoinettes Hilfe hatte sie den Träger mit dem Rahmen für ihre Gobelinstickerei beiseitegeschoben, sodass sie sich nahe dem Erkerfenster in das beste Licht setzen konnte. Seit die hoch aufgetürmten Frisuren aus der Mode waren, kam sie nicht mehr mit ihrem langen blonden Haar zurecht. Antoinette, die geschickt darin war, bemühte sich, es mit Kamm und Bürste zu formen. »Am hübschesten wäre es«, schlug sie vor, »wenn Sie es ganz schlicht tragen würden, ma tante, ein paar Löckchen in die Stirn … ein Band … ähnlich wie ich!«
Elisabeth lächelte zu ihr auf. »Du kannst dir das erlauben!«
»Und Sie etwa nicht?! Sie sind doch auch noch jung!«
»Nein, nein, steck mir mein Haar nur wieder unter die Haube!« Antoinette nahm die Haube mit den Fingerspitzen hoch und betrachtete sie kritisch. »Das alte Ding! Wenn Sie wenigstens einmal eine Putzmacherin kommen lassen würden!«
»Das werde ich tun! Aber für heute muss sie genügen …«
»Aber wenigstens ein paar Löckchen vorne?«
Das Idyll wurde durch Anselm von Deinhartings stürmischen Auftritt jäh gestört; die beiden Frauen fuhren herum.
Der kleine Thomas, der still in einer Ecke des Zimmers auf dem Boden gespielt hatte, sprang auf. »Monsieur!«, rief er und lief zu seinem Vater hin, aber das zornige Gesicht des großen Mannes erschreckte ihn und er blieb stehen.
»Incroyable!«, brüllte Anselm von Deinharting. »Unerhört!« Er war die Treppen in einem solchen Tempo hochgestürmt, dass er jetzt nach Luft schnappen musste.
Elisabeth nahm allen Mut zusammen. »Solltest du dich nicht erst beruhigen, bevor du mit mir sprichst?«
»Wo ist Beata?«
Elisabeth und Antoinette sahen sich an. »Ich weiß es nicht«, musste Elisabeth zugeben.
»Das habe ich mir gedacht! Du hältst es also nicht für nötig, auf deine Stieftöchter aufzupassen!«
»Gustel ist im Unterricht, und Beata ist eine gut erzogene, vernünftige junge Dame, die …«
»… eben im Begriff stand auszureiten!«
Elisabeth wechselte die Farbe. »Das allerdings …«
»… und nicht etwa allein, was leichtsinnig genug gewesen wäre, sondern in Begleitung eines kaiserlichen Offiziers.«
»Das allerdings«, wiederholte Elisabeth und setzte hinzu, »ist sehr ungehörig.«
»Ungehörig!« Anselm von Deinharting lachte wütend auf. »Das ist wohl nicht ganz der passende Ausdruck.«
Antoinette legte Kamm und Bürste hin und nahm den kleinen Thomas, der der Auseinandersetzung mit aufgerissenen Augen gefolgt war, bei der Hand. »Komm, Thomas!« Sie wandte sich an Elisabeth. »Sie erlauben doch?« Sie führte den Jungen aus dem Zimmer.
»Warum schimpft Monsieur so?«, fragte Thomas. »Und was hat Tante Elisabeth getan?«
»Sie sind beide in Sorge um Beata.«
»Warum? Weil sie vom Pferd fallen könnte?«
»Ja, das auch.« Antoinette blieb auf dem Vorplatz stehen und überlegte. »Ich bringe dich zu Mademoiselle Afra, ja?«
»In die Schulstube?« Die lebhaften schwarzen Augen des Jungen leuchteten auf. »O ja, Tonette! Ich mag lernen!«
»Du darfst aber den Unterricht nicht stören, hörst du? Sonst wird Mademoiselle böse!«
»Ich werde ganz brav sein!«
Hand in Hand liefen sie die steinerne gewundene Treppe hinunter und Antoinette klopfte an die Tür am Ende des Ganges.
Afra öffnete von innen – erst einen Spalt breit und dann, als sie erkannte, wer Einlass begehrte, ganz weit. »Antoinette!«, rief sie in ihrem korrekten, wenn auch wenig eleganten Französisch. »Qu'est-ce qu'il se passe?« Afra war einen Kopf kleiner als Antoinette, ihr blasses, breitflächiges Gesicht mit den hohen Jochbogen und den schräg stehenden, dunklen Augen, das sie seit Jahren sorgfältig vor jedem Sonnenstrahl schützte, war nicht gerade schön, aber sehr apart, ihre ganze Erscheinung wirkte ausgesprochen gepflegt. Nur die ernste, gespannte Entschlossenheit ihres Gesichtsausdrucks verriet, dass sie keine Dame war, aber niemand, der es nicht wusste, hätte in ihr die Tochter des Dorfwirtes vermutet.
»Bist du so lieb und beschäftigst Thomas eine Weile?«, bat Antoinette und schob den Jungen rasch in die Schulstube, aus der Augustes neugieriges Kindergesicht zu ihnen hinüberlugte.
Afra schloss die Tür hinter ihm. »Erzähl schon!«
Hastig berichtete Antoinette, was sie wusste.
Afra warf den Kopf in den Nacken. »Mon dieu, was für ein Theater!«
»Ich muss zu Beata. Sie wird außer sich sein!« Antoinette wollte schon wieder weiter. Afra hielt sie am Ärmel fest. »Ich hätte mir das an ihrer Stelle nicht gefallen lassen!«
»Ja, du nicht, du bist auch keine wohlbehütete junge Dame …« Antoinette sah, wie Afras Mundwinkel sich verzogen und fügte versöhnlich hinzu: »… wir beide sind es nicht. Wir haben gelernt, auf uns aufzupassen. Aber Beata …«
»… ist eine dumme Gans!«
»Sie ist das Schlossfräulein!«
»Pah, ich bin genauso viel wert wie sie!«
Antoinette wusste, wie sehr Afra, trotz ihres manchmal geradezu anmaßenden Auftretens, unter ihrer geringen Herkunft litt; sie zeigte Verständnis. »Darum geht's ja gar nicht. Beata hat keine Ahnung, auf was sie sich einlässt, und ihr Papa will sie schützen. Geht das denn nicht in dein Köpfchen? Apropos … wie würde es deinem Vater wohl gefallen, wenn du mit einem der Kaiserlichen ausreiten wolltest?«
In der Anstrengung, sich eine solche Situation vorzustellen, neigte Afra den Kopf zur Seite und presste die Lippen zusammen. »Ich würde mir das nicht verbieten lassen!«
»Und wenn dein Vater der Hofmarksherr wäre?«
Afra war zu ehrlich, um auf ihrem Standpunkt zu beharren, und schwieg.
Antoinette lächelte und strich ihr sanft mit dem Handrücken über die Wange. »Ja, vor dem haben wir alle einen Mordsrespekt! Bis später, Afra! Ich hole Thomas ab, sobald es irgend geht.«
»Hat keine Eile. Er ist ja brav.«
Die Mädchen trennten sich. Afra ging in die Schulstube zurück – man hatte ihr, seit der Hauslehrer im letzten Herbst gekündigt hatte, die Unterrichtung Augustes anvertraut –, Antoinette eilte nach oben.
Indessen war Anselm von Deinharting ruhiger geworden, wenn er auch immer noch grollte. Mit großen Schritten, die Hände auf dem Rücken, ging er in dem oberen Erkerzimmer hin und her, während Elisabeth, die Hände im Schoß, dasaß und seinen Marsch mit den Augen verfolgte.
»Wir mussten diesen Männern Quartier geben«, sagte er, »das ist richtig. Aber wir hätten sie nicht gleichsam in unsere Familie aufnehmen sollen. Erinnere dich, ich war von Anfang an dagegen. Getrennte Mahlzeiten … dann wäre erst gar keine Vertrautheit aufgekommen!«
»Es sind Herren von Stand«, sagte Elisabeth ruhig.
»Das habe ich nie bestritten. Aber sie sind jung, sie sind gesund und ihre Sitten sind durch das Soldatenleben verwildert.«
»Ich habe sie immer sehr höflich gefunden.«
»Elisabeth!« Er blieb vor ihr stehen. »Hältst du einen solchen Ausritt zu zweien … unter diesen Umständen und ohne die Eltern um Erlaubnis zu fragen … tatsächlich für ganz unverfänglich? Wenn das deine Meinung ist, so bin ich im Unrecht.«
»Nein«, musste sie zugeben, »die Sache gefällt mir so wenig wie dir!«
»Na, Gott sei Dank! Ich war schon nahe daran, mich für einen alten Trottel zu halten.«
»Aber ich bin sicher, Beata hat sich nichts Böses dabei gedacht.«
»Ganz richtig. Genau darauf will ich hinaus. Sie ist mit ihren achtzehn Jahren ein ahnungsloses, argloses Kind.«
»Das soll sie auch bis zu ihrer Ehe bleiben.«
»In normalen Zeitläufen wäre ich ganz deiner Meinung. Aber mit diesen jungen Männern im Haus … das Land ringsum wimmelnd von Soldaten … du musst mit ihr sprechen, Elisabeth.«
»Das kann ich nicht!« Elisabeth ließ die schweren Lider über die hellen Augen sinken.
»Und wenn ich dich sehr darum bitte?«
Ihre Lippen schienen noch schmaler zu werden und eine rote Welle stieg aus dem Ansatz ihres weißen Kragens bis in die Haarwurzeln hinauf. »Du weißt, dass ich über solche Dinge nicht sprechen kann.«
Sie war sehr schön, wie sie da vor ihm saß in ihrer schamvollen Hilflosigkeit, mit dem gelösten blonden Haar, das ihr über die Schultern fiel.
Er nahm ihre Hand, die wie leblos in der seinen lag, und küsste ihre Fingerspitzen. »Verzeih mir!« Er schritt auf die schöne Renaissancetür zu, drehte sich dann aber noch einmal um. »Ich kann mich doch darauf verlassen, dass du Beata gegenüber meinen Standpunkt vertreten wirst?«
»Ich bin nicht weniger besorgt um sie als du.«
»Danke, Elisabeth!«
»Anselm!« Ihre Stimme klang gepresst, denn der Anruf hatte sie Überwindung gekostet.
»Ja?« Die Klinke in der Hand, blieb er abgewandt stehen.
»Das mit Hasso tut mir leid.«
»Er war ein guter Hund.«
»Aber ein Hund ist nicht unersetzlich.«
»So wenig wie ein Mensch. Bis später dann, Elisabeth.« Er verließ sie, ohne sie noch einmal anzusehen.
Sie wusste sehr gut, worauf er angespielt hatte: auf ihren grenzenlosen, untröstlichen Schmerz beim Tod des kleinen Maximilian.
Danach hatte sie sich ihm verweigert, weil sie sich außerstande fühlte, ein ähnliches Leid noch einmal durchzustehen. Inzwischen hatte sie eingesehen, wie falsch ihre Haltung gewesen war. Es war Gottes Wille gewesen, und nach schweren inneren Kämpfen hatte sie sich darein gefügt. Sie hatte ihr Kreuz auf sich genommen, so dachte sie jedenfalls.
Aber die Angst vor neuem Leid war geblieben.
Es war ein Schneckenhaus, in dem sie sich eingerichtet hatte, sie empfand das wohl, aber immer, wenn sie sich daraus hervorwagte, zuckte sie sogleich wieder erschrocken zurück.
Sie konnte es nicht ändern.
Wild schluchzend lag Beata auf ihrem Bett. Sie war noch in ihrem Reitdress, hatte aber ihren Hut, die Handschuhe und die Peitsche achtlos fortgeworfen; ihr dichtes weizenblondes Haar hatte sich gelöst und breitete sich wie ein Ährenstrauß auf dem Kopfkissen aus.
Antoinette blieb Sekunden zögernd auf der Türschwelle stehen, ehe sie sich ihr näherte. Sie wusste wohl, dass Beatas Wut und Verzweiflung echt waren, dennoch fand sie es belustigend, dass das erwachsene Mädchen sich wie ein unglückliches Kind benahm. Sie musste sich auf die Lippen beißen, um nicht aufzulachen, wodurch sie Beata tödlich verletzt und ihr Vertrauen für alle Zeiten verloren haben würde. Um sich zu fassen, sammelte sie erst einmal die umherliegenden Reitutensilien auf.
Dann erst trat sie an das Bett und legte Beata sanft die Hand auf die Schulter. »Seien Sie nicht zu traurig, Beata! Ihr Herr Vater hat es nur gut gemeint!«
Beata fuhr herum und zeigte ein verweintes Gesicht. »Wie ich ihn hasse!«
»Oh, nein, Beata, das dürfen Sie nicht sagen!«
»Er hat mich gedemütigt!«
»Das sehen Sie ganz falsch, Beata! Herr von Tobler wird Sie nur doppelt achten, da Sie einen Papa haben, der für Ihre Ehre eintritt.«
Beatas Tränen versiegten. »Meine Ehre? Ich verstehe nicht …«
»Ihr Vater hat sein Leben für Sie riskiert! Es hätte zu einem Duell kommen können, nicht wahr?«
»Aber warum nur, warum? Das alles war so unnötig!«
»Beata!« Antoinette ergriff die Hand des älteren Mädchens. »Sie wissen doch genau, dass das, was Sie vorhatten, unschicklich war.«
»Unschicklich oder nicht … als wenn es darauf ankäme! In einer Zeit wie dieser!«
»Gerade in dieser Zeit, Beata. Seit die Kaiserlichen in Bayern stehen …«
Beata richtete sich auf. »Herr von Tobler würde mich vor jeder Gefahr beschützen!«
»Auch vor sich selber?«
Sekundenlang sah Beata sie mit halb geöffnetem Mund an, was ihr einen etwas törichten Ausdruck verlieh. »Wie könnte er mir gefährlich werden?«
Antoinette suchte nach den richtigen Worten. »Er ist jung und gesund … er ist ein Mann und Sie sind eine sehr reizvolle Person.«
»Ich verstehe nicht, was Sie damit sagen wollen.«
»Nun, er könnte in Versuchung geraten …« Antoinette stockte. »… Sie in die Arme zu nehmen.«
»Niemals! Dazu achtet er mich viel zu sehr!« Beatas hell bewimperten Augen, die vom Weinen noch gerötet waren, blitzten auf.
»Durch das Eintreten Ihres Herrn Vaters kann sich diese Achtung nur verstärkt haben. Hätte er sich gleichgültig gezeigt, dann hätten Sie in den Augen Herrn von Toblers gewiss verloren.«
Jetzt wurde Beata doch nachdenklich. »Bist du sicher, Tonette?« Unwillkürlich fiel sie in die vertraute Form der Anrede zurück, die die Mädchen erst vor wenigen Monaten aufgegeben hatten.
»Ja, Beata, ganz und gar. Ein Mädchen von Stand muss sich den Männern gegenüber so rar wie möglich machen und ihre Eltern müssen sie dabei unterstützen. Nur dann bleibt sie begehrenswert. Oder suchen Sie ein Abenteuer?« Antoinette blieb bei dem formellen Sie, was ihren Beziehungen angemessener schien.
»Ganz gewiss nicht!«
»Dann gibt es auch keinen Grund zu weinen. Herr von Tobler weiß jetzt, dass er sich kein leichtes Spiel mit Ihnen machen kann, und wird sich nur noch mehr bemühen.«
»Und wenn er … gekränkt ist?«
»Dazu besteht kein Grund.«
Schon halb getröstet, zog Beata ein Spitzentüchlein aus ihrem Ärmel und tupfte sich die Augen. »Vielleicht will er jetzt gar nichts mehr von mir wissen«, meinte sie, aber ihr Ton verriet deutlich, dass sie nur im Gegenteil bestärkt werden wollte.
Antoinette durchschaute die Taktik und lächelte. »Das glauben Sie doch selber nicht!« Sie zog Beata hoch. »Und nun machen Sie sich bitte ein wenig frisch und kommen mit hinunter!«
»Ich könnte meinem Papa jetzt nicht in die Augen sehen!«
»Er ist gewiss schon fort. Wenn es Sie beruhigt, werde ich nachschauen. Lassen Sie Ihr Haar nur so, wie es ist. Tante Elisabeth und ich waren gerade dabei, Frisuren auszuprobieren.«
»Oh, das ist charmant!« Beata hatte ein wenig Wasser in die marmorne Waschschüssel geschüttet und sich das Gesicht gekühlt; jetzt hob sie den Kopf und trocknete es ab. »Dein Haar fällt immer so hübsch. Wie machst du das?«
Antoinette schüttelte ihre rotbraunen Locken, die, von einem Band gehalten, dessen Blau der Farbe ihrer Augen entsprach, locker in den Nacken und in die Stirn fielen. »Bei mir ist das ganz einfach, weil es sich von selber lockt. Ich brauche es nur vorne kurz zu schneiden. Das ist das ganze Kunststück.«
»Meines ist so dicht und glatt!«, klagte Beata.
»Dafür aber merveilleux! Kommen Sie und nehmen Sie Kamm und Bürste mit!«
Beata sah an sich herab. »Aber erst muss ich mich umkleiden.«
»Dann laufe ich schon voraus. Ich hole Sie, wenn ich sicher bin, dass Ihr Herr Vater das Schloss verlassen hat.«
Anselm von Deinharting ritt auf Bruna, der mächtigen schwarzen Norikerstute, die Lindenallee hinab. Immer noch zeigte das Land jenes bedrückende tote Weiß unter einem bleiernen Himmel. Er, der es in jeder Stimmung kannte und liebte, hatte es noch nie so trostlos gefunden.
Zur Rechten des Dorfes, ein gutes Stück von der Allee entfernt, aber deutlich sichtbar, war der Boden schwarz und zerstampft. Dort pflegten die kaiserlichen Soldaten zu exerzieren, und wie jedes Mal schnitt ihm der Anblick ins Herz.
Der Schaden, der ihm selber daraus erwuchs, war unbeträchtlich, denn das Land wurde nicht von seinen eigenen Leuten bestellt, sondern war einem der Bauern, dem Weyerer, in Pacht gegeben. Für den allerdings war es schlimm, denn es war sein bestes Stück Weideland. Wenn die Kaiserlichen nicht bis zum Frühjahr abzogen, würde er eine seiner Kühe schlachten müssen, und es war ihm so schon schwer geworden, die eigene Familie und die einquartierten Soldaten zu versorgen.
Zu allem Unglück blieben die Bauern der Hofmarksherrschaft, gleichgültig ob sie ihr Land als Lehen in Pacht hatten oder als Leibeigene bestellten, ihm, dem Hofmarksherrn, weiter abgabepflichtig. Er hätte das gern geändert, denn sein eigener Haushalt wurde trotz der Einquartierung durch die Erträge seines vom Vogt betreuten Gutes ausreichend versorgt. Aber mit einer solchen Maßnahme hätte er sich in krassen Gegensatz zu seinen Standesgenossen – denen er seiner fortschrittlichen Ideen wegen ohnehin verdächtig war – gesetzt. Zudem war er nicht sicher, ob die Bauern ihm ein solches Entgegenkommen nicht als Schwäche ausgelegt hätten. Sie stöhnten unter der Fron, aber würde er ihnen jetzt, unter diesen außergewöhnlichen Belastungen, ihre Pflichten erlassen, so mochten sie auch später, wenn die Zeiten wieder ruhiger geworden sein würden, nie mehr zur Hergabe von »Reichnissen« zu veranlassen sein.
Anselm von Deinharting seufzte schwer. Bei allem, was er tat, musste er auch an seinen Sohn denken, den jungen Anselm, der die Hofmark, so Gott wollte, eines Tages übernehmen würde. Es durfte nicht dahin kommen, dass er zu einem schlechten Verwalter und Erblasser des ererbten Besitzes wurde.
Das Einzige, was er tun konnte, tat er: immer wieder ermahnte er Margarethe Meyr, auf die Not der Bauern Rücksicht zu nehmen, ein mageres Huhn als ein fettes durchgehen zu lassen und es mit den Gewichten nicht allzu genau zu nehmen.
Ständige Mahnungen waren nötig, um sie gnädig zu stimmen. Margarethe Meyr stammte zwar selber aus dem Bauernstand, aber dennoch oder gerade deshalb war sie dickköpfig, was die Belange ihrer Herrschaft anging. »Recht muss Recht bleiben«, pflegte sie zu sagen.
Wahrscheinlich hätten seine Ermahnungen, auch farbigen Schilderungen der Not, die gerade auf den kleinen Höfen herrschte, auf denen sich die Bewohner unter normalen Verhältnissen notdürftig am Leben halten konnten, gar nichts genutzt, wenn er sich nicht hinter den Pfarrer gesteckt hätte.
Pfarrer Reiter war ein milder alter Herr, nicht gerade der mit Teufel und Fegefeuer drohende Prediger, wie die Bauern ihn gewünscht und respektiert hätten. Aber er vertrat, mehr als sie wussten, immer ihre Partei, auch dem Hofmarksherrn gegenüber, der ihm doch nach Bildung und Herkunft näher hätte stehen sollen. Doch für Pfarrer Reiter bestand der Sinn des Christentums immer noch darin, sich der Schwachen anzunehmen.
Ein wenig weltfremd, wie er war, konnte er nicht recht einsehen, wieso der Hofmarksherr seine Bauern nicht durch ein befreiendes Wort oder einen Federstrich aus der Pflicht entlassen konnte. Umso bereiter war er, im Beichtstuhl auf Margarethes christliches Gewissen einzuwirken und ihr die ewige Verdammnis vor Augen zu halten, die demjenigen mit Sicherheit bevorstand, der die Armen unterdrückte.
Das wirkte dann jedes Mal, wenn auch nur für kurze Zeit, sodass die Bauern sich angewöhnten, ihre Abgaben nach dem Tag der Beichte sonntags in der Schlossküche abzuliefern, denn dann war die Köchin erfahrungsgemäß milde gestimmt.
Bei diesem Gedanken musste Anselm von Deinharting doch ein wenig in sich hineinlächeln. Ja, Pfarrer Reiter war ein guter Mann, er schätzte ihn sehr, wenn auch ein jüngerer, tatkräftigerer Geistlicher, der sich um die Unterrichtung der Dorfjugend hätte kümmern können, ein größerer Segen für Deinharting gewesen wäre. Aber es nutzte nichts, sich mit Dingen zu belasten, an denen man doch nichts ändern konnte. Die Pfarrstühle wurden von der Kirche besetzt, bei der er nicht so angesehen war, dass er mit Erfolg besondere Wünsche hätte vorbringen können. Außerdem hatte er die geistlichen Herrn im Verdacht, dass sie zwar die Klugen gerne lehrten, die Dummen aber ebenso gerne dumm sein ließen.
Er bog jetzt um den Kirchhof und auf den Dorfplatz, und plötzlich kam ihm der Gedanke – oder vielleicht hatte er sich schon lange in seinem Innersten gerührt und wurde ihm erst jetzt bewusst –, den Pfarrer aufzusuchen und mit ihm über das, was sich heute nach Morgengrauen im Alpenwald ereignet hatte, zu sprechen. Der Tod des Wilderers bedrückte ihn sehr, mehr als er sich selber eingestehen mochte. Er bereute die Tat.





























